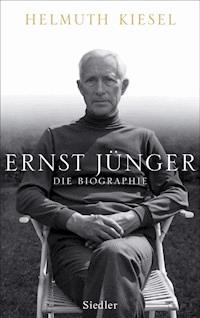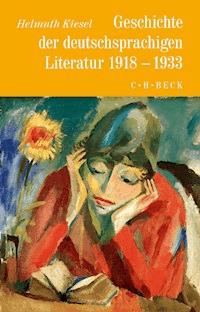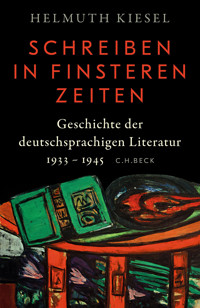
57,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Herrschaft der Nationalsozialisten bedeutete für die deutschsprachige Literatur eine beispiellose Herausforderung. Zweieinhalbtausend Autoren, darunter die besten, mussten Deutschland verlassen. Wer blieb und sich nicht auf die Seite des NS-Regimes stellte, war von Verfolgung bedroht. Trotzdem entstanden Werke von großer zeitgeschichtlicher Repräsentanz und hohem literarischen Rang. Helmuth Kiesel hat die erste Gesamtdarstellung der Epoche aus einer Hand geschrieben. Sie erschließt ein riesiges literarisches Feld zwischen Regimetreue und Exil und vermittelt ein bewegendes, oft erschütterndes Bild jener Zeit. Die schriftstellerische Auseinandersetzung mit der Gegenwart verlangte von den Autoren in den Jahren 1933–1945 besondere existentielle Kraft, politische Klarheit und literarisches Darstellungsvermögen. Helmuth Kiesel widmet sich in seiner großen Epochendarstellung der Literatur des Exils und der inneren Emigration, aber auch regimenahen Autoren, ebenso der österreichischen und schweizerdeutschen Literatur. Dabei stellt er die berühmten Werke der Epoche vor, von Anna Seghers’ Das siebte Kreuz bis Thomas Manns Doktor Faustus, von Ernst Jüngers Marmorklippen bis Hermann Hesses Glasperlenspiel – und daneben zahlreiche vergessene Bücher, die literarisch bemerkenswert und historisch aufschlußreich sind. Viele Autoren sahen ihre Hauptaufgabe darin, die «finsteren Zeiten» (Bertolt Brecht), die sie erlebten, geschichtlich zu ergründen und ihnen mit den Mitteln der Literatur entgegenzutreten. Helmuth Kiesel bringt ihre Stimmen in großer Breite und mit einer bisher nicht erreichten Intensität zur Geltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Schreiben in finsteren Zeiten
Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1933–1945
von Helmuth Kiesel
C.H.Beck
Übersicht
Cover
INHALTSÜBERSICHT
Textbeginn
INHALTSÜBERSICHT
Titel
INHALTSÜBERSICHT
Motto
EINLEITUNG
Literatur in «finsteren Zeiten»
Fragen der Auswahl
Deutsche oder deutschsprachige Literatur?
Spielarten der deutsch(sprachig)en Literatur
Gebremste und fortgesetzte Modernität
Der politische Rahmen: Krise der Demokratie und Faszination von Autoritarismus und Kollektivismus (Totalitarismus)
Autorschaft im Bann der Politik
Anmerkung zu Konzept und Darstellungsweise
ERSTER TEIL: DIE MACHTERGREIFUNG (1933/34) IM SPIEGEL DER LITERATUR
I. MACHTERGREIFUNG, STAATSUMBAU, GLEICHSCHALTUNG UND SÄUBERUNG
1. Machtergreifung: Jubel und Terror
2. Stimmen von Schriftstellern
3. Revolution?
4. Faszination des Total(itär)en
5. Staatsumbau
6. Kulturelle Gleichschaltung und (Selbst-)Unterwerfung der Literatur
6.1. Einrichtung eines Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda
6.2. Gleichschaltung der Dichterakademie
6.3. Bücherverbrennung
6.4. Staatstheater: Hanns Johsts
Schlageter
6.5. Bekenntnisse zum neuen Staat
6.6. Proklamation einer literarischen Wende:
Des deutschen Dichters Sendung in der Gegenwart
6.7. Propagandaschriften
6.8. Hitlers
Mein Kampf
– Verbreitung und Beurteilung
6.9. Hitlers «Kulturreden» und der Streit um die «deutsche» Kunst (Expressionismusdebatte I)
7. Exkurs zur Frage von Modernität und Romantik
II. PROBLEME VON PROTEST UND WIDERSTAND
1. Protestversuche und Bedenken
2. Einschüchterungen
3. Verschweigungen und Verwarnungen
4. Pro und contra Widerstand
5. Reden oder schweigen? Der «Fall» Karl Kraus
6. Politisch organisierter Widerstand und Literatur
7. Jüdische «Selbstbesinnung» und Resistenz
III. DIE SPALTUNG
1. Gehen oder bleiben?
2. Anpassen oder Abtauchen? Situierungsprobleme gebliebener Autoren
3. Zerbrochene Lebensläufe
4. Der Beginn von Flucht und Ausbürgerung
5. Seitenwechsel
IV. DEUTSCHE LITERATUR «DRINNEN UND DRAUSSEN»
1. Terminologisches: «Emigration» oder «Exil»?
2. «Äußere» und «innere Emigration»: Trennung und Solidarität
3. Konfrontationen und Feindseligkeiten: Wer repräsentiert die deutsche Literatur?
4. Streit in Ragusa
5. Politisierung und Lagerbildung in der Emigration
6. «Die Mission des Dichters» in der Emigration
7. Schmerz und Anspruch eines jüdischen Emigranten: Karl Wolfskehls Gedicht
An die Deutschen
V. LITERARISCHE REFLEXIONEN DER MACHTERGREIFUNG UND DER EMIGRATION 1933–35
1. Bekenntnisse und Polemiken, essayistisch und lyrisch
1.1. Binnendeutsche Essayistik
1.2. Essayistik außerhalb der Reichsgrenzen
1.3. Binnendeutsche Lyrik
1.4. Lyrik außerhalb der Reichsgrenzen
2. Epische und dramatische Widerspiegelungen
2.1. Deutschland: «Wege zu Hitler», SA- sowie HJ- und
BDM
-Romane
Nationalsozialistische Wegfindungsromane
HJ- und
BDM
-Romane
SA-Romane und ein SS-Roman
Heimkehr statt Auswanderung
Anpassungsroman eines Unentschiedenen: Erik Regers ‹Schiffer im Strom›
Reisen durch das «neue Deutschland»
2.2. Exil: Beginn von Terror, Flucht und Widerstand
Ouvertüre mit einem Panoramaroman: Lion Feuchtwangers ‹Geschwister Oppenheim›
Erklärungsromane von Anna Seghers, Adam Scharrer, Bodo Uhse, Ernst Glaeser, Maria Lazar, Werner Türk, F. C. Weiskopf und Oskar Maria Graf
Machtergreifungsdramen von Friedrich Wolf, Ferdinand Bruckner und anderen
Parabelstücke von Paul Zech und Bertolt Brecht
Exkurs zu den Problemen Wertung und Authentizität
Die Machtergreifung in Romanen und Erzählungen von Balder Olden, Hermynia zur Mühlen, Heinz Liepman[n], Jan Petersen, Ernst Erich Noth, Walter Kolbenhoff, Hans Natonek, Paul Zech, Lion Feuchtwanger und Paula Buber
Grotesken
Zwei Fanale: Reichstagsbrand und «Röhm-Putsch»
Gestapo-Folter und Konzentrationslager
Berichte von Hans Beimler, Gerhart Seger und anderen
Romane von Willi Bredel, Wolfgang Langhoff und anderen
Juden als «metaphysische Gegner»
Exkurs zum Darstellungsproblem Folter
3. Zwei große Machtergreifungsromane:
Der Augenzeuge
von Ernst Weiß und
Die Verzauberung
von Hermann Broch
4. Ein beklemmendes Gesellschaftsbild: Elias Canettis
Die Blendung
VI. ZWEI UMKÄMPFTE GEBIETE: ÖSTERREICH UND «DIE SAAR»
1. Österreich zwischen Angriff und Verteidigung
«Austrofaschismus» oder «Europas erste Abwehrfront» gegen den Nationalsozialismus?
Der Aufstand vom Februar 1934 im Spiegel der Literatur
Nationalsozialistische «Kampfzeit» und Juliputsch 1934
Dollfuß: «Arbeitermörder» oder «Märtyrer» des Widerstands?
2. «Der Kampf um die Saar»
Das Saargebiet als politisch-literarischer Kampfplatz
Linke Mobilisierungsliteratur
Mobilisierungsliteratur der «Deutschen Front»
Nach der Abstimmung: Jubel, Flucht, Ernüchterung, Kritik
ZWEITER TEIL: NEUORDNUNG DER LITERATURVERHÄLTNISSE NACH 1933
I. DEUTSCHLAND
1. Dokumentationen und Darstellungen
2. Phasen und Objekte der nationalsozialistischen Literaturpolitik
3. Vorläufer der NS-Literaturpolitik
4. Die Einrichtung der Reichsschrifttumskammer und weiterer Kontroll- und Lenkungsämter
5. Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen gegenüber Autoren und Buchhandel
6. Autorenförderung: Literaturpreise und Dichterbünde
7. Bedingte Freiräume
8. Buchpropaganda
9. Einbeziehung der Literaturwissenschaft
10. Zeitgenössische «Literaturkunde»
11. «Volkhafte Literaturbetrachtung» statt Literaturkritik
12. Lesen im Dritten Reich
13. Klassikerpflege
14. Versuch einer Bilanz
15. Jüdische Verlage
II. ÖSTERREICH
1. Literaturverhältnisse in Österreich 1933/34
–
1938
2. Nach dem Anschluß
III. SCHWEIZ
IV. EMIGRATION/EXIL
1. Dokumentationen und Darstellungen
2. Umfang, Phasen und Art der Emigration, Geschlechterverhältnis
3. Topographie
4. Hilfsorganisationen
5. Verlage
6. Zeitschriften
7. Tarnschriften
8. Ausstellung der freien Literatur
9. Paris 1935: Kongreß zur Verteidigung der Kultur
10. Volksfrontillusionen
11. Implementierung des sozialistischen Realismus
12. Realismus statt Formalismus (Expressionismusdebatte II)
13. Literaturkritik
14. «Die Kunst zu erben»
DRITTER TEIL: VON DER MACHTERGREIFUNG ZUM KRIEG: DIE POLITISCHE ENTWICKLUNG BIS 1939 IM SPIEGEL DER LITERATUR
I. LEBENSVERHÄLTNISSE IN DEUTSCHLAND
1. Führerdiktatur, Doppelstaat, Volksgemeinschaft: Hitlers Herrschaftsweise und Erfolge
2. Totaler Staat, Mobilisierungs- und Mediendiktatur
3. Ästhetisierung der Politik und Sakralisierung der Ideologie
4. Kriegsvorbereitung und Friedensbeteuerungen
5. Verständigungsliteratur
6. Deutschlandbesichtigungen
II. STATIONEN DER POLITISCHEN UND GESELLSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG
1. Nürnberger Rassengesetze (1935) und ein Mord in Davos (1936)
2. März 1936: Remilitarisierung des Rheinlands
3. Sommer 1936: Olympische Spiele
4. Sommer 1937: Ausstellungen «deutscher» und «entarteter» Kunst
5. März 1938: Anschluß Österreichs
6. Herbst 1938: Münchner Konferenz und Besetzung des Sudetenlands
7. November 1938: Pogrom
8. März 1939: «Zerschlagung» der Tschechoslowakei
9. August 1939: Hitler-Stalin-Pakt
10. Thomas Manns Überlegungen auf der «Höhe des Augenblicks»
III. GLANZ UND ELEND DES DRITTEN REICHS
1. Lyrisches «Führer»-Lob
2. Deutschlandkritik in der Exilliteratur
2.1. Rudolf Borchardts Schmähgedichte (
Jamben
)
2.2. Erzählungen und Romane über Terror und Verfolgung im Dritten Reich: Irmgard Keun, Anna Seghers, Arnold Zweig
2.3. Furcht und Elend des Dritten Reichs I: Szenen von Bertolt Brecht und Margarete Steffin
2.4. Furcht und Elend des Dritten Reichs II: Zwei Stücke von Georg Kaiser
2.5. Fritz von Unruhs satirischer Roman
Der nie verlor
3. Verdeckte Kritik am Dritten Reich in der binnendeutschen Literatur
3.0. Vorbemerkung zur «verdeckten Schreibweise»
3.1. Schmähgedichte von Gottfried Benn und Georg Kaiser
3.2. Werner Bergengruens Roman
Der Großtyrann und das Gericht
3.3. Friedrich Reck-Malleczewens Roman
Bockelson/Geschichte eines Massenwahns
3.4. Ernst Jüngers Erzählung
Auf den Marmorklippen
4. Gestapo-Gefängnis und Konzentrationslager: Ernst Wiecherts Bericht
Der Totenwald
VIERTER TEIL: DIE BINNENDEUTSCHE LITERATUR DER MITTLEREN JAHRE (1934–39): SYSTEMKONFORME UND NEUTRALE LITERATUR, WERKE DER INNEREN EMIGRATION UND JÜDISCHE LITERATUR
I. HAUPTRICHTUNGEN DER REICHS- ODER BINNENDEUTSCHEN LITERATUR
Die Autoren: Generationsverhältnisse, Richtungen, Namen
Bekennende Nationalsozialisten und Autoren der «jungen Mannschaft»
Autoren der inneren Emigration
Die nicht-nationalsozialistische «junge Generation»
Autoren im Widerstand
Autorenbünde und Dichtertreffen
Eine Bestandsaufnahme aus dem Jahr 1936
Zur Frage der Gruppenzugehörigkeit und der NS-Affinitäten
II. SPIELARTEN DEZIDIERT NATIONALSOZIALISTISCHER LITERATUR: LYRIK UND THINGSPIEL
Zur Frage, was «nationalsozialistische Dichtung» ist
Lyrik der «jungen Mannschaft»
Josef Weinheber
«Reichsdramaturgie»
Reichsfestspiele, Reichstheaterwochen und Theaterkonzepte
Thingspiele
Nationalsozialistisches Volkstheater und Volkskomödie
Pflege des traditionellen Theaters und Entwicklung seines Repertoires
Die meistgespielten Gegenwartsdramatiker der 1930er Jahre
Ein Blick auf ausländische Bühnen
III. NICHT-NATIONALSOZIALISTISCHE ODER NEUTRALE LITERATUR UND LITERATUR DER INNEREN EMIGRATION
Unüberschaubare Mengen
Gedichtanthologien
Gedichtbände von Wilhelm Lehmann, Georg Britting, Peter Gan, Oskar Loerke und Friedrich Georg Jünger
Gedichte von Eberhard Meckel, Marie Luise Kaschnitz, Peter Huchel, Günter Eich und Jens Heimreich
Gedichte und Gedichtbände von Werner Bergengruen, Jochen Klepper und Reinhold Schneider
Erzählungen, Novellen, Legenden: Anthologien
Einige prominente Erzählungen
Beschreibung der inneren Emigration: Rudolf Alexander Schröder und Gottfried Benn
IV. LITERATUR VON FRAUEN
Politische Modifikation des Frauenbilds zu Beginn der NS-Zeit
Drei nationalsozialistische Frauenromane von Brigitte von Arnim, Kuni Tremel-Eggert und Grete von Urbanitzky
Neutrale und kontrastive Frauenliteratur
V. JÜDISCHE LITERATUR IN DEUTSCHLAND
Debatte über eine genuin jüdische Literatur
Lyrik des erzwungenen Aufbruchs: Manfred Sturmann und Karl Wolfskehl
Erzählungen und Romane der Notlage
Imagination der Auswanderung: Rudolf Frank
Palästina-Reiseberichte und Palästina-Romane
Ludwig Strauß’ Gedichtband ‹Land Israel› und andere Gedichte
Else Lasker-Schülers ‹Hebräerland›
Gertrud Kolmars ‹Preußisches Wappenbuch›, ‹Die Frau und die Tiere› und ‹Das Wort der Stummen›
Erinnerungen an vergangenes jüdisches Leben in Deutschland: Gerson Stern und Jacob Picard
Beschwörung des Ostjudentums: Soma Morgensterns Romantrilogie ‹Funken im Abgrund›
VI. SYSTEMKONFORME THEMENFELDER UND GENRES
1. Bauern- und Dorfroman
Auf dem Weg ins Dritte Reich
«Sentimentalische» Bauerndichtung, aber selten von Bauern
Nationalsozialistische «Adligsprechung» des Bauerntums
Hochkonjunktur der Bauernromane und kritische Einwände
Der Kampf um die Höfe: Romane von Josefa Berens-Totenohl
Blicke auf Dörfer und Kleinstädte
Ein prekärer Landlebenroman: Hans Falladas ‹Wir hatten mal ein Kind›
Ein ständestaatlicher Bauernroman: Johannes Freumbichlers ‹Philomena Ellenhub›
Spaten-Nostalgie in Emil Strauß’ ‹Das Riesenspielzeug›
Dramatischer Strukturwandel eines Dorfes in der Zwischenkriegszeit: Anton Betzners ‹Basalt›
Alternative Bauernromane
Landlebenlyrik
Bauernspiele
Waldbücher, insbesondere Ernst Wiecherts ‹Einfaches Leben› und Waldemar Bonsels’ ‹Mario/Ein Leben im Walde›
Großstadtroman: Fehlanzeige
2. Arbeitswelt
Nationalsozialistische Durchdringung der Arbeitswelt
Feier der Arbeit
Propaganda für den Arbeitsdienst
Die Arbeitsfront als Ausdruck der Volksgemeinschaft
Indienstnahme von «Arbeiterdichtern»
Von der «Arbeiterdichtung» zur «Arbeitsdichtung»
Versöhnung von Mensch, Technik und Natur
3. Technologische Aufrüstung
Der Kontext: Rohstoffmangel und «Vierjahresplan»
Anton Zischka: ‹Wissenschaft bricht Monopole›
Karl Aloys Schenzinger: ‹Anilin›
Rudolf Brunngraber: ‹Radium›
Science-Fiction und Paul Gurks Dystopie ‹Tuzub 37›
Ernst Jüngers «Werkstättenlandschaft» und Friedrich Georg Jüngers Technikkritik
4. Erster Weltkrieg
Neues Interesse an Kriegsliteratur
Schreiben über den Krieg im Dritten Reich: Friedrich Franz von Unruh
Neue Romane und Erzählungen über den Ersten Weltkrieg
Heldengeschichten und Todeskitsch
Der Krieg der Frauen
Nachkriegsgeschichten und Kameradschaftsmythos
Leiden am Krieg
Zweierlei Blicke auf Verdun: P. C. Ettighoffer und Arnold Zweig
Österreichische Kriegsromane
Schlachten des Ersten Weltkriegs: Friedrich Georg Jüngers unzeitgemäßes Kriegsepos
Zwei Panorama-Romane über den Krieg: Otto Paust und Bernard von Brentano
Die Schweiz und der Erste Weltkrieg: Meinrad Inglins ‹Schweizerspiegel›
Und ein Helden- und Untergangsbestseller: Frank Thieß’ Seekriegsroman ‹Tsushima›
5. Literatur des «Grenz- und Auslanddeutschtums»
Deutsche im Ausland
Grenz- und Volkstumsbücher, Literaturgeschichten und Anthologien
Grenz- und auslanddeutsche Literatur: Ausgewählte Werke
Panorama der deutschen Auswanderung und Ostkolonisation: Josef Pontens ‹Volk auf dem Wege›
Wertungsfragen
Grenzlandspiele
Ausblick: Heimholungs- oder Heimkehrbücher der Jahre nach 1939
FÜNFTER TEIL: ERFAHRUNG EMIGRATION UND EXIL, SPANIENKRIEG UND MOSKAUER SÄUBERUNGEN
I. FLUCHT, EMIGRATION UND EXIL IM SPIEGEL DER GATTUNGEN
1. Lyrik
«Schlechte Zeit für Lyrik», aber nicht nur
Breite und Vielfalt der Exillyrik (Anthologien)
Brechts Neuansatz: «reimlose Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen»
Konventionelle Formen bei Max Herrmann-Neiße, Johannes R. Becher und anderen
Hauptmotiv Klage
Walter Mehrings Ermutigungen
Johannes R. Bechers ‹Der Glücksucher und die sieben Lasten›
Weitere Sammlungen und Erich Arendts Gedichte
2. Dramatik
3. Epik
Emigrationsromane von Klaus Mann, Luise Straus-Ernst, Konrad Merz, Hans Habe, Bruno Frank, Irmgard Keun, Victoria Wolff
Alfred Döblins Roman ‹Babylonische Wandrung›
Exil als «Passion und Kampf»: Romane von René Schickele, Fritz Erpenbeck, Rudolf Frank, Klaus Mann, Lion Feuchtwanger, Erich Maria Remarque
Zwei ‹Frauenbücher›: Anna Gmeyners ‹Café du Dôme› und Alice Rühle-Gerstels ‹Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit›
II. JUDENTUM IN DER EXILLITERATUR
Zur Frage der Besonderheit
Robert Neumanns Roman ‹An den Wassern von Babylon›
Wohin mit den Juden? Antworten von Stefan Zweig, Arnold Zweig, Lion Feuchtwanger und Alfred Döblin
Deutschsprachige jüdische Literatur in Mandats-Palästina
III. Der spanische Bürgerkrieg
«Bürgerkrieg» oder europäischer «Stellvertreterkrieg»?
«Internationale Brigaden» und Engagement von Literaten
Der Spanienkrieg als mediales Ereignis
Lyrik, Erzählung, Dramatik
Romane von Willi Bredel, Gustav Regler, Eduard Claudius, Hermann Kesten und Stefan Andres
Reichsdeutsche Spanienkriegsliteratur
Das literarische Weiterleben der «Internationalen Brigaden»
IV. DIE BESCHWIEGENEN SÄUBERUNGEN IM MOSKAUER EXIL
«Säuberungen»: Anlaß und Umfang
Einbeziehung der deutschen Schriftstellergruppe
«Stalinismus von unten»: Wachsamkeitsparolen
Interne Säuberungsverhandlungen
Die Moskauer Prozesse: Stellungnahmen von Bertolt Brecht, Ernst Bloch und anderen
Arthur Koestlers ‹Sonnenfinsternis›
Alfred Kurellas ‹Gronauer Akten›
SECHSTER TEIL: BINNEN- UND EXILDEUTSCHE ZEIT- UND GESCHICHTSROMANE UND -DRAMEN
I. BINNEN- UND EXILDEUTSCHE ZEITROMANE
Vorbemerkung zu den Begriffen «Zeitliteratur» und «Zeitstück»
Größere und kleinere Epochenromane: Wolfgang Koeppens ‹Die Mauer schwankt›, Gabriele Tergits ‹Effingers›, Ilse Molzahns ‹Töchter der Erde› und andere
Eine religiös grundierte Epochenanalyse: Elisabeth Langgässers ‹Das unauslöschliche Siegel›
Ein Menetekel am Rande Europas: Franz Werfels ‹Vierzig Tage des Musa Dagh›
Die deutsche Revolution von 1918/19: Alfred Döblins ‹November 1918›
Mit dem Fokus auf der Weimarer Republik: Hans Falladas ‹Wolf unter Wölfen› und ‹Der eiserne Gustav›, Bernhard Diebolds ‹Das Reich ohne Mitte› und Arnolt Bronnens ‹Kampf im Aether›
Die 1920er Jahre im Licht des Dritten Reichs: Horst Langes ‹Schwarze Weide› und Ilse Molzahns ‹Nymphen und Hirten tanzen nicht mehr›
Romane des Übergangs von der Weimarer Republik ins Dritte Reich: Anna Gmeyners ‹Manja›, Maria Gleits ‹Du hast kein Bett, mein Kind› und andere
Politikferne binnendeutsche Romane der 1930er Jahre: Kurt Kluges ‹Der Herr Kortüm›, Ernst Barlachs ‹Der gestohlene Mond›, Friedo Lampes ‹Septembergewitter›, Hans Carossas ‹Geheimnisse des reifen Lebens› und andere
Unter Einbeziehung der Politik: Klaus Manns ‹Mephisto›, Ödön von Horváths ‹Jugend ohne Gott› und Franz Werfels ‹Eine blaßblaue Frauenschrift›
Schweizer Sorgen: Jakob Bührers ‹Sturm über Stifflis› und Albin Zollingers ‹Pfannenstiel›
II. EXIL- UND BINNENDEUTSCHE GESCHICHTSROMANE
Neue Weichenstellung um 1933/34
Der historische Roman in der Debatte emigrierter Autoren
Romane von Stefan Zweig, Heinrich Mann, Hermann Kesten, Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger und Fritz Heymann
Alfred Döblins ‹Amazonas›-Trilogie
Thomas Manns ‹Joseph›-Tetralogie und ‹Lotte in Weimar›
Hermann Brochs Roman ‹Der Tod des Vergil›
Der historische Roman in Deutschland: Gattungsdiskussion und thematisches Spektrum
Der neutrale historische Roman
Der NS-affine historische Roman
Der christliche historische Roman im Dritten Reich (Vorbemerkung)
Jochen Kleppers christlicher Regentenspiegel ‹Der Vater›
Reinhold Schneiders antirassistische Erzählung ‹Las Casas vor Karl V.›
Gertrud von le Forts ‹Magdeburgische Hochzeit›, Werner Bergengruens ‹Am Himmel wie auf Erden› und Erika Mitterers ‹Der Fürst der Welt›
Zwischen Geschichtsbuch und historischem Roman: Frank Thieß’ ‹Das Reich der Dämonen›
III. GESCHICHTSDRAMA
Binnen- und exildeutsche Geschichtsdramatik (Überblick)
Bertolt Brechts ‹Leben des Galilei›
SIEBTER TEIL: DIE LITERATUR DER KRIEGSJAHRE
I. DER KRIEGSBEGINN
1. Der Weg in den Krieg
2. Gemischte Gefühle
II. REICHS- ODER BINNENDEUTSCHE LITERATUR
1. Kriegsdienst deutscher Autoren
2. Poetische Mobilmachung und Kriegskritik
2.1. Kriegslyrik
2.2. Lyrische Einsprüche
III. EXILLITERATUR
1. Auswirkungen des Kriegs auf das Exil
2. Nördliche Flüchtlingsgespräche, südliche Fluchtgeschichten
3. Exkurs: Der Sieg über Frankreich in der binnendeutschen Literatur
4. Neues Exil in Amerika
5. Exilautoren im Abwehrkampf gegen Hitler
6. Das Dritte Reich im Kriegszustand: Blicke von draußen
IV. KRIEGSLITERATUR
1. Berichte und Tagebücher
2. Erzählungen und Romane
3. Lidice
4. Stalingrad
5. Luftkrieg
V. DER MORD AN DEN EUROPÄISCHEN JUDEN
VI. STIMMEN AUS DEN GEFÄNGNISSEN
VII. DREI HAUPTWERKE DER LETZTEN JAHRE
1. Reflexion einer Rebarbarisierung: Gerhart Hauptmanns
Atriden-Tetralogie
2. Hoffnung auf Inseln der Kultur und Humanität: Hermann Hesses Roman
Das Glasperlenspiel
3. «und alle Fragen offen»: Bertolt Brechts Parabelstück
Der Gute Mensch von Sezuan
und
Der kaukasische Kreidekreis
VIII. ABGESÄNGE
EPILOG
ANHANG
DANK
AUSWAHLBIBLIOGRAPHIE
Theorie und Methodologie der Literaturgeschichte
Literaturgeschichtliche Darstellungen, Dokumentationen, Handbücher, Lexika und Sammelwerke für die Jahre 1933–1945
Wichtige Untersuchungen zur binnendeutschen und auslanddeutschen Literatur
Wichtige Untersuchungen zur jüdisch-deutschen Literatur
Wichtige Untersuchungen zur österreichischen und schweizerdeutschen Literatur
Wichtige Untersuchungen zur Exilliteratur
Wichtige politik- und gesellschaftsgeschichtliche Darstellungen
PERSONEN- UND WERKREGISTER
Zum Buch
Vita
Impressum
Motto
Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut In der wir untergegangen sind Gedenkt Wenn ihr von unsern Schwächen sprecht Auch der finsteren Zeit Der ihr entronnen seid.
Bertolt Brecht, An die Nachgeborenen, 1939
EINLEITUNG
Literatur in «finsteren Zeiten»
Die vierzehn Jahre zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Beginn der NS-Herrschaft in Deutschland waren eine Blütezeit der deutschsprachigen Literatur. Krieg und Revolution erwiesen sich als fast unerschöpfliche Generatoren für die künstlerische Entwicklung auf allen Gebieten, für die Literatur nicht nur als Stichwortgeber, sondern auch als Formanreger. In verstärkter Auseinandersetzung mit den sozialen Verwerfungen und der politischen Entwicklung entstanden in avantgardistisch inspirierter Weiterentwicklung tradierter Muster Romane, Dramen und Gedichte, die bis heute als Hauptwerke der literarischen Moderne gelten. Erinnert sei an Thomas Manns Zauberberg (1924) und Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz (1929), an Georg Kaisers Gas-Trilogie (1918–20) und Bertolt Brechts Dramen Die heilige Johanna der Schlachthöfe und Die Maßnahme (1930–32), an seine lyrische Hauspostille (1927) und an Gottfried Benns geschichtskritische und formal kühne Montage-Gedichte im Stil von Chaos (1923) und Qui sait (1927). Die auf 1933 folgenden zwölf Jahre, die unter dem Zeichen des Hakenkreuzes standen, belasteten die Autoren hingegen derart mit politischen Fragen und Anforderungen, Zwängen und Nöten, daß die Wahrung literarischer Qualitäten und die Weiterentwicklung narrativer, dramatischer und lyrischer Ausdrucksformen beträchtlich erschwert wurden, ja das literarische Schaffen überhaupt in Frage gestellt wurde. Nicht nur Hermann Broch bezweifelte unter den eingetretenen Umständen, «ob Dichten» – wegwerfend sagte er mitunter auch «Gschichtln erzählen» – «heute noch eine legitime Lebensäußerung» sei (so in einem Brief vom 23. Mai 1933 an seinen Schriftstellerkollegen Frank Thieß). Und doch wurden viele Autoren – unter ihnen auch Broch – gerade durch die Zumutungen dieser «finsteren Zeit blutigster Unterdrückung» und «Verfolgung», wie Bertolt Brecht sie nannte, fortwährend gedrängt, Stellung zu nehmen, die Verhältnisse und Geschehnisse in künstlerisch profilierter Form für sich und die Leserschaft zu reflektieren, oft in der Hoffnung, Einfluß auf den Gang der Dinge nehmen zu können, oder wenigstens in der Absicht, zeugenschaftlich festzuhalten, was an Entsetzlichem zu erleben und zu erfahren war – «den Toten zum Gedächtnis, den Lebenden zur Schande, den Kommenden zur Mahnung», wie es am Ende von Ernst Wiecherts Bericht Der Totenwald (1939/45) heißt. Literatur und Politik, die heute Geschichte ist, gingen unter diesen Umständen eine besonders enge Verbindung ein, die zumeist durch Kritik, Polemik und Klage bestimmt war, manchmal aber auch durch verblendete Zustimmung zum offenkundigen politischen Verbrechen. Dieses spannungsvolle, die Autoren und ihre Werke in vielfacher Weise tangierende und tingierende Verhältnis von Literatur und Politik in allen wichtigen Dimensionen und an repräsentativen Texten ansichtig zu machen, ist das Ziel dieser Literaturgeschichte.
An historisch und ästhetisch bedeutungsvollen Werken, die neben den großen Würfen der kulturell hochgradig inspirierten Weimarer Zeit bestehen können, fehlt es trotz der genannten Erschwernisse nicht. Viele von ihnen entstanden extra muros, wie man seit alten Zeiten sagt, im Exil, manche intra muros, in Deutschland oder «im Reich», wie man damals auch sagte. Für das Exil seien in exemplarischer Absicht genannt: Thomas Manns Joseph-Romane (1934–43), Franz Werfels Genozid-Roman Die vierzig Tage des Musa Dagh (1933), Willi Bredels Häftlings- und Widerstandsroman Die Prüfung (1934), Alfred Döblins Emigrationsroman Babylonische Wandrung oder Hochmut kommt vor dem Fall (1934), Stefan Zweigs historischer Roman Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam (1935), Elias Canettis Intellektuellen-Roman Die Blendung (1936), Heinrich Manns Regentenromane Die Jugend und Die Vollendung des Königs Henri Quatre (1935 und 1938), René Schickeles humoristisch-verzweifelter Exilroman Die Flaschenpost (1937), Alfred Döblins mehrteiliger Amazonas-Roman, Döblin zufolge eine «Generalabrechnung mit der europäischen Civilisation» (1937/38), des Schweizers Meinrad Inglin historisch-politischer Krisenroman Schweizerspiegel (1938), Anna Gmeyners Epochenroman Manja (1938), Veza Canettis Wiener «Anschluß»-Roman Die Schildkröten (1940 entstanden, 1999 aus dem Nachlaß ediert), Franz Werfels Lourdes-Roman Das Lied von Bernadette, ein Welterfolg (1941), Anna Seghers’ Haft-, Flucht- und Verfolgungsroman Das siebte Kreuz, ebenfalls ein Welterfolg (1942), Arnold Zweigs Deutschland-Roman Das Beil von Wandsbek (1943 in hebräischer Übersetzung in Tel Aviv, 1947 auf deutsch im Neuen Verlag Stockholm), der zivilisationskritische Roman Das Glasperlenspiel (1943) des Wahlschweizers Hermann Hesse, Anna Seghers’ Fluchtroman Transit (1944), Hermann Brochs geschichts- und religionsphilosophischer Roman Der Tod des Vergil (1945), nicht zuletzt Bertolt Brechts Szenenfolge Furcht und Elend des III. Reiches (1938), seine kämpferische Lyriksammlung Svendborger Gedichte (1939) sowie – neben anderem – die Stücke Mutter Courage und ihre Kinder (1941 Uraufführung im Schauspielhaus Zürich) und Leben des Galilei (1943 Uraufführung im Schauspielhaus Zürich). Teilweise unabgeschlossen und jedenfalls vor Kriegsende unveröffentlicht blieben solch bedeutende Werke wie Hermann Brochs Romane Die Verzauberung (1934 ff.) und Der Tod des Vergil (1938 ff.), Alfred Döblins vierbändiges «Erzählwerk» November 1918 (1938–43), Thomas Manns Doktor Faustus (1943–47). – An der Verlagerung der Druckorte ins Ausland und an ihrem durch die politischen Geschehnisse erzwungenem Wechsel (bei Thomas Mann von Berlin über Wien nach Stockholm) läßt sich die Geschichte des literarischen Exils ablesen. Im zeitlichen Ablauf zeigt sich aber auch das anfängliche Festhalten am Verlagsort Deutschland, das durch den Wunsch nach Präsenz und Absatz in Deutschland bestimmt war. Zudem wird am Beispiel von Inglins Schweizerspiegel, der 1938 bei Staackmann in Leipzig erschien, erkennbar, daß Deutschland ein Verlags- und Absatzgebiet blieb, auf das schweizerische und österreichische Autoren kaum verzichten konnten, wenn sie vom Verkauf ihrer Bücher leben wollten.
Die größten dichterischen Werke – Thomas Manns Joseph-Romane, Alfred Döblins Amazonas-Trilogie und seine November 1918-Trilogie, Hermann Brochs Vergil-Roman, Bertolt Brechts Zeitreflexion in «reimloser Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen» und sein Leben des Galilei – wurden unter den materiell schwierigen, aber geistig freien Bedingungen des Exils geschrieben. Gleichrangige Werke gelangen in Deutschland weniger, was zum einen wohl auf den Umstand zurückzuführen ist, daß ein großer Teil der arriviertesten Autoren 1933 Deutschland verlassen mußte, zum andern aber gewiß auch auf die repressiven Lebens- und Arbeitsbedingungen. Gleichwohl entstanden auch in Deutschland respektable Werke, zum Teil sogar aus der Feder von Autoren, die dem Nationalsozialismus nahestanden. In chronologischer Reihenfolge seien genannt: Siegfried von Vegesacks Romantrilogie Die baltische Tragödie (1933–35), Josef Weinhebers Gedichtsammlung Adel und Untergang (1934), Emil Strauß’ Roman Das Riesenspielzeug (1935), Friedrich Georg Jüngers Gedichtbände Gedichte (mit dem Protestgedicht Der Mohn, 1934) und Der Taurus (1937), Werner Bergengruens Roman Der Großtyrann und das Gericht (1935), Elisabeth Langgässers Lyrikband Die Tierkreisgedichte (1935) und ihr Roman Der Gang durch das Ried (1936), Gottfried Benns Statische Gedichte (einzeln ab 1935, als Sammlung 1948), Hans Carossas Roman Geheimnisse des reifen Lebens (1936), Rudolf Brunngrabers Wissenschafts- und Weltdeutungsroman Radium (1936), Johannes Freumbichlers nostalgischer Bauern- und Dorfroman Philomena Ellenhub (1936/37), Ernst Barlachs Roman Der gestohlene Mond (1936/37, 1948 postum ediert), Jochen Kleppers historischer Preußen-Roman Der Vater (1937), Rudolf Alexander Schröders Reflexion einer «inneren Emigration» in Form der Ballade vom Wandersmann (1937), Horst Langes Roman Schwarze Weide (1937), Ilse Molzahns modernistisch erzählter und ideologisch abweichender Roman Nymphen und Hirten tanzen nicht mehr (1938), Kurt Kluges humoristischer Sonderlingsroman Der Herr Kortüm (1938), Ina Seidels Geschichtsroman Lennacker (1938), Reinhold Schneiders Menschenrechtsroman Las Casas vor Karl V. (1938), Heimito von Doderers Schicksalsroman Ein Mord den jeder begeht (1938), Ernst Wiecherts Nachkriegsroman Das einfache Leben (1939), Ernst Jüngers Abenteuerliches Herz in der zweiten, raffiniert regimekritischen Fassung (1938) und seine Widerstandserzählung Auf den Marmorklippen (1939), Alexander Lernet-Holenias Roman Mars im Widder über den Beginn des Kriegs (1940), Horst Langes Kriegserzählung Ulanenpatrouille (1940), Werner Bergengruens historischer Preußenroman Am Himmel wie auf Erden (1940), Erika Mitterers Inquisitionsroman Der Fürst der Welt (1940), Frank Thieß’ romanhafte Geschichte der Antike mit dem Titel Das Reich der Dämonen (1941) und Anton Betzners Basalt (1942), ein bewegender Dorfroman über die Jahre, die vom einen in den andern Krieg führten. Entstanden sind in dieser Zeit auch Werke wie Elisabeth Langgässers Roman Das unauslöschliche Siegel (1937 ff., abgeschlossen und publiziert 1946) und Hermann Kasacks Roman Die Stadt hinter dem Strom (1942 ff., abgeschlossen und publiziert 1947).
Beide Listen wären um weitere Titel von literarischer Qualität und ethischer Dignität zu ergänzen, doch geht es hier nicht um Vollständigkeit, sondern um exemplarische Repräsentativität. Bei manchen Werken, die prinzipiell in Frage kommen, zögert man freilich, sie zu nennen, so zum Beispiel bei Arnolt Bronnens Roman Kampf im Aether oder Die Unsichtbaren, der die Entwicklung des Rundfunks und die Auseinandersetzung um die Republik von 1923 bis zum Vorabend des Dritten Reichs rekapituliert und 1935 unter dem Pseudonym A. H. Schelle-Noetzel bei Rowohlt in Berlin erschien. Seine zupackende und suggestive Darstellungsweise, in der Rundfunkemphase und Politiksatire einander steigern und schärfen, macht ihn zu einem eindrucksvollen Werk, das den Vergleich mit anderen gesellschaftskritischen Romanen früherer Jahre – etwa mit Heinrich Manns vielgerühmtem Roman Der Untertan (1918) – nicht zu scheuen braucht. Allerdings gibt es auch einige Momente wie den unverhohlenen Antisemitismus, die Frontkämpfer- und Fememörderbejubelung und die schäbige Darstellung von Heinrich und Thomas Mann (im Roman: der Dichter Greis), die zögern lassen, den Roman als «Leistung» zu registrieren.
Rassismus und speziell Antisemitismus lassen auch in anderen Fällen zögern, ein Werk zu berücksichtigen. Als Beispiel sei Emil Strauß’ Roman Das Riesenspielzeug genannt, der 1934 (mit Vordatierung auf 1935) bei Langen Müller in München erschien. Strauß, berühmt unter anderem durch den Roman Freund Hein (1902), der eine Welle von Schüler-Selbstmord-Büchern einleitete, wurde 1926 Mitglied der Berliner Dichterakademie, verließ diese 1931 aus Protest gegen deren «internationalistische» Orientierung und trat sowohl dem nationalsozialistischen Kampfbund für deutsche Kultur als auch der NSDAP bei. In seinem fast tausend Seiten zählenden Roman Das Riesenspielzeug, dessen Handlung kurz nach Bismarcks Entlassung (1890) spielt, schildert er den Versuch einiger vegetarisch eingestellter Jungakademiker, auf einem Schloßgut am Oberrhein eine neue Form der Landwirtschaft zu finden. Hier taucht nun auch ein jüdischer Arzt namens Seidschnur auf, für dessen Erscheinungs- und Handlungsweise Strauß auf antisemitische Stereotype rekurriert. Hermann Hesse, der ein Bewunderer von Strauß war, hat dies geradezu unter Schmerzen wahrgenommen und in einer Rezension des Riesenspielzeugs, die am 28. Oktober 1934 in der Neuen Zürcher Zeitung erschien, ausdrücklich benannt: es zeige sich darin «ein starrer und mit nicht gerade unwürdigen, aber billigen, also des Dichters dennoch unwürdigen Mitteln agitierender Antisemitismus». Dennoch ist Hesses Rezension voll des Lobs für den Erzähler Strauß und sein «prachtvolles, reifes, nuancenreiches und musikalisches Deutsch», ebenso für die humoristische Brechung der idealistischen Tendenzen des Geschehens. Erst in späteren Jahren ging Hesse auf Distanz zu Strauß, jedoch ohne ihn ausdrücklich zu verurteilen; nur erwähnte er ihn öffentlich nie wieder.
Fragen der Auswahl
Eine Literaturgeschichte könnte dem folgen und alle Autoren, die in irgendeiner Weise basale Normen des Anstandes und der Humanität, der Toleranz, Menschenwürde, Freiheitlichkeit und Rechtlichkeit gebrochen haben, der Damnatio memoriae unterwerfen. Tatsächlich wurde dieser Weg immer wieder beschritten. In einer profunden zweibändigen Geschichte der deutschen Lyrik von Goethe bis zur Gegenwart, die 1996 im Insel-Verlag erschien, wird Josef Weinheber, der ein Lyriker von Rang, aber auch ein Hitler-Verehrer war, nur mit einem Gedicht zitiert und in einer Fußnote mit ein paar Sätzen bedacht; von seinem übrigen lyrischen Schaffen ist keine Rede. In einem literaturgeschichtlichen Überblickswerk, das 1985 unter dem Titel Tendenzen der deutschen Literatur zwischen 1918 und 1945 in einem renommierten Schulbuchverlag erschien, gibt es für die «Literatur der Weimarer Republik 1918 bis 1933» ein Verzeichnis wichtiger Werke, das rund 700 Titel umfaßt. Die Zeit von 1933 bis 1945 wird in zwei Kapiteln behandelt, zunächst unter der Überschrift «Zur Literatur im Deutschland der dreißiger und vierziger Jahre», dann unter der Überschrift «Zur deutschen Exilliteratur zwischen 1933 und 1950». Dieses Exil-Kapitel hat wiederum ein Verzeichnis wichtiger Werke, das rund 300 Titel zählt. Für das erste Kapitel über die binnendeutsche Literatur von 1933 bis 1945 gibt es ein solches Verzeichnis indessen nicht. Man wollte wohl nicht in den Ruf kommen, Bücher mit nationalsozialistischem Hintergrund oder gar Einschlag empfohlen zu haben. Vielleicht hatte man auch noch Thomas Manns harsches Diktum vom Oktober 1945 im Ohr, wonach alle Bücher, die von 1933 bis 1945 in Deutschland gedruckt wurden, mit einem «Geruch von Blut und Schande» behaftet seien und «eingestampft» werden sollten.
Seitdem hat sich die Wahrnehmung geändert. Lexika, Aufsatzbände wie Dichtung im Dritten Reich? (1996, herausgegeben von Christiane Caemmerer und Walter Delabar), Nationalsozialismus und Exil (2009, herausgegeben von Wilhelm Haefs) oder Dichter für das ‹Dritte Reich› (2009 ff., 5 Bände, herausgegeben von Rolf Düsterberg) und eine große Zahl von Monographien haben viele Einblicke geschaffen. Voraus ging ihnen der materialreiche und bis heute beachtenswerte Studienband Die deutsche Literatur im Dritten Reich (1976, herausgegeben von Horst Denkler und Karl Prümm). Die wichtigsten Werke literarischer Regimegegner (wie Ernst Wiechert) oder indifferenter Autoren (wie Horst Lange) werden in der germanistischen Forschung und Lehre mit differenzierter Wertschätzung behandelt. Dabei werden die Werke nicht etwa nur unter politisch-moralischen, sondern auch unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet, also als Kunstwerke wahrgenommen und gewürdigt. Anders ist es in der Regel bei Werken, die Affinitäten zur NS-Ideologie aufweisen oder von Parteimitgliedern stammen. Die Auseinandersetzung mit ihnen beschränkt sich meist auf die ideologiekritische Entlarvung und auf die Feststellung, dürftige poetische Mittel seien für böse politische Botschaften instrumentalisiert worden. Daß ein NS-naher Autor ein Buch geschrieben haben könnte, das uns – wie es Hesse mit Strauß’ Riesenspielzeug ging – künstlerisch beeindrucken könnte und als dichterische Leistung anzuerkennen wäre, scheint fast ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Das Fragezeichen hinter dem Titel Dichtung im Dritten Reich? bestimmt die Wahrnehmung noch immer und hat auch bleibende Berechtigung.
Neben Werken, die als herausragende literarische Leistungen anzuerkennen sind, gibt es eine große Zahl an Literatur mittlerer Höhe, die im Exil stark politisch ausgerichtet war, in Deutschland selbst hingegen auf die Thematisierung von Politik und Zeitgeschichte weitgehend verzichtete beziehungsweise verzichten mußte. Lion Feuchtwanger verwendete dafür in seinem Roman Exil (1939) den Begriff «Durchschnittsliteratur», und Thomas Mann notierte nach der Lektüre eines entsprechenden Manuskripts am 7. Dezember 1941 in seinem Tagebuch: «Erzählung aus [gemeint: über] Nazi-Deutschland, dramatisch, packend auf mittlerem Niveau.» Wo die Grenze zwischen «hochwertiger Dichtung» und «Literatur mittlerer Höhe» verläuft, ist allerdings eine nicht in jedem Fall intersubjektiv verbindlich entscheidbare Ermessensfrage. So schrieb Hermann Hesse am 2. Mai 1939 an Meinrad Inglin zunächst einmal, er habe dessen Schweizerspiegel, den er gerade gelesen hatte, «nicht als Dichtung betrachtet, sondern als Zeitspiegel und Mahnruf», fügte dann jedoch hinzu, am Ende bleibe «doch ein Gesamteindruck, der eigentlich dichterisch» sei. Inglin wird aber verstanden haben, daß Hesse den Schweizerspiegel als «Zeitroman» las und auch schätzte, aber nicht als «Dichtung» gelten ließ, das heißt: als Werk, das weniger von seinem vergänglichen zeitgeschichtlichen Gehalt lebt als vielmehr von überdauernden Lebenseinsichten in bezwingender Exemplifizierung und spezifischer sprachlicher Vermittlung.
Im Fall des Schweizerspiegels ist es keine Frage, daß der Roman als eines der großen Erzählwerke jener Jahre in einer Literaturgeschichte nicht nur erwähnt, sondern dargestellt und gewürdigt werden muß. Bei vielen anderen Texten kann man lange darüber streiten. Die vorliegende Literaturgeschichte ist diesbezüglich von der Absicht geleitet, die literatur- und zeitgeschichtlich interessanten, also in bestimmter Hinsicht repräsentativen und aufschlußreichen Texte in möglichst großer Breite zur Geltung zu bringen. Die Kriterien der literarischen und ethischen Dignität werden dabei nicht etwa ignoriert, aber zugunsten historiographischer Erfassungsbreite zurückgestellt. Trotzdem bleibt die Auswahl der in Frage kommenden Werke letztlich sehr begrenzt, wie ein Blick auf Autoren- und Publikationszahlen zeigt. Diese sind allerdings nur annäherungsweise zu ermitteln.
Die Reichsschrifttumskammer zählte im Jahr 1942 genau 10.118 hauptberufliche Autoren, von denen 2125 weiblichen Geschlechts waren. Hinzu kommen nebenberuflich tätige Autoren und Gelegenheitsautoren sowie hauptberufliche Autoren, die – wie der «verbotene» Erich Kästner – nicht Mitglieder der Reichsschrifttumskammer waren und deswegen offiziell auch nicht publizieren durften, aber doch teils unter Decknamen, teils in Kooperation mit ausländischen Verlagen literarisch tätig waren. Kurz, die Zahl der literarisch Tätigen dürfte – wie in den 1920er Jahren – bei annäherungsweise 20.000 gelegen haben, die Zahl der emigrierten Schriftsteller und Publizisten bei rund 2500. Auch die Zahl der literarischen Publikationen ist nur annäherungsweise abschätzbar und wird für die Jahre bis 1939 in verlagsgeschichtlichen Untersuchungen auf durchschnittlich etwa 4000 Titel pro Jahr geschätzt.
Von jenem literaturgeschichtlichen Gewicht, das sich außer an der dauerhaften Wertschätzung von Werken auch an dem manchmal flüchtigen Ansehen von Autoren bei ihren Zeitgenossen bemißt, war nur ein kleiner Teil der um 1940 registrierten haupt- und nebenberuflichen Schriftsteller. Das größte qualifizierende deutsche Schriftstellerlexikon, das von Walther Killy begründete und von Wilhelm Kühlmann 2008 bis 2012 novellierte Literaturlexikon, bedenkt rund 820 Autoren, die zwischen 1933 und 1945 mit literarischen Werken in Erscheinung traten, mit Personalartikeln, darunter etwa 90 Frauen. Nationalsozialistische Autoren wie Hanns Johst und Gerhard Schumann, die im Literaturbetrieb jener Zeit eine Rolle spielten, werden selbstverständlich auch berücksichtigt. Auf Emigration wird bei etwa 120 Autoren hingewiesen. – Alle diese Zahlen sind aber nur approximativ zu verstehen, weil das zugrundeliegende Datenmaterial auf den begrenzten Möglichkeiten des Lexikons beruht.
Selbstverständlich kann jeweils nur ein Bruchteil dieser Autoren und Publikationen in einer literaturgeschichtlichen Darstellung berücksichtigt werden – und wenn sie noch so umfangreich wäre. Die vorliegende Übersicht konzentriert sich auf die dichterisch herausragende und zeitgeschichtlich aufschlußreiche Literatur. Die komplette Unterhaltungsliteratur (einschließlich der Kriminalromane) bleibt unberücksichtigt. Auch die vielen Lebens- oder Schicksalsromane, die so geschrieben sind, daß die Zeit, in der sie spielen, kaum erkennbar wird und inhaltlich mehr oder minder bedeutungslos ist, bleiben unberücksichtigt, obwohl sich darunter literarisch beachtliche Werke befinden. Ein Beispiel ist Heimito von Doderers spannend erzählter Roman Ein Mord den jeder begeht (1938), der das wohl um 1930 frühzeitig und tragisch endende Leben eines noch jungen Mannes schildert. Darin kommt im 29. Kapitel das Gespräch auf die spanische Inquisition, die zaristische Polizei «Ochrana» und das Vorhandensein von «Geheimpolizei überall auf der Welt». Aber deren Tätigkeit wird nicht weiter erörtert, sondern im Dunkeln belassen: «Wir wissen es nicht, und wir erfahren es glücklicherweise auch nie, was rundum alles sich oft gegen uns in Bewegung setzt und dann irgendwo stecken bleibt, ohne jemals zu unserer Kenntnis zu gelangen. Anders könnte man ja keine Nacht ruhig schlafen.» Das konnte man in den Jahren um 1930 wohl sagen. Für einen Roman von 1938 ist es aber, auch wenn er in den 1920er Jahren spielt, eine bemerkenswerte Vermeidung von Aktualitätsbezug – und hier ein Grund, diesen ansonsten schätzenswerten Schicksals- und Kriminalroman nicht weiter zu berücksichtigen (zumal auch Versuche, dem Roman «antifaschistische Stiche» zu attestieren, wenig überzeugend ausfielen). Nicht weiter berücksichtigt wird auch ein so vielgelesener Roman wie Franz Werfels Der veruntreute Himmel (1939), obwohl die Erzählerfigur des Romans ein 1938/39 in Paris lebender Emigrant ist und während der Niederschrift der Geschichte der frommen Magd Teta Linek, die sich in den Himmel einkaufen wollte, den «höheren Sinn» der Emigration erfährt; das damit berührte Thema wird aber in anderen Exilromanen so viel ausführlicher exemplifiziert, daß dieser Roman Werfels übergangen werden kann.
Deutsche oder deutschsprachige Literatur?
Bereits in den 1920er Jahren tauchte die Frage auf, ob man angesichts der politischen Gegebenheiten noch von «deutscher Literatur» schlechthin reden und die Literatur der Deutschschweizer, der Österreicher, der deutschstämmigen und deutschsprachigen Minderheiten in den Nachbarländern sowie die in deutscher Sprache geschriebene Literatur jüdischer Autoren mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten umstandslos darunter subsumieren dürfe. Um diesen Vereinnahmungseffekt zu neutralisieren, wurde bereits im Titel des vorausgehenden Bandes X dieser Literaturgeschichte die Bezeichnung «deutschsprachige Literatur» verwendet. Beide Bezeichnungen haben etwas für sich: Die eine betont die sprachliche und kulturelle Zusammengehörigkeit der deutschen Literatur; die andere weist implizit auf politische und kulturelle Differenzen hin, die nicht übergangen werden dürfen. Manche Autoren beschrieben ihren diesbezüglichen Status auf eine sehr differenzierte und sozusagen hybridisierende Weise, die unmöglich auf den einfachen Nenner «deutsch» zu bringen ist. Friedrich Torberg, der 1908 in Wien als Sohn einer Prager jüdischen Familie geboren wurde und nach der Rückkehr der Familie ab 1921 hauptsächlich in Prag lebte, 1924 die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft erhielt und 1938 zunächst nach Frankreich, dann in die Vereinigten Staaten emigrierte, antwortete 1945 auf eine Umfrage unter Exilautoren, ob sie sich als amerikanische Schriftsteller fühlten: «Der Sprache nach fühle ich mich als deutscher Schriftsteller. In Bezug auf Herkunft, Tradition und literarische Zugehörigkeit: als österreichischer. Aufgrund der sittlichen Fundamente, denen ich verpflichtet bin: als jüdischer.» Vermutlich hätte er sein Werk als der deutschen Literatur zugehörig bezeichnet; sicher ist dies aber nicht. Anders Hermann Hesse, der am 25. Januar 1935 an die Redaktion der schwedischen Zeitschrift Bonniers Litterära Magasin schrieb, er lebe zwar in der Schweiz und sei «politisch Schweizer», sei aber «ein deutscher Autor» und rechne zur «deutschen Literatur», über die er im Magasin regelmäßig berichten wolle, «nicht bloß die reichsdeutsche, sondern die Literatur aller Deutsch schreibenden Völker, wozu «außer der deutschen Schweiz auch Österreich» gehöre; und ebenso werde er auch «Bücher der Emigrantenpresse anzeigen». Hesse hielt also am Begriff und an der Vorstellung einer «deutschen Literatur» fest, doch zeigen seine Ausführungen zugleich, daß Differenzierungs- und Erklärungsbedarf bestand. Das spricht für die differenzbewußte Bezeichnung «deutschsprachige Literatur», doch muß man daraus keinen Glaubenskrieg machen.
Spielarten der deutsch(sprachig)en Literatur
Gleich, ob man nun von deutscher oder deutschsprachiger Literatur spricht, gilt, daß sie in unterschiedlichen Spielarten in Erscheinung tritt. Die nationalstaatliche Unterteilung in reichsdeutsche, österreichische, schweizerdeutsche und auslanddeutsche Literatur kann oder muß sogar um Formen ergänzt werden, die sich aus anderen Kriterien wie besonderen Entstehungsbedingungen oder Ausrichtungen ergeben. Das sofort ins Auge springende Beispiel ist die Exilliteratur, über deren Status seit langem verhandelt wird. Handelt es sich bei ihr schlicht um durch und durch deutsche Literatur, deren Bezeichnung als Exilliteratur letztlich nur durch den Umstand gerechtfertigt ist, daß sie, wie Joseph P. Strelka, einer der Doyens der Exilforschung, 1983 in einem grundlegenden Aufsatz unter dem Titel Was ist Exilliteratur? gesagt hat, im Exil geschrieben wurde? Oder handelt es sich um eine außerdeutsche Literatur mit einem eigenen, durch Disruptions-, Migrations-, Alteritäts- und Akkulturationserfahrungen geprägten Charakter, wie Sabina Becker 2009 in Band 9 der Hanserschen Sozialgeschichte der deutschen Literatur mit dem Titel Nationalsozialismus und Exil 1933–1945 und erneut 2013 in dem von Doerte Bischoff und Susanne Komfort-Heim herausgegebenen Aufsatzband Literatur und Exil betonte? Becker nannte hierfür eine Reihe von Autorennamen und Werktiteln, insbesondere Romane von Ilse Losa (Unter fremden Himmeln, portugiesisch Lissabon 1962, deutsch Freiburg 1991), Jenny Aloni (Zypressen zerbrechen nicht, Witten und Berlin 1961), Lore Segal (Wo andere Leute wohnen, englisch New York 1964, deutsch Wien 2003) und Marte Brill (Der Schmelztiegel, Frankfurt am Main 2003, entstanden in Brasilien 1938–41). Die meisten der genannten Titel sind nach 1945 entstanden und stammen von Autorinnen, die auf Dauer im Ausland blieben, was man dann kaum mehr als Exil bezeichnen kann. Unter den oben genannten Titeln ist Marte Brills autobiographisch grundierter Roman Der Schmelztiegel die Ausnahme: eine aus der aktuellen Erfahrung heraus geschriebene Darstellung der Emigration nach Brasilien und der Ansiedlung in São Paulo mit längeren Schilderungen auch der dortigen gesellschaftlichen Verhältnisse (s.S. 976), in mancher Hinsicht ein Pendant zu dem enthusiastischen Buch Brasilien/Ein Land der Zukunft (1941), mit dem Stefan Zweig sich ein Jahr vor seinem Suizid eine neue Heimat erschließen und aneignen wollte. Entsprechende, durch Alteritätserfahrungen und Akkulturationswünsche tingierte Texte gibt es – von Valerie Popp 2008 unter dem Titel Amerikabilder der deutschsprachigen Exilliteratur erörtert – auch für das Exil in den Vereinigten Staaten, ebenso für die Auswanderung nach Palästina (s.S. 996). Ob man sie der deutschen Literatur zurechnen oder als Realisationen einer eigenständigen Migrationsliteratur betrachten soll, ist eine Frage, über die unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände im einzelnen zu verhandeln wäre. Außer dem Inhalt spricht wenig dafür, Zweigs Brasilien oder Brills Schmelztiegel als Beispiele für eine neuartige exildeutsche Literatur gelten zu lassen; weder strukturell noch sprachlich sind exilspezifische Modifikationen oder gar Innovationen zu erkennen. Von den hybriden Schreibformen, die durch Said El Mtounis Dissertation Exilierte Identitäten zwischen Akkulturation und Hybridität (2015) zu einem Hauptmerkmal von Exilliteratur erhoben wurden, ist in den Büchern von Brill und Zweig so wenig zu finden wie in den Büchern anderer deutscher Exilanten. Die meisten von ihnen schrieben unter «Nichterfahrung der Fremde», wie der deutsch-amerikanische Germanist Wulf Köpke schon 1990 in seinem Aufsatz Das Wartesaal-Leben feststellte, oder «gegen ihr Gastland und gegen ihre Umwelt», wie Sabina Becker 2009 konzedierte.
Damit wird nicht geleugnet, daß es Fälle geglückter Akkulturation gab, etwa Christa Winsloe, die teils in den Vereinigten Staaten, teils in Frankreich lebte und sowohl englisch als auch französisch schrieb, oder Stefan Heym, der seinen ersten Roman Hostages (1942) in englischer Sprache schrieb, 1943 die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm und bis zu seiner Rückkehr nach Europa 1952 beim Englischen blieb. Ebensowenig wird bestritten, daß das Exil sich auf manche Werke sowohl gedanklich als auch sprachlich auswirkte. Beides ist beispielsweise an einer einzigen Stelle von Brechts Galilei zu beobachten. Gemeint ist die Szene, in welcher der Eisengießer Vanni als Vertreter der italienischen Manufakturisten, also der progressiven Wirtschaftskräfte, dem Gelehrten deutlich macht, daß die Verbreitung seiner astronomischen Erkenntnisse von größter Wichtigkeit für seine Klasse sei: Sie bedeute die Befreiung von alten Bindungen, was auch zu der in Italien angeblich noch verwehrten Freiheit, Geld zu verdienen, führen könne. In der dänischen Fassung von 1938/39 gibt es diese Szene nicht; sie findet sich erst in der amerikanischen Fassung von 1944–47, wo Vanni wörtlich sagt: «Here we are not even free to make money», und diese typisch amerikanische Formulierung wurde direkt in die Berliner Fassung von 1955/56 überführt, wo es dann in einer damals sehr ungewöhnlichen Form heißt: «Hier haben wir nicht einmal die Freiheit, Geld zu machen» (Szene 11). Die Vanni-Szene und die Formulierung «Geld machen» brauchten, so scheint es, die Erfahrung des amerikanischen Exils mit einem neuen Blick auf die Wirtschaft, und zweifellos gibt es auch zahlreiche andere Texte, an denen solche Einflüsse des Exils zu beobachten sind. Aber sie zwingen nicht dazu, die Exilliteratur als eine sich verselbständigende Form von Literatur zu werten; sie ist deutsch(sprachig)e Literatur, die eben nur im Exil geschrieben wurde.
Wie die Exilliteratur können im Prinzip auch andere große Textbestände isoliert und als besondere Spielarten der deutschen Literatur betrachtet werden, so vor allem die NS-Literatur, die sich zu Hitlers Herrschaft bekannte und vom Regime gefördert wurde, und die Literatur der inneren Emigration, die auf die eine oder andere Weise Dissens anzeigte und staatlicherseits keine Förderung erfuhr. Nicht umsonst waren beide auch mehrfach Gegenstand spezieller literaturgeschichtlicher Darstellungen, die sich im Fall der nationalsozialistischen Literatur meist auf Aufsätze beschränkten, im Fall der Literatur der inneren Emigration Buchform annahmen, zuletzt mit Gerhard Ringshausens großer Untersuchung Das widerständige Wort und Günter Scholdts Buch Schlaglichter auf die «Innere Emigration» (beide 2022). Ebenso ist an die regionalen Spielarten der deutsch(sprachig)en Literatur zu denken, die in den 1930er Jahren im Anschluß an Josef Nadlers Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften (1912–28) stark profiliert und aufgewertet wurden. In Hellmuth Langenbuchers vielfach aufgelegter Darstellung Volkhafte Dichtung der Zeit (1933, in zehnter Auflage 1944) gibt es ein mehr als hundert Seiten zählendes Kapitel über die Literatur der «Landschaften» und «Stammesräume» (Ostpreußen und Schlesien, bayrisch-österreichischer und alemannisch-schwäbischer Stammesraum, Rhein- und Moselufer, niederdeutsches Gebiet), und die Zeitschrift Die Neue Literatur begann im Juni 1939 mit einer Artikelserie unter dem Titel Schrifttum der deutschen Gaue und Landschaften. Man bemühte sich, die «geheime Kraft einer Landschaft», die aus «dem unlöslichen Ineinander von Naturform und Kulturform» erwächst und «die Menschen bildet und ihre Schicksale mitbestimmt», in den Werken von Autoren wie Agnes Miegel (Ostpreußen) oder Jakob Schaffner (alemannischer Raum) aufzuspüren und dingfest zu machen, doch blieben die Befunde banal oder wurden spekulativ. Nach 1945 wurde diese Art der Literaturbetrachtung durch sozial- und kulturgeschichtlich disziplinierte Regionalstudien abgelöst.
Die Möglichkeit und vielleicht sogar Notwendigkeit, die einzelnen Spielarten der deutsch(sprachig)en Literatur gesondert zu betrachten, spricht nicht dagegen, sie als Erscheinungsformen einer Literatur gemeinsam ins Auge zu fassen, und zwar nicht nur, weil sie einfach nebeneinander bestanden, sondern auch, weil sie einige Gemeinsamkeiten haben. Das beginnt mit der Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen Sprachraum, die auf historische Verwandtschaft hindeutet, gemeinsame kulturelle und literarische Traditionen einschließt und überdies aktuelle praktische Bedeutung hatte: Österreichische, schweizerische und «auslanddeutsche», etwa sudetendeutsche und siebenbürgische Autoren brauchten, wenn sie mehr als lokale Bedeutung erlangen und vom Schreiben leben wollten, Deutschland als Verlags- und Absatzgebiet; es ist ja kein Zufall, daß Inglins Schweizerspiegel 1938 bei Staackmann in Leipzig und Ernst Zahns Schweizerromane bei der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart und Berlin erschienen. Auch hauptsächliche Verfahrensweisen und Formen, Genres und Motive kommen aus der gemeinsamen literarischen Tradition und finden breite Verwendung. Das Sonett ist nicht etwa nur eine Lieblingsform der inneren Emigration, sondern wird auch von nationalsozialistischen Autoren genutzt und von Exilanten geschätzt. Im nationalsozialistischen Mobilisierungsroman und in den ersten Exilromanen über die Machtergreifungszeit wirken die Muster des politischen Kampfromans der Weimarer Zeit fort, und das Thingspiel greift auf Formen der früheren Massenspiele und der Sprechchorbewegung zurück. Ebenso wird das Genre des historischen Romans innerhalb und außerhalb Deutschlands vielfach genutzt. Die politische und gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands nach 1933 ist ein Hauptthema der Exilliteratur; sie ist in hohem Maß deutschlandbezogen, schildert, kritisiert und beklagt die deutschen Verhältnisse. Und sie ist primär für ein deutschsprachiges Publikum außerhalb der Reichsgrenzen geschrieben, aber doch auch in der vielfach artikulierten Hoffnung, daß die Ausgrenzung in absehbarer Zeit beendet sein werde. Auch Schweizer Zeitromane wie Albin Zollingers Die große Unruhe (1939) und Pfannenstiel (1940) haben die Entwicklung des nationalsozialistischen Deutschland als Hintergrund für die Profilierung der Schweizer Bürgerlichkeit. Kurzum: Die von deutschsprachigen Autoren innerhalb und außerhalb Deutschlands geschriebene Literatur jener Jahre hat einen gemeinsamen kulturellen Horizont und Rezeptionsrahmen, bedient sich gemeinsamer Formen und hat in allen Spielarten eine solch starke Ausrichtung auf die Probleme der Zeit, daß eine synoptische Betrachtung trotz unterschiedlicher Entstehungsumstände und unterschiedlicher ideologischer Ausrichtung nicht nur naheliegt, sondern geboten ist. Ein umfassendes Bild der Entwicklung der deutschen Literatur zwischen 1933 und 1945 ist anders nicht zu gewinnen. Basale Differenzen werden in der vorliegenden Darstellung im zweiten Teil unter der Überschrift «Neuordnung der Literaturverhältnisse» beschrieben.
Gebremste und fortgesetzte Modernität
Traditionellerweise und aus guten Gründen wird Literaturgeschichte hauptsächlich als Geschichte der Gattungen beschrieben. Auch der im Jahr 2017 erschienene Vorgängerband zur Literatur der Jahre 1918 bis 1933 endet mit einem Kapitel über die Entwicklung der Gattungen. Dies entfällt hier. In der Entwicklung der lyrischen, dramatischen und epischen Formen gab es zwischen 1918 und 1933 eine Fülle von innovativen Vorstößen, die das Erscheinungsbild der Gattungen stark veränderten, man denke nur an den von Alfred Döblin mit Berlin Alexanderplatz realisierten Hybridroman oder an Bertolt Brechts Konzept des epischen Theaters, das mit der Heiligen Johanna der Schlachthöfe und der Maßnahme zwei unterschiedliche, aber in jedem Fall wegweisende Realisierungen fand. Begleitet wurden diese Vorstöße von poetologischen Debatten etwa über die Erzähl- und Romankrise oder über die Form eines zeitgemäßen Theaters. Aber schon um 1930 setzte eine traditionalistische Wende ein, das heißt: eine Abkehr von kühnen und manchmal schwer nachvollziehbaren avantgardistischen Ausdrucksweisen zugunsten einfacherer und historisch vertrauter Bauformen und Diktionen. Damit verbunden war auch eine Abkehr von der Großstadt als dem Inbegriff des modernen Lebens und eine Hinwendung zur «Landschaft» und zur Natur: Boden statt Makadam, Naturlyrik und Bauernroman statt «Asphaltliteratur». Gründe für diese Wende liegen zum einen in der Veränderung des soziokulturellen Klimas, konkret: in einem wachsenden Unbehagen an der Moderne, deren Insuffizienzen und Pathologien neben den emanzipatorischen Vorzügen in der Krisenzeit um 1930 spürbarer wurden; zum andern in dem simplen Umstand, daß die Möglichkeiten der avantgardistischen Erweiterung oder Überbietung von Darstellungsmustern mehr oder minder erschöpft waren, jedenfalls nicht mehr leicht dauerhaft überzeugende Innovationen zuließen.
Ab 1933 wurde diese Wende dann auch politisch forciert. Hitlers «Kulturreden» und die Kampagne gegen die «entartete Kunst» wandten sich ausdrücklich gegen die künstlerische Moderne in jeder Form. Aber auch in der sogenannten Expressionismus- oder Formalismus- und Realismusdebatte, die ab 1937 im Exil geführt wurde und ihr Zentrum in Moskau hatte, gab es – vor allem seitens der Moskauer Fraktion – scharfe Verurteilungen der angeblich «dekadenten» und «konterrevolutionären» künstlerischen Moderne. Mithin waren Modernität und Avantgardismus raumübergreifend diskreditiert und wurden durch praktische Maßnahmen – Kritik, Verbote, Förderungsentzug, Konfiszierung – behindert und verdrängt. Zur politischen Einflußnahme kamen publizistische Erschwernisse: Für avantgardistisch gestaltete Romane wie Alfred Döblins Babylonische Wandrung (1934) fehlte im Exil eine hinreichend breite Käuferschicht; nicht nur aus Gründen der größeren Wirkung, sondern auch in der Hoffnung auf größeren Absatz wählte Döblin für seinen nächsten Roman, Pardon wird nicht gegeben (1935), die realistische Erzählweise. Hermann Broch schrieb am 19. Oktober 1934 an seinen Verleger Daniel Brody, er sei zu der Meinung gekommen, daß «eine asoziale – und damit letzten Endes unverkäufliche! – Kunst überhaupt nicht lebensberechtigt» sei, und fügte hinzu: «Es hieße die didaktisch-pädagogische Aufgabe des Dichterischen völlig verkennen, wenn man die Menschen unter Bruch mit den bisherigen Ausdrucksformen esoterisch vor den Kopf stoßen wollte.»
Trotz all dem wurden dezidiert moderne Schreibweisen und Formen – Montagetechnik, gesprengte Romanform, episches Theater – in begrenztem Umfang sowohl in Deutschland als auch im Exil weiterhin verwendet. Wenn Brecht, wie oft gesagt wird, mit der Szenenfolge Furcht und Elend des III. Reiches (1938) und den Gewehren der Frau Carrar (1937/38) sich in Richtung des sozialistischen Realismus bewegte, so trieb er mit zahlreichen Schriften zur Theaterästhetik – Straßenszene, Messingkauf – und mit Stücken wie Leben des Galilei (1938 ff.), Der gute Mensch von Sezuan (1942) und Der kaukasische Kreidekreis (1944) die Entwicklung seines epischen Theaters voran. Zudem trug er mit seiner «reimlosen Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen» (so seine vielzitierte Charakterisierung von 1938) wesentlich zur weiteren Modernisierung der Lyrik bei. In Walter Mehrings Emigrationsgedichten klingt der Ton seiner Kabarett- und Revuelieder aus den 1920er Jahren fort. Else Lasker-Schüler schrieb im Winter 1940/41 in Jerusalem unter dem Titel IchundIch ein durch und durch avantgardistisch gestaltetes Drama. An diesen und vielen weiteren Beispielen zeigt sich, daß die avantgardistisch inspirierte Poetik der Moderne nicht generell preisgegeben oder gar verworfen wurde, sondern mancherorts weitergepflegt und sogar «dynamisch fortentwickelt» wurde (Bettina Englmann, Poetik des Exils, 2001). Ob dies eher aus Erfahrungen von Migration und Disruption, Alterität und Akkulturation resultierte oder eher in der Konsequenz der bereits vor der Emigration eingeschlagenen Entwicklungspfade lag, ist allerdings nicht leicht ausfindig zu machen.
Vergleichbare, wenn auch weniger prononcierte Ansätze dazu sind auch in der innerhalb Deutschlands entstandenen Literatur zu sehen. In Friedo Lampes Roman Septembergewitter (1936) ist – wie schon in dem vorausgehenden Roman Am Rande der Nacht (1933) – eine Kombination von traditionellem und avantgardistischem, am Film und an Mustern wie John Dos Passos’ Manhattan Transfer (1925) geschulten Erzählen zu erkennen. Elisabeth Langgässer schrieb ab 1936 an ihrem Roman Das unauslöschliche Siegel (publiziert 1946), den sie wegen der Diskontinuität seiner Fabel und seiner spirituellen Bedeutungsebene als «supranaturalistisch» bezeichnete. Ilse Molzahn schrieb mit Nymphen und Hirten tanzen nicht mehr (1938) einen Roman, der mit der Sprengung der Fabel und der Verwendung von Montagetechnik an die Innovationen der 1920er Jahre erinnert. Gottfried Benn griff 1944 für seinen Roman des Phänotyp (publiziert 1949) auf die in den 1920er Jahren entwickelte (und 1950 so benannte) Vorstellung der «absoluten Prosa» zurück, die alles realistisch-chronologische oder geschichtenhafte Erzählen hinter sich läßt und sich in der Evokation von Zuständen und in Reflexionen aller Art bewegt. Er ging damit über die von Döblin und Broch essayistisch und polyhistorisch erweiterte Romanform so weit hinaus, daß die mit dem Titel beanspruchte Bezeichnung «Roman» eigentlich ironisch ist und sich neben der Frage nach der gedanklichen Konsistenz auch die nach der künstlerischen Durchformung des Textes stellt; es ist ein ausgesprochener «Anti-Roman» (Christian Schärf), «absolute Prosa», wie Benn sagte, «außerhalb von Raum und Zeit, ins Imaginäre gebaut, ins Momentane, Flächige gelegt», das «Gegenspiel» von «Psychologie und Evolution». In seiner autobiographischen Schrift Doppelleben (1950) bemühte sich Benn, diese durch Montage herbeigeführte Komposition als wurzel- oder eigentlich mittelachsenzentrierten «Orangenstil» zu plausibilisieren, was den Text aber nicht unbedingt überzeugender macht. Die Moderne erreichte mit dem Roman des Phänotyp einen jener Punkte, an denen sie sich der Gefahr aussetzte, abwegig oder steril zu wirken. Brecht scheint sowohl die Möglichkeit als auch die Fragwürdigkeit solch avantgardistischer Prosa gesehen zu haben. Im vierten Dialog der Flüchtlingsgespräche läßt er den Intellektuellen Ziffel einige Passagen aus seinen geplanten Memoiren vorlesen, die eine überraschende Ähnlichkeit mit Benns Roman des Phänotyp haben, aber kaum als ernsthafter Versuch einer neuen Darstellungsweise gemeint sind, sondern eher als Parodie auf eine nach Ziffels Worten bereits «veraltete» Form der Moderne.
Als Indikatoren für die Fortentwicklung der avantgardistisch inspirierten Moderne sind nicht nur einzelne Werke zu betrachten, sondern auch poetologische Manifestationen. Für die epische Gattung hatte Döblin mit seinem Akademie-Vortrag Der Bau des epischen Werks 1929 die grundlegende Poetik des modernen Hybridromans ausformuliert; sie verbindet Zweckbestimmung, Strukturbeschreibung und Durchleuchtung des Entstehungsprozesses. Für die Dramatik und die Lyrik gelang Vergleichbares erst nach dem Durchgang durch die «finstere Zeit», aber dann ohne großen Verzug: 1949 legte Brecht sein Kleines Organon für das Theater vor, die konzise Beschreibung der Prinzipien und Techniken des «epischen» und zugleich «dialektischen» Theaters als eines Theaters des «wissenschaftlichen Zeitalters», das sich auf den Marxismus stützt und auf Weltveränderung in dessen Sinn zielt. 1951 folgte Benn mit seinem Vortrag Probleme der Lyrik, der – wie Döblins Bau des epischen Werks – sowohl die Spezifik der modernen Lyrik als auch die Genese aus einem intuitiven Impuls und einer folgenden technischen Bearbeitung beschreibt. Beide basieren auf den poetologischen Überlegungen und dichterischen Arbeiten der beiden vorausgehenden Jahrzehnte und bringen damit einen längeren poetologischen Prozeß zu Ende.
Ob Autoren eher modernistisch-avantgardistischen oder eher traditionalistischen Mustern folgten, hing wohl zumeist von mehreren Faktoren ab: von der literarischen Sozialisation über die Einbindung in eher progressive oder eher konservative Künstlerkreise bis zur Rücksichtnahme auf Publikationsmöglichkeiten sowie politische Vorgaben und Kontrollen, Förderungen und Verbote. Aus dem Festhalten an modernen Mustern oder aus Vorliebe für traditionalistische Muster kann jedenfalls nicht auf Distanz oder Nähe zum Nationalsozialismus geschlossen werden. Friedo Lampes Modernismus ist kein Indiz für eine dezidiert oppositionelle Haltung; sein vielleicht nur opportunistischer Eintritt in die NSDAP bereits im März 1933, seine regimekonforme Tätigkeit als Volksbibliothekar und seine Briefe aus jenen Jahren deuten eher auf eine beträchtliche Anpassungsbereitschaft hin, oder, wie Johann-Günther König in seiner Biographie schonungsvoll sagt, auf «seine gleichsam empfindsame Positionierung» innerhalb der auf nationalsozialistischen Kurs gebrachten Hamburger Bücherhallen. Andererseits ist Traditionalismus in Fragen literarischer Form kein sicheres Indiz für NS-Nähe. Günter Scholdt hat in einem bemerkenswerten Aufsatz über die «Bewertung nichtnazistischer Literatur im ‹Dritten Reich›» (Kein Freispruch zweiter Klasse, 2002) darauf hingewiesen, daß manche Autoren der inneren Emigration gerade in einem nichtmodernistischen, traditionalistischen oder konservativen Stil ein Remedium gegen die Zumutungen der Moderne sahen, zu denen sie auch den enthemmten sozialorganisatorischen Dynamismus des Nationalsozialismus rechneten. Der Antimodernismus ihrer Schreibart war für Autoren wie Ernst Wiechert und Werner Bergengruen Widerstand gegen eine negative Zeitgemäßheit gerade auch des Nationalsozialismus.
Als kunst- und literaturgeschichtliche Bezeichnung der Epoche, zu der die Jahre 1933 bis 1945 zählen, dient meist das aus dem Kunsthandel übernommene Etikett «klassische Moderne». Es hat eine gewisse Berechtigung, weil die Hauptwerke der vorausgehenden 1910er und 1920er Jahre rezeptionsgeschichtlich tatsächlich die Vorbildlichkeit von Klassikern erlangten. Der Begriff sagt aber zu wenig über die Eigenart dieser modernen Klassiker aus. In meiner Geschichte der literarischen Moderne (2004) habe ich deswegen vorgeschlagen, statt von «klassischer» von «reflektierter Moderne» zu sprechen: von einer Moderne, die sich vom forcierten Avantgardismus der 1910er Jahre abkehrte, dessen Innovationen aber nicht vergaß, sondern in komplexere und differenziertere Konzepte und Werke überführte, wie man dies an den poetologischen Schriften und Werken insbesondere von Alfred Döblin, Bertolt Brecht und Gottfried Benn beobachten kann. Eine Gruppe anderer Experten (Gustav Frank, Rachel Palfreyman, Stefan Scherer) empfahl ein Jahr später mit dem Aufsatzband Modern Times (2005) den Begriff der «synthetischen Moderne» als Bezeichnung für eine neue Phase der Moderne oder des Modernebewußtseins, die sich um 1925 abzeichnete, sich einer neuen Sachlichkeit befleißigte und zur Verwendung massentauglicher Darstellungsformen tendierte. Modernität sollte gewahrt, aber nicht länger überbetont und demonstrativ ausgestellt werden. In dem 2019 erschienenen Hans-Fallada-Handbuch wurde diese Sichtweise bekräftigt und zugleich Fallada, der sich um 1925 vom Avantgardismus verabschiedete und seinen zeitgemäß modernisierten und popularisierungsfähigen Sozial-Realismus entwickelte, zum Exponenten der ab etwa 1930 dominierenden «synthetischen Moderne» erhoben. In ihr habe neben dem neusachlichen Realismus der ebenfalls in den 1920er Jahren aufkommende «magische Realismus» an Bedeutung gewonnen, ein Stil, der – kurz gesagt – an der realistischen Darstellung einer homogenen Wirklichkeit in eher traditioneller Erzählweise festhält, dieser Wirklichkeit aber durch eine überscharfe und gleichsam röntgenartige Wahrnehmung einen vielschichtigen Charakter gibt und einen geheimen, oft nur erahnbaren Sinn zuschreibt. Als Werke solcher Art gelten beispielsweise die schon genannten Romane von Friedo Lampe, die Romane und Erzählungen von Elisabeth Langgässer und Horst Lange sowie die naturmagischen Gedichte von Wilhelm Lehmann und Oskar Loerke. Mit der Epochenbezeichnung «synthetische Moderne» wird für die Jahre von etwa 1930 bis etwa 1950 die Dominanz realistischer und zugleich eher traditionalistischer Darstellungsweisen behauptet; die Bezeichnung «reflektierte Moderne» betont demgegenüber das von den Autoren gut bedachte und kontrollierte Fortwirken dezidiert moderner Darstellungstechniken und Sageweisen avantgardistischer Provenienz. Diese reflektierte Moderne wurde durch die nationalsozialistische Literaturpolitik und die von Moskau ausgegebene Doktrin des sozialistischen Realismus in ihrer breiteren Entfaltung behindert, blieb aber die kennzeichnende und weiterhin produktive Spielart der literarischen Moderne – und erlangte in der Nachkriegszeit die Bedeutung des maßgeblichen progressiven Paradigmas.
Der politische Rahmen: Krise der Demokratie und Faszination von Autoritarismus und Kollektivismus (Totalitarismus)
Die Etablierung der NS-Herrschaft im Frühjahr 1933 bedeutete eine Zäsur, die nicht weniger einschneidend war als die von 1918, wenn auch zunächst nicht so offenkundig wie diese. Es gab keinen Wechsel von Krieg und Frieden und keine Revolution, die einen Systemwechsel wie den vom Kaiserreich zur Republik herbeigeführt und bewußtseinsmäßig scharf profiliert hätte; von einer «nationalsozialistischen Revolution» sprachen zumeist nur die Nationalsozialisten selbst. Das «Deutsche Reich», wie der offizielle Name des deutschen Staats lautete, bestand nominell unverändert fort. Aber doch änderte sich vieles schlagartig und sichtbar. Der Jubel der NS-Verbände erfüllte das Land. Verfolgung und Terror wurden zu Mitteln der Politik. Bürgerrechte und Menschenwürde wurden in eklatanter Weise verletzt. Die trickreich herbeigeführte Verabschiedung des als «Ermächtigungsgesetz» bezeichneten Gesetzes «zur Behebung der Not von Volk und Reich» am 22. März 1933 bedeutete die Aushebelung der Weimarer Verfassung, gab aber dem folgenden Staatsumbau den Anschein der Legalität. Bald zeigte sich auch, daß Hitler – trotz der «Friedensrede», mit der er am 17. Mai die Besorgnisse der aufgeschreckten europäischen Nachbarn zu zerstreuen suchte – nicht an der Weiterführung versöhnlicher Außenpolitik interessiert war, sondern auf Kollisions- und Expansionskurs ging. Aus historischer Distanz wird der einschneidende Charakter der nationalsozialistischen Machtergreifung noch deutlicher. Mit ihr trat der zweite «dreißigjährige Krieg», von dem zunächst zeitgenössische Analytiker und Politiker (Hermann Rauschning, 1939; Charles de Gaulle, 1941; Sigmund Neumann, 1942; Winston Churchill, 1944), dann auch Historiker (Raymond Aron, 1950; Arno J. Mayer, 1988; Hans-Ulrich Wehler, 2003) sprachen, in eine neue Phase. Der «zwanzigjährige Waffenstillstand» (James J. Sheehan) zwischen dem Ende des Ersten und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde unsicherer als je zuvor und bekam – aus historischer Sicht – den Charakter einer «Zwischenkriegszeit» (Gunther Mai): Indem Hitler einige unausgeräumte Konflikte der «Nachkriegszeit» virulent machte und zudem den westlichen Anti-Bolschewismus verschärfte, überführte er die «Nachkriegszeit» in eine neue «Vorkriegszeit» mit Rüstungssteigerung und diplomatischen Kriegsvorbereitungen.
Zu den Faktoren, die Hitlers Aufstieg begünstigten und seine Machtergreifung ermöglichten, gehörte die europaweite Krise der Demokratien. Nach dem Ersten Weltkrieg war es in Europa mit der Um- und Neubildung zahlreicher Staaten zu einer breiten Demokratisierung gekommen, die jedoch nicht von Bestand war. Beginnend mit dem Jahr 1921 kam es in mehreren Ländern von Italien bis Polen zur Errichtung von ausgesprochenen Diktaturen oder zur Herstellung von diktaturähnlichen Verhältnissen. In den Augen der Machthaber, aber auch guter Teile der Bevölkerungen schienen sie für die Bewältigung der sozialen Probleme und politischen Gefahren bessere Voraussetzungen als die parlamentarische Demokratie zu bieten. Mit der Weltwirtschaftskrise erreichte der Verlust des Vertrauens in die «soziale Demokratie» einen Höhepunkt und begann eine neue Welle der Diktaturbildungen. «Die Wirtschaftskrise», so der Historiker Gunther Mai, «zerriß den dünnen Schleier vermeintlicher Stabilität und diskreditierte die neue Ordnung und die neuen Eliten unwiderruflich, deren fehlende Krisenlösungskompetenz in ernüchternder Schonungslosigkeit vor aller Augen stand. Wirtschaftslenkung und Arbeitsbeschaffung wurden die neuen Instrumentarien der 30er Jahre, die jedoch vielfach erst nach dem Scheitern der parlamentarischen Demokratien voll wirksam wurden.» Die Weltwirtschaftskrise wurde zur «Wetterscheide» (Lutz Raphael) und überdies zum «manichäischen Moment» (Thierry Wolton), in dem bei vielen Zeitgenossen der Eindruck entstand, man müsse sich jetzt zwischen zwei einander ausschließenden Heilswegen entscheiden: zwischen Kapitalismus und Kommunismus, was auch heißt: zwischen bürgerlich-liberaler Demokratie und autoritärem Kollektivismus. Thomas Mann hat diese epochale Entscheidungssituation im Frühjahr 1932 am Ende seiner großen Berliner Akademierede Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters eindringlich beschrieben und bewertet. Er plädierte leidenschaftlich für die bürgerliche Demokratie, meinte aber, daß der Zug der Zeit stark «ins Kommunistische» gehe und «die soziale Welt, die organisierte Einheits- und Planwelt, in der die Menschheit von untermenschlichen, unnotwendigen, das Ehrgefühl der Vernunft verletzenden Leiden befreit sein wird», kommen werde.
Dieser Zug zum planwirtschaftlich Kollektivistischen fand seine Realisierung nicht nur im sowjetischen Kommunismus, sondern – mit charakteristischen Unterschieden – auch im italienischen Faschismus und im deutschen Nationalsozialismus, der ebenfalls als Faschismus bezeichnet wurde. Alle drei Richtungen wurden um 1930 mit der Bezeichnung «totalitär» bedacht und nach 1933 genetisch in Verbindung gebracht und strukturell verglichen. Der prominente und der SPD