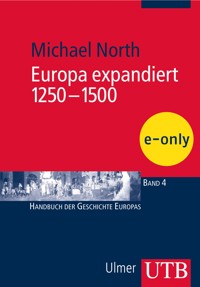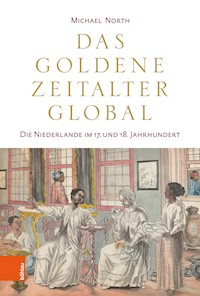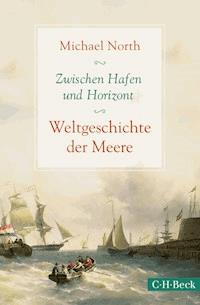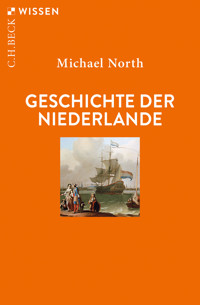
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch bietet erstmals einen kurzgefaßten Überblick über die vielfältige Geschichte der Niederlande von der burgundischen Zeit im 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Im Mittelpunkt der Darstellung stehen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur und dabei vor allem solche Phänomene, die die Einzigartigkeit der Niederlande in der europäischen Geschichte ausmachen: die republikanisch-demokratische Tradition, die soziale Sicherheit, die religiöse Toleranz und die einmalige Entfaltung flämischer und holländischer Malerei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Michael North
GESCHICHTE DER NIEDERLANDE
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
Motto
I. Einleitung
II. Die Burgundischen Niederlande
1. Staat und Städtelandschaft
2. Textilien und Frachtfahrt als Motoren der Wirtschaft
3. Hofkultur und Stadtkultur an der Schwelle der Neuzeit
4. Von den Burgundern zu den Habsburgern
III. Der Aufstand der Niederlande
1. Die Grundlagen der wirtschaftlichen Expansion
2. Humanismus und Reformation
3. Der Kampf gegen die spanische Herrschaft
IV. Das Goldene Zeitalter der Niederlande
1. Innere Gestalt und äußere Politik
2. Drehscheibe der Weltwirtschaft
3. Gesellschaft und Konfession
4. Die Blütezeit der niederländischen Malerei
V. Der Niedergang der niederländischen Republik im 18. Jahrhundert
1. Im Schlepptau der Großmächte
2. Stagnation oder Niedergang der Wirtschaft?
3. Arbeitslosigkeit und sozialer Wandel
VI. Das Königreich der Niederlande
1. Struktureller Wandel
2. Von der Handelsnation zum Industriestaat
3. Koloniale Welt in Niederländisch-Indien
VII. Die Niederlande in Europa
1. Die Entstehung der parlamentarischen Demokratie
2. Die Weltwirtschaftskrise
3. Die deutsche Besatzung
4. Dekolonisation
5. Politischer und ökonomischer Wiederaufbau
6. Protest und Krisenüberwindung
Schlussbetrachtung: Modell Niederlande?
Nachwort zur ersten Auflage
Nachwort zur zweiten Auflage
Nachwort zur dritten Auflage
Nachwort zur vierten und fünften Auflage
Anhang
Literaturverzeichnis
Gesamtdarstellungen
II. Die Burgundischen Niederlande
III. Der Aufstand der Niederlande
IV. Das Goldene Zeitalter der Niederlande
V. Der Niedergang der niederländischen Republik im 18. Jahrhundert
VI. Das Königreich der Niederlande
VII. Die Niederlande in Europa
Zeittafel
Register
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
Für Christopher
Motto
Das Genie dieser Nation, durch den Geist des Handels und den Verkehr mit so vielen Völkern entwickelt, glänzte in nützlichen Erfindungen; im Schoße des Überflusses und der Freiheit reiften alle edleren Künste.
(Friedrich Schiller, Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande, 1788)
I. Einleitung
Niederlande oder Lage Landen bedeutete im Mittelalter nichts anderes als die Niederungen im Mündungsgebiet der großen Flüsse Rhein, Maas und Schelde. In diesem von Marsch und Geest geprägten Raum entstanden früh selbständige Territorien: Flandern, Brabant, Artois, Hennegau, Namur, Limburg, Holland, Seeland, Geldern und die Bistümer Lüttich und Utrecht. Wesentlich für die Geschichte dieser Territorien war ihre staatliche Vereinigung durch die Herzöge von Burgund im 14. und 15. Jahrhundert. Denn seit dieser Zeit bürgerte sich in den europäischen Kanzleien für die burgundischen Erwerbungen die Bezeichnung Païs d’embas oder Nyderlande ein.
Nachdem die Habsburger das burgundische Erbe angetreten hatten, bezeichneten Nederlanden und ’t Nederlan(d)t im 16. Jahrhundert die von den Habsburgern regierten Territorien an der Nordsee. Durch den Aufstand der Niederlande gegen die spanischen Habsburger trennte sich der Norden vom Süden und bildete fortan einen unabhängigen Staat, die Republik der Vereinigten Niederlande, während der Süden bei den spanischen und später bei den österreichischen Stammlanden der Habsburger verblieb. Das Territorium der niederländischen Republik ist weitgehend mit dem heutigen Königreich der Niederlande identisch.
Im Mittelpunkt des vorliegenden Buches steht die Geschichte der niederländischen Republik und des Königreichs der Niederlande bis heute. Ich beginne die Darstellung mit der territorialen Vereinigung in der burgundischen Periode im 14./15. Jahrhundert und schenke ebenso der Emanzipation des Nordens vom Reich der spanischen Habsburger im 16. Jahrhundert größere Aufmerksamkeit.
Es mag vermessen erscheinen, die Geschichte eines Landes auf 130 Seiten darstellen zu wollen – und die in den letzten Jahren entstandenen Handbücher, von denen keines einen Umfang von weniger als 700 Seiten hat, mögen dieses Urteil bestätigen. Dennoch eröffnet die «Beschränkung auf das Wesentliche» zwei noch nicht genutzte Möglichkeiten: zum einen, dem Leser eine bisher fehlende kurzgefasste Geschichte der Niederlande an die Hand zu geben, und zum anderen, besondere inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. So werden in der folgenden Darstellung die Phänomene, Strukturen und Perioden der niederländischen Geschichte besonders gewürdigt, die die Einzigartigkeit der Niederlande in der europäischen Geschichte ausmachen: Burgundische Stadt- und Hofkultur (15. Jahrhundert); Religion und Revolte (16. Jahrhundert); Kunst und Kommerz im Goldenen Zeitalter (17. Jahrhundert); Republikanische und revolutionäre Traditionen (18. Jahrhundert); Restauration und Monarchie (19. Jahrhundert); Soziale Sicherheit und politische Stabilität (20. Jahrhundert).
II. Die Burgundischen Niederlande
Das 15. Jahrhundert gilt als die burgundische Periode in der niederländischen Geschichte. Mit diesem Namen verbindet sich nicht nur die Integration der niederländischen Territorien in den entstehenden Burgundischen Staat, sondern auch eine einmalige Blüte der höfischen und der städtischen Kultur, die als «Herbst des Mittelalters» (Huizinga) in die Kulturgeschichte eingegangen ist.
1. Staat und Städtelandschaft
Das konstituierende Ereignis des Burgundischen Staates war die Heirat der Margarete von Male (1384–1405) mit Herzog Philipp dem Kühnen von Burgund (1363–1404) im Jahre 1369. Margarete, die Tochter Ludwigs von Male, Graf von Flandern, erbte bei dessen Tod (1384) Flandern (einschließlich Wallonisch Flandern mit Lille, Douai und Orchies), Artois, Rethel, Nevers, die Freigrafschaft Burgund (Franche-Comté) sowie die Städte Antwerpen und Mechelen, die mit dem Besitz ihres Mannes, dem Herzogtum Burgund, verbunden wurden. In der Folgezeit konnten Holland, Seeland und Hennegau (1428), Namur (1429) und schließlich Brabant und Limburg (1430) erworben werden. Mit der Einverleibung von Mâcon, Auxerre, der Picardie (1435) und des Herzogtums Luxemburg (1451) entstand ein mächtiger Staat, dessen südlichen Teil die Bourgogne und dessen nördlichen Teil die Niederlande bildeten.
Die Burgundischen Niederlande
Jedoch musste die innere Vereinigung der einzelnen Territorien zu einem Staatswesen erst noch vollzogen werden. Dies war das Werk Herzog Philipps des Guten (1419–1467). Eine seiner wichtigsten Aufgaben war die Zentralisierung des Finanzwesens und der Justiz. Zur besseren Ausschöpfung der herzoglichen Einkünfte baute er die Rechenkammern aus bzw. ordnete deren Zuständigkeiten neu. Gleichzeitig wurde aus dem herzoglichen Hofrat unter dem Namen «Großer Rat» eine Sektion als oberste Gerichtsinstanz etabliert. Dem Widerstand der Stände gegen diese Zentralisierungspolitik (Steuerboykott) begegnete der Herzog, indem er regelmäßig eine Gesamtvertretung seiner niederländischen Territorien zusammenrief, die später (ab 1478) «Generalstände» genannt wurde. Auch wenn so die institutionelle Integration vorangetrieben wurde, lagen der politische wie der ökonomische Schwerpunkt der Burgundischen Niederlande noch immer im Süden des Landes, in Flandern und Brabant. Die Hof- und Verwaltungssprache war Französisch, und der 1430 von Philipp dem Guten ins Leben gerufene Orden vom Goldenen Vlies vereinigte nahezu ausschließlich Adlige aus den südlichen Provinzen.
Ausschlaggebend für die politische und wirtschaftliche Bedeutung des niederländischen Südens war die einmalige flämische und Brabanter Städtelandschaft. Bereits im 14. Jahrhundert hatten die flämischen Großstädte Gent und Brügge mit 64.000 bzw. 46.000 Einwohnern alle anderen Städte Westeuropas – Paris ausgenommen – überragt. Obgleich die Einwohnerzahlen im Laufe des 15. Jahrhunderts zurückgingen, wiesen Flandern und Brabant noch immer die größten Städte und die meisten Einwohner sämtlicher Provinzen auf. Um 1500 hatten Gent und Antwerpen mehr als 40.000 Einwohner, Brügge und Brüssel über 30.000, während die vier führenden holländischen Städte Leiden, Amsterdam, Haarlem und Delft jeweils nicht mehr als 15.000 Einwohner zählten und beispielsweise von Leuven oder ’s-Hertogenbosch übertroffen wurden.
Aber Holland holte im 15. Jahrhundert zunehmend auf. Bei einer Gesamteinwohnerzahl der Niederlande von 2,476 Mio. Menschen nahm Holland bereits hinter Flandern und Brabant die dritte Stelle ein. Hinsichtlich der Bevölkerungsdichte lag es mit 63 Einwohnern pro km² nur wenig hinter Flandern (72 E./km²) und übertraf dieses sogar im Anteil der städtischen Bevölkerung – ein Indiz für die wachsende Bedeutung der zahlreichen kleinen holländischen Städte. Dennoch blieben internationaler Handel, Gewerbeaktivität, finanzielle Ressourcen und politischer Einfluss im Süden und dort in verhältnismäßig großen Zentren (Gent, Brügge, Antwerpen, Brüssel) konzentriert. Entsprechend setzten die großen flämischen Städte der Integration in den Burgundischen Staat den stärksten Widerstand entgegen. Sie konnten ebenso wie die Brabanter Städte auf eine «große Tradition der Revolte» (Blockmans) zurückblicken, die im 14. Jahrhundert eingesetzt hatte und die mit dem Aufstand der Niederlande in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen sollte. In dem Maße, wie der Burgundische Staat bisher von den Städten wahrgenommene juristische und fiskalische Kompetenzen an sich zog, wuchs die Opposition der städtischen Führungsschichten. So führten Eingriffe des herzoglichen Vogtes (baljuw) in das städtische Gerichtswesen zum Brügger Aufstand (1436–1438), der mit der Abstrafung Brügges endete. Die Stadt verlor nicht nur die Kontrolle über ihren Vorhafen Sluis, sondern musste auch eine Bußzahlung von 480.000 Pfund aufbringen. 1447 versuchte Philipp der Gute, eine Steuer auf den Salzverbrauch einzuführen, scheiterte aber am Widerstand Gents und anderer flämischer Städte. Der Konflikt mit Gent war vorprogrammiert, und der Herzog ließ ihn bewusst eskalieren. Eingriffe in die städtische Autonomie, z.B. bei der Wahl der Schöffen, provozierten einen Streik der Handwerker. Nachdem verschiedene Vermittlungsversuche an der Unnachgiebigkeit des Herzogs gescheitert waren, blockierte dieser die Stadt und besiegte das Genter Aufgebot 1453 bei Gavere. Die Bestrafung verlief nach Brügger Muster: 480.000 Pfund waren aufzubringen. Damit hatte der Herzog an den größten Städten ein Exempel statuiert, ohne aber die städtische Macht auf Dauer zu brechen.
Tabelle 1: Die Bevölkerung der Niederlande ca. 1470
Region
Städtische Bevölkerung in %
Ländliche Bevölkerung in %
Einwohner gesamt
Anteil an der Gesamtbevölkerung der Niederlande
in %
Artois
20
80
176.000
7,1
Boulonnais
12
88
31.000
1,3
Brabant
29
71
399.000
16,2
Flandern
33
67
705.000
28,6
Geldern
41
59
133.000
5,4
Hennegau
28
72
202.000
8,2
Holland
44
56
254.000
10,3
Limburg
6
94
16.500
0,7
Lüttich
26
74
135.500
5,5
Luxemburg
12
88
138.000
5,6
Namur
26
74
17.500
0,7
Picardie
19
81
184.000
7,5
Seeland
?
?
85.000
3,4
Gesamt
32
68
2.476.500
100,5
Quelle: Blockmans/Prevenier, De Bourgondiërs.
2. Textilien und Frachtfahrt als Motoren der Wirtschaft
Die bedeutendsten Handelszentren der Niederlande waren Brügge und Antwerpen. Brügge hatte sich bereits im 14. Jahrhundert zur Drehscheibe des Handels zwischen Süd-, West- und Osteuropa entwickelt. Hier wurden Tuche aus Flandern und Brabant, Leder aus Südeuropa, Pelze und Wachs aus dem Osten sowie Gewürze (Safran, Muskat, Pfeffer, Ingwer, Zimt, Anis, Zucker) aus dem Mittelmeerraum und Asien gehandelt. Mit Privilegien versehene Genuesen, Florentiner, Venezianer, Lucceser, Katalanen, Kastilier und Portugiesen ließen sich ebenso wie Engländer und Hansekaufleute in Brügge nieder und machten die Stadt zum bedeutendsten Handelszentrum Nordwesteuropas im Spätmittelalter.
In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts avancierte dann die Brabanter Messestadt Antwerpen zum europäischen Handelszentrum. Bereits zu Anfang dieses Jahrhunderts entwickelten sich die je zweimal jährlich in Antwerpen und Bergen op Zoom stattfindenden Brabanter Messen zu Hauptumschlagplätzen für englische Tuche. Diese wurden z.B. von den englischen Merchant Adventurers als Halbfertigprodukt nach Brabant eingeführt, dort gefärbt und appretiert und als Fertigprodukt sowohl von Hansekaufleuten als auch von Oberdeutschen erworben. Die oberdeutsche Nachfrage nach Tuchen wie der niederländische Bedarf an Silber zogen den expandierenden Handel der Nürnberger und Augsburger Kaufleute mit Silber, Kupfer und Barchent an die Schelde. Hier trafen diese nicht nur auf die Engländer, sondern auch auf die Portugiesen mit ihrem Asienhandel und ihrem aus Afrika stammenden Gold und Elfenbein; die Portugiesen wiederum waren für ihren Austausch mit Afrika und Indien auf oberdeutsche Metallwaren sowie auf Kupfer und Silber angewiesen. So begründeten englisches Tuch, oberdeutsche Metalle und portugiesische Gewürze Antwerpens Aufstieg zum «europäischen Weltmarkt» im 16. Jahrhundert.