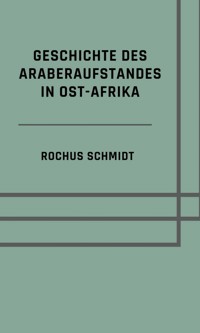
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die große Menge der Afrikawerke, welche in den letzten Jahren auf dem deutschen Büchermarkte erschienen sind, ließ auffallender Weise immer noch eine eigentliche Geschichte des Ostafrikanischen Aufstandes und seiner Niederwerfung vermissen. Eine gesammelte, auf rein historischer Grundlage ruhende und durch mehrjährige persönliche Erfahrung kritisch gesichtete Darstellung der kriegerischen Ereignisse in Ostafrika, ihrer Ursachen und nächsten Folgezustände erschien aber gerade jetzt geeignet. Die Lage unserer deutschen Kolonie in Ostafrika ist keine glänzende, die Stimmen der Gegner erheben sich von Neuem und drängen zu wenig ehrenvollem Rückzug oder zu Beschränkungen, denen ein solcher Rückzug noch vorzuziehen wäre. Das vorliegende Buch soll in gedrängter Kürze die Entwickelung des Aufstandes und seine Niederwerfung behandeln, es soll dem Leser die großen Opfer vorführen, welche zu dieser Niederwerfung notwendig waren, es soll aber auch die Begründung versuchen, daß die Sache solche Opfer verdient.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichtedes Araberaufstandes in Ost-Afrika.
Seine Entstehung, seine Niederwerfung und seine Folgen.
Von
Rochus Schmidt.
Vorwort.
Die große Menge der Afrikawerke, welche in den letzten Jahren auf dem deutschen Büchermarkte erschienen sind, ließ auffallender Weise immer noch eine eigentliche Geschichte des Ostafrikanischen Aufstandes und seiner Niederwerfung vermissen. Eine gesammelte, auf rein historischer Grundlage ruhende und durch mehrjährige persönliche Erfahrung kritisch gesichtete Darstellung der kriegerischen Ereignisse in Ostafrika, ihrer Ursachen und nächsten Folgezustände erschien aber gerade jetzt geeignet.
Die Lage unserer deutschen Kolonie in Ostafrika ist keine glänzende, die Stimmen der Gegner erheben sich von Neuem und drängen zu wenig ehrenvollem Rückzug oder zu Beschränkungen, denen ein solcher Rückzug noch vorzuziehen wäre.
Das vorliegende Buch soll in gedrängter Kürze die Entwickelung des Aufstandes und seine Niederwerfung behandeln, es soll dem Leser die großen Opfer vorführen, welche zu dieser Niederwerfung notwendig waren, es soll aber auch die Begründung versuchen, daß die Sache solche Opfer verdient.
Abenteuer oder farbensatte Schilderungen wird mancher Leser vielleicht vermissen, aber der Verfasser hat sich bemüht, alles zusammenzutragen, was für das vollkommene Verständnis des behandelten Zeitabschnittes nötig ist, kurz eine Geschichte des deutsch-ostafrikanischen Aufstandes zu geben. Ueberall ist dabei der Standpunkt strenger Objektivität gewahrt worden, auch da, wo Personen, Maßnahmen oder Verhältnisse wohl eine herbere, subjektive Kritik hätten herausfordern können. Wo eine Kritik sich findet, beruht sie auf Erfahrung und sorgfältigster Prüfung.
Möge es gelingen, durch das vorliegende Buch der Sache einen Dienst zu leisten.
Berlin, im Juni 1892.
Der Verfasser.
Benutzte Quellen: Brix Förster. — Richelmann. — von Behr. — Paul Reichardt. — Weißbücher. — Kolonialblatt. — Kolonialzeitung. — Koloniale Jahrbücher. — Zeitungsberichte (Militärwochenblatt, Lieut. Heymons, Kreuzzeitung, Dr. Neubaur.).
Inhalts-Verzeichniß.
Geschichte des Araberaufstandes in Ost-Afrika.
2. Kapitel. Entwickelung des Aufstandes und Errichtung des Reichskommissariats.
3. Kapitel. Organisation der Schutztruppe.
Fußnoten:
4. Kapitel. Die ersten Kämpfe um Bagamoyo, Daressalam, Pangani, Tanga und Sadani.
5. Kapitel. Ausbildung des Reichskommissariats.
Fußnoten:
6. Kapitel. Wißmanns Expedition nach Mpapua.
7. Kapitel. Regelung der Verhältnisse um Mpapua und Marsch mit der Stanleyschen Expedition zur Küste.
8. Kapitel. Buschiri und die Mafiti.
9. Kapitel. Wißmanns Thätigkeit an der Küste nach der Rückkehr von Mpapua, Buschiris Gefangennahme und die Unterwerfung Bana Heris.
10. Kapitel. Die Stationen und der Dienst auf denselben.
11. Kapitel. Die Unterwerfung des Südens.
12. Kapitel. Das Reichskommissariat unter Wißmanns Stellvertreter Dr. Karl Wilhelm Schmidt.
13. Kapitel. Wißmanns letzte Thätigkeit als Reichskommissar.
14. Kapitel. Das Deutsch-englische Abkommen.
15. Kapitel. Die wirtschaftlichen Unternehmungen vor, während und nach dem Aufstande.
16. Kapitel. Ostafrika unter Herrn von Soden.
17. Kapitel. (Schluß.) Die Expedition Emin Paschas.
1. Kapitel.Einführung.
Kolonisationsidee in Deutschland. — Erwerbung Deutsch-Ostafrikas. — Verträge in Usegua, Nguru, Usagara und Ukami. — Kaiserlicher Schutzbrief. — Gesellschaft für deutsche Kolonisation. — Gegenbestrebungen des Sultans. — Erste Stationen in Ostafrika. — Expeditionen zu Gebietserwerbungen. — Expedition des Verfassers. — Protest des Sultans Said Bargasch gegen den kaiserlichen Schutzbrief. — Araber in Ostafrika. — Besitzstand des Sultans an der Küste. — Stellung der Walis. — Bismarcks Ultimatum. — Deutsche Flottendemonstration in Sansibar. — Der Sultan erkennt die deutschen Ansprüche an. — Diplomatische Verhandlungen zwischen Deutschland und England. — Londoner Vertrag. — Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft. — Der Küstenvertrag mit dem Sultan. — Stationsbestand der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft.
Eine Geschichte des Araberaufstandes in Deutsch-Ostafrika kann nicht gedacht werden ohne eingehende Betrachtung der Verhältnisse, welche diesem Aufstande vorhergingen. Die Erwerbung Deutsch-Ostafrikas, die einzelnen Phasen im Aufbau der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, die rein politischen und handelspolitischen Faktoren, welche im Zusammenwirken mit den Völkerverhältnissen an der Küste Deutsch-Ostafrikas zum Aufstand führten, bilden eine große logische Kette.
Die Entwickelung der Kolonisationsidee in Deutschland braucht nur mit wenigen Worten gestreift zu werden.
Die allgemeinen Ursachen, auf denen sich diese Idee aufbaute, sind selbstverständlich in erster Linie in der außerordentlichen Machtstellung zu suchen, welche Deutschland besonders nach dem französischen Kriege in der Welt sich erworben. Diese Machtstellung brachte dann eine unerwartete Entwicklung der Industrie mit sich und diese wieder trieb ganz von selbst zu der Notwendigkeit neue Absatzgebiete im Ausland zu schaffen. Während von der einen Seite her diese Absatzgebiete lediglich auf dem Handelswege im Ausland oder in den Kolonien anderer Nationen gesucht wurden, verlangte das wiederbelebte Nationalgefühl der Deutschen seinerseits einen Anteil an der Welt in Gestalt von Kolonien, um auf diese Weise die großen wirtschaftlichen Faktoren im eigenen kolonialen Auslande nutzbar verwerten zu können: mit einem Wort, die politische Unabhängigkeit auch auf dem Gebiete des Handels und der Industrie zu erwerben. Gegenüber allen Verdächtigungen feindlicher Kreise muß den ersten Beförderern der Kolonialidee zweifellos der Ruhm zuerkannt werden, den Weg zu einer solchen Unabhängigkeit ehrlich gesucht und auch thatsächlich gefunden zu haben.
Welch außerordentliche Rolle bei diesen Bestrebungen Deutsch-Ostafrika von vornherein gespielt hat und immer spielen wird, braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden. Einmal haben wir es mit einem Gebiete zu thun, welches nach dem übereinstimmenden Urteil aller unbefangenen Beobachter und Forscher zweifellos die wertvollsten Teile Afrikas entweder in sich begreift oder handelspolitisch zu beherrschen in der Lage ist. Ferner verfügt gerade unser Gebiet über eine durchaus eigentümliche, im ganzen schwarzen Kontinent sich nicht wiederfindende Entwicklung der Handelsbeziehungen nach dem Innern und vom Innern heraus. Endlich besitzen wir in dem Volksstamm, welcher die Handelswege nach dem tiefsten Innern eröffnet hat und auch gegenwärtig noch als alleiniger Träger dieses Handelsverkehrs aufzufassen ist, in den Arabern nämlich, Handelsvermittler von einer kaufmännischen Begabung und gerade für das in Betracht kommende Land geeigneten Vorbildung, wie sie wenigstens für Afrika nicht besser gedacht werden können.
Abgesehen von der wesentlichen Bedeutung aber, welche das deutsch-ostafrikanische Gebiet für Deutschland selbst besitzt, muß darauf hingewiesen werden, in welch ungewöhnlicher Weise die Erwerbung dieses Gebietes durch eine deutsche Privatgesellschaft zur Kolonisation ganz Afrikas und im weiteren zur Lösung kultureller und zivilisatorischer Aufgaben von höchster Bedeutung mitgewirkt hat. Der Eintritt des deutschen Reiches in die Reihe der Kolonialstaaten, die internationale Verteilung Afrikas zwischen Deutschland, England, Frankreich, Italien und Portugal in den Verträgen des Jahres 1890, die internationale Regelung der Sklavereifrage durch die Brüsseler Konferenz vom Jahre 1889 sind lediglich Folgen der deutschen Erwerbung, und es darf gewiß als ein eigenartiges Wirken der Vorsehung angesehen werden, wenn gerade das jüngste Kolonialvolk den Anstoß zur Regelung von Fragen gegeben hat, welche einen ganzen Erdteil betreffen.
Wenige Worte mögen dem Leser den Gang der Erwerbung ins Gedächtnis zurückrufen.
Einige wenige patriotische Männer vereinigten sich am 3. April 1884 zur Gesellschaft für deutsche Kolonisation. Sie stellten sich auf den Boden der von Dr. Karl Peters vorgeschlagenen Thesen, welche darin gipfelten, daß, bis das Reich sich entschlösse in eine Kolonialpolitik einzutreten, es nötig sei, daß das deutsche Volk selbst mit praktischen Schritten, d. h. in erster Linie mit Gebietserwerbungen in fremden Erdteilen, zunächst in Ostafrika, vorginge. Im November 1884 traf bereits die erste Expedition (Dr. Peters, Dr. Jühlke, Graf Joachim Pfeil und Kaufmann Otto) in Sansibar ein. Am 10. November brach die Expedition nach Überwindung unendlicher Schwierigkeiten nach dem Festlande auf, erwarb innerhalb 6 Wochen durch Verträge in den Landschaften Usegua, Nguru, Usagara und Ukami die Hoheits- und eine Reihe von Privatrechten von 10 eingeborenen Häuptlingen (Jumbes), hißte die deutsche Flagge an den entsprechenden Punkten und bestimmte einige Plätze für die Anlegung von Stationen. Anfang Februar 1885 traf Dr. Peters bereits wieder in Berlin ein und erhielt auf Verwendung Sr. Durchlaucht des Fürsten Bismarck am 27. Februar 1885 den Allerhöchsten Schutzbrief Sr. Maj. des Kaisers Wilhelm I. für die gemachten Erwerbungen. Mit Erlangung dieses Schutzbriefes wurden alle Anfeindungen, welche gegen die völker- und staatsrechtliche Gültigkeit jener Verträge erhoben waren, ohne weiteres niederschlagen, — Anfeindungen, welche nicht nur in Deutschland selbst seitens der Kolonialgegner, sondern besonders durch das auf das höchste betroffene England in Szene gesetzt waren. Die Erlangung dieses Schutzbriefes ist daher als ein außerordentlich wesentliches Zugeständnis des deutschen Reiches und zwar in erster Linie des Fürsten Reichskanzlers anzusehen. Es ist der eigentliche Ausgangspunkt der afrikanischen Kolonialpolitik des deutschen Reiches. Die Gesellschaft für deutsche Kolonisation hatte damit ihren ersten und zweifellos größten Erfolg erreicht, einen Erfolg, welcher jedoch der Gesellschaft selbst große und über den Rahmen ihres eigentlichen Wirkungskreises weit hinausgehende Verpflichtungen auferlegte. Es stellte sich sofort die Notwendigkeit heraus, mit weit größeren Kapitalmitteln als bisher die bereits erworbenen Gebiete in thatsächlichen Besitz zu nehmen, andrerseits aber diesen Erwerbungen, welche ja nur als Kern und Ausgangspunkt gedacht waren, neue in weiterem Umkreise hinzuzufügen und den Kolonialbesitz in Ostafrika abzurunden. Besonders die letztere Aufgabe bedingte die allergrößte Eile. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Peters'schen Erwerbung machten sich sowohl von englischer Seite als auch (und zwar vermutlich auf Betreiben der Engländer) seitens des Sultans von Sansibar Bestrebungen geltend, welche darauf abzielten, den erworbenen Besitz zu isolieren und die umliegenden Landschaften rechtlich für den Sultan von Sansibar in Besitz zu nehmen. In richtiger Erkenntnis der Sachlage wurde daher aus der Mitte der Gesellschaft für deutsche Kolonisation heraus bereits am 2. April 1885 eine Kommanditgesellschaft gegründet, welche unter dem Namen »Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, Karl Peters und Genossen« in das Handelsregister eingetragen wurde und so eine Rechtsform für das weitere Vorgehen darstellte.
Als Zweck der Gesellschaft wurde in die Satzungen aufgenommen »Erwerb, Besitz, Verwaltung und Verwertung von Ländern sowie deutsche Kolonisation im Osten Afrikas«. Dr. Peters erhielt Generalvollmacht und zwar in einer solchen Ausdehnung, daß thatsächlich die ganze Gesellschaft in jeder Beziehung durch ihn allein geleitet wurde.
Für Dr. Peters selbst hatte sich nach seiner Rückreise nach Deutschland die Notwendigkeit eines längeren Aufenthaltes in der Heimat herausstellt, um die schwierigen, dort der Gesellschaft harrenden Aufgaben in Angriff zu nehmen, besonders in den Finanzkreisen Deutschlands die nötigen Kapitalien zu schaffen, ferner die weitere Ausbildung der Gesellschaftsformen herbeizuführen und dieser als Direktor vorzustehen. In Ostafrika standen von den mit Peters ausgezogenen Herren noch Dr. Jühlke und Graf Pfeil zur Verfügung, da der Kaufmann Otto in Usagara einer Krankheit zum Opfer gefallen war. Dem Dr. Jühlke wurde die Vertretung der Gesellschaft in Sansibar und Ostafrika übertragen; während Graf Pfeil als erste Aufgabe die Errichtung der Station Sima in Usagara zugewiesen erhielt.
In Deutschland wurden von Dr. Peters nach der Erteilung des kaiserlichen Schutzbriefes eine Reihe von Persönlichkeiten für den Gesellschaftsdienst engagiert, um zur Erweiterung des Gebietes eine Reihe von Expeditionen zu unternehmen. Einer der engagierten Herren, der Gärtner Schmidt, löste den Grafen Joachim Pfeil auf Sima ab mit dem Auftrag dort eine landwirtschaftliche Station zu gründen. Dadurch wurde Graf Pfeil für Uebernahme weiterer Expeditionen frei und ging zunächst auf der von Bagamoyo nach dem Innern sich hinziehenden Karawanenstraße nach Süden, woselbst er der Gesellschaft durch einen Vertrag Ansprüche auf die Landschaft Kutu sicherte. Hieran schlossen sich folgende weitere Expeditionen:
Die Expedition Jühlke, welcher Premier-Lieutenant Weiß zugeteilt war, gewann Rechtstitel auf die Landschaft Usambara.
Graf Pfeil schloß zusammen mit Premier-Lieutenant Schlüter Verträge in den Landschaften zwischen dem Rufidji und Rovuma.
Die Herren Baumeister Hörnecke und Lieutenant von Anderten waren zu gleichem Zweck am Tana und an der Somaliküste thätig und erwarben Ansprüche, die im Jahre 1886 durch eine Expedition des Dr. Jühlke an der Benadirküste erweitert wurden. Hierbei fiel dieser um die Erwerbung unserer Kolonien hochverdiente Mann den heimtückischen Somali leider zum Opfer.
Der Verfasser selbst sicherte der Gesellschaft durch Verträge Rechte auf die Landschaft Usaramo.
Es würde zu weit führen, und ist nicht Aufgabe dieses Buches, die erwähnten Expeditionen im Detail zu verfolgen. Doch dürfte es nicht uninteressant sein, eine solche Expedition etwas ausführlicher zu erzählen, um hierdurch ein Bild von den damals in Ostafrika für die Gesellschaft bestehenden Schwierigkeiten zu geben.
Es wird zu diesem Zweck die vom Verfasser selbst ausgeführte Expedition gewählt; nicht etwa als ob dieser ein besonderer Wert zugesprochen werden soll, sondern weil sie naturgemäß dem Verfasser am nächsten liegt.
Mein Auftrag, den ich nach meiner Ankunft in Sansibar vom Generalvertreter der Gesellschaft, Dr. Jühlke, erhielt, bestand darin, in Sansibar zunächst eine Expedition zusammenzustellen und mit dieser von Bagamoyo aus Usaramo zu durchziehen, das Land zwischen dem Kingani und Rufidji der Gesellschaft zu sichern und dann nach Usagara zu gehen, wo mir weitere Befehle von Seiten der Gesellschaftsvertretung zugehen sollten.
Ich suchte dem erhaltenen Befehle gemäß so schnell wie möglich die für die Expedition nötigen Träger anzuwerben, kaufte die im Inlande gangbaren Tauschartikel ein, verpackte sie in Lasten und war 5 Tage nach meiner Ankunft in Sansibar so weit, daß ich nach Bagamoyo, dem Anfangspunkt meiner Expedition auf dem Festland überfahren konnte. Es war für mich notwendig, die Zahl der für die Expedition nötigen Träger auf ein Minimum zu reduzieren, da Said Bargasch, der damalige Sultan von Sansibar, uns die Anwerbung der Leute, wie überhaupt die Expedition in jeder Weise zu erschweren suchte. Ich sah mich genötigt, nachdem es mir gelungen war, 70 Träger anzuwerben, auch unsere eigenen Bedürfnisse sehr zu beschränken und für diese Trägerzahl die Verpackung der nötigsten Lasten einzurichten. Von der sonst bei einer Expedition üblichen Mitnahme von Karawanen-Askari (Soldaten) mußte ich Abstand nehmen, weil mir die Anwerbung solcher, wenn sie einigermaßen zuverlässig sein sollten, unmöglich war. Meiner Expedition war der 3 Monate vor mir in Ostafrika angelangte Kaufmann Söhnge zugeteilt worden. Von den Schwarzen sind zu erwähnen: der Hetmann der Karawane, der Komorenneger Ramassan, ferner 2 sansibaritische Waniampara (Unterführer) — alle drei mit Gewehren bewaffnet. Im übrigen bestand die Expedition außer unseren schwarzen Dienern nur noch aus sansibaritischem Trägerpersonal. Beim Aufbruch war für mich die größte Eile geboten, schon aus dem Grunde um, bevor das Ziel der Reise bekannt geworden war, Aufhetzungen des Sultans in Usaramo vorzubeugen. Der Sultan konnte uns nicht nur in Sansibar an der Anwerbung der Träger und der Zusammenstellung der Expedition aufs äußerste hinderlich sein, sondern auch im Innern. Hier besaß er zwar an den meisten Plätzen nicht eine direkte Macht, aber doch einen großen moralischen Einfluß, wie sich dies bei mehreren deutschen Expeditionen, z. B. in Usambara gezeigt hat, wo von Said Bargasch die entsprechenden Empfehlungen vorausgeschickt wurden. Durch meinen schnellen Aufbruch indes, und da der Sultan über den Zweck meiner Reise sich im Unklaren befand, die Expedition auch so angelegt war, als ob sie direkt nach Usagara marschierte, welches sich ja bereits in deutschem Besitz befand, wurden wir vor Schädigungen bewahrt.
So war es mir möglich, im ganzen 7 Tage nach meiner Ankunft in Sansibar, von Bagamoyo aus abzurücken, von wo ich zunächst südlich nach Bueni marschierte, um von hier aus den kleinen von Pangani nach Kutu führenden Karawanenweg bis an den Kingani nach Dundanguru einzuschlagen. Auch hier war es wieder mein Bestreben, möglichst schnell vorwärts zu kommen, um nach dem Bekanntwerden meiner Route in Bagamoyo und Sansibar durch die Schnelligkeit des Marsches mich dem Einfluß der Küstenmachthaber zu entziehen. In der That wurde auch die Expedition zunächst von den Eingeborenen überall freundlich aufgenommen, die damals trotz der großen Nähe der Küste Europäer noch gar nicht gesehen hatten, weil diese nur in ganz vereinzelten Ausnahmefällen bislang das Land seitlich der großen Karawanenstraße betreten hatten. Es bildete sich fast überall ein ganz friedlicher Verkehr mit der Bevölkerung heraus, und dieselbe war in der Regel leicht dazu zu bewegen, die Verträge, deren Abschließung der alleinige Zweck der Expedition war, mit uns einzugehen. Wie schon ganz im Eingang erwähnt worden, sind ja diese Verträge sowohl in Deutschland wie im Ausland auf das heftigste angegriffen und verspottet worden. Das Letztere vielleicht mit einem gewissen Recht; denn es konnte sich ja niemand verhehlen, daß der faktische Wert derselben gering war, da die eingeborenen Häuptlinge sich sehr selten, obgleich es ihnen auseinander gesetzt wurde, dessen, was sie mit einigen Krähenfüßen unterschrieben, voll bewußt waren und sie zumeist auch gegen reiche Geschenke in der augenblicklichen Laune waren, alles Mögliche was man von ihnen verlangte, abzutreten, ohne an das Bindende solcher Zugeständnisse für die Zukunft zu denken. Andererseits repräsentierte auch die zweite Vertrag schließende Partei, die ostafrikanische Gesellschaft, damals nur eine geringe Macht und bedurfte dringend des Rückhalts an der Reichsregierung.
Nichtsdestoweniger haben die Verträge ihren Zweck vollkommen erfüllt, da infolge der ungeordneten innerafrikanischen Zustände und infolge der zivilisatorischen und humanitären Verpflichtungen, die wir den auf der tiefsten Kulturstufe stehenden Negern gegenüber zu übernehmen willens waren, die staatsrechtliche Grundlage für die spätere Abgrenzung unserer Interessensphäre durch sie gegeben wurde.
Fand ich nun in der ersten Zeit überall eine gute Aufnahme und volles Entgegenkommen seitens der Eingeborenen auf meiner Expedition, so blieb doch die Aufhetzung des Sultans von Sansibar nicht ohne Erfolg. Denn diejenigen in der Expedition, auf die ich am meisten angewiesen war und von denen der Erfolg derselben abhing, die Träger, warteten nur auf die Gelegenheit, mich während des Marsches im Stich zu lassen und thaten dies auch gleich während der ersten Tage nach meinem Aufbruch von der Küste.
Wie sehr der Sultan auf die Träger einzuwirken im Stande gewesen war, konnte ich daraus ersehen, daß dem treu zu mir haltenden Dolmetscher Ramassan öfters von den Sansibariten gedroht wurde, ihn beim Sultan zu denunzieren, weil er auf Kosten der Interessen des Sultans unsere Bestrebungen zu sehr fördere. Ramassan schwebte daher auch in steter Angst vor der Strafe des Sultans.
Durch das Entgegenkommen der eingeborenen Jumbes oder Pasi, wie sie in Usaramo genannt werden, ist es mir zunächst immer gelungen, die notwendige Zahl von Aushilfeträgern zu erhalten. Doch sah ich mich wegen der steten Zunahme von Desertion der Träger in Dundanguru veranlaßt, zu einem andern Auskunftsmittel zu greifen, da von hier an die Wasaramo nicht mehr willens waren, mir auf meiner nach Süden nach dem Rufidji abbiegenden Route bis an die Grenze der gefürchteten Mahenge zu folgen.
Ich erklärte meinen Trägern, daß, wer nicht weiter mit mir ziehen wollte, die Erlaubnis habe nach Sansibar zurückzukehren, da ich nur solche Leute, die mir freiwillig und gern folgen würden, mit mir zu nehmen wünsche. In Sansibar würde ich die Bestrafung der Davongelaufenen durch Vermittlung des deutschen Konsulats herbeiführen, dagegen die mir während der ganzen Expedition treu bleibenden Träger über meine Verpflichtung hinaus belohnen. So behielt ich nicht ganz 30 Mann bei mir.
Es war mir ganz Unmöglich, mit diesen die Lasten der Karawane weiterzutransportieren. Daher erteilte ich dem Kaufmann Söhnge den Auftrag, am Kingani ein provisorisches Lager zu beziehen und so gut es ging, zu befestigen, während ich selbst mit den für die Dauer eines Monats notwendigen Tauschwaren, die ich in sehr leichte Lasten verpackt hatte, mit 13 Trägern den Marsch nach Süden fortsetzte. Die übrigen Träger ließ ich Herrn Söhnge zur Bewachung und Einrichtung des Lagers.
Ich durchzog nun allein das Land direkt nach Süden bis zum Rufidji verfolgte diesen drei Tagereisen östlich und marschierte dann nach Nordwest zurück, um wieder zum übrigen Teil meiner Expedition am Kingani zu stoßen.
Ich fand bei den Häuptlingen des südlichen Usaramo nicht dasselbe Entgegenkommen wie im nördlichen Teil und wurde überall mißtrauisch aufgenommen; es gelang mir jedoch auch hier, wenn auch nicht mit derselben Leichtigkeit wie vordem, die gewünschten Verträge, 25 an der Zahl, abzuschließen.
Nach meiner Wiedervereinigung mit Söhnge trat ich den weiteren Vormarsch der Expedition nach Usagara an, da es Söhnge gelungen war, sich mit den Parsis der Ortschaften am Kingani zu befreunden und von diesen die für den Weitermarsch nötige Zahl von Trägern anzuwerben. Die große Karawanenstraße von Bagamoyo wurde am Gerengere erreicht und auf dieser der Marsch nach Muini Sagara und von da nach Sima fortgesetzt.
In Sima traf ich den Generalvertreter der Gesellschaft Dr. Jühlke an, welcher die für die weitere Fortsetzung der Expedition oder für Stationsanlagen nötigen Lasten, die ich aus Mangel an Trägern von Sansibar nicht hatte mitnehmen können, mir nachbrachte und ferner den Auftrag des deutschen Generalkonsuls hatte, einen mit dem alten Usagara-Sultan Muini Sagara und einer arabischen Karawane vorgekommenen Streitfall zu untersuchen und zu schlichten. Dieser Auftrag ging in Folge der Erkrankung Jühlkes auf mich über und hielt mich für die nächste Woche noch in Usagara fest.
Endlich im letzten Drittel des Oktober erreichte mich der Befehl nach Sansibar zurückzukehren und dort eine neue Expedition zusammenzustellen, um mit dieser von der Rovuma-Mündung aus zum Zweck weiterer Erwerbungen ins Innere abzumarschieren.
Mein Begleiter Söhnge war bereits vor mir mit den abgeschlossenen Verträgen nach Sansibar zurückgesandt worden, und es schloß sich mir der mit mir zugleich nach Ostafrika gekommene Dr. Hentschel, welcher sich damals ebenfalls in Usagara befand, auf dem Rückmarsche an. Diese Rücktour sollte indes für mich verhängnisvoll werden und einen Strich durch die Ausführung meiner Instruktion machen.
Am 28. Oktober, Morgens, verließen wir unsern Lagerplatz bei Kidete. Die ersten Stunden des Marsches von Kidete aus waren ruhig verlaufen, und wir glaubten, obgleich wir sowohl durch Kidete-Leute, wie auch durch passierende Jäger von den in jener Gegend angesessenen Wakamba des öfteren belästigt worden waren, durchaus nicht an eine ernstere Gefahr, als wir plötzlich etwa um 1/2-12 Mittags von hinten beschossen wurden. Die Karawane bestand damals außer uns beiden Europäern noch aus 20 unbewaffneten Trägern, welche bei diesem Angriffe ebenso wie unsre Boys ihre Lasten fortwarfen und sich schleunigst davonmachten. Wir waren daher auf uns allein angewiesen. Unter dem fortgeworfenen Gepäck befanden sich auch Dr. Hentschels Patronen. Da ich eine größere Anzahl Patronen selbst bei mir trug, half ich hiermit meinem Gefährten aus. Seine Doppelbüchse hatte ein etwas größeres Kaliber als der Büchsenlauf meiner Büchsflinte, weshalb auch seine Schüsse nicht so präzis sein konnten. Wir suchten indes durch schnelle und möglichst gut gezielte Schüsse der uns numerisch überlegenen Bande — es waren etwa 30 an der Zahl — möglichst viel Verluste beizubringen. Die Gegner haben, wie späteren Besuchern der Gegend mitgeteilt wurde, 5 Tote und mehrere Verwundete gehabt. Aber wir selbst wurden beide gleich bei Beginn der Schießerei verwundet. Dr. Hentschel erhielt einen Schuß in die linke Wade und ich einen in den rechten Unterschenkel über dem Knöchel.
Glücklicherweise machten uns unsere Wunden nicht kampfunfähig; wir suchten so gut wie möglich Deckung im Terrain und setzten, obgleich verwundet, das Feuer fort.
Bei den Gegnern wurde dasselbe immer schwächer; doch traf mich eine der letzten gegnerischen Kugeln in die Brust und ging durch meine rechte Lunge hindurch. Das genügte in jenem Augenblick für mich. Die Gegner stellten, wahrscheinlich wegen der verhältnismäßig großen Verluste, die sie hatten, das Feuer ein und verschwanden zu meinem Glück vom Kampfplatz. Dr. Hentschel hielt an meiner Seite aus, bis mich das Bewußtsein verließ, worauf er sich bei seiner ihn am Gehen hindernden Verwundung zum Teil auf allen Vieren nach dem nächsten Dorfe hin fortbewegte, um Hilfe für mich herbeizuschaffen, oder, wenn diese zu spät käme, mich zu beerdigen. Er mußte zu diesem Zweck die davongelaufenen Träger, vor allem Ramassan, wiederbekommen; denn allein konnte er, selbst verwundet, mir nicht helfen. Daher bewog er eine Anzahl Leute im nächsten Dorfe, zu mir zurückzugehen, um mich nach jenem Dorf zu bringen; er gab ihnen als Lohn das einzige, was er gerettet, sein eigenes Gewehr. Die Leute sind indessen nie zu mir gekommen.
Dr. Hentschel selbst kam nicht zurück, weil er hörte, englische Missionare seien etwas weiter vorwärts auf der Straße, aber in der Nähe. Er sah ein, daß das richtigste sei, von diesen ärztliche Hilfe und Medizin zu erbitten, da wir alles verloren hatten. So ließ er sich zu diesen tragen und sandte Ramassan zurück, der indes Angst hatte und erst später zu mir kam. Die englischen Missionare traf Hentschel; dieselben erklärten sich natürlich bereit, auf mich zu warten, während Hentschel sich in Eilmärschen nach Sadani tragen ließ, um von dort nach Sansibar zu fahren und dort den Vorfall zu melden, damit mir ein Arzt und Hilfe entgegengeschickt würde, wenn es auch damals unwahrscheinlich erschien, daß ich am Leben war. Dr. Hentschel hat in dieser Weise durchaus korrekt und besonnen gehandelt; durch seine Handlungsweise hat er wesentlich dazu beigetragen, mir das Leben zu retten, und mich zu Dank verpflichtet.
Nun ein paar Worte über meine Angreifer. Diese bestanden, wie wir später erfuhren, in einer Räuberbande, sogenannten Ruga-Ruga, die es auf Beutemachen und Plünderung Unsrer Sachen abgesehen hatten. Diese Absicht ist nun nicht einmal von ihnen erreicht worden, da die Angreifer nach ihren verhältnismäßig großen Verlusten sich schleunigst empfahlen. Es waren Dritte, denen die Beute zufiel, und zwar Kidete- und Mamboialeute, die, während ich bewußtlos auf dem Kampfplatz lag, alles stahlen und dabei mit großer Gewissenhaftigkeit verfuhren. Bis auf das, was ich persönlich am Leibe trug, ließen sie nichts zurück; doch war ich indessen noch gut daran, daß mir die Ruga-Ruga selbst nicht noch einen Besuch abstatteten, da sie mir sicher das Messer an den Hals gesetzt hätten.
Ich selbst blieb besinnungslos bis zur Zeit der Dämmerung liegen. Da erst, also 6-7 Stunden nach meiner Verwundung, kam ich zum Bewußtsein meiner Hilflosigkeit. Einige Neger befanden sich in meiner Nähe, die, als ich die Augen aufmachte, auf und davon liefen. Brennender Durst peinigte mich. Ich suchte ihn zu stillen, indem ich mir den rechten Stiefel, in dem sich eine Portion Blut, von dem angeschossenen Bein herrührend, angesammelt hatte, auszog und das darin enthaltene Blut begierig trank. Da das Blut aber nachher trocknete und die Wunden überhaupt nur wenig nachbluteten, so gab es für mich bald nichts mehr zu trinken. Die ganze Nacht lag ich bei vollem Bewußtsein da; ich hätte mir gern schleunige Erlösung von meinen Leiden gewünscht. Meine Versuche, aufzustehen, mißlangen. Am nächsten Morgen kaute ich den Thau aus den Gräsern; den Tropenhelm legte ich mir unter den Kopf, um diesen etwas erhöht zu halten, und zog es vor, hierfür mir die glühende Tropensonne auf den Schädel scheinen zu lassen. Die Neger, welche vorbeikamen und mich liegen sahen, hatten kein Mitleid mit mir, verhöhnten mich teilweise noch, ließen mich alle liegen und gaben mir nicht einmal einen Tropfen Wasser zu trinken. Ein altes, fürchterlich häßliches Weib warf mir ein Stück von ihr ausgesogenen Kürbis ins Gesicht mit den Worten »da friß«, während ein Gemütsmensch darunter war, der auf mein Ansuchen, mich von der Stelle zu tragen, nur erwiderte: »Du wirst doch gleich sterben«. So lag ich, bis die Sonne am Himmel reichlich 2 Uhr zeigte, so daß ich also 26-27 Stunden an jener traurigen Stätte zugebracht habe. Da fanden sich endlich zwei hilfsbereite Leute, die mich ins nächste Dorf trugen. Als ich die erste Pfütze passierte, trank ich soviel Wasser, wie meine braven Träger nach ihrer Aussage noch nie einen Menschen hatten trinken sehen.
Ich wurde im nächsten Dorf in der Hütte des Jumbe untergebracht, der mich, so gut er konnte, verpflegte, indem er mich auf eine Negerbettstelle legen ließ und mir aus Matama gemachte Suppe zum Löschen des Durstes gab. Auch kam mein Karawanenführer Ramassan bald nach diesem Dorfe zurück, wusch, nachdem er mir die Sachen, welche über und über voll Blut waren, vom Leibe gezogen hatte, meine Wunden aus, und verklebte den Einschuß an der Brust, den Ausschuß am Rücken und den Einschuß am Bein mit je einem Stück Cigarettenpapier. Das war für die nächste Zeit die einzige Wundbehandlung. Außerdem warb Ramassan zehn Leute in jenem Wasagara-Dorf an mit dem Versprechen, ihnen wenn sie mich an die Küste nach Sadani brächten, reichlichen Lohn auszuzahlen.
Diese zehn trugen mich ununterbrochen die ganze Tageszeit mit Ausnahme einer kurzen Rast während des Mittags in der Hängematte, immer zwei und zwei abwechselnd, nach der Küste zu. Bei diesem Transport wurde in jenem gebirgigen Terrain aber nicht besser als mit einem Stück Waare mit mir umgegangen. Die Aufnahme, welche ich in den nächsten Dörfern während dieser Zeit fand, war eine durchaus hartherzige. In keinem Dorf wurde mir Unterkunft gewährt. Überall mußte ich mit meinen Leuten außerhalb des Dorfes auf einem harten Graslager zubringen. Dabei hatte ich von der während der Nächte verhältnismäßig großen Kälte viel zu leiden, da ich nur mit meinen blutdurchtränkten Kleidern bedeckt war. Nahrung bekam ich nur von meinen eigenen Leuten, und zwar während dieser ganzen Zeit nur eine Matamasuppe. Das Mißgeschick wollte es zudem, daß ich erst nach mehreren Tagen die englischen Missionare erreichte, welche bereits erwähnt sind. Sie hatten mir Boten mit Medizin und Lebensmitteln entgegengeschickt, doch waren diese einen andern Weg gegangen, als ich.
Bei den Missionaren wurde mir nun selbstverständlich alles zu teil, was mir diese Leute bieten konnten. Sie behandelten und verbanden meine Wunden, brachten mich in einem Zelte unter, gaben mir bessere Nahrung und eine bessere Hängematte, in der ich bis zur Küste unter ihrer Obhut getragen wurde. Allerdings war mein Zustand auf diesem Transport ein derartiger, daß man daran zweifelte, ob ich die Küste noch lebend erreichen würde. Am letzten Tage, bevor wir in Sadani ankamen, trafen wir auf dem Marsch den Maler Hellgrewe und Herrn Söhnge, die, nachdem sie von Dr. Hentschel Kunde über mich erhalten hatten, sich sofort aufgemacht hatten, mir Hilfe zu bringen. Sie fuhren an Bord der »Möwe« über die Herr Admiral Knorr auf die empfangene Nachricht hin so gütig war, nach Sadani zu schicken, damit der Arzt der »Möwe«, Herr Dr. Schubert, mir Hilfe leisten könnte. In Ndumi, 2 Stunden von der Küste entfernt, traf mich auch ein kleines Detachement unter Lieutenant Mandt und Dr. Schubert, die für meinen weiteren Transport nach Sansibar auf S. M. S. »Möwe« Sorge trugen. Zur Erinnerung an jene Zeit stiftete mir Hellgrewe später zwei von seiner Meisterhand gemalte Bilder, die gegenwärtig mein Zimmer schmücken. —
Kehren wir nach dieser Abschweifung zu der Entwickelung der ostafrikanischen Verhältnisse zurück. Bereits oben ist von den Bestrebungen die Rede gewesen, welche sich seitens des Sultans gegen die Erwerbungen der ostafrikanischen Gesellschaft geltend machten. Diese Bestrebungen nahmen eine greifbare Form an, als der Sultan am 25. April 1885 offizielle Kenntnis von dem kaiserlichen Schutzbrief erhielt. Der Sultan Said Bargasch erhob nunmehr einen formellen Protest gegen diesen Schutzbrief und die deutschen Erwerbungen überhaupt. Dieser telegraphisch nach Berlin übermittelte Protest hatte folgenden Wortlaut: »Wir haben vom Generalkonsul Rohlfs Abschrift von Ew. Majestät Proklamation vom 27. Februar empfangen, wonach Gebiete in Usagara, Nguru und Ukami, von denen es heißt, daß sie westlich von unsern Besitzungen liegen, Eurer Oberhoheit und deutscher Regierung unterstellt sind. Wir protestieren hiergegen, weil diese Gebiete uns gehören und wir dort Militärstationen halten und jene Häuptlinge, welche die Abtretung von Souveränitätsrechten an die Agenten der Gesellschaft anbieten, dazu nicht Befugnis haben: Diese Plätze haben uns gehört seit der Zeit unsrer Väter.« Gleichzeitig sandte Said Bargasch Truppen nach Witu, Dschagga und Usagara, um durch eine thatsächliche Machtentfaltung die Häuptlinge einzuschüchtern und eine Art Besitzrecht auszuüben.
Es dürfte geeignet erscheinen, an dieser Stelle die Stellung der Araber in Sansibar und ihre Beziehungen zu Ostafrika kurz zu skizzieren. Wann die erste Einwanderung derselben in Ostafrika erfolgte, läßt sich mit Sicherheit nicht feststellen. Die zahlreichen Ruinen arabischer Gebäude an der ganzen Küste entlang legen Zeugnis davon ab, daß die arabische Kultur hier bereits in früheren Jahrhunderten in hoher Blüte gestanden haben muß; auf dem Boden der Geschichte erscheinen die Araber jedoch erst mit der portugiesischen Einwanderung. Es ist bekannt, daß das arabische Element durch die Portugiesen im 16. Jahrhundert fast gänzlich vertrieben wurde und daß die arabischen Städte insgesamt in portugiesische Hände fielen. Ebenso darf die spätere Vertreibung der Portugiesen durch die Maskataraber als bekannt voraussetzt werden. Erst seit dem Jahre 1840 ist Sansibar der unbestrittene Hauptort der arabischen Oberherrschaft. In diesem Jahr verlegte der Sultan Said Said seine Residenz von Maskat nach Sansibar. Ihm folgte 1856 Said Madjid, dem 1870 dann Said Bargasch nachfolgte; unter diesem gewann der englische Einfluß in Sansibar vollkommen das Übergewicht über alle andern Nationen. Said Bargasch starb 1888 und hinterließ die Regierung seinem Bruder Said Kalifa.
Die Stellung, welche die Araber in Ostafrika gegenwärtig und zwar seit der Vertreibung der Portugiesen einnehmen, ist eine durchaus eigentümliche, wie sie sich ein zweites Mal kaum irgendwo auf der Welt wiederfinden dürfte. Der eigentliche Mittelpunkt ihrer Herrschaft ist Sansibar selbst; aber von diesem Zentralsitz aus laufen die von Arabern gesponnenen Fäden bis in das tiefste Innere des schwarzen Kontinents hinein. Ihre weitesten Vorposten liegen gegenwärtig weit über den Tanganjika westlich im Congostaat.
Ein faktisches Besitzrecht hatte der Sultan ganz zweifellos am Küstenstreifen von der Tanamündnng bis zum Rovuma. Denn auf diesem ganzen Küstenstreifen unterhielt er in allen Hauptplätzen Walis (Statthalter), zum Teil auch Garnison. Er übte hier also wirkliche Hoheitsrechte aus. Der Machtbezirk der einzelnen Walis war jedoch außerordentlich begrenzt und erstreckte sich im großen und ganzen immer nur auf die nächste Umgebung ihres Wohnsitzes.
Fast unmittelbar hinter dem Küstenstreifen herrschten die eingeborenen Häuptlinge und zwar meist nach patriarchalischem Brauch unumschränkt, so daß von einem Besitztitel des Sultans hier gar keine Rede sein konnte. Die Ansprüche, welche der Sultan für dieses Innere erhob, begründete er mit dem Umstand, daß in einzelnen Plätzen sich von ihm ernannte Walis befänden. Damit kann jedoch von einer thatsächlichen Besitzergreifung seitens des Sultans nicht die Rede sein. Es erklärt sich das vielmehr lediglich aus Folgendem: Die arabischen Kaufleute, welche in den Plätzen des Innern, von denen hier die Rede ist, also z. B. in Tabora, Mamboia und anderen sich ansiedelten, ließen vom Sultan einen Wali ernennen, nur um durch einen solchen Beamten eine größere Autorität unter sich zu schaffen. Hätten sie einen Wali selbständig aus ihrer Mitte erwählt, so würde sich kein einziger der Araber an dessen Richterspruch gekehrt haben; ernannte aber der Sultan den Statthalter, so war demselben immer ein wesentlicher Einfluß gesichert, weil der Sultan die Endfäden des Gewebes in Händen hielt, d. h. weil er die ungehorsamen Araber bei ihrer Rückkehr nach Sansibar bestrafen konnte. Thatsächlich aber haben diese Walis den Eingeborenen gegenüber keine Rechte ausgeübt; diese standen wenigstens im jetzigen deutschen Interessengebiet nach wie vor unter ihren angestammten Häuptlingen.
Der Protest des Sultans wurde daher mit Recht durch den Fürsten Bismarck am 19. Juni 1885 formell abgelehnt, die Ansprüche für unbegründet erklärt und gegen die nachträgliche Besetzung von Gebieten, welche innerhalb des deutschen Schutzgebietes lagen, Einspruch erhoben. Die deutsche Antwort trug den Charakter eines Ultimatum und wurde durch ein deutsches Geschwader, bestehend aus den Schiffen: Bismarck, Prinz Adalbert, Gneisenau, Stosch, Elisabeth, Olga, Möwe nebst zwei Tendern: Adler und Ehrenfels nachdrücklich unterstützt.
Die Sultanstruppen waren bereits am 24. Juni zurückberufen worden und am 14. August erkannte der Sultan rückhaltlos die Schutzherrschaft Deutschlands über die Länder Usagara, Nguru, Usegua, Ukami und über das Gebiet von Witu an. Diese Erklärung des Sultan wurde vom deutschen Reich als vollkommen genügend angesehen und obwohl thatsächlich niemand in Sansibar, weder die Araber noch die Engländer und Franzosen, daran zweifelten, daß das Geschwader lediglich gesandt worden sei, um das Sultanat zu annektieren, wurde seitens Deutschlands, um die freundschaftlichen Beziehungen zu England nicht zu erschüttern, von diesem Schritte abgesehen. Nicht nur die Deutschen, sondern überhaupt alle Einwohner bis zum Sklaven herunter faßten dies nicht anders, denn als einen Mißerfolg Deutschlands auf. Die gewaltige Flottenentfaltung war gänzlich ohne Resultat, ja die Araber betrachteten sogar die vom Sultan gegebene Erklärung lediglich als ein durch die Not erzwungenes, diplomatisches Auskunftsmittel.
Für die europäischen Mächte bildete jedoch diese diplomatische Korrespondenz die Grundlage für weitere Verhandlungen. England hatte richtig erkannt, wie nahe die Gefahr einer Annexion des ganzen Sultanats gelegen hatte. Um für die Zukunft eine solche Möglichkeit auszuschließen, ging das englische Bestreben jetzt dahin, Deutschland zum Beitritt zu dem englisch-französischen Vertrage vom Jahr 1862 zu bringen, in welchem die Unabhängigkeit des Sultans von Sansibar anerkannt wurde. Die Verhandlungen über die ostafrikanische Frage begannen zwischen England und Deutschland im Dezember 1885 und fanden ihren Abschluß in dem internationalen Abkommen zu London am 1. November 1886.
Das Londoner Abkommen erkannte dem Sultan die Souveränität über Sansibar, Pemba, Lamu und Mafia zu, sowie einen Besitz an der Küste in einer Tiefe von 10 Seemeilen vom Rovuma bis Kipini. Um jedoch der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft einen Zugang zur See zu verschaffen, ohne welchen der Besitz des Innern ja gänzlich wertlos gewesen wäre, machte England im Londoner Abkommen sich anheischig, im Einverständnis mit Deutschland beim Sultan auf die Verpachtung der Zölle in den Häfen von Daressalam und Pangani an die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft hinzuwirken, nachdem bereits im September 1885 die Mitbenutzung Daressalams zugestanden worden war. Gleichzeitig kamen beide Mächte überein, eine Abgrenzung ihrer gegenseitigen Interessensphäre in diesem Teile des ostafrikanischen Festlandes vorzunehmen. Der letztgenannte Punkt bildet die Grundlage des deutsch-englischen Abkommens von 1890.
Mit dem Londoner Vertrage war nunmehr endlich eine politische, internationale Grundlage für die deutsche Kolonisation Ostafrikas geschaffen. Die erste günstige Wirkung derselben war die Erkenntnis, daß nicht wie bisher durch verhältnismäßig geringfügige Kapitalbeteiligung ein Erfolg zu erzielen sei. Das Großkapital sollte und mußte herangezogen werden und die Gesellschaft selbst verlangte eine Neuorganisation.
Im Februar 1887 verwandelte sich die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft, die Leitung wurde in die Hände eines Verwaltungsrats gelegt und Dr. Peters zum Generalvertreter in Sansibar ernannt.
In der That gelang es Peters schon im Jahre 1887, den Sultan Said Bargasch zu einer Abtretung der Zölle zu bringen, aber die Ratifikation des Vertrages durch die Direktoren der Gesellschaft verzögerte sich so lange, daß Said Bargasch darüber hinstarb und erst unter Said Kalifa im April 1888 der überaus wichtige Küstenvertrag zu Stande kam, durch welchen die gesamten Festlandszölle, so weit sie die Ausfuhr betrafen, an die Gesellschaft abgetreten wurden. Da dieser Küstenvertrag die eigentliche Grundlage und Ursache des Aufstandes bildet, so mögen seine Bestimmungen hier Platz finden:
»Dem Sultan sollen keine Verbindlichkeiten erwachsen weder aus den Kosten der Besitzergreifung der Küste durch die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, noch auch aus den daraus etwa entstehenden Kriegszuständen. Dagegen willigt er ein, alle Akte und Handlungen, welche erforderlich sind, um die Bestimmungen des Vertrags zur Ausführung zu bringen, vorzunehmen und der Gesellschaft mit seiner ganzen Autorität und Macht zu helfen.«
»Im ersten Jahre liefert die Gesellschaft den ganzen Betrag der erhobenen Ein- und Ausfuhrzölle an den Sultan ab, abzüglich der Geschäftsunkosten (nicht über 272000 M.) und einer Kommissionsgebühr von 5 Prozent. Auf Grund der im ersten Jahre gemachten Erfahrungen soll die Durchschnittssumme der jährlich zu zahlenden Pacht festgestellt werden.«
»Die Gesellschaft wird ermächtigt, Beamte einzusetzen, Gesetze zu erlassen, Gerichtshöfe einzurichten, Verträge mit Häuptlingen zu schließen; alles noch nicht in Besitz genommene Land zu erwerben, Steuern, Abgaben und Zölle zu erheben, Vorschriften für den Handel und Verkehr zu erlassen, die Einfuhr von Waaren, Waffen und Munition und allen andern Gütern, welche nach ihrer Ansicht der öffentlichen Ordnung schädlich sind, zu verhindern; alle Häfen in Besitz zu nehmen und von den Schiffen Abgaben zu erheben.«
»Die Verwaltung soll im Namen des Sultans und unter seiner Flagge, sowie unter Wahrung seiner Souveränitätsrechte geführt werden. Der Sultan erhält eine nach einem Jahr festzustellende Pachtsumme, ferner 50 Prozent des Reineinkommens, welches aus den Zollabgaben der Häfen fließen wird; endlich die Dividende von zwanzig Anteilscheinen der Gesellschaft à 10000 M., nachdem Zinsen in der Höhe von 8 Prozent auf das eingezahlte Kapital der Anteilscheinbesitzer bezahlt worden sind.«
Zur Zeit dieses Vertragsabschlusses besaß die Ostafrikanische Gesellschaft in Deutsch-Ostafrika folgende 18 Stationen:
Auf Sansibar selbst: die Hauptstation Sansibar;
in Usaramo: Bagamoyo, Daressalam, Dunda, Madimola, Usungula;
in Usambara: Pangani, Korogwe, Mafi;
im Süden zwischen Rufidji und Rovuma: Kilwa, Lindi, Mikindani;
in Usagara: Sima und Kiora;
weiter westlich in Ugogo: Mpapua;
in Usegua: Mbusini (Petershöhe);
am Kilimandscharo: Moschi und Aruscha.
Von diesen waren nur Kilwa, Lindi und Mikindani Zollstationen. Im übrigen wurden die Zölle in Sansibar selbst erhoben, da der gesamte Verkehr von der Nordküste sich über Sansibar bewegte. Die Stationen im Innern waren vor der Hand als Stützpunkte für Erwerbungen oder eventuelle spätere wirtschaftliche Ausnutzung anzusehen. Den Beamten der Gesellschaft, welche die betreffenden Stationen inne hatten, blieb es je nach ihrer Befähigung und Initiative überlassen, daraus zu machen, was sie konnten oder wollten.
2. Kapitel.Entwickelung des Aufstandes und Errichtung des Reichskommissariats.
Hoheitsrechte der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. — Übernahme der Küste, Schwierigkeiten bei Ausübung der Souveränität. — Widerstand der Araber und Inder. — Unzufriedenheit der Küstenbevölkerung. — Machtlosigkeit der Gesellschaft. — Sultanssoldaten im Dienst der Gesellschaft. — Einfluß des Sultans auf dieselben. — Verhalten der Gesellschaftsbeamten. — Weigerung des Wali von Pangani, die Gesellschaftsflagge zu hissen. — Eingreifen der Möwe und Carola. — Ausweisung des Wali. — Erneute Unruhen in Pangani. — Einschreiten des Generals Matthews. — Zurückziehung der Gesellschaftsbeamten. — Unruhen in Tanga. — Zustände in Bagamoyo. — Wühlereien der Bagamoyo-Jumbes. — Angriffe auf das Gesellschaftsgebäude. — Versuch, den Admiral abzufangen. — Besetzung Bagamoyos durch die Marine. — Streifzüge Gravenreuths. — Erstes Eingreifen Buschiris. — Buschiri landet mit 800 Mann in Sadani. — Vorrücken auf Bagamoyo. — Befestigung dieser Station durch Zelewski. — Angriffe auf Bagamoyo. — Stellung der Katholischen Mission. — Verhältnisse um Daressalam. — Angriff auf die katholische Mission in Pugu. — Ermordung der Missionare. — Verhältnisse im Süden. — Aufgabe von Lindi und Mikindani. — Ermordung der Gesellschaftsbeamten in Kilwa. — Wirkung dieser Nachrichten in Deutschland. — Blokade-Erklärung. — Antisklaverei-Antrag des Dr. Windthorst. — Errichtung des Kommissariats.
Durch den Vertrag der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft mit Said Kalifa ging außer der Verwaltung der Zölle auch die Ausübung der Hoheitsrechte des Sultans (Verwaltung und Gerichtsbarkeit) an die Gesellschaft über. Als äußeres Zeichen dafür sollte überall, wo Stationen der Gesellschaft im Sultansgebiet sich befanden, zugleich mit der Sultansflagge die Flagge der Gesellschaft gehißt werden. Jedoch schon bald nach der Uebernahme der Küste wiesen erfahrene Gesellschaftsbeamte wie von Zelewski und Freiherr von Eberstein in ihren Berichten an den Generalvertreter darauf hin, daß die der Gesellschaft vertragsmäßig zu teil gewordenen Hoheitsrechte auf die Dauer von den Beamten nicht würden ausgeübt werden können; die nächste Zeit hat gezeigt, wie berechtigt diese Befürchtungen waren.
Es waren zwar die Eingeborenen und alle Bewohner des Küstendistrikts durchaus geneigt, der Gesellschaft die üblichen Zölle zu zahlen, da sie in der Uebertragung derselben an die Gesellschaft eine einfache Verpachtung sahen, wie eine solche auch schon früher von Seiten des Sultans an andere Personen besonders Inder, stattgefunden hatte, und es hätte diese Zollerhebung seitens der Gesellschaft ohne den geringsten Machtaufwand ungestört überall stattfanden können, — wenn nur nicht damit eine Ausübung der Souveränität verbunden gewesen wäre.
Bei dem überaus conservativen Charakter der arabischen Bevölkerung, bei ihrer Eigenart, vom kleinsten Gemeinwesen hinauf bis zum Staat patriarchalische Organisationen zu schaffen, für welche das Religionsgesetz den Nahmen gab, mußte ein solcher Versuch um so schwerere Bedenken erregen, als gar keine wirkliche Macht dahinter stand. — Den Fremden, den Ungläubigen, deren Persönlichkeiten ihnen noch dazu meist gänzlich fremd waren und von den ihnen unbekannt war, ob sie ihre Sitten respektieren würden, mochten die Araber sich nicht fügen. Sie sahen die Ausübung der Souveränität im Namen des Sultans von Seiten der Gesellschaftsbeamten nur als Anfang zu gänzlicher Unterwerfung unter die deutsche Herrschaft an; sie fürchteten durch zu hartes Vorgehen der neuen Beamten in der Sklavenfrage eine Schädigung ihrer Interessen und glaubten ihre gesamte Existenz aufs äußerste bedroht, da sie befürchteten, daß sie auch in ihrem rein kaufmännischen Gewerbe beeinträchtigt werden würden. Das letztere Moment hatte sich übrigens schon früher in Tabora geltend gemacht, wo die Araber mit allen Mitteln gegen die europäische Konkurrenz zuerst die eines Franzosen und dann der großen Hamburger Elfenbeinfirma Meyer, ankämpften. Ein Angestellter der Firma, Herr Giesecke, wurde im Jahre 1887 von den Arabern mit Erlaubnis des Häuptlings Sikke von Unianiembe — aus Geschäftsrücksichten — ermordet.
Die Furcht vor dieser kaufmännischen Konkurrenz einerseits, sowie das Faktum einer im Lauf der Zeit eingetretenen großen Abhängigkeit der Araber von den Indern war übrigens auch für letztere ein Grund, sich bei Ausbruch des Aufstandes den Rebellen gegenüber sympathisch zu verhalten. Sie traten uns natürlich nicht mit den Waffen in der Hand entgegen, leisteten aber doch durch Lieferung von Waffen und Munition sowie durch Spionage den Aufständischen Vorschub.
Ein weiterer Grund zur Unzufriedenheit war der, daß vielen Küsten-Leuten und zwar Arabern wie Negern ein sehr bequemes Einkommen, welches sie bis dahin gehabt hatten, der Natur der Verhältnisse nach mit der Neuordnung genommen wurde. Es bezieht sich dies auf die Walis, Akidas und Jumbes in den Hauptküstenplätzen Bagamoyo, Pangani, Kilwa und Lindi. Hier war überall von den genannten Personen unter allen möglichen Vorwänden und Titeln den Karawanen Tribut abgenommen worden. Daß die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft einem derartigen Unfug sofort ein Ende machen mußte, war selbstverständlich; aber ebenso selbstverständlich war es, daß die geschädigten Mrimaleute solche Maßregeln als ganz unerlaubten Eingriff in ihre Rechte betrachteten.
Dennoch würden alle diese Gründe zusammen nie den Ausbruch eines allgemeinen Aufstandes herbeigeführt haben, wenn die Gesellschaft in der Lage gewesen wäre, bei Uebernahme der Verwaltung den Arabern und Küstenbewohnern einen nachhaltigen Respekt durch Entfaltung von Machtmitteln einzuflößen. Hierzu langten aber die Mittel nicht, und die deutsche Reichsregierung zeigte sich damals noch nicht geneigt, mit Nachdruck für die Gesellschaft einzutreten. — Die einzigen militärischen Kräfte, welche die Gesellschaft hinter sich hatte, waren die unter den Walis und Akidas der Küstenplätze bisher beschäftigten Sultanssoldaten, die ihrerseits aber von jeher in engem Kontakt mit der Bevölkerung gestanden hatten und da sie Geschenke von dieser empfingen, auch von ihr abhängig waren. Sie haben den Beamten nur geschadet, indem sie meist zu den Rebellen übertraten und offen gegen die deutsche Herrschaft ankämpften. Dazu kam, daß der Sultan von vornherein kaum gesonnen war, den abgeschlossenen Vertrag wirklich zu halten, sondern seinen Organen an der Küste geheime Instruktionen zugehen ließ, nach Möglichkeit Schwierigkeiten zu machen. So trug er selbst zum Ausbruch des Aufstandes bei, bis schließlich, als er ein Interesse daran hatte, die Unruhen zu ersticken, ihm seine sogenannten Unterthanen nicht mehr folgsam waren.
Nur wenige Leute unter den früheren Sultansbeamten haben wirklich, nachdem sie in deutsche Dienste getreten waren, ehrlich zu den Deutschen gehalten und an ihrer Seite auch zur Zeit des Unglücks ausgeharrt, so z. B. Schech Amer, Said Magram in Bagamoyo und Mohammed ben Seliman in Daressalam.
Als einen wesentlichen Grund zum Aufstande beliebte man damals daheim wie in Sansibar von gegnerischer Seite das Benehmen der Gesellschaftsbeamten den Eingeborenen gegenüber anzugeben. Es ist dies völlig unzutreffend, und es sind im Gegenteil aus dem Gesellschaftsdienst diejenigen Leute hervorgegangen, welche durch ihre Kenntnis der Verhältnisse und nicht zum mindesten dadurch, daß sie die Leute zu behandeln gelernt hatten, dem Reichskommissar später am meisten genützt haben. Wenn auch hier und da einmal Ausnahmen von der Regel vorgekommen sind, so stehen jene wenigen Ausnahmen absolut nicht in ursächlichem Zusammenhang mit dem Ausbruch des Aufstandes. Ebenso falsch ist es, wenn der Aufstand als ein von den Muhamedanern als solchen gegen uns Christen angefachter Krieg hingestellt wird. Es ist allerdings von geschickten Führern das religiöse Moment später mit hereingezogen worden, aber nur künstlich, um durch ein allgemein verständliches Motiv die Massen mehr in die Hand zu bekommen. Wenn wir auf den erbeuteten Fahnen vielfach religiöse Inschriften fanden, so sind dies Koransprüche, wie sie der Sitte gemäß von den Krieg führenden Muhamedanern auf allen ihren Fahnen angebracht werden; keineswegs sind sie aus besonderem Fanatismus gegen uns verwendet worden.
Die im Vorstehenden aufgeführten Gründe zur Unzufriedenheit der Küstenbevölkerung wurden damals weder von der Leitung der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft noch von der Vertretung der Reichsregierung in Sansibar genügend erkannt und gewürdigt; man ließ sich an der papiernen Macht des Küstenvertrages genügen und installierte zunächst ohne wesentliche Schwierigkeiten je zwei Beamte in den Küstenstationen Tanga, Pangani, Bagamoyo, Daressalam, Lindi und Mikindani. Bald aber gewann die Gährung an der Küste einen greifbaren Ausdruck.
Die ersten unbefriedigenden Nachrichten kamen aus Pangani. Der dortige Bezirkschef der Gesellschaft, Herr von Zelewski berichtete, daß der Wali von Pangani dem ihm vom Sultan erteilten Befehl, sich dem Bezirkschef zu fügen, nicht nachkäme und daß er gegen die Hissung der Gesellschaftsflagge protestiere. Es wurde in Folge dieses Berichtes der Kreuzer »Möwe« am 17. August 1888 nach Pangani abgesandt. Sein Erscheinen bewirkte, daß der Wali versprach, den Bezirkschef als seinen Vorgesetzten anzuerkennen und seinen Befehlen in jeder Beziehung nachzukommen. Daraufhin dampfte die Möwe wieder von Pangani ab, eine Macht wurde nicht zurückgelassen; man ließ es darauf ankommen, ob die Sache gut gehen werde oder nicht. Kaum aber war das Schiff außer Sicht, da verweigerte der Wali wiederum den Gehorsam, und dasselbe thaten auf sein Anstiften hin die in den Dienst der Gesellschaft übergetretenen Sultanssoldaten. Als darauf am 18. August die Carola bei Pangani vorbeikam, um sich nach der inzwischen erfolgten Entwicklung der Verhältnisse zu erkundigen, entsandte auf Antrag des Herrn von Zelewski der Kommandant des Schiffes am 19. ein Landungscorps, dessen Erscheinen die aufrührerische Bevölkerung einschüchterte. Die Abteilung der Marine drang bis zum Hause des Wali vor, um diesen dort gefangen zu nehmen, fand aber das Haus leer — der Wali war nach Sansibar geflohen. Man begnügte sich, die Sultanstruppen zu entwaffnen und ließ auf Antrag des Bezirkschefs 2 Unteroffiziere und 16 Matrosen als Wache im Stationsgebäude zurück. Die Carola verließ hierauf die Rhede, und am 23. erschien statt ihrer die Möwe, um die Wache wieder abzuholen.
Unbegreiflicherweise gab man sich damals trotz der soeben gemachten Erfahrungen einem derartigen Optimismus hin, daß man es nun schon wieder darauf ankommen ließ, ob die Sache weiterhin gut gehen würde oder nicht. Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft that das einzige, was sie thun konnte; sie verfügte die Ausweisung des Wali von Pangani aus dem Küstengebiet und der Generalkonsul begnügte sich mit dieser Maßregel, weil durch diese Ausweisung der Wali für die Beamten der Gesellschaft unschädlich geworden war.
Die Folgen dieser Vertrauensseligkeit zeigten sich fast augenblicklich. Als der Bezirkschef von Pangani bei der Ankunft von 1000 Faß Pulver auf einer Dhau auf dem Pangani-Fluß das Landen dieser Menge von Munition verbot und verfügte, daß die Dhau nach Sansibar zurückkehren sollte, bildete diese an sich selbstverständliche Maßregel die Veranlassung zum Ausbruch wirklicher Unruhen. Der größte Teil der Bevölkerung rottete sich zusammen, zog vor das Haus der Gesellschaft und setzte die Beamten gefangen. Das Haus wurde verschlossen, eine Wache davor gesetzt und den Gefangenen jeder Verkehr nach außen untersagt.
Zufälligerweise war der General-Vertreter der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, Konsul Vohsen, in begreiflicher Sorge um die Sicherheit seiner Beamten, gerade an diesem Tage auf dem Sultansdampfer Barawa nach Pangani unterwegs, um sich persönlich nach der Entwicklung der Verhältnisse zu erkundigen.
Obwohl er schon im Boot erfuhr, daß in Pangani Krieg sei und ihm von Wohlmeinenden dringend geraten wurde, nicht an Land zu gehen, setzte er die Fahrt fort, wurde indes durch die sein Boot beschießenden Rebellen zur Umkehr gezwungen. Die Barawa kehrte am nächsten Tage nach Sansibar zurück, und auf die Intervention des deutschen Generalkonsuls und des Konsuls Vohsen schickte nun der Sultan, nachdem die Barawa mit Vohsen an Bord wieder nach Pangani zurückgegangen war, seinen General Matthews mit Truppen nach Pangani, um die Beamten zu befreien. Die Befreiung derselben ist dem General nur mit Not und Mühe und unter eigener Lebensgefahr gelungen, ein Beweis dafür, daß die ohnehin schwache Autorität des Sultans ganz aufgehört hatte.
In dem nördlichen Platze Tanga waren die beiden Gesellschaftsbeamten (v. Frankenberg und Klenze) gleichfalls in ihrem Stationshause am 5. September gefangen gesetzt worden, wurden aber am 6. September durch das Einschreiten der vor Tanga erscheinenden Möwe mit Waffengewalt befreit. Aus Pflichtgefühl lehnten die Beamten die ihnen angebotene Rückkehr auf der Möwe nach Sansibar ab und verblieben auf ihrem Posten. Die Möwe selbst überbrachte Meldung von dem Vorgefallenen nach Sansibar.
Die hierauf vor Tanga erscheinenden Kriegsschiffe Leipzig, Olga und wiederum Möwe schickten dann in der Nacht vom 7. zum 8. ein Landungscorps aus und machten den Versuch, den Wali gefangen zu nehmen, der jedoch auch hier mißlang. Die Beamten wurden auf Befehl der Generalvertretung von der Leipzig nach Sansibar gebracht.
In Bagamoyo als dem Hauptplatz der Küste hatte am 16. August unter besonderen Feierlichkeiten die Flaggenhissung und die Übergabe an die Gesellschaft im Beisein des General-Vertreters stattgefunden. Der Wali hatte sich bereit erklärt, in den Dienst der Gesellschaft überzutreten und hatte nur in einem Punkte Schwierigkeiten gemacht, nämlich als von ihm die Entfernung der Sultansflagge von seinem Hause gefordert wurde. Doch gelang es in den darauf mit ihm geführten Verhandlungen, diese Schwierigkeit zu beseitigen, indem auch auf seinem Hause die Sultansflagge neben der Gesellschaftsflagge weiterhin gehißt wurde. Aber auch hier erwiesen sich bald die Verhältnisse als unhaltbar. Grade in Bagamoyo fühlten sich die Jumbes Makanda, Bomboma und Simbambili in ihren Interessen bedroht und scharten eine große Masse Unzufriedener um sich. Bis zum 22. September hatte die Sache immerhin noch einen so friedlichen Anstrich, daß der Bezirkschef, Frhr. v. Gravenreuth, an Feindseligkeiten nicht dachte und am frühen Morgen jenes Tages mit dem Geschwaderchef, Admiral Deinhard auf einem Boot der Leipzig zur Flußpferdjagd in den Kingani fuhr. Als die Herren unterwegs waren, wurde den übrigen Gesellschaftsbeamten vom Wali mitgeteilt, daß er der Bewegung nicht mehr Herr werden könne, die Rebellen wollten gegen das Gesellschaftsgebäude vorgehen und es sei Gefahr im Anzuge. Die Beamten vereinigten ihre Askaris im Hause der Gesellschaft und hielten die Rebellenschar durch das in der Station befindliche 4,7 cm-Geschütz, welches der Stationsbeamte Rühle mit großer Bravour unter dem Feuer der Aufständischen bediente, von derselben fern. Die Rebellen wagten die Station selbst nicht zu stürmen, sondern zogen nach dem Strande, um das Gesellschaftsboot zu zerstören, wurden aber von einer Abteilung der Askaris, geführt von den Beamten, in der Richtung auf die französische Mission hin vertrieben. Zu gleicher Zeit war die Leipzig durch Signale von dem Angriff benachrichtigt worden und sandte ein Landungscorps nach der Stadt, das die Rebellen noch über die französische Mission hinaus verfolgte. Die geschlagenen Aufrührer haben dann noch den Versuch gemacht, den deutschen Admiral und den Bezirkschef im Kingani gefangen zu nehmen. Sie trafen das Boot mit genannten Herren an einer seichten Stelle des Flusses bei abfließendem Wasser festgefahren und suchten sie an das Ufer zu locken. Doch waren glücklicherweise die Herren durch einen Boten des Arabers Said Magram gewarnt und warteten im Fluß das Steigen des Wassers ab, um so am Abend an Bord der Leipzig zurückzukehren, wo der Admiral von den Vorfällen des Tages in Kenntnis gesetzt wurde.
Die persönliche Gefahr, welcher der Admiral durch das wackere Benehmen Said Magrams entronnen war, ließ nun plötzlich die Bedeutung des Aufruhrs in einem ganz anderen Lichte erscheinen, als man sie bisher zu betrachten gewohnt war. Daß mit bloßen Verhandlungen hier nichts zu erreichen war, lag auf der Hand.
Herr v. Gravenreuth, welcher vor Begierde brannte, die Aufrührer aus der nächsten Umgebung von Bagamoyo zu vertreiben, unterbreitete dem Admiral seine Pläne und nachdem dieser bereitwilligst in das Stationsgebäude zu Bagamoyo eine Abteilung der Marine unter dem Kommando eines Marineoffiziers gelegt hatte, war Gravenreuth in der Lage, mit den Gesellschaftsbeamten und den von ihm eingedrillten Stationssoldaten offensiv gegen die Rebellen vorzugehen. Er machte, in Bagamoyo angekommen, einen Streifzug in die Umgegend, schlug die Rebellen zurück und wiederholte diese Streifzüge mehrfach in nächster Zeit. So blieb er Herr der Situation und führte sogar eine auf dem Wege nach Bagamoyo befindliche Waniamuesi-Karawane, welche von den Rebellen abgefangen werden sollte, in die Stadt hinein. Eine andere große Waniamuesi-Karawane hingegen wurde nach der Straße von Daressalam abgedrängt.
Aber auch die Erfolge Gravenreuths konnten den andrängenden Strom nur für kurze Zeit eindämmen. Der Aufruhr wuchs in riesigem Maße, die einzelnen Herde desselben flossen in einander und bald erschien die Person des Führers auf dem Schauplatze, dessen organisatorischem Talente und dessen Energie die Massen sich unterordneten.
Dies war der Halbaraber Buschiri, der sich bereits früher unter Said Madjid im Innern durch seine Anteilnahme an den Kämpfen gegen Mirambo ausgezeichnet hatte. Dann hatte er sich, an die Küste gekommen, am Panganifluß auf einer Schamba niedergelassen. Als Said Bargasch zur Regierung kam, wurde er von diesem wiederholt vor Gericht gefordert wegen beträchtlicher gegen ihn schwebender Geldforderungen. Er entzog sich jedoch dem Richterspruch des Sultans und leistete auch, da er sich bei seiner Schamba durch Anlegung einer starken Buschboma befestigt hatte, den Soldaten Said Bargaschs erfolgreichen Widerstand, so daß letzterer es schließlich vorzog, ihn nicht mehr weiter zu behelligen.
So hatte Buschiri unter der Küstenbevölkerung und den Arabern sich ein gewisses Renommee erworben; tatsächlichen größeren Einfluß wußte er erst unter geschickter Benutzung der Verhältnisse bei Ausbruch des Aufstandes gegen die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft zu erlangen.
Buschiri schiffte sich in Pangani mit 800 Mann ein und landete dieselben in Sadani, wo er den Machthaber Useguas, Bana Heri zum Aufstand anreizte, ohne daß es ihm jedoch damals glückte, eine Verbindung mit demselben zu erlangen. Von Sadani zog Buschiri über Land nach Bagamoyo und übernahm hier die Führung der vereinigten Bagamoyo-Jumbes und ihrer Horden. Seine Hauptstütze, gewissermaßen sein Generalstabschef, war der Komorenser Jehasi, der früher als Artillerist im Congostaat gedient hatte und dementsprechend auch bei Buschiri seine Hauptverwendung in der Bedienung der der Gesellschaft abgenommenen Geschütze fand.
Mit dem Erscheinen Buschiris und der Vermehrung der Rebellenkräfte um Bagamoyo verschlimmerte sich daselbst die Lage der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft auf das äußerste.
Von einem Verwaltungsdienst oder gar von Zollerhebung seitens der Beamten konnte naturgemäß nicht mehr die Rede sein. Schon jetzt kamen lediglich militärische Gesichtspunkte in Betracht, vor allem die Behauptung der Stadt Bagamoyo selbst.
Herr von Gravenreuth war um diese Zeit durch schwere Fieberanfälle genötigt worden, nach Deutschland zurückzukehren und hier Heilung zu suchen. Das Kommando der Station und die Verteidigung der Stadt übernahm Herr v. Zelewski, der bereits als Bezirkschef von Pangani Erwähnung fand. Er sah ein, daß den stark überlegenen Kräften bei der geringen Zahl der Gesellschaftsaskaris nicht mehr nach dem Gravenreuthschen System der Offensive durch Ausfälle aus der Station beizukommen sei, zumal die Hilfe der Marine ausschließlich für die Besetzung und Verteidigung der Station bestimmt war. Zelewski, aufs Eifrigste unterstützt von Wilkens, befestigte infolgedessen das Wohnhaus der Gesellschaft, indem er es mit einer Mauer umgab, diese zur Verteidigung durch die Askaris und Europäer einrichtete und das Land in der nächsten Umgebung der Station frei legte, um ein hinreichendes Schußfeld gegen die nunmehr öfters gemachten Angriffe der Rebellen zu haben. Alle Europäer, die damals unter Zelewskis Kommando die Station hielten, schreiben es seiner Umsicht und seinem Verdienst zu, daß es ihm und seinem Nachfolger ermöglicht wurde, den Platz bis zum Eingreifen der Schutztruppe zu halten.
Im Dezember 1888 mußte auch Zelewski, nachdem er 3 Jahre in Ostafrika ausgehalten hatte, wegen seines Gesundheitszustandes die Heimat aufsuchen und das Kommando der Station ging nun an Herrn v. Eberstein über, der den weiteren Ausbau und die Verteidigung im Sinne Zelewskis leitete.
Die im Dezember, Januar und Februar von Buschiri unternommenen Angriffe wurden stets zurückgeschlagen; doch konnte nicht verhindert werden, daß die Stadt Bagamoyo von ihm zum großen Teil gebrandschatzt und zerstört wurde.
Der letzte Angriff auf die Station fand am 3. März 1889 statt; die Rebellen wurden abermals zurückgeschlagen, und es wurde durch die Herren Lieutenant Meyer mit der Marinebesatzung und Ostermann, von Medem und Illich das eine der von Buschiri der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft abgenommenen 4,7 cm-Geschütze zurückerobert. Buschiri bezog hierauf ein befestigtes Lager beim Dorf Kaule.
Der einzige Ort, welcher während aller dieser Kämpfe in Bagamoyo seine völlige Neutralität zu bewahren verstand, und von den Eingeborenen als sichere Zufluchtsstätte betrachtet wurde, war die katholische Mission. Ihr kluges Verhalten und die den Arabern wie Eingeborenen stets entgegengebrachte Humanität sicherten ihr diese merkwürdige Ausnahmestellung und verschaffte gleichzeitig uns Deutschen wesentliche Vorteile.
Von der Mission aus wurden die bedrängten Deutschen stets mit Nachrichten über die Bewegungen und die Absichten der Rebellen versehen, Nachrichten, die in erster Linie der in den weitesten Kreisen bekannte Bruder Oskar oft mit eigener Gefahr persönlich den Deutschen übermittelte, wenn er nicht, was auch geschah, in wenigen Zeilen auf einem Zettel oft recht drastischen Inhalts (wie: »Passen Sie auf! die Schweinehunde kommen morgen um 10«) uns Nachrichten zukommen ließ.
Derjenige Platz, welcher unter dem Aufstande zunächst am wenigsten zu leiden hatte, war Daressalam. Es erklärt sich dies zwar teilweise aus der geringen Bedeutung dieses Platzes für den Karawanenverkehr, der geringen Einwohnerzahl und der unkriegerischen Gesinnung der umwohnenden Wasaramo, zum wesentlichen Teil aber verdankte Daressalam seinen friedlichen Zustand dem Geschick und der Energie des Stationschefs Leue, der vor Ausbruch des Aufstandes bereits Gelegenheit gehabt hatte, sich dort vollkommen einzuleben und in Respekt bei den Arabern und Eingeborenen zu setzen, — seit seiner Ankunft in Afrika im Jahre 1887 war er einzig und allein an diesem Platze thätig gewesen. Leues Hauptstütze war unter der Bevölkerung der uns durchaus ergebene Akida Mohammed ben Seliman.
Erst im Dezember erreichte der Aufstand Daressalam, und zwar hauptsächlich infolge des Umstandes, daß eine große Zahl befreiter Sklaven auf der Missionsstation daselbst untergebracht wurde. Der Araber Seliman ben Sef organisierte jetzt seinen Anhang von Arabern, Belutschen und früheren Sultanssoldaten und verband sich mit der Partei des Negers Schindu, welche bisher gegen Leues Autorität offen anzutreten nicht gewagt hatte. Schließlich kam es auch in Daressalam so weit, daß sich sowohl der Bezirkschef Leue wie auch sein Nachfolger auf jenem Stationsposten, Herr v. Bülow (auch Leue mußte wegen perniziösen Fiebers Ostafrika verlassen) nur mit Hilfe eines im Hafen von Daressalam stationierten Kriegsschiffes und einer in das Stationsgebäude gelegten Marinebesatzung halten konnten.
Ende Dezember 1888 und Januar 1889 erfolgten Angriffe seitens der Rebellen, die ihre sämtlichen Kräfte dicht bei Daressalam vereinigt hatten und diesen Ort selbst unsicher machten. Die Angriffe wurden stets durch die Geschosse des Kriegsschiffes — es lagen abwechselnd Möwe, Sophie, Carola dort vor Anker — und die wenigen wohlgedrillten Askaris unter Herrn von Bülow, zurückgeschlagen.





























