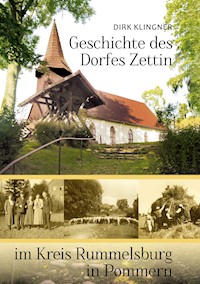
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zettin im Kreis Rummelsburg ist ein kleines, verschlafenes Dorf wie viele andere in Pommern. Doch auch hier finden sich Spuren der großen Ereignisse der Geschichte: Die Zettiner Puttkamer standen im Dienst der pommerschen Herzöge und Bischöfe. Pfarrer Palis kam in Kontakt mit Adolph von Thadden-Trieglaff, dem bedeutenden Vertreter der Erweckungsbewegung. Der letzte Pastor des Kirchspiels Wolfgang Marzahn war ein Schüler von Dietrich Bonhoeffer. Zettiner jüdischer Herkunft wurden im KZ ermordet. Trotz aller Bescheidenheit und aller Verbindungen zur großen Geschichte war Zettin für die dort lebenden Menschen jedoch vor allem eines: geliebte Heimat. Diesen Menschen und der Geschichte ihres Dorfes will das vorliegende Buch ein Denkmal setzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meiner Tante Rita Tolksdorf, geborene Prange, geboren am 2. Juni 1941 in Zettin, zum 80. Geburtstag.
Rita, Irmgard, Vera und Otto Prange vor ihrem Haus in Zettin, ca. 1943.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Zettin: Lage, Nachbargemeinden und Ortsteile
Zettin: Der Name des Dorfes
Zettiner Flurnamen
Zettin auf alten Landkarten
Vorgeschichte
Die Anfänge im Mittelalter
Frühe Neuzeit
Eigentümer und Bewohner Zettins im 17. und 18. Jahrhundert
Meliorationen und Maulbeerbaumzucht – Kameralismus zur Zeit Friedrichs des Großen und seiner Nachfolger
Neuzeit
Das Ende des deutschen Dorfes Zettin
von Hans-Ulrich Kuchenbäcker
Sicher auf dem Friedhof
Volkskundliches
Landwirtschaft
Statistische Angaben
Die Familie von Puttkamer als Besitzer des Rittergutes Zettin
Das Rittergut
Das Kirchspiel Zettin
Die Pfarrer des Kirchspiels Zettin
Die Kirche zu Zettin
Das Pfarrhaus
Religiöse Minderheiten: Altlutheraner, Katholiken und Juden in Zettin
Die Schule
Die Einwohner von Zettin
Die Friedhöfe von Zettin
von Willi Palm
Verkehrswesen und Post
Anhang
Predigt zum Christfest 1943 für die eigene Gemeinde – Zettin, Kreis Rummelsburg – aus dem Felde geschrieben von Pastor Wolfgang Marzahn
Erzählungen aus Zettin
Quellen- und Literaturverzeichnis
Abbildungsnachweis
Vorwort
Zettin im Kreis Rummelsburg ist ein kleines, verschlafenes Dorf wie viele hundert andere in Pommern. Es liegt noch immer idyllisch abseits der großen Verkehrswege und es hat bis ins 20. Jahrhundert gedauert, bis es durch eine befestigte Straße erschlossen wurde. Die größeren Straßen führten und führen noch immer daran vorbei. Auch die Eisenbahn, vor mittlerweile 30 Jahren eingestellt, tangierte das Gemeindegebiet nur mit einer Nebenstrecke. Die Böden waren und sind nicht von besonderer Qualität und ermöglichten nur ein bescheidenes Einkommen. Mitten im Ort erhebt sich bis heute auf einem Hügel die Kirche. Auch die Schule blieb erhalten, wenn auch heute der Unterricht im Nachbardorf Treblin stattfindet. Einst prägte auch ein großes Gut den Ort. Die Wirtschaftsgebäude blieben erhalten, das Herrenhaus verfiel in der Zeit nach Ende des Zweiten Weltkrieges.
Trotz aller Bescheidenheit war Zettin wie viele andere Dörfer und Städte für die dort lebenden Menschen jedoch vor allem eines: geliebte Heimat. Diesen Menschen und der Geschichte ihres Dorfes will das vorliegende Buch ein Denkmal setzen.
Als ich mich vor einigen Jahren intensiver mit dem Heimatdorf meiner Mutter und meiner Tante zu beschäftigen begann, gab es zunächst nur spärliche Informationen. Hier ein paar Zeilen, da einige statistische Angaben. Doch je länger die Beschäftigung dauerte, je mehr ich suchte und fragte, um so mehr konnte ich finden. Jetzt ist es an der Zeit, alles zu einem Buch zusammenzustellen in dem Wissen, das es nur einen vorläufigen Stand darstellt und in der Hoffnung, dass weitere Mosaiksteine das Bild vervollständigen werden. Schon jetzt wird deutlich, das Zettin kein so unbedeutender Ort war. Auch von diesem kleinen hinterpommerschen Dorf lassen sich Verbindungen zu den großen Ereignissen der Geschichte ziehen. Die Zettiner Puttkamer des späten 15. und des 16. Jahrhunderts standen im Dienst der pommerschen Herzöge und der Kamminer Bischöfe. Der in Waldow geborene und einige Jahre in Zettin aufgewachsene Pfarrerssohn Johannes Lassenius wurde Theologieprofessor in Kopenhagen. Pfarrer Palis hatte im frühen 19. Jahrhundert Kontakt mit Adolph von Thadden in Trieglaff und lenkte die Erweckungsbewegung in Zettin in kirchliche Bahnen. Der letzte Pastor des Kirchspiels Wolfgang Marzahn besuchte das Predigerseminar bei Dietrich Bonhoeffer, dem wichtigsten Theologen des evangelischen Widerstandes gegen das Dritte Reich. Und mindestens vier Zettiner jüdischer Herkunft wurden in Ghettos und Konzentrationslagern ermordet. Schließlich kam der von Deutschland entfesselte Krieg zurück nach Deutschland und zerstreute die Zettiner wie viele Millionen Ostdeutsche in alle Winde. Das abseits gelegene Zettin lag nicht abseits der Geschichte.
Bedanken möchte ich mich bei allen, die zum Entstehen dieses Buches beigetragen haben. Bei meiner Großmutter, meiner Mutter und meiner Tante, die durch ihre Erzählungen schon früh mein Interesse für die verlorene Heimat geweckt haben. Die Mitglieder des Heimatkreis Rummelsburg e. V. haben gerne meine Fragen beantwortet und Material zur Verfügung gestellt. Hier gilt mein Dank dem Vorsitzenden Nikolaus von Puttkamer und dem Ehrenvorsitzenden Hans-Ulrich Kuchenbäcker, Hans-Jürgen Knaack und Jürgen Lux. Karl Friedrich Schwirz hat immer wieder uneigennützig Fotos, historische Archivmaterialien und Standesamtsunterlagen bereitgestellt. Ein besonderer Dank geht an Regine Marzahn-Blöcher und ihre Geschwister, die Kinder des letzten Zettiner Pastors. Sie machten mich mit dem künstlerischen Werk ihres Vaters bekannt. Und auf einem Dachboden in Hildesheim kam ein Fotoalbum von Wolfgang Marzahn zum Vorschein, dessen Bilder dieses Buch wesentlich bereichern. Auch Pastor Christian Baethge, Sohn des vorletzten Zettiner Pfarrers Heinz Baethge, konnte mit einigen Fotos und Informationen zum Gelingen beitragen. Ulrike Reinfeld vom Landeskirchlichen Archiv in Greifswald stellte mir aufschlussreiche Fragebögen von Pfarrer Thomas zur Verfügung, die wesentliche Einblicke in das Leben im gesamten Kirchspiel und im Dorf geben. Heidelore Sünkel und Anita Schmidt, beide geb. Fallisch, stellten Fotos bereit und standen mir Rede und Antwort. Mit Lieselotte Schott, Tochter des Lehrers Friedrich Pallas, führte ich zwei aufschlussreiche Telefongespräche. Barbara und Harald Pinl stellten mir ihre familiengeschichtlichen Publikationen und Fotos der beiden Pastoren Meyer zur Verfügung. Robert Kupisiński vom „Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku“ (Mittelpommersches Museum in Stolp) beschaffte die Fotos des Lutherbildes aus der Zettiner Kirche, das als echte Entdeckung gelten kann. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank.
Ganz besonders danken möchte ich meiner Frau Barbara. Sie hat mich auf allen drei bisherigen Reisen nach Zettin begleitet und wir teilen das Interesse für Geschichte. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Mit ihr konnte ich alles diskutieren und sie hat alle Texte gelesen, korrigiert und verbessert. Vor allem aber hat sie es immer mit Liebe ertragen, wenn ich mich über längere Zeit fast immer nur mit Zettin, dem Kreis Rummelsburg und Pommern beschäftigte. Vielen herzlichen Dank für alle Liebe, Langmut und alles Verständnis.
Leipzig, am 2. Juni 2021
Dirk Klingner
Zettin: Lage, Nachbargemeinden und Ortsteile
Zettin liegt im Nordosten des ehemaligen Kreises Rummelsburg in Hinterpommern. Etwa 27 Kilometer Luftlinie entfernt in südöstlicher Richtung liegt die ehemalige Kreisstadt Rummelsburg. Die Entfernung nach dem nördlich von Zettin gelegenen Stolp beträgt ebenfalls ca. 27 Kilometer. Nächstgelegene Stadt ist die heutige Zettiner Kreisstadt Bütow, rund 23 Kilometer entfernt in südöstlicher Richtung gelegen. Etwa 35 Kilometer beträgt die Entfernung bis zum nordwestlich von Zettin gelegenen Schlawe.
Im Norden grenzt Zettin an die Nachbargemeinde Starkow, im Osten an Neu Kolziglow. Beide Dörfer liegen jeweils etwa drei Kilometer entfernt. Das nur knapp zwei Kilometer in Sichtweite entfernt gelegene Poberow grenzt im Süden an Zettin. Durch ein Waldgebiet getrennt von Zettin sind die jeweils etwa vier Kilometer entfernt liegenden Dörfer Treblin im Südwesten und Sellin im Nordwesten.
Karte 1: Ausschnitt aus der Karte "Kreis Rummelsburg", erschienen im Jahr 1915.
Abb. 1: Blick von Zettin über die Wiesen am Ripsbach in Richtung Poberow, Aufnahme aus dem Jahr 2018.
Von Norden aus dem Kreis Stolp kommend, fließt der Ripsbach durch das Dorf in südlicher Richtung weiter nach Poberow. Im Süden des Dorfes bildet der Bachlauf in etwa die Grenze zwischen Zettin und Poberow. Etwa am südlichsten Zipfel der Zettiner Flur mündet der Ripsbach in den Krummbach, der sich wiederum bei Wussowke mit der Wipper vereinigt.
Zettin liegt in hügeliger Landschaft. Etwa 35 Meter betragen die Höhenunterschiede innerhalb der Dorfgrenzen. Der niedrigste Punkt findet sich mit 87,6 Metern über NN im Kranichmoor an der Grenze zu Treblin. Unweit des ehemaligen Vorwerks Theresenhof an der östlichen Gemeindegrenze mit Neu Kolziglow befindet sich die mit 122,9 Metern über NN höchste Erhebung auf Zettiner Flur.
Zettin: Der Name des Dorfes
Im Gesamthand-Lehnbrief der Herzöge Georg I. (1493–1531) und Barnim IX. (1501–1573) für das Geschlecht Puttkamer aus dem Jahr 1527 wird Zettin als erstes der Lehnsdörfer genannt, hier in den Formen Sattin und Cztettin .1 Auch andere Orte, wie z. B. Reddies, erscheinen in zwei Schreibweisen. Die Form Sattin findet sich auch auf den frühen Landkarten, zuletzt um 1760. Etwas verändert in der Form Czettin erscheint der Name des Dorfes im Gesamthand-Lehnbrief der Herzöge Johann Friedrich (1542–1600) und Barnim X. (1549–1603) für die Puttkamer aus dem Jahr 1575.2
Der Ortsname Zettin wird nach Angaben des Slawisten Friedrich Lorentz (1870–1937)3 im Jahr 1545 in seiner heutigen Form Zettin erstmals urkundlich bezeugt. Die Grundform Cetynjь deutet Lorentz als „possessives Adjektiv zum Personennamen Cetynõ“ , d. h. der Name des Dorfes leitet sich von einer Person ab, die das Dorf gründete oder im Besitz hatte. Als weiteres Beispiel wird der tschechische Ortsname Cetyně aufgeführt4, ein Dorf im Bezirk Příbram in der Mittelböhmischen Region der Tschechischen Republik.
Ein heute 33 Einwohner zählender Ortsteil der Gemeinde Wernberg in Kärnten führt als einziger Ort im deutschen Sprachraum ebenfalls den Namen Zettin. Wernberg liegt am Rand des gemischten Sprachgebietes, im Slowenischen wird Zettin als Cetinje bezeichnet. Diesen Namen führt auch die ehemalige Hauptstadt des Balkanstaates Montenegro, gelegen im Tal der Cetina. Ein Fluss dieses Namens fließt auch durch Kroatien und mündet östlich von Split in die Adria.
1 Puttkamer 1984, Dokumentenanhang, S. 740 u. 742.
2 Ebd., S. 743f.
3 Lorentz 1964, S. 145.
4 Lorentz führt hier an: Franz von Miklosich, Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen im Slavischen. Wien, Denkschriften der Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Wien 1865, S. 1–74.
Zettiner Flurnamen
Mit einem Flurnamen wird ein kleinräumiger Teil der Landschaft (Flur) namentlich bezeichnet. Flurnamen teilen das Gelände ein und tragen zur Orientierung und Identifizierung bei. Mit Flurnamen werden kleine und kleinste geografischen Einheiten bezeichnet, z. B. Berge, Gipfel und Täler, Wälder, Weiden, Wiesen, Äcker und Auen, Wege, Gewanne und Fluren.
Flurnamen sind geografische Namen, die von den Einheimischen geprägt und oft ohne schriftliche Fixierung im örtlichen Sprachgebrauch weitergegeben wurden. Flurnamen besitzen eine große Vielfalt und einen vielseitigen Zeugniswert. Der in ihnen vorhandene appellativische Wortschatz ist reicher und differenzierter als z. B. bei Siedlungsnamen.
Flurnamen sind vor allem Gebrauchsnamen. Meist kennt man sie nur innerhalb einer Stadt oder eines Dorfes. Nur durch die eindeutige Benennung mit Flurnamen können Besitzverhältnisse geregelt werden. Flurnamen erleichtern die Identifizierung der Lage eines Flurstückes innerhalb einer Gemarkung.
Aus Zettin sind folgende Flurnamen bekannt:5
Abb. 2: Der Pijal(en)-Teich, Aufnahme aus dem Jahr 2016.
Auf dem Messtischblatt Nr. 1768 Zuckers sind noch weitere Namen zu entdecken:
Kranichmoor
ein feuchtes Waldstück im äußersten Westen Zettins, an der Grenze zu Treblin gelegen
Ochsenmoor
ein Stück feuchtes Wald- und Wiesenland am Ripsbach im Norden Zettins, südlich der Bahnlinie Zollbrück–Bütow
Pijal-Berg
eine kleine Erhebung kurz hinter dem Dorfausgang Richtung Starkow, auf der linken Seite an der Straße gelegen
Pijal(en)-Teich
kleiner Teich unterhalb des Pijal-Berges, links der Straße nach Starkow gelegen
7
; auch als „Piejola“ bezeichnet
8
Seekenmoor
ein Stück feuchtes Wald- und Wiesenland südlich des Theresenhofes, unmittelbar an der Flurgrenze zu Neu Kolziglow und Poberow gelegen
Sockelbach
kleiner Wasserlauf in den Wiesen südlich des vom Friedhof in Richtung Westen führenden, von einigen Gehöften gesäumten Weges
Sockelfichten
kleines Waldstück südlich des Sockelbaches
Der „Todsch“ in Zettin9von Heidelore Sünkel
Diese Quelle war bei den Zettinern sehr, sehr beliebt. Wenn die Landarbeiter zur Feldarbeit gingen oder fuhren, wurde noch vorher die Feldflasche oder ein anderes Behältnis mit dem wunderbaren Wasser aus der Quelle unterhalb des Kirchberges gefüllt. Und so verhielt es sich auch beim Heimkommen vom Feld – vor dem Heimweg wurde noch einmal Wasser aus der Quelle geschöpft. Wir Zettiner sprachen von dieser Quelle nur immer als vom „Todsch“. Und auch ich habe bei meinen drei Besuchen in der Heimat aus dieser Quelle – eben diesem „Todsch“ – getrunken. Ein gutes klares kaltes Wasser – und dann gehen die Gedanken zurück zu unseren Vorfahren, die genau wie wir an gleicher Stelle ihren Durst löschten.
Ein Flurstück oder ein Feld am südöstlichen Ende Zettins in der Nähe des Ripsbaches, nahe an Poberow, wurde als „Grand“ bezeichnet. Besitzer Koball fand beim Pflügen „auf dem Grand“ im Jahre 1923 Urnenscherben und Knochenreste.10 Bis auf den „Grand“ und den „Totsch“ und der auf dem
Abb. 3: Spielende Kinder am „Totsch“, der Dorfquelle, Aufnahme aus den Jahren 1935/36.
Abb. 4: Am Ripsbach in Zettin, Aufname aus dem Jahr 2016.
Messtischblatt verzeichneten sind bis jetzt keine Lokalisierungen der Flurnamen möglich.
5 Robert Holsten, Von den Flurnamen. In: Kreis Rummelsburg 1938/1979, S. 427– 433, hier S. 428f. und 431.
6 Hans-Friedrich Rosenfeld, Franz Jost, Hinterpommersches Wörterbuch der Mundart von Gross Garde (Kreis Stolp). Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern. Reihe 4, Quellen zur pommerschen Geschichte, Bd. 11. Köln, Weimar, Wien 1993, S. XV.
7 Vgl. auch das Foto von Willi Palm vom 9. Juni 2002 in: Rummelsburger Land 10. Jg. (2003), Nr. 3, S. 2.
8 Vgl. S. 73.
9 Vgl. Rummelsburger Land 27. Jg. (2020), Nr. 3, S. 17.
10 Vgl. Anmerkung 19, S. 37.
Zettin auf alten Landkarten
Erstmals erscheint Zettin, noch unter der Bezeichnung „Sattin“, auf der bekannten „Lubinschen Karte“. Das Kartenwerk des Rostocker Mathematikers und Geographen Eilhard Lubinus (1565–1621) entstand zwischen 1610 und 1618 im Auftrag des Herzogs Philipp II. von Pommern (1573–1618) als erste vollständige Karte des Herzogtums Pommern. Bis ins 18. Jahrhundert war die Lubinsche Karte die Grundlage aller gedruckten pommerschen Landkarten.
Karte 2: Ausschnitt aus der Lubinschen Karte, erstmals 1618 gedruckt.
Mehrmals durchreiste Lubinus Pommern, besuchte mindestens 152 Orte und fertigte viele Notizen und Zeichnungen an. Ende 1617 begannen die Kupfersticharbeiten, die Nikolaus Geelkercken ausführte. Der Amsterdamer Verleger und Kartograph Jodocus II Hondius († 1629) gab die Landkarte heraus, die im Maßstab 1:235.000 angelegt wurde. Insgesamt bestand das Kartenbild aus 12 Kupferplatten. Zusammengesetzt aus den Einzelblättern hat die Karte eine Größe von 1,25 x 2,21 m.
Auf der detaillierten Karte sind mehr als 2000 Städte und Dörfer, Wälder, Flüsse, Sümpfe und Hügel mit für die damalige Zeit erstaunlicher Genauigkeit verzeichnet.
Auf dem Ausschnitt erkennt man westlich und östlich von Zettin zwei große Waldgebiete. Eingezeichnet sind die Nachbardörfer Poberow, Treblin, Sellin, Starkow, Versin und Reddies. Die Schreibweisen der Orte unterscheiden sich nur wenig oder gar nicht von den späteren Varianten. Nur in Richtung Alt und Neu Kolziglow wird die Karte etwas unübersichtlich, vor allem was den Flusslauf der Stolpe anbelangt.
Etwa um 1760 erschienen in Augsburg sechs Karten von Pommern unter dem Titel „Ducatus Pomeraniae citerioris et ulterioris principatibus, comitatibus urbibus suis definitae nova et ampla descriptio geographica“. Das 52 x 61 cm große Blatt 3 zeigt im Maßstab ca. 1:250.000 Hinterpommern von Köslin und Rügenwalde an in Richtung Osten. Deutlich erkennt man noch immer, nach fast 140 Jahren, das Vorbild der Lubinschen Karte. Sowohl die Schreibweise der Orte, die Verteilung der Waldflächen und Hügel als auch die Bach- und Flußläufe unterscheiden sich nicht von Lubinus. Zettin wird weiterhin als „Sattin“ bezeichnet. Die turmartigen Symbole in den Nachbardörfern Poberow, Treblin und Versin scheinen auf größere Herrenhäuser hinzuweisen.
Karte 3: Ausschnitt aus der Karte „Ducatus Pomeraniae citerioris et ulterioris principatibus, comitatibus urbibus suis definitae nova et ampla descriptio geographica“, Augsburg um 1760.
Karte 4: Ausschnitt aus der Schmettauschen Karte, um 1780.
Um 1780 erscheint eine deutlich detailliertere und genauere Karte. Der preußische Generalleutnant, Topograph und Kartograph Friedrich Wilhelm Karl von Schmettau (1743–1806) hatte ab 1767 damit begonnen, gegen die Bedenken König Friedrichs II. (1712–1786) systematisch das gesamte preußische Staatsgebiet östlich der Weser kartographisch zu erfassen. Insgesamt entstanden 270 Kartenblätter der Schmettauschen Karte in den Abmessungen 97 × 64 cm im Maßstab 1:50.000. Die Karten erschienen Anfang der 1960er Jahre im Druck.11
Deutlich zu erkennen sind die einzelnen Häuser und Gehöfte sowie die Kirche von Zettin. Eingezeichnet sind das Vorwerk Augusthof, die Wege zu den Nachbardörfern, der sich in der Mitte des Dorfes zum Teich erweiternde Ripsbach sowie Wiesen und Wälder. Zettin erstreckt sich beiderseits des Bachlaufes. Etwa 50 Gebäude sind zu erkennen, vermutlich sowohl Wohnhäuser als auch Ställe und Scheunen. Dafür spricht die häufige Anordnung von zwei Gebäuden hintereinander. Entfernungen und Proportionen stimmen mit der Realität schon ziemlich genau überein. Anhand der Schmettauschen Karte bekommt man einen recht guten Eindruck von der topographischen Situation.
Der Architekt, Stadt- und Regionalplaner David Gilly (1748–1808) hatte bereits im Jahr 1760 damit begonnen, Landkarten zu zeichnen. Seine „Karte des königl. preuss. Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern“ erschien 1789. Gestochen wurde die Karte von Daniel Friedrich Sotzmann (1754–1840), der als Begründer der gewerblichen Kartographie in Berlin angesehen wird. Auf der im Maßstab 1:175.000 erarbeiteten Landkarte erkennt man die bebauten Flächen der Dörfer und viele Wege. Kirchen sind nicht verzeichnet, dafür die Mühlen. In Zettin erkennt man eine Mühle am Ripsbach. Zum Betrieb der Mühle hat man vermutlich den Bach zu einem kleinen Teich angestaut.
Karte 5: Ausschnitt aus der "Karte des königl. preuss. Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern" von David Gilly, 1789.
Nur wenige Jahre später erschien die deutlich einfacher gestaltete „Charte von dem Herzogthum Pommern, sowohl schwedisch- als preussischen Theils“. Franz Ludwig Güssefeld (1744–1808), einer der angesehensten und produktivsten Kartographen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, erstellte die 1792 in Nürnberg gedruckte Karte auf zwei Blättern (55 x 93 cm) im Maßstab 1:390.000. Auf dieser Karte sind die Kirchdörfer durch kleine Türme neben dem Ortssymbol markiert. Auch Mühlen sind verzeichnet. Abbauten und Wohnplätze unterscheiden sich durch ein eckiges Symbol von den Dörfern. Etwas unstimmig ist der Verlauf der Bäche. Wahrscheinlich sind nur einige größere Waldflächen in Auswahl wiedergegeben, da zum Beispiel die große Waldfläche zwischen Zettin und Treblin völlig fehlt.
Karte 6: Ausschnitt aus der "Charte von dem Herzogthum Pommern, sowohl schwedisch- als preussischen Theils" von Franz Ludwig Güssefeld, 1792.
Zwischen 1789 und 1806 wurde der Atlas „Schauplatz der fünf Theile der Welt“ herausgegeben. Allerdings behandelt der österreichische Verleger, Kartograph und Schriftsteller Franz Johann Joseph von Reilly (1766–1820) entgegen der Ankündigung des Titels nur Europa, das aber auf immerhin 830 Blättern. Karte Nr. 337 zeigt „Des Herzogthums Hinter Pommern Schlawischer und Rummelsburgischer Kreis“ im Maßstab von ca. 1:300.000 auf einem 25 x 28 cm großen Blatt. Vermutlich entstand das Kartenblatt 1795 oder 1796.12 Besonders markiert sind die Grenzen der Kreise. Wieder sind die Kirchdörfer herausgehoben. Flüsse und Bäche, Seen und Waldstücke sind verzeichnet. Einige Dörfer und Straßen jedoch fehlen. Der Atlas möchte jedoch nicht alle Details abbilden. Aber hier erscheinen vor etwa 225 Jahren viele Dörfer des Kreises Rummelsburg wohl erstmals in einem Kartenwerk, das den gesamten europäischen Kontinent abbildet.
Karte 7:"Des Herzogthums Hinter Pommern Schlawischer und Rummelsburgischer Kreis" von Franz Johann Joseph von Reilly, ca. um 1795/96.
Karte 8: Ausschnitt aus "Des Herzogthums Hinter Pommern Schlawischer und Rummelsburgischer Kreis" von Franz Johann Joseph von Reilly, ca. um 1795/96.
Im „Historischen Atlas von Pommern“ erschien im Jahr 1935 eine Kreiskarte von Pommern in drei Teilen, die den Stand der Kreiseinteilung und die Kirchspielzugehörigkeit in den Jahren 1817/18 dokumentiert.13 Die Kreisgrenzen unterscheiden sich deutlich von den heutigen, so gehören Teile des späteren Kreisgebietes um Wussow und Varzin noch zum Kreis Schlawe. Nördlich und westlich des eigentlichen Kreisgebietes existierten einige Rummelsburger Exklaven, so um Quackenburg und Jannewitz. Deutlich erkennen kann man an den Linien die den Kirchspielen zugeordneten Dörfer. Im Süden reicht das Kirchspiel Zettin bis nach Franzdorf und Carlswalde, im Norden bis Darsekow und zum Vorwerk Muddschiddel. Treblin ist als Tochterkirche von Zettin gekennzeichnet.
Karte 9: Pommersche Kreiskarte. Die alten und neuen pommerschen Kreise nach dem Stande von 1817/18. Berlin 1935, Ausschnitt.
Karte 10: Ausschnitt aus der Karte "Königlich Preussische Provinz Pommern / entworfen und gezeichnet von C. F. Weiland. L. Beyer sc."
In Weimar erschien im Jahr 1834 im „Geographischen Institut“ im Maßstab von ca. 1:630.000 die 60 x 43 cm messende Karte „Königlich Preussische Provinz Pommern“, gezeichnet von Carl Ferdinand Weiland (1782– 1847) und Leonhard Beyer. Deutlich erkennbar ist in der Übersichtskarte eine in der Legende als „Poststraße“ ausgewiesene Verbindung, die von Stolp kommend über Zuckers, Sellin und Treblin nach Kremerbruch führt und dort Anschluss an die Poststraße Rummelsburg–Bütow hat. Von Bartin kommend führt eine „Landstraße“ über Sellin, Starkow, Neu Kolziglow und Reinfeld nach Bütow. Diese Straßen waren aber noch keine befestigten oder ausgebauten Straßen oder Chausseen, sondern im Frühjahr, Herbst und Winter kaum passierbare Wege.14 Zettin liegt noch abseits dieser Wege und ist, wie auch Treblin und Alt Kolziglow, als Kirchdorf gekennzeichnet. In Zuckers und Kremerbruch befanden sich Poststationen, gekennzeichnet durch ein Posthorn. Ansonsten sind auf der Karte die Kreisgrenzen farbig hervorgehoben und man erkennt den Verlauf der Flüsse und größeren Bäche sowie einzelne Seen.
Der deutsche Militärkartograph Daniel Gottlob Reymann (1759–1837) publizierte ab 1806 die erste vollständige topographische Landkarte für ganz Deutschland im Maßstab 1:200.000. In der preußischen Armee lobte man die Detailtreue und Genauigkeit der Karten. Die einzelnen Blätter der immer wieder neu aufgelegten Karten sind 34 x 23 cm groß. Mit Bergstrichen erfolgt die Darstellung der Geländestruktur. Höhen, Flüsse und Ortschaften, selbst kleinste Dörfer sind im Kartenbild festgehalten. Auch Kirchen und Herrenhäuser sowie Mühlen sind zu erkennen.
Karte 11: Ausschnitt aus „G. D. Reymann’s topographischer Special-Karte von Central Europa Nr. 16 Stolp“, 1850.
Auf Blatt Nr. 16 (Stolp) ist der nördliche Teil des Kreises Rummelsburg bis etwa in die Höhe von Treten dargestellt. Im Umfeld von Zettin fallen zwei Fehler auf: So wird der Ripsbach als „Tiefer Graben“ bezeichnet, der Krummbach als „Melisse-Fluss“. Auch fließt der Krummbach nicht weiter Richtung Treblin, sondern geht in einen Weg in Richtung Augusthof über. Besser ausgebaute Wege führen bereits von Zuckers nach Alt Kolziglow und Treblin. Zettin mit Kirche und Gutshaus sowie den Vorwerken Theresenhof und Augusthof liegt noch abseits der Straßen.
Im Jahr 1915 erschien im Oskar Eulitz Verlag in Lissa (Posen) eine Karte des Kreises Rummelsburg im Maßstab 1:100.000 (siehe Karte 1, S. 13). Man erkennt Höhenzüge, Waldgebiete und den Lauf von Flüssen und Bächen. Nördlich von Zettin führt die Bahnstrecke von Zollbrück nach Bütow vorbei. Noch immer ist Zettin nur über „Verbindungswege“, so werden sie in der Legende bezeichnet, zu erreichen. Lediglich innerhalb des Dorfes scheint es eine etwas bessere Straße zu geben. Die nächste Chaussee endet im Nachbarort Poberow und verbindet diesen mit Treblin und damit mit der Chaussee Stolp–Rummelsburg. Die Chaussee nach Poberow war gerade erst fertiggestellt worden (in den Jahren 1911 und 1912). Kurz nach Drucklegung der Karte führte man die Straßenbauarbeiten in den Jahren 1916 und 1917 fort. Nun führte die Chaussee von Poberow weiter über Zettin und den Bahnhof Neu Kolziglow bis nach Alt Kolziglow.15
Das Königreich Preußen führte zwischen 1877 und 1915 eine erneute Landesaufnahme durch. Höhere Ansprüche an die Genauigkeit und mittlerweile deutlich verbesserte Darstellungsmöglichkeiten machten diese Neuaufnahme erforderlich. Über 3000 Kartenblätter im Maßstab 1:25.000 wurden angefertigt. Diese werden als Messtischblatt bezeichnet. Ein 4 cm breites Gitter überzieht die Karte, wobei 4 cm auf der Karte 1 km in der Natur entsprechen. An Genauigkeit sind die Messtischblätter kaum noch zu überbieten. Genaue Höhenangaben, Fließrichtungen der Gewässer, Angaben zum Bewuchs und genaue Einzeichnung der Gebäude machen den Wert der Karte aus.
Die Zettiner Flur verteilt sich auf zwei Karten. Das Messtischblatt 1768 (Zuckers) zeigt die Ortslage Zettin und den gesamten sich westlich, südlich und nördlich davon erstreckenden Bereich. Auf dem Messtischblatt 1769 (Alt Kolziglow) ist der östliche und nordöstliche Teil der Zettiner Flur mit dem Vorwerk Theresenhof abgebildet. Die letzten Vorkriegsausgaben der Messtischblätter erschienen 1939 für das Blatt 1768 (Zuckers) in dreifarbiger Ausführung und 1942 für das Blatt 1769 (Alt Kolziglow) in einfarbigem Druck.
Karte 12: Ausschnitt Zettin aus dem Messtischblatt Nr. 1768 Zuckers.
Karte 13: Ausschnitt Zettin aus dem Messtischblatt Nr. 1769 Alt Kolziglow.
11 Historischer Atlas von Pommern, Sonderreihe – Schmettausche Karten von Pommern um 1780. Hrsg. von Franz Engel. Köln, 1963.
12 Vgl. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reilly_337.jpg?uselang=de.
13 Historischer Atlas von Pommern. Hrsg. von der Landesgeschichtlichen Forschungsstelle der Provinz Pommern. 1. Abteilung. Pommersche Kreiskarte. Die alten und neuen pommerschen Kreise nach dem Stande von 1817/18. 3 Blätter. Bearbeitet von Fritz Curschmann und Ernst Rubow. Maßstab 1:350.000. Berlin 1935, Blatt 2.
14 Bruno Lange, Straßenwesen. In: Kreis Rummelsburg 1938/1979, S. 400–409, hier S. 400.
15 Ebd., S. 408.
Vorgeschichte
Vorgeschichtliche Funde auf Zettiner Flur weisen auf eine frühe Besiedlung der Gegend hin.16 In die jüngere bzw. späte Bronzezeit (ca. 1300–800 v. Chr.) werden elf Steinkistengräber mit Urnen und Beigaben datiert17. Allerdings gibt es auch spätere Ansetzungen und man nimmt an, dass in Ostpommern „die Steinkistengräberkultur vielleicht noch bis ins 2. Jahrhundert vor Chr. Geb. hinabreicht“.18 Diese neue Bestattungsform verbreitete sich in Pommern von Osten her bis zur Rega. Datierungen der Gräber werden anhand bronzener Grabbeigaben vorgenommen. Die Steinkistengräber umfassen mehrere Kammern und wurden flach in den Boden eingesenkt. Sie lassen sich verhältnismäßig einfach durch Abnahme der Deckplatte oder einer Seitenplatte an der Schmalseite für spätere Nachbelegungen öffnen. Die Bestattung in den Grabkammern erfolgte in Form von Urnen. In Zettin wurden auch leere Kammern gefunden. Gräber deuten auf eine dauerhafte Besiedlung hin.
Abb. 5: Die Kartenskizze zeigt mit rot markierten Dreiecken die Stellen an, an denen die vorgeschichtlichen Gräber gefunden wurden.
Abb. 6: Grab Nr. 1: Steinkiste, die teilweise aus gehauenem Stein und teilweise aus rauen Feldsteinen besteht und den Eindruck einer sehr unregelmäßigen Struktur erweckt. Sie besteht aus drei Kammern. Längsachse der Grabkammer von Nord nach Süd. Die Breite in derselben Richtung beträgt 1,33 m, in Ost-West-Richtung 27 cm. Die Südkammer enthält zwei Urnen und zwei Gefäße. Eines der Gefäße ist beschädigt, das andere ist intakt. Die mittlere Kammer ist leer.
Abb. 7: Grab Nr. 4: Eine Steinkiste in Nord-Süd-Richtung aus Kalksteinplatten. Der Deckel besteht aus grob behauenem Feldstein. Die Maße der Grabkammer betragen 50 x 38 cm. Der Inhalt besteht aus einer Urne. Der Boden ist nicht gehärtet. Die Urne wird von kleinen Steinen auf dem Boden getragen.
Auf der Facebook-Seite „Zettin–Cetyń“ sind Unterlagen und Fotos der archäologischen Funde aus Zettin zu sehen.19 Lageskizzen, Fotos und Beschreibungen geben ein genaues Bild von den Funden. Die Unterlagen stammen aus deutscher Zeit. Leider fehlen Angaben zur Herkunft. Dazu gibt es polnische Beschreibungen mit detaillierten Informationen, die vermutlich ebenfalls aus den Unterlagen entnommen wurden. Es folgt die Übersetzung des Textes und der Bildunterschriften unter die Lagepläne und Fotos: „Aus den archäologischen Untersuchungen, die im Jahr 1933 unter der Aufsicht von Gerhard Giesen durchgeführt wurden, erfahren wir, daß das Gebiet von Zettin in der Stein- und Bronzezeit bereits bewohnt war. Die Dokumentation zeigt, daß ursprünglich auf beiden Seiten der Straße von Zettin nach Starkow ein alter Kiefernwald wuchs, der im Jahr 1926 gefällt wurde. Bei der Abholzung wurden elf Steingräber mit bronzezeitlichen Urnen entdeckt. Archäologische Untersuchungen wurden jedoch erst nach sieben Jahren durchgeführt. Dann stellte sich heraus, daß die meisten Gräber bereits leer waren. Es wurden nur zwei Gefäße und ein Bronzering gefunden.“ Der Inhalt der Gräber befand sich im Museum Rummelsburg.20
Zeitlich unbestimmt bleibt der Fund eines Bernsteinringes aus Zettin.21
In einer Notiz des Rummelsburger Lehrers Gerhard Giesen aus dem Jahr 1936 werden erwähnt: Urnenscherben und Knochenreste, ein Steinhammer und ein im Ripsbach gefundener Netzsenker, dort, „wo früher der Mühlenteich war“22. Der Netzsenker deutet auf Fischfang im Ripsbach hin.
Diese Funde konnten nicht datiert werden, ebenso wie 19 Flachhügelgräber, die sich vermutlich rechts der Straße nach Starkow befanden.23
Weiter erwähnt die Facebook-Seite „Zettin–Cetyń“: „In einem Bericht aus dem Jahr 1935 schreibt Gerhard Giesen über die Schulsammlung des Zettiner Lehrers Friedrich Pallas, die eine Steinaxt und ein Steinmesser enthält, die um 1928 in Zettin gefunden wurden.“ Vermutlich handelt es sich dabei um das „Steinbeil mit angefangener Bohrung“ und das „Steinmesser“, das sich in Privatbesitz befand.24 Den Angaben bei Eggers/Giesen zufolge dürften die Funde der jüngeren Steinzeit (ca. 3000 v. Chr. – 2000 v. Chr.) angehören.
Abb. 8: Kartenskizze mit dem Fundort eines Bernsteinrings und Skizze des Rings, der im März 1936 von Frau Berta Raddatz, geb. Wehnert beim Umgraben ihres Gartens gegenüber dem Friedhof gefunden wurde.
16 Hans Jürgen Eggers, Gerhard Giesen, Die Vorgeschichte. In: Kreis Rummelsburg 1938/1979, S. 31–46, hier S. 46.
17 Sliwa 1974, S. 32–60. Hier S. 60. Fotos ohne nähere Beschreibung wurden abgedruckt in: Ostpommersche Heimat 1933, Nr. 17, S. 3.
18 Eggers, Giesen, wie Anm. 16, S. 36.
19https://www.facebook.com/Zettin-Cety%C5%84-555084661300640/, Eintrag am 09.04.2017.
20 Eggers, Giesen, wie Anm. 16, S. 46.
21 Kunkel/Borchers/Bethe 1939, S. 255–343, hier S. 269, Anm. 28.
22 Vgl. auch Eggers, Giesen, wie Anm. 16, S. 46.
23 Ebd. Vgl. Messtischblatt Nr. 1768 Zuckers mit der Angabe „Hügelgräber“.
24 Eggers, Giesen, wie Anm. 16, S. 46.





























