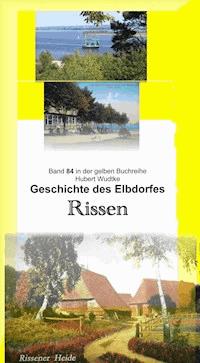
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: gelbe Buchreihe aus Rissen bei Jürgen Ruszkowski
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte des Elbdorfes Rissen wird von dem in Rissen lebenden emeritierten Professor Hubert Wudtke in diesem Band 84 der gelben Buchreihe aus Rissen in Wort und Bild seit der ersten Erwähnung in alten Dokumenten vor mehr als 760 Jahren detailliert und interessant dargestellt. Von den ersten ärmlichen Bauernhäusern auf kargem, sandigem Sumpf- und Dünengrund bis hin zum heutigen Hamburger Nobelvorort mit über 14.000 Einwohnern gab es eine lange bewegte Entwicklung. Die Rissener lebten unter der Herrschaft der Schauenburger Grafen, als dänische, österreichische und deutsche Untertanen, wurden im 30jährigen Krieg verschont, nicht jedoch im ersten und zweiten Weltkrieg. Die NS-Herrschaft des "tausendjährigen Reiches" hinterließ auch in Rissen Wunden, vor allem bei jüdischen Mitbürgern. Nach seiner Pensionierung hat Hubert Wudtke diese Texte in Ergänzung zu den Veröffentlichungen der Stadtteilarchivgruppe Rissen geschrieben. Es war anfangs die Absicht gewesen, nur für die Zeit von 1250 bis 1850 weiteres informatives und erzählwürdiges Material zu einem Bauerndorf ohne eigenes Kirchspiel, ohne große Ereignisse und ohne Schauplätze zu finden und dann zu prüfen, ob es für den heutigen Leser noch interessant ist, etwas von Hufnern und Dorfschulmeistern, von Kätnern und Schiffszimmerern, von Torfstechern und Steinegräbern, von Schweinezucht und Treibjagden, vom Feldertausch und von Hungerzeiten zu erfahren. Und dann sind da noch die schweren Jahre in und zwischen den Kriegen von 1914 bis 1945, über die auch nur wenig aufgeschrieben worden ist. Auch zu diesen Jahren wurde ergänzendes Material gesammelt, geprüft und mit Berichten von Zeitzeugen angereichert. Seit 2013 erschienen diese Texte in loser Folge in der Rissener Rundschau und fanden dort interessierte Leser. Sie werden hier nun mit kleinen Änderungen und einigen Ergänzungen als Buch vorgestellt. Lesen Sie selber, was sich in Rissen so zugetragen hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hubert Wudtke
Geschichte des Elbdorfes Rissen
Band 84 in der gelben Buchreihe aus Rissen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Vorwort des Autors
Vorgeschichte
Historische Geschichten aus Rissen
Kirchspiel Nienstedten
Verwaltungssitz: Hatzburg
Tafelbild der Grafschaft Schauenburg
Erste Namen und erste Dorfereignisse aus Rissen und Tinsdal um 1590
Rissen 15. Jahrhundert: erste Steuerlisten
Turbulenzen in der Grafschaft Pinneberg – 1616 – 1622
Schiffsexplosion vor Wittenbergen 1622: Waffenschmuggel
Rissen und der 30jährige Krieg
Rissen und Umgebung: die Kriegsfolgen
Rissen wird für 224 Jahre ein dänisches Dorf
Leben in Rissen nach dem großen Kriege
Die erste Schule – vor 1700?
Die ersten Lehrer in Rissen – 1650?
Ein Haus in Wittenbergen – ein irischer Graf – eine englische Lady
Graf Clancarty – 1668 – 1734 – eine Biografie wie eine Seifenoper
Graf Clancarty – eine Erzählung von 1903
„Lady Clancarty“ – ein Theaterstück
Die dänische Gemeinde Rissen um 1800 – Bauerndorf und Leibeigenschaft
Transporte in der Marsch, in der Geest und auf der Elbe um1800
Schiffsbau in Wittenbergen:1760-1872
1850: armes, sandiges Rissen
Bäuerliches Leben im 19. Jahrhundert
Dänisches Walddorf Rissen 1860: 407 Einwohner
Rissen wird ein österreichisches Dorf: 1864/5
Rissen wird ein preußisches Dorf
Rissen wird ein deutsches Dorf
1840 Rissen – noch ein dänisches Heidedorf
Aufbruch in die Moderne: die Eisenbahn
Rissen: der Weg in die Moderne – Eisenbahn – Dampfschiffe
Rissener Kiesgrube – Zuckerfabrik Schulau
Rissen – deine Leuchttürme
Preußen – Landkreis Pinneberg
Gemeinde Rissen 1906 – 1912
Das Ortsstatut für die Gemeinde Rissen 1912
Gemeinde Rissen 1914-1918: 1. Weltkrieg
Johanna Wolff 1858 – 1943
Johanna Wolff – eine Schriftstellerin aus Rissen – ihre Themen
Preußen – Groß-Altona – Rissen
Ende der Gemeinde Rissen 1927
Golfplatz Rissen
Klövensteen
Sommerfrische Wittenbergen (1910)
Fährhaus Wittenbergen – Perle am Elbstrand
Wittenbergen: Strandleben
Strandleben bis 1927 – ein Bericht
Rissen: das Wandern ist des Bürgers Lust – Wandervögel
Landschaft zwischen Elbe und Geest
Ende der Weimarer Republik
Rissen im Zeichen des Hakenkreuzes
Rissen nach 1933 – Rissen ein deutsches Dorf
Rissen unterm Hakenkreuz – 1936: Kirche und Kaserne
Rissen wird Hamburger Vorort
Vorzeichen des Krieges
Rissen: Vorkriegsjahre
Jüdische Mitbürger in Rissen vor 1939
Jüdische Mitbürger – wer weiß etwas?
Rissen: Namen – Schicksale?
Jüdische Mitbürger in Rissen vor 1939 – Familie Schindler
Jüdische Mitbürger in Rissen vor 1939 – Richard und Louise Samson und das Haus Moorfred
Jüdische Mitbürger in Rissen – Schlussnotiz
Kibuzze und Judenhäuser
September 1939 – wieder Krieg!!
Kriegsalltag an der „Heimatfront“
Rissen – Kriegsjahre
Der Krieg ist aus: 8. Mai 1945
Rissen 1945 – 1948 – Überleben
Licht am Horizont 1948: Währungsreform
Rissen 1948-50: Arbeit für alle? – Zukunft für alle?
Maschinenfabrik Rissen
1946: allmählicher Aufbruch – Entfaltung des Gemeindelebens
Rissen: Gartensiedlung Mechelnbusch 1946-1954
Der Rissener Sportverein wird gegründet
Koreaboom
Rissen wird selbstständige Kirchengemeinde
Stadtteilarchivgruppe Rissen
Literatur:
Die maritime gelbe Buchreihe
Sonstige Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Zu den von mir bevorzugt gelesenen Büchern gehören Dokumentationen zur Geschichte, Zeitgeschichte und Biographien. Seit etwa zwei Jahrzehnten sammle ich Zeitzeugenberichte, zunächst von Seeleuten, mit denen ich über Jahrzehnte in meinem Beruf als Diakon und Dipl.-Sozialpädagoge in einem Seemannsheim täglichen Kontakt hatte. So kam es, dass ich seit 1992 in etlichen Bänden Lebensläufe und Erlebnisberichte von Fahrensleuten aufzeichnete und zusammenstellte.
Die positiven Reaktionen auf den ersten Band und die Nachfrage ermutigen mich, weitere Bände zu gestalten Die gelbe Buchreihe enthält jedoch auch etliche nicht maritime Bände.
Diese Rezension findet man bei amazon: Ich bin immer wieder begeistert von der „Gelben Buchreihe“. Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. Danke, Herr Ruszkowski.
Ein kürzlich erschienener Band enthält Bilddokumentation über den Neubau der Stadtteilschule Rissen auf dem Gymnasium-Schulcampus
In diesem Band 84 wird die Geschichte des Elbdorfes Rissen vorgestellt, über die der Autor Professor Hubert Wudtke bereits in vielen Folgen in der Rissener Rundschau berichtet hat. Wiederholt wurde er gefragt, ob er seine Texte und Bilder nicht auch als Buch veröffentlichen könne. Das soll nun mit diesem Band geschehen.
Da für die Gestaltung eines ebooks eine maximale Dateigröße vorgegeben ist, mussten die eingefügten Bilddateien stark verkleinert werden, was sich auf die Bildqualität auswirkt. Im Printbuch erscheinen die Bilder in wesentlich besserer Darstellung.
Hamburg, 2016 Jürgen Ruszkowski
Vorwort des Autors
Dieses kleine Buch erzählt die Geschichte Rissens bis 1953, es möchte die schönen Veröffentlichungen der Stadtteilarchivgruppe Rissen und die Festschrift zur 750 Jahrfeier ergänzen. Es war anfangs meine Absicht gewesen, nur für die Zeit von 1250 bis 1850 informatives und erzählwürdiges Material zu finden; es war aber ungewiss, ob es überhaupt Dokumente und Aufschreibungen zu einem Bauerndorf ohne eigenes Kirchspiel, ohne große Ereignisse und ohne Schauplätze gab.
Kann man aus Landkarten, Steuerlisten und Gerichtsnotizen etwas Mitteilbares erfahren? Und ist es für den heutigen Leser anregend und interessant etwas von Hufnern und Dorfschulmeistern, von Kätnern und Schiffszimmerern, von Torfstechern und Steinegräbern, von Schweinezucht und Treibjagden, vom Feldertausch und von Hungerzeiten zu erzählen? Ich denke ja, denn die Prosa und die Poesie des Lebens finden wir in jedem Haus, in jedem Leuchtturm und in jedem Krug?
Und dann sind da noch die Jahre von 1925 bis 1945, über sie ist wenig aufgeschrieben worden. Auch zu diesen Jahren habe ich Material gesammelt und habe mit Zeitzeugen gesprochen. Es ist gut sich daran zu erinnern, dass wir die Wahl haben zwischen freundlichen und gewalttätigen Sinnmustern, um unser öffentliches und privates Leben zu gestalten.
Rissen ist ein kleiner Kosmos mitten in der Welt, aus dem man – wie aus einem Guckkasten heraus – in und auf die Welt schauen kann. Die kleinen Erzählungen hier im Buch verbinden sich zu einem Rissener Weltbilderbogen. Wir erzählen, um nicht alles zu vergessen und sind ständig auf der Suche nach einem Kompass, um gelassen in den Nebel der Zukunft zu fahren.
Ohne Adolf Schmedding, Jürgen Zimmern, Werner Sturm, Dr. Carsten Meyer-Tönnesmann – meine Miterzähler aus der Stadtteilarchivgruppe Rissen – und ohne Hermann Schwarz, Helen Schumacher, Hartmut Bünz, Otto Maak, Erwin Hoff – meine Miterzähler aus dem „Dorf“ – wäre dieses Büchlein nicht zustande gekommen, auch nicht ohne die Unterstützungen von Frau Anke Rannegger, der Stadtarchivarin von Wedel.
Mein Dank gilt der Rissener Rundschau und Roland von Ziehlberg, die mir die Plattform und das Format gegeben haben, über drei Jahre in 44 Folgen dieses Buch Schritt für Schritt zu erschreiben. Zuletzt danke ich Herrn Ruszkowski, der mich im Frühjahr 2016 überraschend anrief und mir mitteilte, dass er Lust habe aus den 44 Folgen ein Buch zu machen und in seiner gelben Reihe herauszugeben. So ist es nun geschehen und hier ist das Buch!
Hubert Wudtke
Vorgeschichte
Erste Siedlungen nomadisierender Wildbeuter um 10.000 v. Chr. im Bereich des heutigen Rissen
Am Ende der letzten Eiszeit (10.000 v.) durchbrechen Schmelzwasser die Endmoränen im heutigen Elbgebiet. Die gewaltigen Wassermassen lassen den Meeresspiegel steigen und formen in jahrhunderte langer Arbeit das Elburstromtal. Stürme wehen das Tal aus, feine Sande fliegen landeinwärts, und in den Niederungen der Moränenlandschaften entstehen ausgedehnte Dünenflächen – die Holmer Sandberge, die Tinsdaler Düne, der Wittensand, die Sicheldüne im Klövensteen.
Wittenbergen: Dünen
Die Sande fressen sich in das Sumpfland und in die Moore hinein. Das ganze Land ist durchzogen von Wasseradern, die sich zu kleinen Auen vereinen, die vom Blankeneser Höhenrücken aus das Land nordwärts entwässern. Die Dünenflächen zwischen den Seen (heute: Schnaakenmoor) und das hohe Elbufer, durch die Vor- und Rückwärtsbewegungen des Eises zusätzlich hoch gestellt, bieten sich als trockene Siedlungsplätze an. Bewachsen von Kriecheichen und Krüppelkiefern stellen sie günstige Schutz- und Rückzugsgebiete dar. Das Hochufer bricht hinter Tinsdal und Schulau ab, und stromabwärts schließen sich die langen fruchtbaren Marschen an – ein winziges Stück Marsch liegt auch vor Wittenbergen.
In der Vorzeit durchziehen Großhirsche, Bären, Wölfe und Elche ganzjährig die norddeutschen Tundren und Wälder, im Winter wandern Rentiere aus Skandinavien ein, die ganze Region ist für nomadisierende Wildbeuter – ausgerüstet mit Harpune und Bogen – ein lohnendes Jagdgebiet. Und dann ist da noch die Elbe mit ihrem Fischreichtum an Schollen, Butten, Barschen, Karpfen und Hechten. Schon um 10.000 v. C. im Übergang von der Alt- zur Jungsteinzeit werden im heutigen Rissener Gebiet nomadisierende Wildbeuter zeitweilig sesshaft, wie viele Werkzeugfunde am Elbufer und auf der Sicheldüne (nahe Waldspielplatz) im Klövensteen bezeugen.
Die Schaber, Pfeilspitzen und Federmesser aus Flintsteinen machen die ersten „Rissener“ in Expertenkreisen berühmt, sind doch die einseitig scharfen Messer, Schaber und Pfeilspitzen von besonderer Art, und ihre spezielle Fundlage im Dünensand erlaubt eine relativ klare zeitliche Zuordnung, denn im Dünensand werden übereinander zwei Lagen von unterschiedlichen Artefakten aus den Jahren 10.000 und 8.000 vor C. gefunden. Die ältere Lage erhält den Beinamen „Rissener Stufe“ gefolgt von der „Ahrensburger Stufe“. Über Jahre war die Sicheldüne im Klövensteen das Übungsfeld für Grabungen und Vermessungen von Studenten der Vor- und Frühgeschichte der Hamburger Universität.
Federmesser
Grabung Sicheldüne: Karl Stülcken + 3 Rissener Jungen
Die Ausgrabungen begeistern aber auch die Rissener Jungen in den 1940er Jahren; mehrere haben sich freiwillig und mit Elan an den Arbeiten beteiligt. Von einem „großen“ Entdecker – vorne links – werden wir noch zu sprechen haben.
Siedlungen: Einzelgehöfte – Ackerbau – Viehzucht – Handel
In der jüngeren Steinzeit beginnt die Besiedlung der Elblandschaften. Bären, Rentiere und Elche ziehen sich in die kälteren Regionen zurück, das Standwild (Rot- und Schwarzwild, Hasen und Wildvögel) erleichtert die Jagd vor Ort und erlaubt die Zähmung der Wildtiere und den Übergang zur Viehzucht.
Der sich durchsetzende Ackerbau (ab 4.000 v. C.) auf Rodungsinseln mit Einzelgehöften steigert die lokale Ökonomie, und die Überschüsse eröffnen Chancen für weitreichende Tauschhandlungen. Vermutlich schon seit der Bronzezeit (2.000 v.) verbindet der Ochsenweg die Elbregion mit Jütland, mit dem Viehhandel steigert sich auch der Fernhandel mit Metallen, Metallprodukten (Werkzeuge, Waffen, Schmuck) und Bernstein.
Auch vor Ort entwickeln sich die technischen Fähigkeiten zur Produktion von Tonwaren und zur Verhüttung von Raseneisenerz, Lehmböden und große Lagerstätten von Raseneisenerz (Iserbarg, Iserbrook) in geringer Bodentiefe werden in den Niederungen von Hamburg bis hinauf nach Flensburg gefunden – Verhüttungsöfen in Wittenbergen. Die neuen Technologien produzieren aber auch Umweltschäden. Die Brandrodungen für den Siedlungs- und Ackerbau und die Erzeugung erheblicher Mengen Holzkohle für die Eisenverhüttung vernichten Waldbestände, und die Heideflächen breiten sich aus.
Hügelgrabkultur und Urnenfelder
Sesshaftigkeit führt auch zu neuen Kulturformen, in der Bronzezeit setzen sich die Bestattungen in Stein- und Hügelgräbern (Erd- und Feuerbestattung) durch und werden dann in der Eisenzeit von großen Urnenfeldern so auch bei Tinsdal (400 Grabstellen) und Sülldorf (250 Grabstellen) abgelöst.
Hünengrab Groß-Flottbek – zerstört (Helms Museum)
Viele der Stein- und Hügelgräber aus der Region sind verschwunden oder zerstört worden, so beim Bau des kaiserlichen Altonaer Exerzierplatzes in Groß-Flottbek (heute: Desy), in der Suurheide beim Bau der Kaserne in Rissen (heute: Krankenhaus) und beim Bau der Eisenbahn.
Bronzezeitliches Hügelgrab in Rissen: Ringbettung – zerstört
Gräber und Friedhöfe der Vorzeit im Bereich des heutigen Rissen
Rissen, Wittenbergen, Tinsdal und Sülldorf stellen ein lohnenswertes vorgeschichtliches Siedlungsgebiet dar, das – trotz vieler Plünderungen und Zerstörungen – auch heute noch unser Interesse verdient, denn wer weiß schon, was sich unter dem Dünensand, in den Feldern, an den Ufern der Au oder im abstürzenden Gemergel des Elbhochufers noch finden lässt.
Lilienberg
Zwei Grabhügel können in Rissen heute noch erkannt werden. Der Lilienberg – ein flacher kreisrunder Hügel mit schönem Baumbestand - liegt zwischen dem Marschweg und dem Feldweg 77 bei den Anlagen des Rissener Sportvereins; und unweit vom Lilienberg auf dem ehemaligen Grundstück Tannenhof an der Ecke Gudrunstraße / Grot Sahl liegt der Kaffeeberg.
Kaffeeberg
Der Kaffeeberg – einst im Dünengelände – befindet sich heute in einem Vorgarten von Bäumen umgeben, bei Sonnenschein bildschön – wenn man ihn bemerkt. H. Sch. aus der Nachbarschaft hat 1934 bei der Ausgrabung und Untersuchung des Hügels als Jugendlicher mitgeholfen. Er erzählt, dass zuerst von dem Gärtner in geringer Tiefe rund dreißig Meter vom Hügel entfernt 15 teils braune, teils tiefschwarze Urnen entdeckt und freigelegt wurden, die jeweils von einer Steinpackung umgeben waren. Es wurden auch eine Nadel und eine Spange aus Eisen gefunden.
In dem Hügelgrab hat vermutlich eine Familie über Generationen ihre Toten beerdigt. Diese Grabstelle verfügt neben dem Basisgrab über mehrere spätere Grabeintiefungen aus der Bronze- und Eisenzeit. An den Schäden der Steinpackungen war gut erkennbar, dass die Gräber schon vor langer Zeit geöffnet und geplündert worden waren: Gefunden wurden nur Feuersteinstücke und Tonscherben. An den Stempel-Ornamenten auf einer rotgelben Trinkbecherscherbe erkannten Experten spanische Einflüsse.
Urnen Tinsdal / Sülldorf
Die großen Urnenfelder von Tinsdal und Sülldorf aus der Eisenzeit (Nordeuropa: 100 – 400 n. Chr.) legen beredtes Zeugnis davon ab, wie die Besiedlungsdichte zunimmt. Der Dorfschullehrer Caspar Hinrichs Fuhlendorf (1844-1903) hat – mit Hilfe von Schülern – in Sülldorf einen ganzen Friedhof von Urnen mit und ohne Grabhügel ausgegraben.
Bronzenadeln aus Tinsdal und Sülldorf (aus: Beuche)
Er hat die Grabstätten kartographiert und die Urnen, Urnenscherben und Beigaben aus der Bronze- und Eisenzeit – Nadeln, Fibeln, Ketten, Schnallen – nach Kiel ins Museum verbracht. Fuhlendorf hat sich um die Entdeckung und Sicherung prähistorischer Funde aus den Elbgemeinden große Verdienste erworben.
Das Elbhochufer bei Tinsdal war vor seiner Befestigung in den 1960er Jahren eine wahre Fundgrube für Flintstein- und Feuersteinwerkzeuge: Klingen, Beile, Pfeilspitzen. Aber bearbeitete Feuersteine wurden auch an der Au, auf den Feldern, in den Dünen gefunden. Hier soll nun noch von Funden am Elbhochufer von Rissen erzählt werden.
Elbhang Wittenbergen 19. Jahrhundert
Bearbeitete Feuersteine – gefunden von Jürgen Zimmern an der Au in Rissen
Luusbarg in Wittenbergen
Der Luusbarg in Wittenbergen ist ein attraktiver baum- und heidebewachsener Abschnitt des Elbhochufers. Das Gelände gehörte Ende des 19. Jahrhunderts dem Bauern E. Ladiges aus Tinsdal. Auf diesem Gelände brach eines Tages unter dem Tinsdaler Schäfer die Erde ein, und er landete in einer Grabstelle mit Steinrahmung, Skelettknochen und kleinen Beilagen. An der Nordseite des Luusbargs wurde dann ein weiteres Grab, dieses Mal ein Kinder-Doppelgrab zusammen mit einem Tongefäß und den Resten eines bronzenen Vollgriffmessers: „beidseitig verziert, mit rhombischen, glatt abschließendem Knauf“ (Prüssing, S. 61) gefunden. Kein Wunder, dass der Luusbarg nun das Interesse auf sich zog.
Ab 1880 ließ Bauer Ladiges „fast alle Hügel und Berge an der Elbe gegen Vergütung bis zu einer Tiefe von 2-3 m nach Steinen durchgraben. Fuhlendorf gegenüber hatte er sich verpflichtet, alle Funde für das Kieler Museum herzugeben“ (Krahn 1981).
Bauer Ladiges war ausschließlich kommerziell an den Steinen interessiert und nicht an den ärmlich ausgestatteten Grabstätten, ihren Knochen und Tonscherben. Die Findlinge, die in der Eiszeit an die Elbe verbracht worden waren oder schon in der Vorzeit beim Grabbau gebraucht worden sind, wurden im 19. Jahrhundert als Grenzsteine, Pflastersteine und erneut als Grabsteine gern verwendet und waren im Baugewerbe begehrt für Stadtmauern, Fundamente, Fußböden und beim ländlichen Brunnenbau.
Der Verwahrfund vom Luusbarg
und die Geschichte seiner Entdeckung
Bei den Grabungen auf dem Gelände Ladiges kommt es 1885 zu einer kleinen Sensation, Steinsucher finden eine größere Urne gefüllt mit Bersteinperlen, Schmuck und Jagdwaffen aus Bronze: Ösenhalsringe, Ohrringe, Nadeln, Armringe, ein Randleistenbeil und eine Lanzenspitze von 15 cm Länge.
Bei dem „Schatz“ handelt es sich um einen Verwahrfund, den sein Besitzer nur für eine gewisse Zeit vergraben wollte, aber der „Schatz“ bleibt über 3.500 Jahre in der Erde verborgen.
Verwahrfund
„Am 14. Januar 1885 erfuhr Fuhlendorf...von einem bedeutenden Fund in Tinsdal... Der Finder, ein im Auftrage von Ladiges arbeitender Steingräber namens Plath, war eben im Begriff, die Bronzefunde lieblos in ein Taschentuch zu wickeln, um sie in seine Wohnung nach Wedel mitzunehmen. Mit größter Mühe...und mit dem Versprechen auf einen Finderlohn seitens des Kieler Museums (heute: Schloss Gottorp) gelang es Fuhlendorf, den Fund an sich zu nehmen.
Dem Finder wurde bald darauf von Dr. Brinkmann am Kunstgewerbemuseum in Hamburg neben verlockenden Fundprämien für Urnen und andere Funde für den Bronzefund ein Preis von 400 Mark geboten. Es entspann sich nun um den geringen Finderlohn von 30 Mark, den Kiel zu zahlen bereit war, ein heftiger Federkrieg zwischen allen Beteiligten, wobei viele böse Worte hin und her flogen und vor allem die Bestrebungen der Hamburger in den Augen Fuhlendorfs nicht gut wegkamen. Es blieb zum Schluß bei dem Preis des Kieler Museums, in dessen Händen der Fund ohnehin schon war. Zu den Fundumständen brachte Fuhlendorf folgendes in Erfahrung:
Die Arbeiter waren beim Steine suchen am südwestlichen Abhang des Luusbargs ungefähr 100 m von den Schmelzöfen entfernt in 40 cm Tiefe auf eine einfache Steinpackung gestoßen, in der ein Tongefäß stand. Von dem beim Herausnehmen zerstörten Gefäß fehlten nachher mehrere Scherben und auch die im Gefäß liegenden Bronzegegenstände waren z. T. beschädigt. Sie alle haben zusammen mit den Bernsteinperlen in dem Topf gelegen. Das Auffinden ging nach Aussage der Arbeiter so vor sich, dass Plath mit der Spitzhacke die Steinpackung auseinanderreißen wollte. Gleich beim ersten Hieb traf er mitten in den Topf mit der Bronze hinein“ (Krahn 1981, S.25).
Der Luusbarg wird 1907 von dem Hamburger Bankier Münchmeyer gekauft, um sich dort ein Sommerhaus zu bauen. Hofft er auf weitere Schatzfunde gemäß der Sage vom versunkenen Schatz im Luusbarg: In der Johannesnacht leuchtet auf dem Luusbarg ein Licht, das immer erlischt, wenn man sich ihm nähert.
Idol von Rissen – Erdgöttin von Rissen
Am 18.06.1971 berichten die Norddeutschen Nachrichten und der Blickpunkt Wedel von einem Vorzeitfund in Rissen ...von europäischer Bedeutung. „Ein sensationeller Fund ist in Rissen, am Tinsdaler Leuchtturm, gemacht worden: ein schwarzer Stein mit dem eingeritzten Bildnis eines Idols, das rund 4.000 Jahre alt sein dürfte...
Idol von Rissen – 4.000 Jahre alte Erdgöttin
Es handelt sich um das erste Idol aus Stein und in dieser Form aus dem Neolithikum, der Jungsteinzeit, das im Raum Norddeutschlands und Skandinaviens gefunden wurde... Zum ersten Mal erleben wir, dass ein Mensch dieser Zeit, ein Künstler, die Gestalt eines göttlichen Wesens schuf. Wie sieht es aus? Die Göttin ist 8 cm hoch, aufrecht stehend, und an der Basis 6 cm breit. Sie besteht aus schwarzem cambrischen Schiefer. Unheimlich lebendig und suggestiv wirkt sie auch heute noch. Die tiefen Augen, der weit geöffnete Mund scheinen etwas aussagen zu wollen. Ist es eine Erdgöttin?“
Eine sakrale Figur – eine Rissener Göttin? Das erwartungsfrohe Auge wird aber von dem Anblick der Figur dann doch enttäuscht: keine üppige weibliche Figur wie die Venus von Willendorf, eher eine Studienrätin der Geometrie geschmückt mit ornamentalen Symbolen. Und gleicht das Gesicht nicht der Zeichnung eines 1. Klässlers: Punkt, Punkt, Komma, Strich – fertig ist das Mondgesicht?
Venus von Willendorf (Alter 29.000 Jahre)
Ich habe mich in den 1990 er Jahren an das Helms Museum gewandt und nach dem Idol von Rissen gefahndet. Ziemlich schnell war klar, dass der Entdecker W. E. der Öffentlichkeit einen Bären – oder besser eine Göttin - aufgebunden hatte.
Das Helms Museum verwies mich an das Universitätsinstitut für Frühgeschichte. W. E. war dort technischer Mitarbeiter gewesen. Er hatte noch einige Steine hinterlassen, die man mir gern aushändigen wollte. Was also – kein sensationeller Fund in Rissen? Kein Weltkulturerbe?
Im Blickpunkt Wedel erschien kurz nach dem ersten Bericht noch ein Artikel über einen zweiten sensationellen Fund von W. E., er hatte am Tinsdaler Hochufer magische Steine mit Ritzzeichnungen aus der Altsteinzeit gefunden. Hatte ihn nach seinem ersten Täuschungserfolg nun der sportliche Ehrgeiz gepackt?
Stein mit Ritzzeichnungen
Rissen hat nicht nur eine Geschichte sondern auch seine ganz eigenen Geschichten. Vielleicht ist bei W. E. der Traum das Idol von Rissen zu finden schon bei seinen Grabungen als Junge in der Sicheldüne unter Karl Stülcken entstanden.
W. E (vorne links)
Historische Geschichten aus Rissen
Der Name: Rissen
Hebt das lautmalende Wort Rissen den Klang der Vorzeit auf, als der Wind aus dem Elbtal den Sand über die weißen Berge von Wittenbergen, die Heide von Tinsdal, die Felder und die noch unbewaldeten Dünen trug, und der Sand ein ums andere Mal den Rissener Bauern das reifende Getreide zerschlug? Rissen – Rieseln des Sandes?
Die in allen Sprech- und Schreibvarianten – Risne – Rysten – Rissen – erscheinende Stammsilbe ris steht im Althochdeutschen für Sumpf, Moor, sie verweist auf Ried, Reet, Schilfrohr, auf das Schwankende, sich Schüttelnde. Dänisch ryste ist mit schütteln, zittern zu übersetzen; lateinisch ruscus ist die Binse. Manche Sprachforscher interpretieren ris als Reisig, Buschwerk. Die Endsilbe -sen steht für ein verkürztes -husen. Rissen: das Moordorf oder die Häuser im Busch.
Wenn man sich an der Innenseite der Sprache entlang zurückphantasiert, dann entsteht auf ganz eindringliche Weise ein Bilderbogen der Rissener Landschaft und Naturgeschichte.
Was der Name Rissen anklingen lässt, vernehmen wir auch im Namen Tinsdal (tin – Moor, dalle – feuchte Kuhle – oder am Endes des Tals) und wiederholt sich als Echo in den alten Familien- und Straßennamen: Brunkhorst – der im Moorgehölz lebt; Timmermann – der Mann aus dem Moorland, Ladiges – lad / Schmutzwasser.
Man wohnte am Lüttmoor, in der Racketwiete (racke – Schmutzwasser), in der Brünschentwiete (Röhricht), im Garrelweg (Sumpf), im Wateweg (Sumpf) oder Achtern Sand oder in der Grot Sahl (Sahl sumpfiges Gelände) und begab sich durch die Heide von Tinsdal zu den witten Bergen an der Elbe.
Die Sprache hebt die Szenerie vergangener Zeiten auf. Rissen mit seinen Geschwistern Tinsdal und Wittenbergen startet als Ensemble von Bauerhöfen zwischen Elbe, Elbhochufer, Heide, Dünen und Moore.
Taufurkunde: 1255
Mit der ersten urkundlichen Erwähnung von 1255 betritt Rissen die Weltbühne der Geschichte und Geschichten. Für die Zeitgenossen und die Nachwelt wird festgehalten, dass die Schauenburger Grafen Gerhard und Johann von Holstein den „gantzen Zehnten“ der abgabepflichtigen Erträge von Rissen, Tinsdal, Holm und Spitzerdorf an das Domkapitel in Hamburg und das Kloster Harvestehude, in dem die Mutter der Grafen zu diesem Zeitpunkt bereits lebte, „zu ewigem Besitz“ überschreiben.
Das Zisterzienser-Nonnen-Kloster Harvestehude ist 1245 von der Gräfin Heilwig gegründet worden; 1295 erfolgte die Umsiedlung der Nonnen von dem ursprünglichen Standort nahe der Elbe (heutiges Altona) ins Jungfrauenthal.
Es soll jetzt und in Zukunft bekannt sein, dass wir (Johann und Gerhard von Holstein), die wir uns ueber die zuverlaessige Treue unseres getreuen Herrn Friedrich von Haselthorpe freuen, die ihm deutlich bei allen gerechten und vernünftigen Dingen hoeren wollen, alle unsere Rechte, die er bei seinen Guetern, die er aus unseren Haenden als Lehen hatte und die entweder uns oder unseren Erben gehoerten, zu seinem Gutduenken und seinem Wohlgefallen dem Herrn Friedrich und seiner gluecklichen Jungfrau Marie in Hamborch (Kloster Harvestehude) zu ewigem Besitz uebertragen haben.
Das sind folgende Besitzttuemer: die Haelfte des Zehnten in Ostersteinbeck und Steinbeck, Boberg, Hanevalle, den ganzen Zehnten in Spitzerdorf in Trockenheit und Sumpf, den ganzen Zehnten in Rissen, ebenso in Tinsdahl und der ganzen Ortschaft Holm mit dem Zehnten und den Menschen, die dort wohnten.
Der Vater der Holsteiner Grafen Adolf IV. von Schauenburg, Gründer von Kiel und Itzehoe, hatte 1227 in der Schlacht von Bornhöved mit einem Koalitionsheer die Grafschaft Holstein von dem Dänenkönig Waldemar zurückerobert und ist dann seinem Gelübde gemäß nach der siegreichen Schlacht und der Teilnahme an einem Kreuzzug in Livland 1239 in das Franziskanerkloster Maria-Magdalenen in Hamburg eingetreten.
1244 wird er in Rom zum Priester geweiht, 1261 verstirbt er im Kieler Franziskanerkloster.
Vor dem Klostergarten des Kieler Klosters steht ihm zur Erinnerung heute eine Bronzeplastik, die seine Wandlung vom Ritter zum Bettelmönch zeigt.
Graf Adolf IV. – Aufbahrung – Museum für hamburgische Geschichte
Eine Verkaufsurkunde: 1348
Am 8. September 1348 weist eine zweite Urkunde aus, dass Graf Adolf VII. von Holstein und Schauenburg die Rechte am Dorf Rissen für 100 Mark mit Rückkaufsrecht an das Harvestehuder Kloster verkauft – „villam nostram dictam Rysene pro centis marcis Hamburgensium denariorum“.
100 Mark klingen in unseren Ohren nach einem Schnäppchen, aber das trifft nicht zu. Für 100 Mark konnte man zu jener Zeit ungefähr 25 Ochsen oder 12 Wirtschaftspferde oder 160 Mäntel erwerben.
Für 200 Jahre schweigt dann die Überlieferung. Erst Steuerlisten, Gerichtsnotizen, erste Landkarten und ein Tafelbild aus dem 15. und 16. Jahrhundert werden es erlauben, ein kräftigeres Bild vom Alltagsleben des Dorfes Rissen zu zeichnen.
Kirchspiel Nienstedten
1257 wird für Nienstedten erstmals eine Kirche erwähnt. Zum „Kerspel Nigenstedte“ gehören neben Rissen, Tinsdal, Osdorf, Schenefeld, Blankenese, Flottbek, Sülldorf auch die Elbinseln Finken- und Goriswerder. Die aufgeführten Orte des Nienstedter Kirchspiels mit ihren vertrauten Namen gehören politisch zur Herrschaft der Grafen von Schauenburg, die 1110 mit der Grafschaft Holstein belehnt wurden und zusammen mit dem Erzbischof von Bremen die Eindeichung und Besiedelung der Elbmarschen durch holländische Kolonisten (Hollerland) befördern.





























