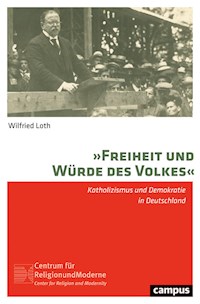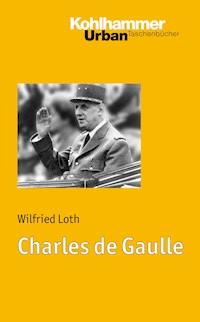14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Wilfried Loth zeichnet den spezifischen französischen Weg zum modernen Industriestaat nach und bietet damit sowohl eine Einführung als auch eine Bilanz: eine Einführung in die französische Geschichte, die die politische Kultur Frankreichs historisch erklärt, und eine Bilanz der Zeitgeschichtsforschung, die die Bestimmungsfaktoren des französischen Modernisierungsprozesses herausarbeitet und so Anstöße zu einer vergleichenden Betrachtung der deutschen und französischen Geschichte im 20. Jahrhundert liefert. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Ähnliche
Wilfried Loth
Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert
FISCHER Digital
Inhalt
Vorwort
Die französische Geschichte im 20. Jahrhundert ist voller überraschender Entwicklungen und bemerkenswerter Leistungen: Ein Bauernvolk setzt seinen Ehrgeiz in die Entwicklung technologischer Spitzenleistungen; ein Land von Individualisten entwickelt eine präsidiale Regierungsform; eine Gesellschaft der Klassengegensätze findet immer wieder zum nationalen Konsens; eine europäische Großmacht muß vor dem deutschen Expansionsdrang kapitulieren und kann doch im Zeitalter der Supermächte eine gewisse Eigenständigkeit behaupten.
In diesem Buch wird der Versuch unternommen, diese Prozesse in ihrer Wechselwirkung darzustellen und so den spezifischen französischen Weg zum modernen Industriestaat herauszuarbeiten, von der »Belle Epoque« des beginnenden Jahrhunderts bis zur »Cohabitation« unserer Tage. Wie jede Darstellung dieser Art verfolgt es zwei Ziele zugleich. Es will erstens in die französische Zeitgeschichte einführen, die Ergebnisse der einschlägigen Forschung in komprimierter und übersichtlicher Form präsentieren und dem Leser so ein rasches Zurechtfinden in den verschiedenen Bereichen dieser Geschichte ermöglichen. Und zweitens möchte es auch zur Interpretation dieser Geschichte beitragen: die Ergebnisse der Detailforschung der letzten Jahre in größere Zusammenhänge einordnen, Entwicklungen und Probleme thematisieren, die erst in der Zusammensicht deutlich werden, und Vorgänge skizzieren, die in der Einzelforschung bislang unterbelichtet geblieben waren.
Ein solches Unternehmen ist von Zeit zu Zeit notwendig, um die Orientierung zu erleichtern und der Forschung neue Impulse zu vermitteln. Für die französische Zeitgeschichte steht es schon seit längerer Zeit aus; es liegen wohl Überblicke zu einzelnen Abschnitten vor (insbesondere in der Reihe der »Nouvelle histoire de la France contemporaire«), aber keine Gesamtdarstellung, die das gesamte Jahrhundert umfaßt, und erst recht keine Einführung in den Forschungsstand in deutscher Sprache. Diese Lücke zu füllen, schien mir um so dringlicher, als die politische Kultur Frankreichs hierzulande trotz vielfacher Anstrengungen doch noch ziemlich wenig bekannt ist und wenig verstanden wird und die Diskussion über die Besonderheiten der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert zumeist in nationaler Blickverengung geführt wird. Der Blick in die jüngste Geschichte des französischen Nachbarn kann gewiß helfen, sowohl das gegenwärtige Frankreich in seinen Eigenheiten und Problemen besser zu verstehen als auch manche Probleme der deutschen Geschichte durch den Vergleich treffender zu erfassen.
Um einen umfassenden Überblick zu ermöglichen, ist die Darstellung bewußt sehr knapp gehalten worden. Dadurch treten wohl die Grundlinien der Interpretation recht klar hervor; es unterbleibt aber auch manche wünschenswerte Differenzierung und nähere Begründung für die vorgetragenen Thesen. Der Leser, der das ebenso als einen Nachteil empfindet wie der Autor, sei auf das ausführliche Literaturverzeichnis am Ende des Bandes verwiesen: Er findet dort thematisch gegliederte und meist mit knappen Kommentaren versehene Literaturhinweise, die ihm ein gezieltes Weiterarbeiten ermöglichen. Wenn das Buch auf diese Weise dazu anregen könnte, sich noch eingehender mit der französischen Zeitgeschichte zu beschäftigen, dann hätte es seinen Zweck mehr als erfüllt.
Die Entstehung dieses Buches fiel in eine turbulente Phase meiner beruflichen Existenz, die mich von Saarbrücken über Berlin nach Münster und schließlich nach Essen geführt hat. Ich habe in dieser Zeit viel freundliche Unterstützung und Ermunterung erfahren und möchte dafür einer großen Zahl von Kollegen, Freunden und Mitarbeitern danken. Ebenso danke ich meiner Familie, die diese Turbulenzen nicht nur ertragen, sondern auch mitgetragen hat. Ein besonderer Dank gilt Frau Monica Wejwar für das außergewöhnlich hohe Maß an Verständnis und Geduld, das sie als Lektorin für dieses Unternehmen aufgebracht hat. Meinem Mitarbeiter Michael Gaigalat danke ich sehr herzlich für Umsicht und Engagement bei der Erstellung eines aufwendigen Registers. Bei Stefanie Goßens, Christine Heim und Birgit Hientzsch bedanke ich mich für zuverlässige und kritische Unterstützung bei den Korrekturarbeiten.
Essen, im März 1987
Wilfried Loth
Für die Taschenbuchausgabe wurde das 17. Kapitel wesentlich erweitert: Der Bericht über die Ära Mitterrand endet jetzt nicht mehr mit der Berufung von Jacques Chirac zum Premierminister der »Cohabitation«, sondern mit der Ablösung von Michel Rocard durch Edith Cresson im Mai 1991. Der übrige Text wurde durchgesehen und geringfügig ergänzt, das Literaturverzeichnis wurde gründlich aktualisiert.
An der Gesamtaussage des Buches hat sich dadurch nichts geändert. Das Titelbild zeigt daher erneut Marianne, wie sie der Grafiker Paul Colin kurz vor der Befreiung von Paris im August 1944 gesehen hat: vom Leiden des Krieges gezeichnet und zugleich von der Aussicht auf eine glanzvolle Zukunft geblendet. Die Dialektik zwischen leidvollen Erfahrungen und produktiven Anstrengungen zur Zukunftsbewältigung stellt das Grundthema der französischen Geschichte im 20. Jahrhundert dar; von ihr geht die Faszination aus, die jeden erfaßt, der sich mit dieser Geschichte beschäftigt.
Essen, im Mai 1991
Wilfried Loth
Für die zweite Auflage der Taschenbuchausgabe (1995) wurde der Bericht über die Ära Mitterrand bis zur Wahl von Jacques Chirac zum französischen Staatspräsidenten im Mai 1995 fortgeführt. Das 17. Kapitel bietet damit jetzt einen vollständigen Überblick über die Präsidentschaft Mitterrands und zugleich eine erste knappe Bilanz seiner Leistungen. Darüber hinaus wurde das Literaturverzeichnis erneut aktualisiert.
Essen, im Juni 1995
Wilfried Loth
Einleitung: Die republikanische Synthese
Der Weg zur französischen Republik war lang und schwierig. Die erste Republik, die sich nach dem Scheitern der Bemühungen um die Errichtung einer konstitutionellen Monarchie 1792 etablierte, wandelte sich unter dem Druck der feindlichen Koalitionsheere und gegenrevolutionärer Aufstände rasch zu einem diktatorischen Terrorregime und mußte nach dem Abflauen einer äußeren Bedrohung einem bürgerlichen Direktorium Platz machen, das dann in die Herrschaft Napoleons mündete. Auf den Zusammenbruch der napoleonischen Herrschaft folgte die Restauration der Monarchie, freilich nun mit konstitutionellen Zusätzen, die die bürgerliche Rechtsordnung und die politische Mitbestimmung der Notabeln konservierten. Der Versuch der Revolutionäre von 1830, dieses Restaurationsregime durch eine neue Republik abzulösen, führte nur zur Bekräftigung der konstitutionellen Elemente in der »Julimonarchie« des Herzogs von Orléans, Louis Philippe. Ein neuerlicher revolutionärer Anlauf 1848 brachte wohl eine zweite Republik zustande; doch sorgte die Angst der Bauern und des Bürgertums vor einer sozialen Revolution bald dafür, daß Napoleon III. mit plebiszitären Mitteln ein Regime errichten konnte, das partielle Zugeständnisse an die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen mit der Unterdrückung offen republikanischer Kräfte verband.
Auch nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 stand die Republik noch nicht auf der Tagesordnung. Gewiß proklamieren die liberalen Abgeordneten des Parlaments nach der Gefangennahme Napoleons III. durch die Deutschen am 4. September 1870 eine neue Republik; aber sie taten das unter dem Druck eines Arbeiteraufstands in Paris und sahen ihre Aufgabe zumeist nur darin, gegen die Gefahr einer sozialen Revolution, die in den großen Städten drohte, die Ordnung zu wahren. Die Nationalversammlung, die im Februar 1871 im ganzen Land gewählt wurde, wies eine deutliche Mehrheit von monarchistisch gesinnten Abgeordneten auf; und als eine neue Stadtversammlung in Paris (die »Kommune«) der drohenden Restauration durch die Bildung einer föderalistischen Republik zuvorkommen wollte, gingen die Ordnungskräfte der Nationalversammlung mit Waffengewalt gegen die Hauptstadt vor. Als der provisorische »Chef der Exekutive«, Adolphe Thiers, einst Minister unter Louis Philippe, nach dem Sieg über die Kommune erkennen ließ, daß er bereit war, eine gemäßigte Form der republikanischen Ordnung zu akzeptieren, wurde er von der Versammlung gestürzt. Sein Nachfolger, General Mac-Mahon, verstand sich als Statthalter des künftigen Monarchen.
Nur ganz allmählich verschoben sich die Gewichte zur Republik hin. 1873 scheiterte der Versuch, einen neuen Monarchen zu etablieren, am Gegensatz zwischen Anhängern des traditionellen Königshauses, die auf eine Rückkehr zum Ancien régime hinarbeiteten, und »Orleanisten«, denen eine Restauration der Notabeln-Herrschaft der Julimonarchie vorschwebte. Der Thronerbe des Bourbonenhauses, Graf Henri Charles von Chambord, weigerte sich, durch einen Verzicht auf das Lilienbanner den Anhängern der Julimonarchie Entgegenkommen zu signalisieren. Notgedrungen wurde daraufhin das Mandat von Mac-Mahon um sieben Jahre verlängert. 1875 verabschiedete die Nationalversammlung eine Reihe von Verfassungsgesetzen, die Mac-Mahon zum Präsidenten der Republik beförderten, dabei aber noch offenließen, ob die Regierung allein dem Parlament oder auch dem Präsidenten verantwortlich war. Bei den Wahlen zur Abgeordnetenkammer im März 1876 errangen die Anhänger der Republik eine breite Mehrheit. Die Kraftprobe zwischen dem Präsidenten und dem Parlament, die sich daraus ergab, ging zum Nachteil MacMahons aus: Im Dezember 1877 erklärte er sich nach einem vergeblichen Versuch, das Wahlergebnis durch Neuwahlen zu korrigieren, zur Anerkennung der parlamentarischen Regierungsweise bereit; und als die republikanische Mehrheit daraufhin auch noch die Zustimmung zur Ablösung monarchistischer Kräfte in der Verwaltung, der Justiz und der Armee von ihm verlangte, trat er am 30. Januar 1879 zurück. 1880 schließlich gaben die Republikaner ihrem Sieg symbolischen Ausdruck, indem sie die Marseillaise zur Nationalhymne erklärten und den 14. Juli, den Tag der Erstürmung der Bastille im Revolutionsjahr 1789, zum Nationalfeiertag bestimmten.
Schwierigkeiten und Sieg der Republik hingen eng mit den besonderen Umständen der Industrialisierung Frankreichs zusammen. Obwohl die industrielle Produktion im Textilgewerbe und im Bergbau schon in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts begann, überwog noch während des gesamten 19. Jahrhunderts der landwirtschaftliche Produktionsbereich und schritt die Industrialisierung auch danach nur langsam fort. Der Anteil der Landwirtschaft an der Gesamtproduktion, der 1825 76 % betragen hatte, ging bis 1890 nur auf 65 % zurück und betrug zu Beginn des Ersten Weltkrieges immer noch 44 %. Über 80 % der Bevölkerung lebten zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf dem Land. 1870 waren es noch 70 % und 1911 56 %. Die Masse der Bevölkerung aber, insbesondere die zahlreichen selbständigen Kleinbauern und Pächter, orientierten sich nach der Befreiung von den Feudallasten in konservativer Richtung, aus Abneigung gegen die bürgerlichen Honoratioren ebenso wie aus Furcht vor einer sozialen Revolution, und zum Teil, besonders im Westen, auch noch aus Anhänglichkeit gegenüber der katholischen Kirche. Und die grundbesitzende Bourgeoisie, politisch und ökonomisch nach der Revolution von 1789 die einflußreichste Klasse, blieb mit Blick auf den Konservatismus der Bauern wie auf den revolutionären Unmut der Stadtbevölkerung darauf bedacht, die breite Masse der Bevölkerung vom politischen Entscheidungsprozeß fernzuhalten.
Daß sich die Republik nach 1870 mit der Zeit dennoch durchsetzen konnte, war danach auf zwei Faktoren zurückzuführen: Zum einen war die Industrialisierung nach einem Wachstumsschub in den Jahren des zweiten Kaiserreichs jetzt doch schon so weit fortgeschritten, daß die Industriebevölkerung – die Arbeiter ebenso wie die zahlreichen Angehörigen der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Zwischenschichten – politisch stärker ins Gewicht fiel. Zum anderen verstanden es die gemäßigten Republikaner um Thiers, einem Teil der Bauern und den großbürgerlichen Notabeln begreiflich zu machen, daß auch eine republikanische Ordnung sozial konservativ sein konnte. Allein schon die Niederschlagung der Kommune wirkte hier als eindrucksvoller Anschauungsunterricht; und dann sorgten eine Reihe von Verfassungsbestimmungen dafür, daß die Interessen der Landbevölkerung und der Notabeln auch bei weiterem Fortschreiten der Industrialisierung großes Gewicht behielten. So wurde neben der Abgeordnetenkammer der Senat als zweite Kammer eingeführt; dieser wurde durch Wahlkollegien auf Departementsebene gewählt, in denen die Mandatsträger der kleinen Gemeinden überproportional vertreten waren, und war der direkt gewählten ersten Kammer in der Gesetzgebung gleichgestellt; im Unterschied zu dieser konnte er aber vom Präsidenten nicht aufgelöst werden. Die erste Kammer, von deren Vertrauen die Minister abhängig waren, wurde nach dem Mehrheitswahlrecht auf der Ebene von Arrondissements gewählt, deren Zuschnitt regelmäßig hinter der tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung zurückblieb. Der Präsident wurde nicht etwa vom Volk gewählt, sondern von einer Nationalversammlung, die aus den beiden Kammern bestand.
Angesichts dieser Rückversicherungen sahen die Bauern ihre Interessen in einer republikanischen Ordnung immer noch besser aufgehoben als bei einer Rückkehr zur Notabelnherrschaft der Julimonarchie. Das Großbürgertum, mit dem die Aristokratie unterdessen mehr und mehr verschmolzen war, fand sich zum Verzicht auf die politische Dominanz bereit, nachdem sichergestellt war, daß das allgemeine Wahlrecht nicht zur Bedrohung seiner wirtschaftlichen Macht führte und sein Einfluß in der Verwaltung nicht wesentlich gemindert wurde. Und die bürgerlichen Mittelschichten, die nun das Gros des politischen Führungspersonals stellten, ohne über eine starke Exekutive zu verfügen, nahmen die Einschränkungen des republikanischen Gleichheitsideals hin, um der Republik wenigstens grundsätzlich die nötige Massenbasis zu verschaffen. So wurde ein dreifacher Kompromiß der besitzenden Klassen zur eigentlichen Grundlage des neuen Regimes und die Verteidigung des Besitzes zu seinem grundlegenden Prinzip. Bei der großen Zahl bäuerlicher Kleineigentümer, selbständiger Gewerbetreibender, Angehöriger freier Berufe, kleiner Anleger und Immobilienbesitzer und der Macht der großen Bourgeoisie in Wirtschaft und Verwaltung ergab sich daraus eine stabile Ordnung, die nicht mehr so leicht in Frage gestellt werden konnte.
Die Stabilität der Republik war um so größer, als sich die überwiegende Mehrheit der Besitzenden ökonomisch konservativ verhielt. Wohl gab es einzelne Unternehmer, die den technischen Fortschritt mit Energie in industrielle Innovation umsetzten. Die meisten Besitzer von industriellen Unternehmen blieben jedoch ängstlich darauf bedacht, den Status quo zu wahren, und schreckten vor riskanten Neuerungen zurück. Kleine und große Anleger investierten eher in gewinnträchtige Unternehmungen im Ausland als in die nationale Produktion; Bürger jeder Kategorie sparten eher als zu konsumieren. Die Geburtenrate lag, Ursache und Folge des wirtschaftlichen Malthusianismus zugleich, kaum über der Sterblichkeitsrate; und ein vielfältiges System von Außenzöllen schützte Kleinbauern wie Großgrundbesitzer, Landwirtschaft wie Industrie vor unliebsamer auswärtiger Konkurrenz. Die mangelnde Dynamik des Industriebürgertums bewahrte die Bauern und Kleinbürger vor dem wirtschaftlichen Abstieg und sorgte so für eine Fortdauer der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Gleichzeitig öffnete die Beteiligung am Finanzkapital der Masse der kleinen Eigentümer grundsätzlich die Aussicht auf einen Aufstieg in höhere Gesellschaftsschichten und beugte so etwaigem Unmut über die äußerst ungleiche Einkommensverteilung vor. Der Kompromiß der Besitzenden, der die Republik trug, wurde damit noch bekräftigt und verlor auch über längere Zeit hinweg nichts von seiner Bedeutung.
Außerdem verwandten die Republikaner nach ihrem Sieg erhebliche Anstrengungen darauf, die große Masse der Bevölkerung, auf dem Land wie in den unterbürgerlichen Schichten, auch ideologisch für die republikanische Ordnung zu gewinnen. Unter der Führung von Jules Ferry, 1879 bis 1885 in wechselnden Kabinetten Unterrichts- und Premierminister, beseitigten sie Schritt für Schritt den bis dahin dominierenden Einfluß der Kirche auf das Schulwesen und etablierten ein laizistisches Schulsystem, das wissenschaftlichen Rationalismus mit der Vermittlung bürgerlicher Tugenden verband. Insbesondere die Lehrer an den Primarschulen (die »Instituteurs«) verbreiteten nun, von der Aufsicht des Klerus und der lokalen Honoratioren befreit, bis ins letzte Dorf hinein ein einheitliches Nationalbewußtsein, in dem die Republik als Inkarnation der Nation, Vollendung der Revolution von 1789 und Garantin für die Verwirklichung der universalen Ziele der Menschheit erschien. Neben ihnen wirkten die Freimaurer mit der Fülle ihrer Organisationen, Zeitungen und überparteilichen Verbindungen als Multiplikatoren der aufklärerischen und republikanischen Ideale, die die dritte Republik über pragmatische Nützlichkeitserwägungen hinaus auch emotional fest in den Herzen einer wachsenden Mehrheit der Nation verankerten und einen nationalen Konsens stifteten, der über die Solidarisierungseffekte der Revolution oder der beiden napoleonischen Unternehmungen hinausging.
Über die affektive Zustimmung zu den republikanischen Idealen hinaus wirkte ein militanter Patriotismus integrationsfördernd, der an die Tradition der Revolutionskriege anknüpfte und damit Bedürfnisse abdeckte, die sich auch schon die beiden Napoleons zunutze gemacht hatten. Er kristallisierte sich besonders um die Sorge um die 1871 verlorenen Provinzen Elsaß und Lothringen und den daraus resultierenden Gegensatz zum Deutschen Reich. Die Armee, die diese Provinzen einst zurückbringen sollte, wurde zum Objekt allgemeiner Begeisterung und, besonders seit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1889, zu einer weiteren »Schule der Nation«; ihre Aufmärsche und Paraden nahmen den Charakter von nationalen Feiertagen an. Daneben fanden nationales Prestigedenken und Hochschätzung der »zivilisatorischen Mission« Frankreichs auch in der Unterstützung für die koloniale Expansion Ausdruck, die Ferry mit Vorstößen nach Tunesien, Madagaskar und Indochina in Angriff nahm. Diese Politik blieb nicht unumstritten, vor allem weil sie zu einer Annäherung an das Deutsche Reich führte; nachdem aber eine Militärkonvention mit Rußland 1892 die Position Frankreichs gegenüber Deutschland gestärkt hatte, wurden weitere Erwerbungen in West- und Äquatorialafrika sowie das Vordringen nach Marokko von einer breiten Zustimmung zur Vergrößerung des französischen »Rangs« in der Weltpolitik getragen.
Missionarischer Republikanismus und Patriotismus reichten freilich nicht aus, um den Republiken in der gesamten Nation die nötige Legitimität zu verschaffen. Die katholische Kirche, die die Bemühungen um eine Rückkehr zur Monarchie nach Kräften unterstützt hatte, blieb unter dem Einfluß ultramontaner Kreise auch nach dem Sieg der Republikaner die Wortführerin einer Wiederherstellung des Ancien régime und wurde damit zum Kristallisationspunkt für jede Art reaktionärer Bewegung. Die ideologische Offensive der Republikaner nahm darum auf weite Strecken den Charakter eines antiklerikalen Feldzuges an, der nicht nur der Verbreitung der Aufklärung galt, sondern auch der Beseitigung des kirchlichen Zugriffs auf den Staat. Sie hatten damit aufs Ganze gesehen Erfolg – zum einen, weil sie in der Kräftekonstellation, die sich Ende der 1870er Jahre herausgebildet hatte, über die stärkeren Bataillone verfügten; zum anderen aber auch, weil ihr Programm der allgemeinen Säkularisierungstendenz des Jahrhunderts entsprach. Dennoch konnten sie nicht verhindern, daß sich Zentren des Widerstands gegen die Vereinnahmung für die Republik bildeten und diese infolge der Defizite der republikanischen Ordnung auch wieder neue Unterstützung fanden.
Daneben hatte die Republik auch Schwierigkeiten, in den Reihen der Arbeiter genügend Unterstützung zu finden. Mit fünf bis sechs Millionen ein knappes Drittel der Aktivbevölkerung, lebten die Arbeiter in dieser Republik unter sehr unterschiedlichen Bedingungen: häufig noch in Betrieben mit einigen wenigen Beschäftigten, in den großen Städten in Kontakt mit dem Kleinbürgertum, in den neuen Industrieaggloremationen teils brutal ausgebeutet und teils paternalistisch kontrolliert. Eine einheitliche Arbeiterbewegung konnte unter diesen Voraussetzungen nur sehr schwer zustande kommen; in der Regel ließen aber die ständige Unsicherheit des Arbeitsplatzes, die ununterbrochene Erschöpfung in einem Zwölfstundentag, der Ausschluß vom kulturellen Leben und das Fehlen jeglicher Perspektive auf einen sozialen Aufstieg die Distanz zu den übrigen Klassen deutlich hervortreten. In diese Welt konnte der republikanische Diskurs wohl grundsätzlich vordringen, insofern er die Gleichheit der Individuen betonte und die Macht der Feudalherren und Notabeln attackierte. Da sich die Republikaner im Interesse an der Konsolidierung des bürgerlichen Kompromisses aber hüteten, ihre Kritik an den Mächtigen auch auf die neuen Herren der Industriegesellschaft auszudehnen, und die Koalition der Besitzenden folglich kaum Anstalten traf, die materielle Situation der Arbeiter zu verbessern und ihre gesellschaftliche Isolation abzubauen, blieben die Beziehungen der Republik zu diesem Teil der Gesellschaft prekär.
Die Schwächen der republikanischen Synthese wurden erstmals 1887 deutlich, als die gemäßigten Republikaner einen militanten Kriegsminister, der zur Konfrontation mit dem Deutschen Reich drängte, aus dem Amt entließen: Binnen kurzem sammelte dieser General Georges Boulanger so viele Stimmen nicht nur fanatischer Nationalisten, sondern auch von oppositionellen Arbeitern und enttäuschten Kleinbürgern, daß er mit Unterstützung monarchistischer und bonapartistischer Kreise zu einer Herausforderung für das noch wenig gefestigte Regime wurde. Auf eine Reihe spektakulärer Erfolge in Nachwahlen gestützt, forderte er eine Stärkung der Exekutive auf Kosten der Parlamentsherrschaft, verbunden mit grundlegenden sozialen Reformen und dem Übergang zu einer offen revanchistischen Außenpolitik. Nachdem er im Januar 1889 einen triumphalen Wahlsieg in Paris errungen hatte, schien vielen Beobachtern schon das Ende der Republik gekommen. Boulanger widersetzte sich freilich den Abenteurern, die ihn zu einem Staatsstreich drängten; und in den allgemeinen Wahlen im September des gleichen Jahres zeigte sich dann, daß die Koalition seiner Anhänger doch zu heterogen war und der Einfluß des Republikanismus auf dem Lande schon zu weit fortgeschritten, um die republikanische Mehrheit wirklich zu gefährden.
Mit der Beschleunigung des industriellen Wachstums in der Hochkonjunkturperiode, die Mitte der 1890er Jahre begann und mit Unterbrechungen im ersten Jahrfünft nach der Jahrhundertwende bis zum Jahr 1913 dauerte, wuchsen die oppositionellen Strömungen weiter an. Die Arbeiter, zahlenmäßig nun etwas stärker, empfanden die Diskrepanz zum bürgerlichen Wohlstand trotz allmählicher Besserung der Einkommensverhältnisse stärker denn je. Ein kleiner Teil von ihnen – fünf bis sechs Prozent – engagierte sich in einer Gewerkschaftsbewegung, die sich zunehmend den Thesen des revolutionären Syndikalismus verschrieb; andere begannen, statt der Republikaner sozialistische Abgeordnete zu wählen. In den kleinbürgerlichen Kreisen griff die nationalistische Erregung weiter um sich, oft verbunden mit antisemitischen Attacken und antiparlamentarischer Frontstellung. Und auch in den oberen Gesellschaftsklassen bekam der Nationalismus jetzt manchmal eine antiparlamentarische Färbung und fand der Katholizismus als defensive Ordnungsideologie neue Resonanz. Eine einheitliche Oppositionsbewegung entwickelte sich daraus allerdings nicht mehr; vielmehr eilten die Sozialisten und mit ihnen viele Arbeiter der Republik gegen die Bedrohung durch eine neue Rechte zu Hilfe.
Zum Katalysator dieser Entwicklung wurde von 1897 an die Affäre um einen jüdischen Offizier, Alfred Dreyfus, der zu Unrecht wegen Spionage verurteilt worden war: Der Versuch, Dreyfus zu rehabilitieren, führte auf der einen Seite zu einem Ausbruch nationalistischer und antisemitischer Agitation, die sich bald auch gegen die Republik und ihre Repräsentanten richtete, und auf der anderen Seite zu einer Bekräftigung des republikanischen Idealismus, für den sich nun, beginnend mit einer fulminanten Attacke des Schriftstellers Emile Zola gegen die Vertuschungsmanöver der Exekutive, eine große Zahl von Intellektuellen engagierte. Vor dem Hintergrund der erbitterten Auseinandersetzung fand sich ein Teil der bürgerlichen Republikaner bereit, zur Verteidigung republikanischer Prinzipien auch mit den Sozialisten zusammenzuarbeiten, und entschlossen sich die parlamentarischen Wortführer der Sozialisten, meist selbst bürgerlicher Herkunft, die republikanische Ordnung gegen die Allianz der militanten Rechten und der Ordnungskräfte in Armee und Kirche zu verteidigen. Im Juni 1898 bildete der gemäßigte Republikaner René Waldeck-Rousseau ein Kabinett, dem mit Alexandre Millerand zum erstenmal ein sozialistischer Minister angehörte.
Das Bündnis aus Sozialisten, radikalen Republikanern und einem Teil der gemäßigten Republikaner, das damit begründet wurde, setzte die Autorität des Staates ein, um die Agitation der rechtsextremen Ligen unter Kontrolle zu bringen, beseitigte Widerstände in der Armee gegen eine Revision des Dreyfus-Falles und nahm dann den Kampf gegen den Einfluß der Kirche auf Staat und Gesellschaft wieder auf. Die religiösen Kongregationen, deren Vermögen und Aktivität im höheren Schulwesen beträchtlich zugenommen hatten, wurden einer staatlichen Genehmigungspflicht unterworfen, die restriktiv gehandhabt wurde; dann, nach der Ausweisung zahlreicher nichtzugelassener Ordensleute, wurde ihnen die Erteilung von Unterricht ganz verboten; und schließlich wurde 1905 ein Gesetz über die Trennung von Kirche und Staat beschlossen, das die Mitwirkungsrechte des Staates bei der Berufung des Klerus beseitigte und zugleich die finanzielle Unterstützung der Kirche durch den Staat abschaffte. Parallel dazu wurden einige Sozialgesetze verabschiedet, die der Ausbeutung der Arbeiter erste Grenzen setzten: So wurde die tägliche Arbeitszeit auf zehn Stunden begrenzt, ein wöchentlicher Ruhetag verpflichtend eingeführt, eine staatliche Unterstützung für die Altersversorgung beschlossen und eine bescheidene Versicherung für den Krankheitsfall organisiert.
Infolge der Zusammenarbeit der laizistischen Linken im sogenannten »Block« – an dessen Spitze die wachsende Zahl der radikalen Republikaner stand, seit 1901 in einer lockeren »Parti radical et radical-socialiste« organisiert – konnte die republikanische Ordnung gefestigt werden, insbesondere in der Verwaltung und im öffentlichen Bewußtsein. Sie reichte jedoch nicht hin, die Kluft zwischen den bürgerlichen Kreisen und den Arbeitern wirklich zu überwinden. Was an Sozialgesetzen verabschiedet wurde, blieb weit hinter den Erwartungen der Sozialisten zurück; Anläufe zur Durchsetzung eines generellen Schlichtungsverfahrens für Arbeitskämpfe und zur Einführung einer Einkommenssteuer scheiterten ganz. Die Widerstände eines Teils der Sozialisten gegen eine Beteiligung an einer »bürgerlichen« Regierung konnten folglich nicht überwunden werden; die Gewerkschaftsbewegung rückte weiter vom parlamentarischen Sozialismus ab; und von 1904 an erschütterten zunehmend heftigere Streikbewegungen das Land. Als dann die Wahlen vom Mai 1906 den radikalen Republikanern und ihren gemäßigten Verbündeten eine Mehrheit auch ohne die Stimmen der Sozialisten einbrachten, zerbrach der Block an den wachsenden Klassenspannungen: Ministerpräsident Georges Clemenceau, einer der historischen Wortführer des radikalen Republikanismus, ging mit allen Mitteln staatlicher Macht gegen die Streikbewegungen vor und trieb die Sozialisten damit in die Opposition.
Die Kluft zwischen der bürgerlich-republikanischen Mehrheit und der Arbeiterbewegung wurde noch vertieft durch die Zuspitzung der internationalen Lage. Während die revolutionäre Linke eine heftige antimilitaristische Agitation entwickelte und die republikanischen Sozialisten mit einer Minderheit der radikalen Republikaner auf Verständigung und internationale Schiedsgerichtsbarkeit drängten, betrieb die Regierungsmehrheit, zur Kraftprobe mit dem Deutschen Reich bereit, die Stärkung der Armee und fand darüber auch wieder zur Zusammenarbeit mit den gemäßigt-konservativen Republikanern zurück, die die Wende zum laizistischen »Block« nicht mitvollzogen hatten. Im Juli 1913 wurde die Militärdienstzeit mit den Stimmen der Rechten und gegen einen Teil der Linken von zwei auf drei Jahre verlängert. Danach konnten die Gegner der dreijährigen Dienstzeit in den Wahlen vom April/Mai 1914 beträchtliche Stimmengewinne erzielen, und es wurde für die regierenden Republikaner immer schwieriger, zwischen Antirepublikanismus auf der einen und Pazifismus auf der anderen Seite eine solide Basis für die Regierungsarbeit zu finden.
Damit war eine Fortentwicklung der Republik über die Festigung des Status quo hinaus auf absehbare Zeit blockiert: Die prekären Mehrheitsverhältnisse erlaubten weder einen antiparlamentarischen Rechtsruck noch energische Schritte zur Integration der Massen der Industriegesellschaft in das republikanische Gemeinwesen. Die Republik blieb auf die gesellschaftlichen Verhältnisse ihrer Gründungsära fixiert: gegründet auf den Kompromiß der Besitzenden und am Zielbild einer vorindustriellen Bürgergesellschaft orientiert. Angesichts der geringen Dynamik der französischen Industrialisierung ließ sich damit gewiß für längere Zeit leben. Auf Dauer stellte sich freilich die Frage, wie lange sich die Republik gegen die Klassenspannungen behaupten konnte, die zu überwinden sie nicht in der Lage war.
1 Frankreich im Ersten Weltkrieg
Als das Deutsche Reich am 3. August 1914 der Französischen Republik den Krieg erklärte, glaubten viele zeitgenössische Beobachter zunächst an einen gewaltsamen Ausbruch der Klassengegensätze zwischen französischer Bourgeoisie und französischen Arbeitern. Die Arbeiterorganisationen hatten die Spannungen zwischen den Großmächten als Ausdruck imperialistischer Ambitionen des großen Kapitals verstanden und in ihrem Kampf gegen den Imperialismus auch die Kapitalistenklasse des eigenen Landes nicht geschont; sie hatten sich in Kontakten mit der deutschen Sozialdemokratie um die Entwicklung einer gemeinsamen Kriegsverhütungsstrategie bemüht, und sie hatten vor allem die Ausrufung des Generalstreiks als Mittel gegen die Entfesselung eines Krieges ernsthaft ins Auge gefaßt. Im Verlauf der Juli-Krise 1914 hatte ihre Partei, die sich seit 1905 demonstrativ internationalistisch »Französische Sektion der Arbeiter-Internationale« nannte (»Section Française de l’Internationale Ouvrière« oder abgekürzt SFIO), das Bekenntnis zum Generalstreik auf einem Parteitag noch einmal bekräftigt; und der Parteiführer Jean Jaurès hatte die Kraft der pazifistischen Bewegung bei den Regierungsverantwortlichen zur Geltung zu bringen versucht. Die Staatsmacht hatte die organisierte Arbeiterbewegung als ersten Feind ausgemacht, der im Falle eines Krieges auszuschalten war; und sie hatte darum als Teil der Mobilmachung die Verhaftung aller bedeutenden Partei- und Gewerkschaftsführer (aufgelistet in dem berüchtigten »Carnet B«) vorgesehen. Ein nationalistischer Fanatiker war darüber hinausgehend schon zur Tat geschritten: Er hatte Jaurès am Abend des 31. Juli erschossen.
1.1 Die »Union sacrée«
Tatsächlich erwies sich aber die nationale Solidarität als stärker als die Klassenspannungen. Beide Seiten, Regierung und Arbeiterführer, schreckten vor der vorgesehenen Konfrontation zurück und verbündeten sich statt dessen zur Abwehr des äußeren Feindes. Nachdem Innenminister Malvy am 1. August im Kabinett die Suspendierung der Verhaftungsdekrete durchgesetzt hatte, rief Gewerkschaftsführer Léon Jouhaux am 4. August die Arbeiter am Grabe von Jaurès zum Kampf gegen den deutschen Militarismus und Feudalismus auf; gleichzeitig stimmten die sozialistischen Abgeordneten in der Nationalversammlung der Übertragung aller Vollmachten zur Kriegsführung an die Regierung zu. Am 26. August traten zwei führende Sozialisten, Marcel Sembat und Jules Guesde als Minister in die Regierung Viviani ein, die damit den Charakter einer überparteilichen Notstandsregierung annahm. Die Angst vor der Konfrontation mit den Klassenfeinden wich einer ungeheueren nationalen Begeisterung, in der sich die Erleichterung über die Versöhnung der Klassen ebenso widerspiegelte wie die Hoffnung, die gesellschaftlichen Konflikte nun endlich im Sinne der eigenen Klasse lösen zu können.
Bei der Entscheidung der Arbeiterorganisationen für die »Union sacrée« bildete die Wahrnehmung der akuten internationalen Krise eine wichtige Rolle: Die Verhandlungen, die Jaurès mit den Regierungsverantwortlichen geführt hatte, hatten den Eindruck hinterlassen, daß die eigene Regierung nicht um jeden Preis kriegslüstern war, während die deutsche Führung nach der Kriegserklärung des Reiches an Rußland und dem Einmarsch deutscher Truppen in Belgien um so aggressiver erschien; am defensiven Charakter der französischen Kriegsanstrengungen herrschte folglich kein Zweifel. Gleichwohl verbliebene Bedenken gegen eine Mitwirkung an dem Krieg des bürgerlichen Staates zerstreuten sich, als die deutschen Sozialdemokraten am 3. August ihrer Regierung Kriegskredite bewilligten: auf eine wirkungsvolle Aktion des internationalen Proletariats war danach definitiv nicht mehr zu hoffen. Wichtiger als die Revision des Bildes vom eigenen Staat wie von der internationalen Arbeiterbewegung war indessen das Ausmaß der Integration der Arbeiterklasse in die bürgerlich dominierte Gesellschaft, das trotz aller verbliebenen Spannungen unterdessen erreicht war und nun im Moment der Entscheidung sichtbar wurde. Die Arbeiterbewegung stand nicht mehr unter dem Druck einer gewaltsamen Repression über nationale Grenzen hinweg, wie sie in der Entstehungsphase des Arbeiter-Internationalismus 1848 und 1871 vorgekommen war; sie konnte sich die Organe des bürgerlichen Staates für ihre Interessen zunutze machen; und ihre Anhänger waren auf vielfältige Weise in die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse eingebunden. Das Konzept des Reformismus, das in dieser Situation ohnehin nahelag, gewann nun durch die Erfahrungen der ersten August-Tage rasch an Plausibilität; gleichzeitig trugen reformistische Hoffnungen dazu bei, die Hinwendung zur »Union sacrée« zu bekräftigen: Was an sozialer Emanzipation und gesellschaftlichem Aufstieg bis zur Gleichberechtigung noch fehlte, sollte nun durch die Demonstration nationaler Unentbehrlichkeit und Zuverlässigkeit erreicht werden.
Die gesellschaftliche Entwicklung in den ersten Kriegsmonaten schien dieses Kalkül zu bestätigen: der kriegsbedingte Aufschwung der Industrie führte zur Vollbeschäftigung und damit zur Stärkung der strategischen Position der Arbeiter im Arbeitskampf. Entsprechend stiegen die Arbeiterlöhne und verbesserte sich die materielle Lage der Arbeiter; das wirtschaftliche Überleben wurde spürbar leichter. Die Arbeiter in den kriegswichtigen Produktionsbereichen brachten es sogar zu einem bescheidenen Wohlstand; auch wurden sie zumeist vom Militärdienst freigestellt, häufig sogar, nachdem sie in den ersten Kriegswochen zunächst an die Front geschickt worden waren. Die Angehörigen der Mittelklassen, insbesondere Angestellte und Rentenempfänger, mußten demgegenüber beträchtliche materielle Verluste einstecken: hier fiel durch Einberufung zu den Truppen vielfach der Ernährer aus; und die steigenden Preise wurden nicht durch entsprechend oder gar überproportional steigende Gehälter ausgeglichen. So verlor die Trennungslinie zwischen Arbeitern und Mittelklassen materiell an Bedeutung und stieg zumindest ein Teil der Arbeiter auch gesellschaftlich nach oben.
Die Integration der Arbeiter kam noch einen gewaltigen Schritt weiter voran, als der Jaurès-Schüler Albert Thomas im Mai 1915 das Amt eines Staatssekretärs für die Kriegsproduktion übernahm. Thomas hatte diese Berufung dem Umstand zu verdanken, daß die Arbeiter unterdessen erhebliche strategische Bedeutung für den Kriegserfolg gewonnen hatten; und er suchte diesen strategischen Wert der Arbeiterklasse nun dazu zu nutzen, unter Hinweis auf die Erfordernisse des Krieges partnerschaftliche Sozialstrukturen durchzusetzen. Er widersetzte sich mit Erfolg allen Versuchen der Unternehmerseite, bestehende Arbeiterrechte im Zuge der Kriegsanstrengungen einzuschränken, sorgte für sozialstaatliche Eingriffe in das Wirtschaftsleben, die den bislang herrschenden wirtschaftsliberalen Prinzipien strikt zuwiderliefen, und richtete auf allen Ebenen kooperativ angelegte Institutionen ein. Über die Regelung der Arbeitsbedingungen wurde unter seiner Vermittlung in gemischten Kommissionen von Unternehmern und Gewerkschaftsvertretern verhandelt. Neue Produktionsstätten für die Kriegsproduktion wurden, beginnend mit einer Modellfabrik in Roannes, nach Mitbestimmungsgrundsätzen organisiert. Und zur Bekämpfung der Konsumverteuerung unterstützte er nach Kräften die Errichtung von Kooperativen, die er als Keimzellen einer künftigen sozialistischen Gesellschaftsordnung verstand.
Der Umbau des bürgerlich dominierten Klassenstaats zu einem Sozialstaat, den Thomas auf diese Weise Schritt für Schritt vornahm, blieb nicht ohne Widerspruch. Auf der einen Seite warnten Unternehmer und liberale Ideologen vor einem Ausverkauf der bürgerlichen Freiheiten an den Kollektivismus; auf der anderen Seite wurde in den Reihen der Arbeiter wiederholt der Verdacht geäußert, der sozialistische Staatssekretär betreibe letztlich doch das Geschäft der Kapitalistenklasse. Diese Widerstände schränkten Thomas’ Aktionsmöglichkeiten ein, so daß er insbesondere das Problem einseitiger Kriegsgewinne nicht in den Griff bekam; sie waren aber lange Zeit nicht stark genug, um die »Union sacrée« ernsthaft zu erschüttern. Bis ins Jahr 1917 hinein wirkte der Krieg auf die französische Gesellschaft eher integrierend als desintegrierend.
1.2 Erschütterungen des nationalen Konsenses
Die Erosion der »Union sacrée« begann, als deutlich wurde, daß der Krieg bedeutend länger dauern und bedeutend mehr Opfer verlangen würde, als ursprünglich angenommen worden war. Die französische Kriegsplanung war darauf abgestellt gewesen, den Deutschen in den ersten Kriegswochen erfolgreiche Abwehrschlachten in Lothringen und nördlich von Verdun zu liefern; danach sollte der Einbruch der russischen Armeen im Osten die Deutschen zwingen, einen Teil ihrer Truppen von der Westfront abzuziehen und dann in kurzer Frist vor der Übermacht der Flügelmächte zu kapitulieren. Tatsächlich waren es aber zunächst die Deutschen, die die Kämpfe im Nordosten Frankreichs gewannen; am 2. September 1914 floh die Regierung aus der bedrohten Hauptstadt nach Bordeaux. Als die Deutschen Truppen an die Ostfront verlegen mußten, kam der deutsche Vormarsch zwar in der zweiten Septemberwoche zum Stillstand (das »Wunder an der Marne«); die Deutschen standen aber nun tief in französischem Territorium, und die Franzosen waren nicht stark genug, sie aus eigener Kraft wieder hinauszudrängen. Von Mitte September bis Mitte November lieferten sich die feindlichen Armeen von der Marne aus zunächst nach Nordwesten und dann immer weiter nach Norden vorstoßend eine ganze Serie von Schlachten; dann war im Norden das Meer erreicht und insgesamt von Belfort bis Nieuport eine Front errichtet, die sich auch unter großen Anstrengungen nicht mehr wesentlich verschieben ließ.
Im Winter 1914/15 erstarrte der Krieg auf französischem Boden so zum Stellungskrieg, in dem beide Seiten unter ungeheurem Einsatz von Material und Menschenleben versuchten, eine Entscheidung zu ihren Gunsten zu erzwingen. Trotz der Fülle der Attacken und Materialschlachten gab es jedoch das ganze Jahr 1915 über keinerlei Frontbewegung; und auch die großen Offensiven des Jahres 1916 brachten keine Entscheidung, weder die deutsche Offensive vor Verdun im Februar noch die Offensive der Franzosen und ihrer britischen Verbündeten an der Somme im Juli. Dabei kostete allein die letzte Schlacht die Alliierten 615000 Tote, während die Deutschen 650000 Opfer zu beklagen hatten. Ein Ende des mörderischen Ringens war aber auch danach noch nicht abzusehen.
Das schreiende Mißverhältnis zwischen Einsatz und Ergebnis ließ im Laufe des Jahres 1915 erste Stimmen aufkommen, die einem Abbruch der Kriegsanstrengungen ohne durchschlagendes Ergebnis das Wort redeten. Im bürgerlichen Lager sammelte der frühere Ministerpräsident Joseph Caillaux Befürworter eines Verhandlungsfriedens, die bereit waren, auf eine Rückgewinnung Elsaß-Lothringens zu verzichten, und weitgehende, auf den Erwerb des linken Rheinufers zielende Expansionspläne scharf bekämpften. Ihre Initiativen fanden jedoch vorerst wenig Echo; der bürgerliche Pazifismus blieb auf kleine intellektuelle Zirkel beschränkt. Wichtiger wurden die Sammlungsbemühungen des revolutionären Syndikalisten Alphonse Merrheim in den Reihen der Arbeiterbewegung: Als er im September 1915 an der internationalen Sozialistenkonferenz in Zimmerwald teilnahm, war er zwar noch relativ isoliert; im April 1916 stimmten auf einem SFIO-Parteitag aber schon ein Drittel der Delegierten gegen die Fortführung der »Union sacrée« und für einen Frieden ohne Annexionen.
Verstärkt wurde die Anti-Kriegs-Bewegung in den Reihen der Linken dadurch, daß der Krieg mit der Zeit neue gesellschaftliche Ungleichheiten produzierte und das Regime nicht in der Lage, zum Teil auch gar nicht willens war, die spektakulären Ungleichheiten wieder abzubauen. Die Kriegsanstrengungen wurden nicht durch neue Steuern finanziert, sondern durch Auslandsanleihen und vor allem durch kurzfristige Schatzanweisungen, die denjenigen, die über genügend Kapital verfügten, die Möglichkeit verschafften, am Krieg noch zu verdienen. Gleichzeitig ermöglichten die besonderen Umstände der Kriegsproduktion bestimmten Produzenten geradezu phantastische Profite: für die Herstellung kriegswichtiger Produkte erhielten sie staatliche Finanzhilfen; sie konnten ihre Preise nach oben treiben, weil ihnen die staatliche Absatzgarantie die Sorge nahm, auf ihren Produkten sitzen zu bleiben; ihre Gewinne aber blieben im wesentlichen unversteuert. Der Entwurf eines allgemeinen Einkommenssteuergesetzes blieb in den Parlamentsausschüssen hängen; und von einer besonderen Kriegsgewinnsteuer war erst gar nicht die Rede. Viele Kriegsgewinnler stellten ihren neuen Reichtum demonstrativ zur Schau; und so entwickelte sich Paris (das seit Ende 1914 wieder Regierungssitz war) bald zur mondän-anrüchigen »Hauptstadt des Vergnügens«, deren Frivolität in einem bitter empfundenen Kontrast zu den Leiden und Opfern stand, die an der Front zum Teil auch draußen im Land erbracht werden mußten.
Das Handeln der zivilen und der militärischen Führung wurde unterdessen durch vielfältige Querelen verhindert: Es gab Spannungen zwischen der Zivilregierung und dem militärischen Hauptquartier unter Generalstabschef Joseph Joffre, das die Mitsprache der Zivilisten am liebsten ganz ausschalten wollte; es gab offen ausgetragene Rivalitäten zwischen den militärischen Führern; und es gab, je größer die Unzufriedenheit mit der Exekutive wurde, immer mehr parlamentarische Initiativen, die der Zivilregierung das Leben schwermachten, die meist de facto bestimmenden Militärs aber nicht erreichten. Ministerpräsident Viviani kapitulierte im Oktober 1915 vor den Kritiken aus den Reihen der Nationalversammlung; aber auch seinem Nachfolger Aristide Briand, der seine Politikerkarriere ursprünglich als Sozialist begonnen hatte, gelang es nicht, größere Autorität zu erringen. Als die Kritik nach dem Fehlschlag der Somme-Schlacht stark anwuchs, unternahm Briand Ende 1916 den Versuch einer Stärkung der Regierungsgewalt: Joffre sollte in ein vierköpfiges Kriegskomitee eingebunden werden, das dem Kabinett die Entscheidungen abnahm; und das Parlament sollte der Regierung die Vollmacht erteilen, kriegswichtige Entscheidungen per Dekret durchzusetzen. Das Vorhaben schlug jedoch fehl: Die Nationalversammlung zeigte sich so feindlich, daß Briand erst gar nicht wagte, um die außerordentlichen Vollmachten zu bitten; und Joffre demissionierte. Im März 1917 mußte auch Briand seinen Abschied nehmen, nachdem sein Kriegsminister Lyautey öffentlich die Verschwiegenheit der Abgeordneten in kriegswichtigen Angelegenheiten in Frage gestellt hatte. Nachfolger wurde das älteste Mitglied des bisherigen Kabinetts, Alexandre Ribot, der nun noch weniger in der Lage war, eine effektive Kriegsregierung aufzubauen.
Karte 1: Truppenbewegungen 1914–1918
1.3 Die Krise des Jahres 1917
Wie brüchig der nationale Konsens unterdessen geworden war, zeigte sich im Frühjahr 1917, als sich die militärische Lage des Landes deutlich verschlechterte und ein Sieg der Deutschen in den Bereich des Möglichen rückte. Der deutsche Rückzug um 15 bis 40 km hinter die Befestigungen der »Siegfriedlinie« brachte die alliierten Offensivpläne durcheinander, so daß eine Entscheidung an der deutsch-französischen Front auf unabsehbare Zeit nicht mehr zu erzwingen war. Gleichzeitig setzte der uneingeschränkte U-Boot-Krieg voll ein; und es war zu befürchten, daß er seine Wirkung tun würde, ehe die USA, die die deutsche Entscheidung für den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erwartungsgemäß mit der Kriegserklärung beantwortet hatten, den Alliierten wirkungsvoll zu Hilfe kommen konnten. Hinzu kam dann noch, daß der russische Verbündete de facto ausfiel: Seit der russischen Februarrevolution war die russische Armee in Auflösung begriffen. Entsprechend ließ die Kampfmoral bei den französischen Truppen nach, und die parallele Entmutigung auf seiten der Briten verstärkte dann noch die allgemeinen Ermüdungserscheinungen.
Die offensichtliche Sinnlosigkeit der vielen Kleinattacken, bei denen Menschenleben ohne erkennbaren Erfolg geopfert wurden, führten im Mai und Juni 1917 zu einer Reihe von Meutereien, an denen insgesamt 30000 bis 40000 Soldaten beteiligt waren. Am 29. Juni marschierten sogar zwei Regimenter entgegen ihren Befehlen von Soissons nach Paris, um von der Nationalversammlung eine Entscheidung für einen unmittelbaren Friedensschluß zu erzwingen. Im Landesinneren kam es zu zahlreichen Arbeitsniederlegungen: Nachdem es 1915 im Zeichen der »Union sacrée« so gut wie keine Streikbewegungen gegeben hatte und 1916 immerhin schon 41000 Arbeiter in den Ausstand getreten waren, zählte man nun im Laufe des Jahres 1917 nicht weniger als 696 Streikaktionen mit insgesamt 293800 Beteiligten. In den Gewerkschaftsorganisationen waren die revolutionären Syndikalisten um Merrheim gegenüber den Reformisten um Generalsekretär Jouhaux im Vormarsch; und auch in der sozialistischen Partei gerieten die Verteidiger der »Union sacrée« zusehends in die Defensive. Seit der Petersburger Sowjet im März 1917 zu einem »Frieden ohne Annexionen und Kontributionen« aufgerufen hatte, war in der Arbeiterbewegung keine Mehrheit für eine offensive Kriegsführung mehr zu finden.
Die Meutereien fanden ein rasches Ende, als Philippe Pétain, der Verteidiger von Verdun, am 15. Mai zum neuen Oberkommandierenden der beiden Nordarmeen berufen wurde und Ferdinand Foch das Amt des Generalstabschefs übernahm. Die neue militärische Führung entschied sich, die sinnlos gewordenen Attacken zugunsten einer defensiven Strategie aufzugeben: Damit fiel der wesentliche Grund für die Auflehnung weg. Außerdem ergriff Pétain energische Maßnahmen zur Wiederherstellung der Disziplin. Etwa ein Zehntel der Meuterer wurden von Kriegsgerichten verurteilt, davon 554 zum Tode. Ausgeführt wurden aber schließlich nur 49 Todesurteile; und dann kümmerte sich Pétain persönlich um erträglichere Kampfbedingungen für seine Soldaten, was ihm persönlich große Popularität unter den Kämpfenden einbrachte und allgemein zur Beseitigung vieler Unzulänglichkeiten des militärischen Apparats führte. Damit war die militärische Krise entschärft; die Nordarmeen stärkten ihre Kräfte in der Defensive und warteten im übrigen die Entscheidungen auf anderen Kriegsschauplätzen ab.
Die »Union sacrée« im politischen Bereich war dagegen nicht mehr zu retten. Bei den Sozialisten konnten die militanten Kriegsgegner zwar noch nicht die Mehrheit erringen; jedoch verloren die Verfechter der »Union sacrée« die Kontrolle über die Partei an eine dritte Gruppe, das »Zentrum« um den Marx-Schwiegersohn Jean Longuet und Marcel Cachin, die sich den russischen Vorschlägen gemäß mit den Sozialisten aller kriegsführenden Länder über einen Friedensschluß verständigen wollten. Ende Mai beschloß der Nationalrat der SFIO einstimmig die Entsendung von Delegierten zu der sozialistischen Verständigungskonferenz, die auf Initiative der niederländischen Parteifreunde nach Stockholm einberufen worden war. Unter dem Druck der Militärs und der nationalistischen Kräfte, die in dem Vorhaben ein Manöver zur Destabilisierung der eigenen Front sahen, entschied sich die Regierung Ribot jedoch dafür, den sozialistischen Delegierten die erforderlichen Pässe vorzuenthalten. Damit war die »Union sacrée« zerbrochen: Die Mehrheit der Sozialisten war nicht bereit, sich länger an einer Regierung zu beteiligen, die offensichtlich expansionistische Kriegsziele verfolgte und damit die Kriegsleiden unnötig verlängerte. Als die parlamentarische Rechte die Regierung Ribot wegen zu großer Nachgiebigkeit gegenüber Streikenden und Meuterern Anfang September zu Fall brachte, mußte Thomas sehr gegen seinen Willen das Amt des Rüstungs-Staatssekretärs aufgeben; in der neuen Regierung unter dem Vorsitz von Paul Painlevé waren die Sozialisten nicht mehr vertreten.
Damit rückte, ohne daß der militärische Erfolg schon gesichert war, die Gefahr eines Zusammenbruchs der inneren Front näher. Die alten Klassenspannungen brachen nicht nur wieder auf; sie nahmen unter dem Eindruck der allgemeinen Anspannung der Kräfte noch schärfere Dimensionen an als zuvor. Auf der Rechten hielt man nun vielfach den Zeitpunkt für gekommen, die Zugeständnisse an die Arbeiterbewegung, die durch die Kriegssituation erzwungen worden waren, wieder zurückzunehmen, während auf der Linken der Prozeß der Desolidarisierung vom Regime fortging und beide Seiten im Verhalten der Gegenseite genügend Anlaß fanden, ihren Kurs bestätigt zu sehen. Zwischen den Extremen hindurchzulavieren, wurde immer schwieriger: Das mußte Painlevé erfahren, als er die Spannungen reduzieren wollte. Nach nur zweimonatiger Amtszeit wurde er von einer heterogenen Mehrheit aus Rechten und Linken zugleich gestürzt. Um die Tendenz zur Polarisierung abzufangen, war eine Stärkung der Exekutive nötiger denn je; tatsächlich aber war die Exekutive gerade aufgrund des bereits erreichten Ausmaßes an Polarisierung schwächer denn je, und es war nicht zu sehen, wie die innere Polarisierung noch aufgehalten werden sollte.
1.4 Die Aktion Clemenceaus
Daß Staatspräsident Raymond Poincaré in dieser Situation Mitte November 1917 einen alten Intimfeind, den 76jährigen Georges Clemenceau, zum Ministerpräsidenten berief, deutete zunächst nicht auf eine Korrektur der bisherigen Entwicklung hin.
Clemenceau hatte sich im Laufe seiner langen, bis in die Tage der Pariser Kommune zurückreichenden Politikerkarriere einen Namen als militanter Republikaner, laizistischer Nationalist und autoritärer Gegner der Arbeiterbewegung gemacht und war während des Krieges wiederholt als scharfer parlamentarischer Kritiker der Regierungen hervorgetreten; aber das qualifizierte ihn nicht unbedingt für die Führung eines Landes in einer kritischen Situation. Poincaré verband mit seiner Berufung in erster Linie das Kalkül, auf diese Weise einem unbequemen Parlamentarier den Wind aus den Segeln zu nehmen; außerdem hoffte er, der neue Ministerpräsident werde sich in dem schwierigen Amt rasch kompromittieren und damit auf Dauer an politischem Gewicht verlieren.
Tatsächlich nutzte Clemenceau das Mißtrauen, das man ihm entgegenbrachte, als Grundstein für eine ganz außerordentliche Machtstellung: Weil niemand unter den führenden Politikern das Risiko eingehen wollte, sich an seiner Seite zu kompromittieren, konnte er ein Kabinett aus Männern des zweiten Gliedes bilden, das ihm ein effektives Regieren ermöglichte. Die Verbindungen zu den verschiedenen politischen Lagern blieben erhalten, aber das Hineinregieren unverantwortlicher Kräfte hörte auf, und das Kabinett wandelte sich zu einer Regierungsmannschaft unter straffer Leitung. Die Appelle an Opferbereitschaft und Patriotismus, mit denen sich Clemenceau an die Öffentlichkeit wandte, wirkten unter diesen Voraussetzungen deutlich glaubwürdiger als zuvor; und mit dem Erfolg wuchs seine Autorität bald so weit, daß er Parlamentarier und Militärs unter Berufung auf die Erwartungen der Öffentlichkeit unter Druck setzen konnte. Schritt für Schritt nahm er die Entscheidung über die militärischen Aktionen in die Hand, baute er eine neue Kriegswirtschafts-Administration auf und profilierte er sich als Sprecher eines jakobinischen Kriegs-Nationalismus, der an die Tradition der Französischen Revolution anknüpfte. Im Februar 1918 stattete ihn das Parlament mit außerordentlichen Vollmachten zur Sicherung der Ernährung und des kriegswichtigen Handelns aus; und im Juni kam es sogar seiner Forderung nach Sanktionen gegen Foch und Pétain nach, die für militärische Fehler beim Vormarsch der Deutschen im Mai verantwortlich gemacht wurden.
Die Aktivierung patriotischer Emotionen verband Clemenceau mit heftigen Attacken auf Defaitisten und Pazifisten. Das brachte ihm viel Beifall in den Reihen der Rechten ein und entsprechenden Zorn in den Reihen der Linken; es führte aber nicht zu einer Radikalisierung der Arbeiterschaft in großem Umfang, wie sie nach dem Bruch der »Union sacrée« zu erwarten war. Die Beseitigung zahlreicher Mißstände, die Clemenceaus energische Aktion ermöglichte, und die Kriegserfolge bremsten die Verzweiflung in den Reihen der Arbeiter ab und verschafften dem neuen Ministerpräsidenten zum Teil auch hier Respekt. Die Regierungs-Sozialisten, d.h. die verbliebenen Befürworter der »Union sacrée«, die innerparteilich in die Minderheit geraten waren, fanden sich sogar zu offener Unterstützung bereit: Abgeordnete ihrer Couleur übernahmen die Leitung von Regierungskommissionen und neutralisierten damit die sozialistische Parlamentsopposition. Die Angriffe gegen den Pazifismus fanden hier ebensoviel Zustimmung wie bei den offiziellen Regierungsparteien. In der sozialistischen Partei blieb folglich das »Zentrum« majoritär, das die »Union sacrée« verdammte, ohne deswegen gleich der Vorbereitung einer Revolution das Wort zu reden. Auf dem SFIO-Nationalrat Ende Juli 1918 gab es 1544 Stimmen für einen Text, der jede Intervention der Alliierten im bolschewistischen Rußland ablehnte und die nochmalige Bewilligung von Kriegskrediten von der Erlaubnis zur Teilnahme an einer internationalen Sozialistenkonferenz abhängig machte. Die Befürworter eines neuen Engagements an der Ostfront, das den deutsch-sowjetischen Frieden von Brest-Litowsk zunichte machen sollte, erhielten nur 1172 Stimmen und mußten bald darauf die Kontrolle über die Parteizeitung aufgeben.
Im Frühjahr 1918 kam es zu einer neuen Streikwelle, die sich im Umfang durchaus mit der Streikbewegung des Jahres 1917 messen konnte. Die Ursache war diesmal jedoch nicht eine allgemeine Erbitterung über die Leiden des Krieges, sondern eine Kombination sehr spezifischer Forderungen junger Facharbeiter und politischer Manöver: Die jungen Arbeiter sahen sich um ihre Zukunftschancen gebracht, weil sie nun doch noch zum Militärdienst eingezogen wurden und ausländische Arbeiter in ihre Plätze in den Fabriken einrückten; und eine Minderheit »revolutionärer« Gewerkschaftsfunktionäre glaubte, diese Unzufriedenheit zur Entfachung einer allgemeinen Revolutionsbewegung nach russischem Vorbild nutzen zu können. Die Streikbewegung blieb jedoch begrenzt; es kam nicht zu einer allgemeinen Solidarisierung der Arbeiter mit den Streikenden. Selbst Merrheim, der mit der Sammlung der pazifistischen Kräfte begonnen hatte, war nun nicht bereit, eine Revolution zu verantworten, die auf einer militärischen Niederlage beruhte. Die richtige Dosierung staatlicher Zwangsmittel – Verhaftung von Rädelsführern, aber keine Einführung allgemeinen Arbeitszwangs – trug dann noch zusätzlich dazu bei, der Bewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mitte Mai wurde überall die Arbeit wiederaufgenommen. Die Mehrheit der Arbeiter blieb in kritischer Distanz zum Regime; sie wagte es aber nicht (und hielt es zum Teil auch gar nicht für notwendig), zur offenen Opposition überzugehen.
Unterdessen zeichnete sich allmählich auch eine Wende in der militärischen Auseinandersetzung ab. Im März hatte die deutsche Oberste Heeresleitung noch einmal eine Offensive an der Westfront eingeleitet, darauf bedacht, den definitiven Durchbruch zu erzielen, ehe die amerikanischen Truppen in voller Stärke auf dem französischen Kriegsschauplatz eingreifen können. Diese Offensive war im Laufe des Aprils von Alliierten, die nun einheitlich unter dem Oberbefehl Fochs kämpften, zunächst aufgehalten worden; Ende Mai, Anfang Juni stürmten die Deutschen an der Aisne noch einmal vor; dann aber, nach einem Frontgewinn von 60 km, blieb ihre Offensive am 11. Juni stecken. Nachdem amerikanische Anleihen schon seit Frühjahr 1917 die beträchtlichen Finanzierungslücken der französischen Kriegsmaschinerie abgedeckt hatten, machte sich nun auch das Eintreffen amerikanischer Waffen auf den Kampfplätzen bemerkbar. Am 18. Juli begannen die Alliierten bei Villers-Cotterêts, die Deutschen hinter die Linien zurückzudrängen, die ihnen die Mai-Offensive eingebracht hatte. Damit war der Punkt erreicht, von dem an ein deutscher Sieg nicht mehr möglich war: Die Alliierten entschlossen sich im Vertrauen auf die Wirkung des bevorstehenden massiven Eingreifens der Amerikaner zur Gegenoffensive großen Stils. Am 8. August – die deutsche Seite empfand ihn als den »schwarzen Freitag« – gelangen ihnen mehrere Einbrüche in die deutschen Linien. Die Deutschen leisteten zwar noch hartnäckigen Widerstand an mehreren Rückzugslinien; aufs Ganze gesehen verloren sie jedoch unaufhaltsam an Terrain.
Die letzte Phase des Krieges wurde von einem Ringen um möglichst günstige Ausgangsbedingungen für die Friedensverhandlungen bestimmt. Ende September, nach dem Zusammenbruch Bulgariens und der damit erreichten Gefährdung des österreichischen Verbündeten, setzte General Ludendorff bei der deutschen Reichsleitung den Entschluß durch, die Alliierten um einen Waffenstillstand zu ersuchen. In der Nacht vom 3. zum 4. Oktober schickte die soeben erstmals auf parlamentarischer Grundlage gebildete Regierung des Prinzen Max von Baden eine Note an den amerikanischen Präsidenten ab, in der dieser aufgefordert wurde, einen Waffenstillstand auf der Grundlage der »14 Punkte« herbeizuführen. Durch den Appell an das Selbstbestimmungsrecht, für das sich Präsident Wilson stark gemacht hatte, sollte der Zusammenschluß des deutschen Staatsverbands, nach Möglichkeit unter Einschluß von Elsaß-Lothringen, über die Niederlage hinweg gerettet werden; ebenso durch das Einlenken zu einem Zeitpunkt, da die deutschen Truppen noch weit im gegnerischen Territorium standen und noch beträchtliche alliierte Anstrengungen nötig waren, um das französische Territorium freizukämpfen. Auf der französischen Seite plädierte Pétain für eine Offensive in Lothringen, um die Rückkehr der 1871 verlorenen Gebiete auf jeden Fall militärisch zu sichern und die französische Ausgangsposition für Verhandlungen generell zu verbessern. Er konnte mit dieser Forderung jedoch nicht sogleich durchdringen: Weil Oberbefehlshaber Foch die Widerstandskraft der deutschen Truppen nach wie vor als außerordentlich hoch einschätzte, wurde die lothringische Offensive auf Mitte November verschoben, einen Zeitpunkt, für den man sich eine volle Entfaltung des amerikanischen Truppenpotentials erhoffte.
Tatsächlich wurden Pétains Pläne dann überhaupt nicht mehr verwirklicht, weil sich die Alliierten unterdessen auf einen kompromißlosen Kurs gegenüber dem Deutschen Reich verständigten und die deutsche Regierung von einer Fortsetzung des Widerstands zu Recht nur weitere Verschlechterungen der deutschen Position erwartete. Am Morgen des 11. November unterzeichnete Matthias Erzberger im Auftrag der deutschen Regierung in Compiègne das Waffenstillstandsabkommen, das Foch der deutschen Delegation vorgelegt hatte. Danach mußten nicht nur die besetzten Gebiete einschließlich Elsaß-Lothringen sofort geräumt werden; in einer zweiten Phase mußten sich die deutschen Truppen auch aus dem linksrheinischen Gebiet und einer neutralen Zone sowie aus drei Brückenköpfen rechts des Rheins (um Mainz, Koblenz und Köln) zurückziehen. Außerdem mußte die deutsche Hochseeflotte einschließlich aller U-Boote ausgeliefert werden, ebenso Tausende von Lokomotiven, Eisenbahnwaggons und Lastwagen sowie Kriegsmaterial aller Art. Die Friedensverträge, die das Deutsche Reich zu seinen Gunsten im Osten abgeschlossen hatte, wurden für hinfällig erklärt, die alliierten Kriegsgefangenen entlassen, die Geltung des Waffenstillstands zeitlich befristet. Eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen durch die Deutschen sollte danach nicht mehr möglich sein und war auch nicht mehr möglich. Gleichwohl war Frankreich nicht in der Lage, ungehindert über die Zukunft der internationalen Ordnung zu bestimmen: Da die Entscheidung über den Ausgang des Krieges vom Engagement Großbritanniens und mehr noch der USA abgehangen hatte, waren die angelsächsischen Mächte in die Rolle von Schiedsrichtern hineingewachsen, die über die künftige Verteilung der Macht auf dem europäischen Kontinent zu entscheiden hatten.
In Frankreich wurde der Ausgang des Krieges dagegen überwiegend als französischer Sieg verstanden und gefeiert. Nachdem man lange um den Sieg gebangt und schon einer Niederlage ins Auge gesehen hatte, war die Erleichterung über den schließlichen Erfolg ungeheuer; und nachdem man von allen Verbündeten am meisten unter diesem Krieg zu leiden gehabt hatte, glaubte man nur zu gern, auch den größten Anteil an diesem Sieg zu haben. Entsprechend groß waren die Erwartungen, die man in die Friedensverhandlungen setzte. Der Friedensvertrag sollte nicht nur sichere Garantien gegen einen erneuten deutschen Angriff und damit gegen eine Wiederholung der Kriegsleiden enthalten; die Deutschen sollten auch für alle erlittenen Verluste aufkommen, und sie sollten darüber hinaus durch ihre Kontributionen ein Wiederanknüpfen an die Vorkriegsverhältnisse ermöglichen, die unterdessen in der Erinnerung vielfach zur »Belle Époque« verklärt worden war. Die Überzeugung, daß »Deutschland alles zahlen wird«, tröstete über die Misere der Kriegserschöpfung hinweg und entschärfte zugleich die innergesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Ein antideutsch bestimmter Nationalismus wurde zum wichtigsten Integrationsmittel einer Gesellschaft, deren innere Friktionen durch die Kriegserfahrung eher verstärkt und vermehrt als eingeebnet worden waren.
2 Kriegsfolgen und Stabilisierung 1919–1928
Die nationale Begeisterung, die Frankreich bei Kriegsende erfaßt hatte, war in doppelter Hinsicht oberflächlicher Natur: Zum einen waren die Hoffnungen, die die verschiedenen sozialen Gruppen in den Sieg gesetzt hatten, bei dem tatsächlichen Substanzverlust, den Frankreich durch diesen Krieg erlitten hatte, weit übertrieben; zum anderen war über die Verteilung der Kriegskosten angesichts der Fragwürdigkeit der Hoffnungen auf deutsche Zahlungen noch nicht wirklich entschieden. Zu den traditionellen Interessenkonflikten kamen also neue Verteilungskämpfe hinzu; und es war sehr die Frage, ob der Staat genügend Steuerungsinstrumente entwickeln würde, um einen Übergang zur Friedensordnung ohne nachhaltige Erschütterungen des Sieg-Konsenses zu ermöglichen.
2.1 Der Sieg des Nationalen Blocks
In den Reihen der Arbeiter hielt man vielfach den Zeitpunkt für eine Kraftprobe mit dem bürgerlichen Staat für gekommen. Dort, wo man an der reformistischen Perspektive der »Union sacrée« festgehalten hatte, glaubte man, nunmehr den Lohn für die Rettung des Vaterlandes einfordern zu können; und wo man über fortdauernde Klassendiskriminierung und sinnlose Kriegsleiden erbittert war, setzte man auf eine Wiederaufnahme des Klassenkampfes von – gemessen an den Vorkriegsverhältnissen – günstigeren Ausgangspositionen aus. Die Kampfbereitschaft, die sich aus diesen, wenn auch zum Teil gegensätzlichen Einstellungen ergab, wurde noch dadurch verstärkt, daß das Mißverhältnis von Siegeserwartungen und Nachkriegsrealität sehr rasch deutlich wurde: Die Reallöhne lagen bei Kriegsende bei 15–20 % unter dem Stand von 1914; die Preise galoppierten davon; und die Wiedereingliederung der Kriegsteilnehmer in das zivile Erwerbsleben nahm auf weite Strecken den Charakter einer regelrechten Deklassierung an. Entsprechend wuchs der Organisationsgrad der Arbeiter. Die Gewerkschafts-Dachorganisation CGT (»Confédération Générale du Travail«) erhöhte ihre Mitgliederzahl von 700000 zu Beginn des Weltkrieges auf eine Million; weitere 150000 Arbeiter sammelten sich in der neuen, katholisch orientierten »Confédération Française des Travailleurs Chrétiens« (CFTC). Die Sozialistische Partei wuchs von nur 36000 Mitgliedern 1914 auf 133000 im ersten Nachkriegsjahr und 180000 im zweiten.
Die Kombination von Siegeshoffnungen, Enttäuschung und Begeisterung über die revolutionären Bewegungen in Rußland, Deutschland und Ungarn führte bei der großen Mehrheit der Sozialisten zu einer revolutionären Grundstimmung. Dabei ging es den wenigsten um ein Nachahmen des russischen Beispiels, das in seinen Einzelheiten auch gar nicht bekannt war. Auf der extremen Linken bildete sich zwar ein »Komitee für die Dritte Internationale«, aber dieses stand weit mehr in der Tradition des revolutionären Syndikalismus als unter bolschewistischen Vorzeichen, und es fand zudem in der Partei wenig Echo. Die überwiegende Mehrheit hoffte auf die baldige Herbeiführung einer »wahren«, emanzipatorischen Demokratie, ohne über eine klare Revolutionsstrategie zu verfügen; sie ging auf Distanz zum bürgerlichen Parlamentarismus, wollte aber die Errungenschaften der bürgerlichen Freiheitskämpfe nicht preisgeben. Der Parteitag vom April 1919 bestätigte folglich die Führungsrolle der »Zentristen« um Longuet und Cachin, die zwischen Revolution und Republik schwankten; er sprach sich für die Beteiligung an den bevorstehenden Wahlen zur Abgeordnetenkammer aus, verbot aber zugleich jede Wahlallianz mit Vertretern bürgerlicher Parteien. Die Reformisten der »Union sacrée« hatten fürs erste ausgespielt: teils bewegten sie sich, wie etwa Albert Thomas, am Rande der Partei; teils resignierten sie; und manche versuchten es auch mit einer Partei-Neugründung, der »Sozialistischen Partei Frankreichs«, für die freilich bei der Zuspitzung der Klassenauseinandersetzungen wenig Entfaltungsmöglichkeiten blieben.
Die Regierung Clemenceau bemühte sich, der revolutionären Bewegung die Spitze zu nehmen, indem sie sich zu Zugeständnissen auf sozialpolitischem Gebiet bereit fand. Vor allem ließ sie nun, einer langjährigen Forderung der Syndikalisten entsprechend, in aller Eile ein Gesetz über die Einführung des Achtstundentags verabschieden. Daneben wurde die Einführung kollektiver Arbeitsverträge gesetzlich geregelt, gab es Steuererleichterungen und Schuldenmoratorien für die Masse der heimkehrenden Soldaten und wurde den Demobilisierten eine ansehnliche Abfindung gewährt. Indessen blieben die Reformanstrengungen auf halbem Wege stecken: So war die Einführung kollektiver Arbeitsverträge nicht zwingend; und von der Achtstundenregelung gab es zahlreiche Ausnahmen. Vor allem aber scheiterten die Pläne des Handelsministers Etienne Clémentel, die Instrumente, die dem Staat im Laufe des Kriegs auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet zugewachsen waren, zur Entwicklung eines Systems kontinuierlicher wirtschaftlich-sozialer Globalsteuerungzu nutzen, die die sozialen Dissonanzen der liberalen Wirtschaftspraxis einzuebnen versprach. Ein Generalstreik, wie ihn die Wortführer der revolutionären Minderheit wieder erhofften, blieb unter diesen Umständen zwar aus; doch gab es vom Frühjahr 1919 an massive Streikbewegungen, Demonstrationen und zum Teil blutige Zusammenstöße mit den Ordnungskräften. Als die Regierung ein Expeditionskorps gegen die Bolschewisten ins südliche Rußland losschickte, brach in der Flotte eine Meuterei los, die schließlich die Aufgabe der Interventionspläne erzwang.
Die offensichtliche Radikalisierung der Arbeiterbewegung ließ die verschiedenen Fraktionen des bürgerlichen Lagers noch enger zusammenrücken, als es der Krieg ohnehin schon bewirkt hatte. Vor dem Krieg war die Haltung zum Erbe von 1789 noch eine Haupttrennlinie in der innenpolitischen Auseinandersetzung gewesen; die bürgerliche Mitte hatte mit den Sozialisten für die laizistische Republik und gegen die klerikale Reaktion gekämpft. Vor dem Hintergrund des gemeinsamen Kriegserlebnisses waren diese Gegensätze jedoch verblaßt: Royalisten hatten sich für die Rettung der Republik engagiert, und antiklerikale Eiferer hatten ihre Vorurteile gegen die katholische Minderheit revidiert; der offizielle Republikanismus war hinter die Bekundungen des gemeinsamen Nationalismus zurückgetreten. Nun ließ die Furcht vor einer proletarischen Revolution, die unter dem Eindruck der auswärtigen Beispiele viel nachhaltiger empfunden wurde, als es vom tatsächlichen Zustand der französischen Arbeiterbewegung her gerechtfertigt war, den Antibolschewismus zum zusätzlichen Integrationsmittel werden, das die Kräfte der politischen Mitte und der bisherigen Rechten zusammenband und die Sozialisten aus dem nationalen Konsensbereich wieder hinausdrängte. Bis auf eine Minderheit der extremen Rechten, die an ihrer Ablehnung der Republik festhielt, verabredeten sich die Politiker der Rechten und der Mitte für die Wahlen vom 16. November 1919 in den meisten Wahlkreisen auf eine gemeinsame Liste des »Nationalen Blocks«, der die bolschewistische Gefahr in den Mittelpunkt des Wahlkampfes rückte.
Nationalismus, Antibolschewismus und das Prestige Clemenceaus verhalfen dem Nationalen Block zu einem überwältigenden Wahlsieg. In der neuen Kammer verfügte er über nicht weniger als 417 von 619 Sitzen. Die SFIO