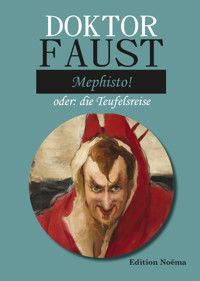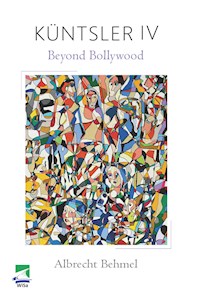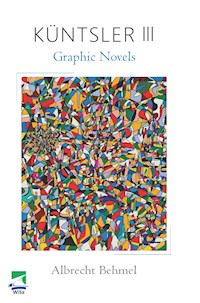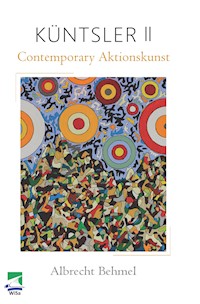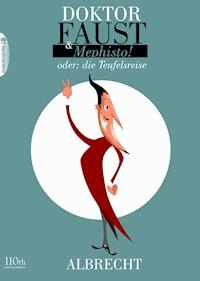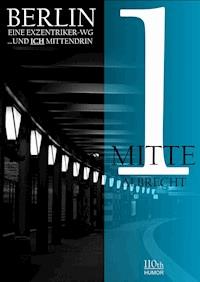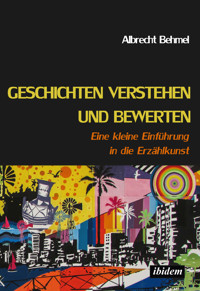
12,99 €
Mehr erfahren.
Storytelling mag ein Modewort sein, doch das Geschichtenerzählen ist eine uralte und mächtige Kulturtechnik, mit der sich jeder vertraut machen sollte, der sich mit Medien beschäftigt – als Konsument, als Beobachter oder als Produzent. Seit jeher haben einflussreiche Menschen Geschichten eingesetzt, um Werte, Ideen und Visionen zu vermitteln. Aktuell ist so auch der Begriff des Narrativs – letztlich also der ‚Erzählung‘ – mehr denn je ein Thema. Albrecht Behmel zeichnet die zentralen Mechanismen des Storytelling anhand von populären Beispielen aus Film und TV, Literatur und Unterhaltung nach und gibt dem Leser das Rüstzeug an die Hand, sich qualifiziert mit Stories aller Art auseinanderzusetzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Bausteine der Realität
Geschichten als Artefakte
Warum gibt es Geschichten?
Der Wettbewerb der Geschichten
Erzähltraditionen der Kulturen
Storytelling kann man lernen
Storytelling kann man nicht lernen
Storytelling ist Kommunikation
U- und E-Kultur
Sequels und Prequels
Perspektiven
Witze und Tabus
Genres
Geschichten verändern sich
Wann sind Geschichten wertvoll?
Konflikt der Tugenden
Natur und Technik
Figuren
Archetypen
Eine Matrix für literarische Figuren
Welten und Reisen
Erzählstimmen
Titel einer Geschichte
Anfänge von Geschichten
Schluss einer Geschichte
Kommerzielle Geschichten
Professionelle Schriftsteller
Die deutsche Filmförderung
Das “Epische Theater” auf der Leinwand
Der deutsche Film als “Entwicklungsland”
Evolution von Geschichten und Figuren
Verbotene Geschichten
Umstritten, indiziert und redigiert
Impressum
Einleitung
Wir sind von Geschichten umgeben. Jeden Tag kommen neue Filme, Gerüchte, Bücher, Witze und Erzählungen hervor und wir müssen damit zurechtkommen, wenn wir uns für die Urheber interessieren. Mit Geschichten zurechtkommen bedeutet mehr als ihnen zuzuhören. Wir müssen sie verstehen und einordnen, bewerten und, wenn es sinnvoll ist, sie uns merken.
Es gibt kommerzielle Geschichten, private, ideologisch motivierte, wozu auch religiöse Geschichten gehören können, es gibt motivierende Geschichten und abschreckende, es gibt informative und verwirrende Geschichten. Je nach Motivation der Erzähler beeinflussen sie unsere Haltung und unsere Stimmung.
Dieses Buch soll dabei helfen, Geschichten aus professioneller Perspektive zu sehen und zu bewerten, das Umfeld, aus dem heraus sie entstanden sind, einzuordnen und die Motivation eines Erzählers zu identifizieren.
Geschichten waren schon immer ein wirkungsvolles Machtinstrument, und seit den Gesängen Homers und Vergils haben sich Urheber Gedanken darüber gemacht, wie sie ihre Geschichten möglichst effektiv platzieren können. Gerichtsprozesse, Parlamentsdebatten, Werbekampagnen und Propagandafeldzüge gab es bereits zu Zeiten des Hamurabi und im alten Ägypten.
In den folgenden Überlegungen zum Thema “Geschichtenerzählen” sind einige dieser uralten Techniken vor allem anhand moderner Beispiele wie Film und TV-Serien aufgezählt.
Zürich im Mai 2018,
Albrecht Behmel
Bausteine der Realität
Mit Geschichten erschaffen sich Menschen Welten - erfundene und reale. Durch Erzählungen können über Generationen hinweg Werte und Ziele vermittelt werden. Dadurch entsteht Gemeinschaft und durch Gemeinschaft entsteht Macht. Geschichten berichten von Glaubensinhalten, wie im Fall der griechischen Mythen oder der Weihnachtsgeschichte; sie stellen reale politische Ziele und Kämpfe dar wie das Nibelungenlied; sie berichten von Gewissenskonflikten wie bei Doktor Faust oder in den Sagen von König Arthur.
Das Wort “Geschichte” ist verwandt mit dem Verb “geschehen”. Geschichten beschreiben angeblich “Geschehenes”, aber sie sind immer zumindest in Teilen konstruiert und folgen fast nie dem, was tatsächlich einst vorgefallen ist. Auch bei “wahren Geschichten” ist dies so. Geschichten sind in Bezug auf Fakten so zuverlässig wie Augenzeugenberichte in Bezug auf Tathergänge - also nicht sehr. Dennoch sind sie oft das einzige Element, über das wir verfügen, wenn es um die Rekonstruktion der Vergangenheit geht. Auch, wenn Geschichten eingesetzt werden, um eine Zukunft zu entwerfen, sind sie häufig das einzige, über das wir verfügen, wie zum Beispiel in Elon Musks Plänen, den Mars zu besiedeln.
Bei all dem spielt es eine erstaunlich geringe Rolle, ob es sich um rein erfundene, phantastische Geschichten handelt, oder um mehr oder weniger historische Begebenheiten oder konkrete Zukunftsvisionen, die freilich fast immer ausgeschmückt oder zumindest “interpretiert” werden. Man kann beinahe sagen, dass sich reale Geschichten und erfundene auf halber Strecke begegnen: Reale Geschichten werden literarisiert, erfundene Geschichten werden der Realität angepasst in der Hoffnung, sie glaubhafter zu machen.
Oftmals ist es so, dass Geschichten von ihren Urhebern ganz bewusst an große Namen geknüpft werden, um ihre Glaubwürdigkeit zu steigern. Das gleiche geschieht mit Zitaten. Sie wirken stärker, wenn sie von ausgewiesenen Autoritäten stammen. Das Internet ist voll von Zitaten, Memes, von Einstein, Gandhi oder Martin Luther King, die in Wirklichkeit von anderen Leuten stammen.
Zitate oder Anekdoten funktionieren dann gut, wenn sie mit einer Person zu tun haben, die man zu kennen glaubt. Dabei ist es weniger wichtig, ob diese Vertrautheit aus dem realen Leben stammt oder daher, dass diese Figur immer wieder in den Medien erscheint. So glaubt man, Einstein zu kennen, Mozart oder Moses. Dabei vergessen wir oft, dass wir, etwa in den beiden letzt genannten Fällen nicht einmal wissen, wie die betreffenden Menschen genau aussahen.
Warum hören Menschen gerne Geschichten? Zum einen helfen sie, Inhalte zu vergegenwärtigen. Es fällt leichter, eine Geschichte im Gedächtnis zu behalten als Fakten. Geschichten zu hören ist mit Kindheitserinnerungen verbunden. Viele große Erzähler und Erzählerinnen nehmen daher bewusst einen großväterlichen oder großmütterlichen Habitus ein. Das ist wirksam, denn Geschichten zu erzählen ist ein Privileg der Überlebenden. In der Vorzeit, als es schon Geschichten aber noch keine Bücher gab, waren Geschichten überlebenswichtig. Durch Erzählungen wurden Gefahren und Erfolge lebendig gehalten. Wer Gefahren überstand, konnte und musste davon berichten. Das machte den Erzähler automatisch zu einem sozial wichtigen Teil der Gemeinschaft. Bis heute hat sich das so erhalten, allerdings mit einem tragischen Twist zu Ungunsten der Schriftsteller. Heute genießen vor allem die großen Schauspieler den Ruhm der Überlebenden. Dies drückt sich auch in den gigantischen Gagen der Stars aus. Wenn wir im Kino sitzen, fällt es uns leicht, die Tatsache zu vergessen, dass es ein Drehbuch gab, das wiederum oft auf einem Roman basiert, in dem alle Handlungen und genialen Tricks der Hauptfiguren festgehalten sind. Vielmehr lässt sich das Publikum gern auf die Illusion ein, es sei tatsächlich Mark Wahlberg oder Danny Trejo, der sich aus unmöglichen Zwangslagen befreit. Ähnlich ist es mit den Geschichten mit Schwarzenegger, Brad Pitt, Bruce Willis oder anderen Heldendarstellern. Wir vergessen gern, dass sie nur die Darsteller oder auch die Produzenten sind oder, wenn sie am Drehbuch mitgeschrieben haben, dies getan haben, bevor gefilmt wurde.
Geschichten werden von Überlebenden erzählt. Das macht sie automatisch glaubhaft. Werden nun viele Geschichten von vielen Überlebenden erzählt, steigert sich die Glaubhaftigkeit noch mehr. Insbesondere dann, wenn die Geschichten zueinander nur bedingt widersprüchlich sind. Eine kleine Brise Widerspruch ist dabei freilich nützlich, denn sie regt zum Nachdenken an. Zum Beispiel im Fall der kleinen Zeitmaschine im dritten Band von Harry Potter.
Warum kamen diese Geräte eigentlich nicht schon früher zum Einsatz, etwa, um den bösen Zauberer Voldemort zu stoppen oder seine Opfer zu retten? Wenn es dem Publikum gelingt, sich selbst eine Antwort zu geben, zum Beispiel, dass die Zeitmaschinen nur einige Stunden Spielraum verschaffen, nicht aber Jahre, oder dass ihre Funktion auf das Gelände der Schule beschränkt ist, hat der Widerspruch sogar zum Reiz der Geschichte beigetragen. Es macht Spaß, Einwände gegen eine geliebte Geschichte zu entkräften.
Man legt stets sein natürliches Misstrauen ab, wenn man sich freiwillig einer Geschichte aussetzt. Was bei einem persönlichen Gespräch etwa im Kontext eines Geschäftstreffens sofort aufgegriffen und diskutiert würde, wird im Fall einer guten Geschichte ignoriert oder so interpretiert, dass es dem Hörvergnügen der Geschichte nicht schadet. Dies bringt für den Erzähler eine gewisse Narrenfreiheit mit sich. Allerdings endet diese, wenn der Erzähler zu viele logische Fehler begeht oder es sich beim Erzählen zu einfach macht. In diesem Fall verlassen die Zuschauer oder Zuhörer die magische Welt und beginnen, nach weiteren Fehlern zu suchen. Die Geschichte wendet sich dann gegen ihren Urheber.
Geschichten treten zumeist in Bündeln auf. Sie beschreiben zusammen eine Welt, die als mehr oder weniger einheitlich aufgefasst wird. Die Welt von Hänsel und Gretel passt zur Welt von Dornröschen oder Schneewittchen. Das Publikum empfindet die Welt der Grimm’schen Märchen als mehr oder weniger harmonisch gestaltet, obwohl die Geschichten untereinander an sich keine Berührungen haben. Das zeigt sich gut am Beispiel der Shrek Filme, wo die Märchenfiguren eine quasi einheitliche Bevölkerung stellen.
Dies reicht zurück bis zu den Heldentaten des Herkules oder den Abenteuern des Odysseus. Bei kommerziell hergestellten Geschichten, wie Star Trek oder dem Marvel-Universum ist es ähnlich. Geschichten muss man pluralisch denken. Erst die gesamten Arbeiten des Herkules ergeben eine mythologische Aussage; erst die gesammelten Abenteuer des Superman erschaffen einen Mythos.
Darauf basieren TV-Serien wie Friends genauso wie die Berichte aus der Bibel: Einzeln unterhalten sie; zusammen ergeben sie einen Sinn. Die moralischen Werte der TV-Serie sind: Solidarität und Geduld mit Freunden; Familiensinn und Treue, Häuslichkeit und Verlässlichkeit, aber auch die Tugend, niemals aufzugeben und seine Freunde und Nachbarn nie im Stich zu lassen; Ehrlichkeit und Toleranz gegenüber gewissen menschlichen Schwächen. In den Gleichnissen des Neuen Testaments ist es ähnlich: Erst zusammen ergeben sie die zentrale theologische Aussage von Gottvertrauen, Bescheidenheit, Nächstenliebe und Geduld; Leidensfähigkeit und die Hoffnung auf das Himmelreich und das ewige Leben. Welche einzelne Geschichte könnte dies leisten?
Dokumentarfilme funktionieren oft ähnlich, zum Beispiel, wenn Augenzeugen zu Wort kommen, die miteinander nichts gemeinsam haben außer der Tatsache, dass sie eben Zeitgenossen eines Moments sind: Feldpostbriefe, Berichte aus der Zeit der Kreuzzüge und der großen Pest oder die Erzählungen der Überlebenden von Schiffsuntergängen. Gemeinsam ergeben sie ein mehr oder weniger stimmiges Bild. Geschichten brauchen verschiedene Stimmen.
Wenn Unternehmen ihre Marken ausbauen, verwenden sie diese Mechanismen ganz bewusst, um Gemeinschaft zu stiften. Red Bull veranstaltet oder unterstützt spektakuläre Sportereignisse. Apple präsentiert neue Produkte in geradezu liturgischer Form. Walt Disney baut Erlebnisparks und Coca Cola fährt im Dezember mit einem eigenen Weihnachtsmann durch die Welt. Politische Parteien und Verbände eifern den Unternehmen nach. Auch sie versuchen, Bündel von Erzählungen über sich selbst herzustellen, die von den Menschen weitergegeben werden. Organisationen müssen Erzählungen und Geschichten generieren, wenn sie als erfolgreich empfunden werden wollen. Die Kirchen, die Arbeiterbewegung, die Pfadfinder und selbst die Anonymen Alkoholiker bauen unablässig an diesem riesigen Gebäude aus Worten. Wenn sie gut konstruiert sind, geben diese Geschichten den Angehörigen der Organisationen eine Heimat. Geschichten mit sozialer Relevanz sind oft Gruppenleistungen, wobei die Gruppen immense Größe erreichen können, man denke an die Fanfiction Bewegung oder an Deviant Art.
Was bringt andererseits einzelne Menschen dazu, Geschichten zu schreiben? Eitelkeit, Angst vor dem Tod beziehungsweise Streben nach Unsterblichkeit, Missionswille und Bewältigung von prägenden Ereignissen sind sicherlich häufige Motive. Es sind die gleichen Gründe, aus denen heraus Menschen auch in anderen Kunstformen aktiv sind: Der Wunsch oder Zwang, sich künstlerisch zu betätigen, die Suche nach Schönheit oder Sinn und die Freude an der Gestaltung.
Schreiben ist eine Form des Lernens und des Denkens. Durch das Formulieren von Inhalten, gleich ob es literarische oder dokumentarische Stoffe sind, erschließt sich dem Autor eine Welt, die er, wenn er mag, mit anderen teilen kann. Schreiben ist, genau wie das Programmieren, eine Lebensart, ein Life-Style, der zugleich ein Beruf sein kann. Das Geldverdienen kann zwar auch eine Motivation für das Schreiben sein, doch eine vergleichsweise schwache oder unrealistische, wenn man an die kleinen Honorare von Autoren denkt oder an die dünnen Chancen, einen Verlag zu finden. Die meisten Menschen, die schreiben, tun dies mehr oder weniger für sich selbst.
Wahrscheinlich entstehen die meisten guten Geschichten einfach aus der Neugier eines entsprechend begabten Menschen heraus. Ein Mensch mit Sprachgefühl, Einfühlungsvermögen und einem Sinn für Spannung entdeckt ein Thema, sagen wir, das Leben auf einem fernen Planeten, dessen dominante Lebensform riesige, hochintelligente Spinnen oder überlegene Primaten sind. Oder das Leben in einem Zauberschloss, das von einem verwünschten Monster bewohnt wird; oder das Leben in einem Sanatorium für Lungenkranke oder an Bord eines Segelschiffes im Mittelmeer oder im Orientexpress. Alles weitere ist Erkundung und Erfindung, was in der Literatur oft das gleiche ist: Welche Charaktere treffen aufeinander? Welche Konflikte entstehen? Wer gewinnt? Wer verliert? Aber auch: Wie sieht die Welt aus? Was prägt diese Welt? Welche Werte hat die Gesellschaft, die in dieser Welt lebt?
Man sieht bereits an den Fragen, dass es grundsätzlich zwei Herangehensweisen an eine Geschichte gibt, nämlich einmal über die Konstruktion einer Welt gegenüber, zweitens, der Konstruktion von Figuren. Dem folgt oft eine zweite Frage, nämlich, ob die Geschichte in erster Linie eine Handlung beschreiben soll, etwa den Verlauf von Konflikten, oder aber ob sie einen Charakter beschreiben soll.
Der erste Ansatz ist in der angelsächsischen Welt stark vertreten. Der zweite Ansatz findet sich in Deutschland und Skandinavien häufiger, aber auch in Japan.
Geschichten als Artefakte
Nicht alle Geschichten sind kommerzielle Produkte. Sie entstehen aus den verschiedensten Gründen und haben unterschiedliche Zielrichtungen. Was sie jedoch alle verbindet ist die Tatsache, dass sie von Menschen für Menschen erschaffen wurden, genau wie andere Produkte oder Artefakte auch.
Der menschliche Geist sucht beständig nach Zusammenhängen. Das ist das Erfolgsgeheimnis unserer Spezies. Es erlaubt uns Dinge zu erträumen und an der Umsetzung zu arbeiten. Die Zusammenhänge entstehen oft nach dem Muster:
“Erst A, und dann B.”
Daraus kann man beliebig lange Ketten bilden. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von anderen Verbindungsgliedern, doch die Und-Dann-Kette ist die wichtigste. Schon kleine Kinder begreifen das, wenn sie ihre Fragen stellen: “Und dann?” Damit generieren sie eine potenziell unendliche Erzählung. Und-Dann kann auch heißen: “aber gleichzeitig” oder “und trotzdem” oder “Niemand bemerkte, dass gleichzeitig …”
Mit diesen Konjunktionen und Halbsätzen werden Ereignisse in Zusammenhänge gebracht, die sowohl zeitlich als auch kausal sind; post hoc ergo propter hoc, wie es auf Lateinisch heißt. Dieser alte Lehrsatz zeigt ein gängiges Missverständnis auf, nämlich die menschliche Schwäche, zwischen zwei Ereignissen, die aufeinander folgen, ein Verhältnis von Ursache-Wirkung zu sehen. Beim Geschichtenerzählen funktioniert das besonders gut, weil die Geschichte nicht von einer Kontrollgruppe begleitet wird, wie bei einem wissenschaftlichen Experiment.
Fiktive Geschichten machen sich das zunutze und stellen Ereignisse in einen engen kausalen Zusammenhang. Diese Kette von Ereignissen muss einen Sinn ergeben. Das unterscheidet die Literatur von der Wirklichkeit, die diesem Zwang nicht unterliegt. Ergibt eine fiktive Geschichte keinen kausalen Sinn, wirkt sie etwas enttäuschend, wie zum Beispiel Signs (2002) oder The Village (2004) von Night M. Shyamalan.
Das Ende einer Geschichte sollte aus dem Anfang heraus folgen ohne dabei vorhersehbar zu sein. Das zu gestalten ist die Herausforderung an Erzähler seit es Geschichten gibt. Meister dieser Balance sind die großen Krimi-Autoren wie Agatha Christie und Arthur Conan Doyle, die allein durch das Genre bedingt immer kausal erzählen müssen: Wie ist es zu dem Verbrechen gekommen? Wer ist der Tat verdächtig? Wer hatte welches Motiv und welche Gelegenheit? Was ist dann passiert? Wer log aus welchen Gründen? Wie sind die Spuren zu deuten?
Sherlock Holmes geht dabei stets nach dem gleichen Muster vor: Er schließt alles aus, was nicht der Fall sein kann, bis die eine wahre Erklärung übrig bleibt, ganz gleich, wie unwahrscheinlich sie anfangs auch wirken mochte. Ähnlich gehen Spock, Data und House MD vor.
Die großen Stoffe der Weltliteratur wie Don Quixote, Faust, Robin Hood, Gulliver oder Pinocchio folgen dabei einer eigenen Logik, die mit der Logik der realen Welt mehr oder weniger kompatibel ist. “Es könnte so sein” lautet die Bedienungsanleitung dieser Geschichten. Die gängige Formulierung hierfür ist natürlich “Es war einmal…” oder, um ein weiteres Beispiel zu nennen “In a galaxy far far away”.
Auch wenn es in diesen fernen Ländern, Galaxien und Königreichen Drachen, Lichtschwerter, Magie und sprechende Tiere gibt, so sind die Kausalitäten der Handlungen immer realistisch. Figuren sind austauschbar, die Gesetze der Logik nicht. Das macht sie der Öffentlichkeit zugänglich.
Je bekannter eine Geschichte wird, desto mehr Macht oder Einfluss muss ihr Schöpfer in der Regel abgeben. Der Autor einer unveröffentlichten Geschichte hat vollkommene Herrschaft über Figuren und Handlung. Sobald er sein Manuskript einem Verlag anbietet, beginnt das Spiel der Kompromisse und der Verhandlungen. Dies kann den Titel der Geschichte betreffen, das Cover, den Namen der Hauptfigur und, ein häufiges Thema, das Ende der Geschichte. Wird eine Geschichte verfilmt, kommen weitere Kompromisse hinzu, etwa die Frage der Besetzung und der Treue zur Romanvorlage. In dem Film “What Just Happened?” mit Robert De Niro aus dem Jahr 2008 werden diese Problematiken satirisch aber sehr wirklichkeitsnah beleuchtet.
Geschichten, die jenseits einer Verfilmung wirksam sind, werden noch weiteren Kompromissen unterworfen. Die Figuren machen sich selbständig und werden zu kulturellem Allgemeingut. Man kann nur erahnen, welche Konflikte zwischen Künstlern und Managern bewältigt werden mussten, um zum Beispiel Disneyland oder andere Themen-Parks zu bauen, Spielzeuge wie die Tigerente, Actionfiguren und andere Produkte auf den Markt zu bringen. Je stärker eine Geschichte auf dem Markt ist, desto mehr Positionen entstehen in Bezug auf ihre weitere Vermarktung. Kluge Autoren geben daher immer nur ein Minimum an Einfluss auf ihre Werke auf. Kluge Produzenten versuchen, möglichst viele Rechte an einer Geschichte zu erwerben oder zu optionieren. Aus diesem Interessenkonflikt heraus entstehen manchmal wertvolle Einsichten, wie eine Geschichte besser gemacht werden kann. Geschichten können zu jedem Zeitpunkt ihrer Vermarktung verbessert werden.
Warum gibt es Geschichten?
Erzählungen sind uralt und ihre Wirkungskraft basiert darauf, dass sie zur Funktionsweise des menschlichen Geistes passen. Man könnte sagen, Geschichten spiegeln das Bewusstsein des Menschen wider und dienen damit nicht in erster Linie der Unterhaltung, sondern dem Überleben.
Geschichten wurden von Anfang an erzählt, um das Verhalten der Mitmenschen zu beeinflussen, sie zu disziplinieren und zu belehren, sie zu unterdrücken oder zu befreien. Geschichten sind Machtinstrumente, die wiederholt eingesetzt werden, bis sie nicht mehr hinterfragt werden. Legenden, Mythen und Märchen halfen bereits in vor-schriftlichen Gesellschaften das Gemeinwesen zu stärken, Feinbilder aufzubauen und für Abwehrbereitschaft zu sorgen, oder die bestehende Sozialordnung zu rechtfertigen. Man denke an die Fabel des Menenius Agrippa, dessen Fabel angeblich dazu beitrug, den Klassenkampf im Alten Rom zu beenden. Ob dies tatsächlich so geschehen ist oder nicht, spielt keine Rolle, denn allein schon die Erzählung über die Fabel und die Behauptung der Wirksamkeit ist eine eigene Geschichte mit eigener Wirkung.
Jede Kriegserklärung, jede Wahl und Nachfolge von Anführern ist von Geschichten begleitet. Jede Rückschau auf historische Ereignisse, wie die Völkerwanderung findet sich in Geschichten wieder, wie das Nibelungenlied und die Edda zu beweisen scheinen. Diese Geschichten können staatstragend oder zersetzend wirken. Auch aus diesem Grund ist das Geschichtenerzählen immer von Zensur und von Gewalt gegenüber Erzählern begleitet gewesen.
Geschichten können Menschen massiv beeinflussen und zu Dingen überreden, die sie ohne Geschichten nicht tun würden. Geschichten fokussieren die Aufmerksamkeit der Menschen auf Unmögliches, wie im Fall des Gelobten Landes und dem Auszug aus Ägypten, der bis heute nacherzählt wird und der die Israeliten in biblischer Zeit mehr oder weniger bei der Stange hielt. Selbstmordattentäter und Terroristen, die sich selbst und andere zerstören, tun dies aufgrund von Geschichten und Erzählungen. Soldaten, Krankenpfleger, Nothelfer und andere Berufe, die ein hohes Maß an Aufopferung erfordern sind begleitet von Geschichten, die die Entbehrungen und die geringe Bezahlung zu verkraften helfen.
Menschen mögen Geschichten, aber das ist nicht zwingend der Grund, warum sie erzählt werden. Sicherliche gibt es auch reine Unterhaltungsgeschichten, die dazu dienen sollen, die Zuhörer zu begeistern oder zumindest zu beschäftigen, wie im Fall der Kindersendungen im Fernsehen, die zum Großteil nicht produziert werden, um Kinder auf das Leben vorzubereiten, sondern dazu, den Eltern eine Stunde Frieden im Haus zu ermöglichen. Stünden Lernziele im Zentrum der Kinderunterhaltung, gäbe es die meisten Formate vermutlich nicht.
Geschichten dienen auch dazu, die Kompetenz des Erzählenden darzustellen und zu unterstreichen, wie im Fall der Kommentatoren von Sportereignissen, die stets bemüht sind, Hintergründe aufzuzeigen und Entwicklungen nachzuvollziehen, in anderen Worten, die Geschichten zu erzählen, die dem gegenwärtigen Turnier oder Wettkampf vorausgegangen sind. Geschichten sortieren Aufmerksamkeit und unterhalten dabei. Wie andere Werkzeuge auch, können Geschichten zum Guten wie zum Bösen eingesetzt werden, und wer sich über die Mechanik im Klaren ist, ist weniger für Manipulation anfällig.
Der Wettbewerb der Geschichten
Wie viele Bücher liest ein Erwachsener pro Jahr durchschnittlich? Wie viele davon sind Sachbücher? Wie viele Filme schaut er sich an? Wie viele davon im Kino und wie viele davon im TV oder auf seinem Handy oder Computer? Wie viele Games lädt sich ein durchschnittlicher Teenager pro Monat auf seinen Rechner, wie viele ein Erwachsener? Wie viele Kinderbücher kaufen Eltern für ihre Kleinen?
Selbst in relativ kleinen oder mittleren Sprachräumen wie dem deutschen oder dem Italienischen ist die Zahl der Neuerscheinungen pro Jahr so hoch, dass selbst professionell-spezialisierte Leser keine Chance haben, auch nur einigermaßen Schritt zu halten. In Deutschland erscheinen pro Jahr ungefähr 90.000 Bücher neu. Doch selbst diese Zahl ist im Vergleich zu der Menge der pro Jahr eingereichten Manuskripte noch sehr klein.
Der Wettbewerb der Geschichten beginnt zum Beispiel bei der Verlagssuche. Dies liegt auch daran, dass der Beruf “Schriftsteller” sich nicht klar von dem Hobby “Schriftsteller” trennen lässt. Wer ein Buch geschrieben hat, darf sich Autor nennen. Wer eine Kurzgeschichte geschrieben hat, darf sich ebenfalls Autor nennen.
Die Qualität der Manuskripte, die jeden Tag massenhaft die Lektorate von Verlagen erreichen, ist zwangsläufig weit gefächert. Selbst gute Erstlingswerke haben es daher schwer, auch nur bemerkt zu werden. Fast jeder ernsthafte Autor erhält ordnerweise Absageschreiben, wenn er sich die Mühe macht, Verlage zu kontaktieren. Die Verlage müssen sich gegen die Flut der Texte schützen. Einige tun dies, indem sie nur Ausdrucke auf Papier akzeptieren oder sehr genaue Format-Vorgaben für ihre Manuskripte machen; einige wenige akzeptieren nach englischem Vorbild nur Texte, die sie über eine Agentur erreichen. Doch alle diese Filter haben eine Schwäche: Sie betreffen nicht die Qualität der eingereichten Geschichten, denn diese ist kaum in Wort zu fassen oder in eine formale Struktur zu bringen. Deswegen müssen Verlage oft zu einer ganz simplen Verteidigungsstrategie greifen: Sie akzeptieren überhaupt keine Autoren, die sie nicht kennen, sondern erwerben Lizenzen bestimmter Bücher aus dem Ausland oder vergeben sogar Aufträge oder “Anregungen” an bereits etablierte Autoren. Die Schwelle zum professionellen Schreiben ist ohne ein Netzwerk an persönlichen Kontakten sehr hoch.
Man könnte auch sagen, dass der Wettbewerb der Geschichten sogar noch früher beginnt, nämlich im Kopf des Verfassers. Viele Autoren verfügen über eine Sammlung von Ideen für Zusammenhänge, Beobachtungen und damit letztlich Geschichten. Dies sind die klassischen Notizbücher und Zettelkästen oder, wie Kurt Tucholsky sie bezeichnete, Schnipsel