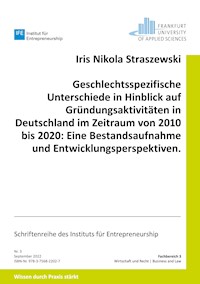
Geschlechtsspezifische Unterschiede in Hinblick auf Gründungsaktivitäten in Deutschland im Zeitraum von 2010 bis 2020: Eine Bestandsaufnahme und Entwicklungsperspektiven. E-Book
Iris Nikola Straszewski
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Schriftenreihe des Instituts für Entrepreneurship
- Sprache: Deutsch
In Deutschland gibt es trotz eines hohen Maßes an Gleichberechtigung in bestimmten Bereichen Geschlechterdisparitäten. Hierzu zählen die Bereiche der wirtschaftlichen Teilhabe und Chancengleichheit. Dies äußert sich auch in niedrigeren Gründungsquoten bei Frauen als bei Männern. Die Ursachen hierfür sind nicht vollständig bekannt und in der Forschung werden verschiedene Ansatzpunkte diskutiert. Auf politischer Ebene wurden die Geschlechterunterschiede ebenfalls erkannt und Initiativen zur Förderung von Gründungen durch Frauen gestartet. Eine Schwierigkeit bei der Untersuchung der Thematik ist ein Mangel an regelmäßig veröffentlichten umfangreichen Daten. Die Arbeit bringt diese Aspekte zusammen, indem neue Auswertungen durchgeführt und im Kontext der bekannten Erklärungsansätze und politischen Initiativen diskutiert werden. Das Buch enthält neue Auswertungen zu Daten des Adult Population Surveys des Global Entrepreneurship Monitors für Deutschland für die Jahre 2010 bis 2020, die um Literatur- und Internetrecherchen ergänzt werden. Anhand dieser Daten wird ein umfassendes Bild von Unterschieden und Gemeinsamkeiten in den Aktivitäten männlicher und weiblicher Gründungspersonen und den Einstellungen von Männern und Frauen in der Bevölkerung zum Thema Gründungen in Deutschland gezeichnet. Ergänzend werden bestehende Initiativen und Maßnahmen zur Förderung von Gründungen durch Frauen auf Bundesebene betrachtet und Handlungsempfehlungen abgeleitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort der Autorin
Die vorliegende Masterarbeit wurde von mir im Dezember 2021 im Fachbereich 3 – Wirtschaft und Recht an der Frankfurt University of Applied Science eingereicht. Die Auswertungen enthalten Daten bis einschließlich für das Jahr 2020.
Ziel der Arbeit war es durch umfassende Auswertungen der Daten des Adult Population Surveys des Global Entrepreneurship Monitors für Deutschland eine Bestandsaufnahme zu Gründungen durch Frauen und Männer für den Zeitraum zwischen 2010 und 2020 in Deutschland durchzuführen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Die Daten des Global Entrepreneurship Monitors werden zu diesem Zweck um umfangreiche weitere Datenquellen ergänzt. Nichtsdestotrotz zeigt sich an einigen Stellen, dass eine weitergehende systematische und differenzierte Erfassung von Daten zu Gründungen durch Männer und Frauen helfen würde, Gemeinsamkeiten und Unterschiede – sowie deren Ursachen – besser zu verstehen.
Trotz der wirtschaftlichen und sozialen Relevanz des Themas sind die Ursachen für die Geschlechterunterschiede in den Gründungsquoten in Deutschland nur unzulänglich bekannt. Die Literatur zum Thema verdeutlicht, dass es sich um ein komplexes Thema handelt. Entsprechend gibt es verschiedene Ansätze, um die Unterschiede zu erklären. Im Rahmen der Arbeit werden einige dieser Ansätze vorgestellt und anhand der Ergebnisse reflektiert.
Ein besseres Verständnis des Gründungsverhaltens von Männern und Frauen, aber auch in Abhängigkeit von Gründungen nach Branchen und Branchenstrukturen, bietet Vorteile für den Wirtschaftsstandort der Bundesrepublik Deutschland, kann aber auch dazu beitragen, Herausforderungen im Erreichen der wirtschaftlichen Chancengleichheit zu identifizieren und langfristig zu überwinden.
Als Autorin der Arbeit ist es mein Wunsch, dass Interessierte Zugang zu den verfügbaren Daten erhalten können und die Handlungsempfehlungen den ein oder anderen Anstoß für konkrete Maßnahmen in der Praxis geben.
Mein herzlicher Dank geht an Herrn Professor Dr. Cord Siemon für die Betreuung der Arbeit sowie stellvertretend für das Institut für Entrepreneurship für die Aufnahme dieser Arbeit in die Schriftenreihe. Des Weiteren gilt mein herzlicher Dank Frau Professor Dr. Simone Chlosta für die Zweitbetreuung der Arbeit und die Möglichkeit zur Kooperation mit dem Fachbereich Gründung des RKW Kompetenzzentrums zur Auswertung der Daten des Global Entrepreneurship Monitors. Ich danke ebenfalls herzlich Frau Dr. Natalia Gorynia-Pfeffer vom Fachbereich Gründung des RKW Kompetenzzentrums, die mich als Ansprechpartnerin während der Kooperation unterstützt hat, sowie Herrn Daniel von Wedel als Ansprechpartner für die Publikation in der Schriftenreihe.
Frankfurt am Main, September 2022
Dr. Iris Nikola Straszewski
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1.
Einleitung
1.1 Untersuchungsgegenstand
1.2 Motivation des Themas
2.
Akademische Ausgangsbasis
2.1 Daten zu Geschlechterunterschieden bei Gründungen in Deutschland
2.1.1 KfW-Gründungsmonitor
2.1.2 Female Founders Monitor
2.1.3 Gründerreport der Deutschen Industrie- und Handelskammern
2.2 Ansätze zur Erklärung von Geschlechterunterschieden im Gründungsverhalten in der Gründungsliteratur
2.2.1 Humankapital
2.2.2 Bildungshintergrund und Gründungsbranchen
2.2.3 Persönliche Netzwerke und Ökosysteme
2.2.4 Zugang zu Finanzkapital
2.2.5 Motivation
2.2.6 Innovativität
2.2.7 Persönlichkeit
2.2.8 Vereinbarkeit von Beruf und Familie
2.2.9 Vorbilder
2.2.10 Einkommenseffekte durch wirtschaftliche Selbstständigkeit
2.2.11 Unternehmensnachfolge
2.2.12 Problematische Herangehensweise an die Erforschung von weiblichem Unternehmertum
2.2.13 Fazit zu Erklärungsansätzen
2.3 Daten zur Situation in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2020
2.3.1 Wirtschaftswachstum: Veränderungsrate des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts
2.3.2 Arbeitsmarkt: Gemeldete Arbeitsstellen
2.3.3 Bildung
2.3.4 Studienabschlüsse nach Fächergruppen
2.3.5 Erwerbstätigkeit
2.3.6 Wirtschaftszweige
2.3.7 Einkommens- und Verdienstunterschiede
2.3.8 Frauen in Führungspositionen
2.4 Übersicht über Initiativen und Maßnahmen zur Steigerung von Gründungsaktivitäten durch Frauen
2.4.1 Bundesweite gründerinnenagentur (bga)
2.4.2 Initiative FRAUEN unternehmen
2.4.3 #StarkeFrauenStarkeWirtschaft
2.4.4 Gründungsoffensive GO!
2.4.5 Angebote Dritter zur Förderung weiblichen Unternehmertums bzw. Gründungen durch Frauen
2.4.6 Informationen auf Landesebene
2.4.7 Zusammenfassende Evaluation
2.5 Leitfragen
3.
Empirischer Teil
3.1 Methodische Vorgehensweise
3.2 Auswertungen und Ergebnisse
3.2.1 Gründungsquote
3.2.2 Geschäftsinhaber*innenquote
3.2.3 Bildungsniveau
3.2.4 Solo- und Teamgründungen
3.2.5 Erwartungen zum Personalwachstum
3.2.6 Verteilung auf Wirtschaftszweige
3.2.7 Innovativität
3.2.8 Gründungsmotive
3.2.9 Einschätzung der Gründungschancen in der Region
3.2.10 Gründungsabsichten
3.2.11 Gründungseinstellungen: Berufswahl Gründer*in sowie Ansehen und Respekt für Gründer*innen
3.2.12 Intrapreneurship
3.2.13 Persönlicher Kontakt zu Gründer*innen
3.2.14 Selbsteinschätzung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
3.2.15 Angst vor dem Scheitern
4.
Diskussion
4.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
4.2 Interpretation und Erklärungsansätze
4.2.1 Humankapital
4.2.2 Bildungshintergrund und Gründungsbranchen
4.2.3 Vorbilder, Persönliche Netzwerke und Ökosysteme
4.2.4 Motivation
4.2.5 Innovativität
4.2.6 Persönlichkeit
4.2.7 Problematische Herangehensweisen
4.2.8 Andere Erklärungsansätze
4.2.9 Zusammenfassung
4.3 Limitationen der Auswertungen
4.3.1 Beschränkungen des Datensatzes
4.3.2 Beschränkungen der getätigten Auswertungen
4.4 Vorschläge für zukünftige Forschung
4.5 Ableitungen von Handlungsempfehlungen
5.
Fazit
Anhang
A.
Daten zum EXIST-Gründerstipendium
B.
bga-Detailvorstellung
B.1 bga-Schwerpunkte
B.2 Beratung
B.3 Vernetzung
B.4 Mediathek
B.5 Service
C.
Übersicht zu Webseiten mit Informationen auf Landesebene
D.
Ergänzungen des empirischen Teils
D.1 Methodenteil
D.2 Ergänzende Auswertungen
E.
Ergebnisse zur Recherche zu Stipendien für potenzielle Gründerinnen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1. KfW-Gründungsmonitor: Anteil an Gründungen durch Frauen in Prozent.
Abbildung 2: Veränderung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von Deutschland gegenüber dem Vorjahr in Prozent.
Abbildung 3: Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen in Deutschland.
Abbildung 4: Arbeitslosenquote in Deutschland nach Geschlecht.
Abbildung 5: Geschlechterverteilung an bestandenen akademischen Abschlussprüfungen im Jahr 2020 nach Fächergruppen.
Abbildung 6: Erwerbstätigenquote nach Geschlecht und Alter.
Abbildung 7. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Branchen, Geschlecht und Arbeitszeit.
Abbildung 8: Vorbild-Unternehmerinnen pro Bundesland.
Abbildung 9: Häufigkeitsverteilung der Variable "Gender" für die Jahre 2010 bis 2020
Abbildung 10: TEA-Quote insgesamt und nach Geschlecht.
Abbildung 11: Frauenanteil an Gründungspersonen
Abbildung 12. Quote der Geschäftsinhaber*innen ohne werdende Gründende inklusive Landwirtschaft nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2020
Abbildung 13: Bildungsniveau in der Bevölkerung und bei Gründungspersonen nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2020 zusammengefasst
Abbildung 14: Anzahl der Eigentümer pro Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2020
Abbildung 15: Erwartung von mehr als fünf Beschäftigten innerhalb der nächsten fünf Jahre nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2020
Abbildung 16: Verteilung der Gründungspersonen auf Wirtschaftszweige nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2020 zusammengefasst
Abbildung 17. Technologieintensität der Branche nach Geschlecht über die Jahre 2011 bis 2020 zusammengefasst
Abbildung 18: Anteil neuer Technologien nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2018
Abbildung 19: Anteil neuer Produkt-Markt-Kombination nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2018
Abbildung 20: Anwendung neuer Technologien oder Verfahren nach Neuheitsgrad in Region, Land und Welt nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 21. Neuheit der Produkte oder Dienstleistungen in Region, Land und Welt nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 22: Quote der Notwendigkeits- und Geschäftsgelegenheitsgründungen nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2018
Abbildung 23: Gründungsmotive nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 24: Einschätzung der Gründungschancen in der Region innerhalb der nächsten sechs Monate nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2018
Abbildung 25: Einschätzung der Gründungschancen in der Region nach Geschlecht und Bildungsniveau für die Jahre 2010 bis 2018
Abbildung 26: Einschätzung der Gründungschancen in der Region durch verschiedene Gruppen von Frauen
Abbildung 27: Einschätzung der Gründungschancen in der Region durch verschiedene Gruppen von Männern
Abbildung 28: Einschätzung der Gründungschancen in der Region nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 29: Einschätzung der Gründungschancen in der Region durch Gründungspersonen nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 30: Gründungsabsichten (in 18-64-Jährige, die nicht in unternehmerische Aktivitäten involviert sind) nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2020
Abbildung 31: Gründungsabsichten bei Frauen verschiedener Gruppen
Abbildung 32: Gründungsabsichten bei Männern verschiedener Gruppen
Abbildung 33: Einschätzung des Gründens als erstrebenswerte Berufswahl nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2018
Abbildung 34: Einschätzung des Gründens als erstrebenswerte Berufswahl nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 35: Einschätzung des Gründens als erstrebenswerte Berufswahl für verschiedene Gruppen von Frauen
Abbildung 36: Einschätzung des Gründens als erstrebenswerte Berufswahl für verschiedene Gruppen von Männern
Abbildung 37: Einschätzung des Gründens als erstrebenswerte Berufswahl für Gründungspersonen nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 38: Einschätzung des Ansehens von und Respekts gegenüber Gründer*innen nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2018
Abbildung 39: Einschätzung des Ansehens von und Respekts gegenüber Gründer*innen nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 40: Einschätzung des Ansehens von und Respekts gegenüber Gründer*innen durch Gründungspersonen nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2018
Abbildung 41: Einschätzung des Ansehens von und Respekts gegenüber Gründer*innen durch Gründungspersonen für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 42: Anteil an Intrapreneur*innen nach Geschlecht und Gründungsabsicht für die Jahre 2011 bis 2020
Abbildung 43: Persönlicher Kontakt zu Gründer*innen nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2018
Abbildung 44: Persönlicher Kontakt zu Gründer*innen nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 45: Aufteilung der positiven Antworten für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 46: Persönlicher Kontakt zu Gründer*innen für verschiedene Gruppen von Frauen
Abbildung 47: Persönlicher Kontakt zu Gründer*innen für verschiedene Gruppen von Männern
Abbildung 48: Persönlicher Kontakt zu Gründer*innen bei Gründungspersonen nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 49: Anzahl an Gründer*innen, zu denen persönlicher Kontakt besteht, für Gründungspersonen nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 50: Selbsteinschätzung der Gründungsfähigkeiten nach Geschlecht für die Jahre 2010 bis 2018
Abbildung 51: Selbsteinschätzung der Gründungsfähigkeiten nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 52: Selbsteinschätzung der Gründungsfähigkeiten für verschiedene Gruppen von Frauen
Abbildung 53: Selbsteinschätzung der Gründungsfähigkeiten für verschiedene Gruppen von Männern
Abbildung 54. Selbsteinschätzung der Gründungsfähigkeiten von Gründungspersonen nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 55: Unterlassen einer Gründung aus Angst vor dem Scheitern nach Geschlecht und Gründungsperson für die Jahre 2010 bis 2018
Abbildung 56: Unterlassen einer Gründung aus Angst vor dem Scheitern nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 57: Unterlassen einer Gründung aus Angst vor dem Scheitern bei Gründungspersonen nach Geschlecht für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 58: Unterlassen einer Gründung aus Angst vor dem Scheitern nach Bildungsniveau und Geschlecht zusammengefasst für die Jahre 2010 bis 2018
Abbildung 59: Gegenüberstellung eTraining für Gründerinnen und BMWi Lernprogramm "Existenzgründung"
Abbildung 60: Beispiel Profil in Gründerinnengalerie
Abbildung 61: Visuelle Darstellung des Konzepts des Unternehmenslebenszyklus und der TEA des GEM.
Abbildung 62: Anzahl der Gründungspersonen für die Jahre 2010 bis 2020 nach Geschlecht
Abbildung 63: Verteilung der Gründungspersonen nach Geschlecht auf die Branchen für die Jahre 2019 und 2020
Abbildung 64: Technologieintensität der Branche für Männer für die Jahre 2011 bis 2020
Abbildung 65: Technologieintensität der Branche für Frauen für die Jahre 2011 bis 2020
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Listung der ausgewerteten Variablen und ihrer Beschreibung
Tabelle 2: Angaben zum Anteil von Gründerinnen, die durch ein EXIST-Gründerstipendium gefördert wurden.
Tabelle 3: Variablen mit fehlenden Zeiträumen
Tabelle 4: Variablenänderungen ab 2019
Tabelle 5: Stipendien in Deutschland zur Förderung potenzieller Gründerinnen
Abkürzungsverzeichnis
bga
Bundesweite gründerinnenagentur
BMBF
Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMFSJ
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
BMWi
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
ESF
Europäischen Sozialfonds
MINT
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
VdU
Verband deutscher Unternehmerinnen
1. Einleitung
1.1 Untersuchungsgegenstand
Die Masterarbeit untersucht Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Kontext von Gründungsaktivitäten in Deutschland im Zeitraum von 2010 bis 2020. Für den empirischen Teil der Arbeit wurden Individualdaten des Adult Population Surveys der deutschen Ausgabe des Global Entrepreneurship Monitors für die Jahre 2010 bis 2020 in Bezug auf Geschlechterunterschiede ausgewertet. Für die Untersuchung der Geschlechterunterschiede wurden neben der Variablen für Geschlecht 26 weitere Variablen betrachtet. Dabei wurden einerseits Vergleiche zwischen Männern und Frauen, die nicht in Gründungsaktivitäten involviert sind, aber auch Vergleiche zwischen Männern und Frauen, die ein Unternehmen führen, oder als Gründungsperson in frühphasige Gründungsaktivitäten (bestehend aus der Vorbereitung einer Gründung oder den ersten 42 Monaten nach der Gründung)1 involviert sind, ausgewertet. Ziel der Auswertungen ist, ein umfassendes Bild von Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Gründungen durch Männer und Frauen zu zeichnen und zu untersuchen, inwieweit die Daten Aussagen über Veränderungen im Betrachtungszeitraum zulassen.
Zur Einordnung der Ergebnisse des empirischen Teils werden einerseits Erklärungsansätze aus der Entrepreneurship-Forschung dargestellt und andererseits veröffentlichte Auswertungen zu Geschlechterunterschieden im Gründungskontext vorgestellt. Dabei liegt der Fokus auf Veröffentlichungen auf Basis des KfW-Gründungsmonitors und auf dem Female Founders Survey, der seit 2018 Geschlechterunterschiede bei Start-Up-Gründungen betrachtet.
Ein Praxisbezug wird durch eine Betrachtung und kritische Diskussion von Initiativen und Maßnahmen von Gründungen durch Frauen in Deutschland hergestellt. Zu diesem Zweck werden Maßnahmen und Initiativen in Deutschland auf Bundesebene beschrieben und Handlungsempfehlungen für Verbesserungspotenziale oder mögliche weitere Ansätze ausgesprochen.
Da es sich sowohl um ein breites Thema als auch um einen längeren Auswertungszeitraum handelt, müssen für die Zwecke der Masterarbeit Eingrenzungen vorgenommen werden.
Der empirische Teil und die Betrachtung von Maßnahmen und Initiativen zur Förderung von Gründungen durch Frauen sind auf Deutschland begrenzt. Auch wenn eine Stärke des Global Entrepreneurship Monitors in der internationalen Vergleichbarkeit der Daten besteht, wird auf Vergleiche mit anderen Ländern verzichtet. In der Betrachtung der Entrepreneurship-Literatur liegt der Schwerpunkt, gerade bei empirischen Studien, ebenfalls auf Deutschland, die Literatur ist jedoch nicht auf Deutschland begrenzt.
Des Weiteren ist eine Eingrenzung der Fokus auf die frühphasige Gründungsaktivität. Im empirischen Teil wird zwar auch an ausgewählten Stellen auf Geschäftsinhaber*innen etablierter Unternehmen Bezug genommen, es wird jedoch keine Betrachtung von Geschlechterunterschieden hinsichtlich des Lebenszyklus von Unternehmen oder des unternehmerischen Erfolgs vorgenommen.
Gründungen können als Übernahme eines bestehenden Unternehmens oder in Form von Neugründungen erfolgen. Basierend auf Daten des KfW-Gründungsmonitors machte der Anteil an Nachfolgegründungen für die Jahre 2010 bis 2020 zwischen 6% (2013) und 13% (2018) aus (Metzger 2021c:3). Im empirischen Teil der Arbeit liegt der Fokus auf Neugründungen, da der Global Entrepreneurship Monitor frühphasige Gründungsaktivität über die Vorgründungsphase und die ersten 42 Monate nach Neugründung eines Unternehmens definiert. Im Literaturteil der Arbeit werden Studien zu Nachfolgegründungen nicht systematisch ausgeschlossen.
Eine weitere Eingrenzung erfolgt hinsichtlich der Auswertungen im empirischen Teil. Diese sind auf deskriptive Statistik beschränkt. Es wurden keine Analysen zur Untersuchung der statistischen Signifikanz der Unterschiede oder zur Modellierung der Unterschiede und beeinflussender Faktoren durchgeführt.
Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Anschließend an die Darlegung des Untersuchungsgegenstandes folgt als weiterer Teil der Einleitung die Motivation des Themas. Darauf folgt das Kapitel zur akademischen Ausgangsbasis. Dieses beginnt mit einer Vorstellung von Daten zu Geschlechterunterschieden bei Gründungen in Deutschland. Anschließend werden Ansätze zur Erklärung von Geschlechterunterschieden aus der Literatur vorgestellt und die Hintergrundsituation in Deutschland anhand für den Betrachtungszeitraum relevanter Statistiken erläutert. Darauf folgt eine Übersicht zu Initiativen und Maßnahmen zur Förderung von Gründungen durch Frauen. Das zweite Kapitel schließt mit einer Formulierung Leitfragen für den empirischen Teil. Im empirischen Teil wird zunächst die methodische Vorgehensweise erläutert, bevor thematisch geordnet die Auswertungen und Ergebnisse vorgestellt und diskutiert werden. Anschließend werden im vierten Kapitel „Diskussion“ die wesentlichsten Ergebnisse zusammengefasst und Interpretationen und Erklärungsansätze vorgestellt. Darauf folgen Limitationen der Auswertungen und Vorschläge für die zukünftige Forschung. Ableitungen von Handlungsempfehlungen bilden den letzten Abschnitt des Kapitels. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
1.2 Motivation des Themas
Warum eine Masterarbeit zum Thema Geschlechterunterschiede im Gründungsverhalten?
Deutschland ist ein Land, in dem im internationalen Vergleich ein hohes Maß an Gleichberechtigung und ein niedriges Geschlechtergefälle vorliegt. Das spiegelt sich auch im Erreichen des elften Platzes des Global Gender Gap Index 2021 (World Economic Forum 2021:10). Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch in Deutschland in verschiedenen Bereichen Geschlechterdisparitäten vorliegen. In der Kategorie Political Empowerment („Politische Befähigung“) erreichte Deutschland, das in den letzten 16 Jahren eine Kanzlerin an der Spitze der Regierung hatte, den zehnten Platz (World Economic Forum 2021:19). In der in der Kategorie Economic Participation and Opportunity („Wirtschaftlichte Teilhabe und Chancengleichheit“) wurde allerdings nur der 62. Platz erreicht (World Economic Forum 2021:18). Ein Blick auf die Veränderung des Länderprofils zwischen 2006 und 2021 zeigt, dass sich zwar das Gesamtergebnis für Deutschland innerhalb der letzten 15 Jahre leicht verbessert, die Gesamtplatzierung sich jedoch von Platz fünf auf Platz 11 verschlechtert hat (World Economic Forum 2021:199).
Bezüglich der wirtschaftlichen Teilhabe und Chancengleichheit zeigen sich in Deutschland an verschieden Stellen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Obwohl die Erwerbstätigenquote von Frauen im Alter von 20 bis 64 Jahren im Jahr bei 75,8% lag und Deutschland damit den dritthöchsten Wert in der EU hatte (Eurostat 2021), sind Frauen deutlich seltener als Männer in Managementpositionen vertreten (Anteil an Frauen in Senior Management Positionen 29% (World Economic Forum 2021:14)). Ein weiterer Bereich, in dem Frauen deutlich weniger vertreten sind als Männer sind Gründungen von Unternehmen. In der Auswertung des KfW-Gründungsmonitors lag der Frauenanteil an Gründungen für das Jahr 2020 bei 38% (vgl. Abbildung 1). Politisch ist dieses Geschlechtergefälle bekannt und Anlass für Initiativen. Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen beispielsweise schreibt: „Frauengeführte Unternehmen sind trotz aller Anstrengungen weiterhin unterrepräsentiert“ (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 2015).
Die Ursachen für einen niedrigeren Anteil an Frauen in Managementpositionen und für einen niedrigeren Gründerinnenanteil sind ohne Frage vielschichtig und komplex. Unter dem Stichwort „Gender Gap in Entrepreneurship“ ist es Gegenstand der Entrepreneurship-Forschung.
Nichtsdestotrotz ist es ein Thema, bei dem noch viele Fragen offen sind, und das wirtschaftlich und gesellschaftlich relevant ist. Die wirtschaftliche Relevanz liegt in der Rolle von Gründungen für die Entwicklung einer Volkswirtschaft. In der Literatur wird dafür beispielsweise das Bild des Motors verwendet, der Arbeitsplätze schafft (Obschonka u. a. 2014:1) und für wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand sorgt (Hopp & Martin 2017:517). Bleibt ein Teil des Potenzials für Gründungen und Unternehmertum aufgrund einer niedrigeren Beteiligung von Frauen ungenutzt, kann die Volkswirtschaft die möglichen Vorteile daraus nicht nutzen (Obschonka u. a. 2014:1). In der Förderlinie „Innovators of the future: bridging the gender gap“ („Innovator*innen2 der Zukunft: Überwindung des Geschlechtergefälles“) beschreibt die Europäische Kommission die Herausforderung mit den Worten, dass „weibliche Kreativität und weibliches Innovationspotenzial eine unzureichend genutzte Quelle für Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind“ (Europäische Kommission 2018).
Die gesellschaftliche Relevanz des Themas geht mit der Verbindung zwischen Geschlechteridentität, Geschlechterrollen und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie einher. Wenn sich auch die traditionellen Rollenbilder verändert haben, schrieben Furdas und Kohn noch vor elf Jahren, dass Frauen sich häufiger um die Betreuung von Kindern oder anderen Familienangehörigen sowie den Haushalt kümmern (Furdas & Kohn 2010:5). Geschlechterunterschiede in der Doppelbelastung um Vereinbarkeit von Beruf und Familie zeigen auch die Statistiken zur Teilzeitbeschäftigung in Deutschland. Daten aus dem Jahr 2019 (destatis 2021b) zeigen beispielsweise, dass der Anteil an aktiv erwerbstätigen Vätern im Alter zwischen 20 und 49 Jahren mit einem Kind unter sechs Jahren im Haushalt bei 6,9% lag. Der äquivalente Anteil an Frauen, die in Teilzeit arbeiteten lag bei 72,6%.
Diese Zahlen zeigen, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Deutschland sich unterschiedlich auf die Erwerbstätigkeit von Männern und Frauen auswirkt.
Ein Unternehmen zu gründen ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen eine abhängige Erwerbstätigkeit. Die hohe Erwerbstätigenquote bei Frauen und die gleichzeitig im Verhältnis geringe Gründungsquote zeigen, dass Frauen in Deutschland eine Präferenz für eine abhängige Beschäftigung zu haben scheinen. Wie eingangs bereits angemerkt ist dies sicherlich das Resultat vieler Einflussfaktoren. Neben den Unterschieden im Anteil an in Teilzeit Arbeitenden ist beispielsweise bekannt, dass sich Frauen und Männer unterschiedlich auf die Wirtschaftszweige verteilen und sich Wirtschaftszweige auch hinsichtlich ihrer Selbstständigenquote unterscheiden (Institut für Mittelstandsforschung 2021).
Dennoch liegt in der Forschung häufig ein Fokus auf Unterschieden zwischen den Geschlechtern ohne eine ausgeprägte Differenzierung der weiteren Umstände für die Entscheidung zu gründen oder einer abhängigen Beschäftigung nachzugehen.
Eine Schwierigkeit bei der Untersuchung von Geschlechterunterschieden im Gründungskontext ist die Verfügbarkeit von umfassenden Statistiken. In der Vergangenheit gab es Berichte, die das Ziel hatten, Daten und Fakten zu Gründerinnen und Unternehmerinnen in Deutschland zusammenzustellen (Lauxen-Ulbrich & Leicht 2005; Dautzenberg u. a. 2015). Allerdings handelt es sich dabei soweit ersichtlich nicht um Formate, die als regelmäßige Veröffentlichung aktuell fortgeführt werden.
Neben den spezifisch auf Gründerinnen und Unternehmerinnen ausgerichteten Publikationen, gibt es etablierte Veröffentlichungen (z.B. KfW-Gründungsmonitor, Global Entrepreneurship Monitor), die die Gründungslage in Deutschland beschreiben, jedoch liegt der Fokus dieser Publikationen nicht auf der Untersuchung von Geschlechterunterschieden. Dies hat zur Folge, dass die jährlichen Veröffentlichungen nur im begrenzten Umfang Geschlechterunterschiede thematisieren. Beispielsweise werden in den Publikationen zum KfW-Gründungsmonitor jährlich der Frauenanteil an Gründungen insgesamt sowie der Frauenanteil an Gründungen im Neben- und Vollerwerb veröffentlicht. Weitere Auswertungen sind jedoch nicht standardmäßig in den jährlichen Publikationen enthalten, beispielsweise auch nicht die Anzahl an Gründungen durch Frauen oder die Gründungsquote bei Frauen.
Auch der jährliche Länderbericht des Global Entrepreneurship Monitors enthält standardmäßig nur ausgewählte Auswertungen zu Geschlechterunterschieden. Diese werden um Auswertungen zu Sonderthemen und weitere Veröffentlichungen, die auch Auswertungen zu Geschlechterunterschieden beinhalten, ergänzt. Mit internationalem Fokus wird zudem alle zwei Jahre der GEM Women’s Entrepreneurship Report veröffentlicht, der Vergleiche zu Gründungsaktivitäten durch Frauen in unterschiedlichen Ländern und Regionen der Welt ermöglicht.
Dennoch werden einige mögliche Auswertungen auf Basis der GEM-Daten, die das Bild vom Gründungsverhalten von Frauen in Deutschland beleuchten und ergänzen könnten, nicht standardmäßig durchgeführt und veröffentlicht. Das Ziel der Masterarbeit ist daher, dieses Bild durch eigene explorative Auswertungen zu ergänzen.
Für die Auswertungen wurde der Zeitraum von 2010 bis 2020 gewählt. Die Länge des Zeitraums soll Aussagen zu Veränderungen innerhalb der letzten Jahre ermöglichen. Um langfristige Veränderungen zu beobachten ist der Zeitraum verhältnismäßig kurz gewählt. Dennoch ermöglicht die Zeitspanne eine erste Einschätzung, ob sich ein Trend abzeichnet.
1 Diese Personen werden im Kontext der Arbeit auch als „Gründungspersonen“ bezeichnet.
2 Da sich die Arbeit mit Unterschieden zwischen Männern und Frauen befasst, ist eine eindeutige Verwendung von Sprache wichtig. Daher sind generische Formen (d.h. generisches Maskulinum oder generisches Femininum) ungeeignet, da eine Abgrenzung von der Verwendung als generische Form oder als echtes Maskulinum oder Femininum über den Kontext keine ausreichende Eindeutigkeit erzeugt. Eine explizite Listung der männlichen und der weiblichen Form wird aus zwei Gründen als nur bedingt geeignet empfunden. Zum einen entsteht durch die Und-Koordination zusätzliche Länge und ggf. eine Verschlechterung des Leseflusses. Zum anderen ist zum Teil nicht klar, ob tatsächlich Männer und Frauen in einer Gruppe vorhanden sind. Für Fälle, in denen eine geschlechtsneutrale und geschlechtsinklusive Verwendung intendiert ist, wird in der Arbeit das Gendersternchen benutzt.
2. Akademische Ausgangsbasis
2.1 Daten zu Geschlechterunterschieden bei Gründungen in Deutschland
In diesem Abschnitt werden Daten zu Geschlechterunterschieden bei Gründungen in Deutschland innerhalb des Zeitraums von 2010 bis 2020 vorgestellt. Da es in Deutschland keine amtliche Statistik gibt, die das Gründungsgeschehen in vollem Umfang widerspiegelt (Metzger 2021d:1), wird hierfür auf ausgewählte Erhebungen zurückgegriffen. Dies sind Daten des KfW-Gründungsmonitors, des Female Founders Monitor und aus dem Gründerreport der Deutschen Industrie und Handelskammer. Diese Quellen wurden ausgewählt, da sie Daten zu Geschlechterunterschieden im Betrachtungszeitraum liefern. Geschlechterunterschiede aus Veröffentlichungen zu Daten des Global Entrepreneurship Monitors werden an dieser Stelle nicht vorgestellt, da diese Daten sich mit den eigenen Auswertungen überschneiden und diese ausführlich im empirischen Teil vorgestellt werden.
Eine Herausforderung bei der Untersuchung von Geschlechterunterschieden ist, dass häufig Daten nicht geschlechterdifferenziert berichtet werden, obwohl Angaben zum Geschlecht zum Standard der Erhebungstechnik gehören. Für Lauxen-Ulbrich und Leicht (Lauxen-Ulbrich & Leicht 2005) besteht ein grundsätzliches Problem darin, dass datennutzende Personen auf die Dokumentation und Bereitstellung geschlechterdifferenzierender Daten angewiesen sind, dies jedoch häufig nicht der Fall ist (Lauxen-Ulbrich & Leicht 2005:20). So enthalten beispielsweise die Daten des Global Entrepreneurship Monitors und des KfW-Gründungsmonitors die Variable Geschlecht und ermöglichen Geschlechtervergleiche, in den jährlichen Berichten werden aber nur ausgewählte Aspekte standardmäßig nach Geschlecht ausgewertet3. Noch deutlicher wird dies bei Berichten über Beteiligungen oder Förderungen, die gegebenenfalls wenig für Geschlechterunterschiede sensibilisiert sind. Dies soll anhand von zwei Beispielen erläutert werden.
Das erste Beispiel sind Förderquoten im Rahmen des EXIST-Programms. EXIST ist ein Förderprogramm zur Förderung von Existenzgründungen aus der Wissenschaft (BMWi 2020). Ein Element des Programms ist das EXIST-Gründerstipendium, das gründungsinteressierte Studierende, Absolvent*innen und Wissenschaftler*innen an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen unterstützt (BMWi 2021). Basierend auf den Anteilen an Frauen bei Hochschulabsolventen und Promovierten könnte davon ausgegangen werden, dass es sich um ein Tätigkeitsfeld handelt, in dem Frauen und Männer zu fast ausgeglichenen Teilen aktiv sind. Versucht man in den Zahlen des EXIST-Programms Informationen zu Geschlechtsaspekten zu bekommen, so kann man lediglich Anteile an Gründerinnen, zum Teil für größere Zeiträume zusammengefasst, finden. Selbst nachdem begonnen wurde, den Anteil an Gründerinnen zu berichten, wurde dieser nicht jährlich berichtet. Eine Darstellung der Anteile findet sich in Tabelle 2 im Anhang A. Bei den berichteten Zahlen aus dem Zeitraum 2011 bis 2019 liegt der Frauenanteil zwischen 11% im Jahr 2018 und 22% im Jahr 2015.
Da es sich bei EXIST um ein wichtiges Element der Gründungsförderung im Wissenschaftskontext handelt, wäre es von großem Interesse zu wissen, wie die deutlich niedrigeren Anteile an geförderten Frauen zustande kommen. Entsprechend wären Angaben zur Erfolgsquote von Anträgen nach Geschlecht oder die Verteilung der Geschlechter auf Forschungsbereiche und die Verteilung der Förderung auf diese Bereiche relevant gewesen. Die alleinige Veröffentlichung des Anteils an Gründerinnen erlaubt keine Interpretation und dadurch wenig Raum für Empfehlungen zur Weiterentwicklung. Eine mögliche Gefahr ist, dass die ausschließliche Veröffentlichung des Gründerinnenanteils ohne den Kontext der Erfolgsquoten nach Geschlecht dazu führt, dass potenzielle Bewerberinnen fürchten, dass es für sie schwieriger ist, die Förderung zu erhalten. Dies könnte eine Folge sein, obwohl es möglich ist, dass die – unveröffentlichte – Erfolgsquote bei Frauen tatsächlich höher ist als bei Männern.
Ein anderes Beispiel sind Anteile und Erfolgsquoten von Frauen bei einer Bewerbung um eine Beteiligung des High-Tech Gründerfonds, Deutschlands größten Frühphaseninvestors. In der Evaluation des HTGF wurden keine Angaben zu Geschlechterunterschieden bei den Beteiligungen gefunden (Geyer u. a. 2016).
2.1.1 KfW-Gründungsmonitor
Neben dem Global Entrepreneurship Monitor ist der jährlich erscheinende KfW-Gründungsmonitor, der sich selbst als „Analyse von Struktur und Dynamik des Gründungsgeschehens in Deutschland“ beschreibt (Hagen u. a. 2012), eine wichtige Quelle zu Daten zu Gründungen in Deutschland. Der KfW-Gründungsmonitor ist eine Querschnittsbefragung, für die jeweils 50.000 in Deutschland ansässige Personen im gründungsrelevanten Alter zwischen 18 und 64 Jahren zufällig ausgewählt und telefonisch interviewt werden. Die Strichprobe ist repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland. Unter den interviewten Personen befinden sich auch Gründer*innen. Als Gründer*innen gelten Personen, die im Zeitraum von bis zu fünf Jahren vor dem Zeitraum der Befragung eine gewerbliche oder freiberufliche Selbständigkeit begonnen haben, unabhängig davon, ob diese zum Zeitpunkt der Befragung besteht oder nicht (Metzger 2021d:1). Laut eigener Angabe liefert der Kfw-Gründungmonitor „ein umfassendes Bild der Gründungstätigkeit in Deutschland“ (Metzger 2020a:1).
Eine Stärke des Kfw-Gründungsmonitors ist, die Erfassung von Aspekten zur weiteren Beschreibung der wirtschaftlichen Selbständigkeit als Voll- oder Nebenerwerb, Freiberufler, Gewerbetreibender, Neugründung und Übernahme.
Allerdings beschränken sich die geschlechtsspezifischen Auswertungen häufig auf Anzahl und Anteile an Gründungen. Somit liefern die jährlich veröffentlichten Berichte zwar wesentliche Daten zu Gründungen in
Deutschland, sind aber nur bedingt zur Untersuchung von Geschlechterunterschieden im Gründungsverhalten geeignet4.
Im Folgenden werden wesentliche Daten aus dem KfW-Gründungsmonitor und anderen Publikationen, die auf Daten des KfW-Gründungsmonitors beruhen, zu Geschlechterunterschieden im Betrachtungszeitraum zwischen 2010 und 2020 vorgestellt.
Eine Größe, die jährlich im KfW-Gründungsmonitor veröffentlich wird, ist der Anteil an Gründungen durch Frauen an allen Gründungen sowie die Aufteilung dieser Gründungen in Voll- und Nebenerwerbsgründungen.
Abbildung 1. KfW-Gründungsmonitor: Anteil an Gründungen durch Frauen in Prozent.Eigene Darstellung anhand der Daten des KfW-Gründungsmonitors (Metzger 2021d:5; Metzger 2020a:3; Metzger 2020b:5; Hagen u. a. 2011:26; Hagen u. a. 2012:42; Metzger & Ullrich 2013b:6; Metzger 2014b:6; Metzger 2015b:6; Metzger 2016:6).
Die Abbildung 1 zeigt die Veränderung des Frauenanteils an Gründungen über die Zeit. Das Grundmuster bezüglich des Frauenanteils an Existenzgründungen hat sich im betrachteten Zeitraum nicht geändert: Betrachtet man alle Gründungen, liegt der Frauenanteil unter dem Männeranteil. Die Geschlechterunterschiede sind bei Vollerwerbsgründungen stärker, bei Nebenerwerbsgründungen nur schwach ausgeprägt. Der Höchstwert des Gesamtanteils lag bei 44% im Jahr 2014, der niedrigste Wert bei 36% im Jahr 2019. Die Höchstwerte für den Frauenanteil an Gründungen im Nebenerwerb lagen bei 49% im Jahr 2013 und für den Frauenanteil an Gründungen im Vollerwerb bei 41% im Jahr 2014. Statistisch war der Geschlechterunterschied in der Gründungswahrscheinlichkeit bei Analysen für die Jahre 2010 und 2011 nur für Vollerwerbsgründungen signifikant (Hagen u. a. 2012:49; Hagen u. a. 2011:30).
Bei der Interpretation des Frauenanteils muss berücksichtigt werden, dass der Anteil nicht mit einem Anstieg oder einer Abnahme an der Anzahl der Gründerinnen gleichzusetzen ist. So war beispielsweise die Abnahme des Frauenanteils im Jahr 2017 nicht durch eine geringere Anzahl an Gründungen durch Frauen bedingt, sondern „das Ergebnis einer stärkeren Beteiligung von Männern“ (Metzger 2018a:4). Die absoluten Zahlen an Existenzgründungen durch Frauen stagnierten seit 2017 und fielen von 2019 auf 2020 nur moderat um 10.500 auf 205.000 (Metzger 2021c:5).
Als Erklärung für die niedrigeren Gründungsanteile von Frauen insgesamt und die niedrigeren Anteile an Vollerwerbsgründungen wurden drei Aspekte angeführt: Erstens schlechtere körperliche Voraussetzungen für die Gründung in bestimmten Branchen mit hohen Selbstständigenquoten wie Landwirtschaft und Baugewerbe (z.B. aufgrund geringerer Körperkraft), zweitens Persönlichkeitsmerkmale wie höhere Risikoaversion, weniger ausgeprägter Optimismus und negativere Einschätzung der Gründungsfähigkeiten und Rahmenbedingungen sowie drittens Schwierigkeiten in der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, besonders hinsichtlich der Auswirkungen von Erwerbsunterbrechungen zur Kindererziehung (Hagen u. a. 2012:41).
Über den Frauenanteil hinausgehend werden keine Werte jährlich berichtet. Jedoch wurden in verschiedenen Jahren weitere Geschlechterunterschiede aufgegriffen.
So wurden für die Jahre 2010 und 2011 keine Geschlechterunterschiede in Hinblick auf die Stabilität der Gründungen gefunden (Hagen u. a. 2011:35; Hagen u. a. 2012:55).
Eine Analyse für das Jahr 2012 zeigte, dass Frauen (11 Monate) Vollerwerbsgründungen länger vorbereiten als Männer (8 Monate) und die Vorbereitungszeit für Nebenerwerbsgründungen bei beiden Geschlechtern sechs Monate betrug (Metzger & Ullrich 2013a:6). Der Unterschied in der Vorbereitungsdauer wurde als Indikator für größere Sorgfältigkeit in der Vorbereitung interpretiert. Im Folgejahr war der Geschlechterunterschied in der Planungsdauer aufgehoben (Abel-Koch 2014:3). Für das Jahr 2012 wurden auch Geschlechterunterschiede in der gearbeiteten Stundenzahl berichtet (Metzger & Ullrich 2013a:7). Der Unterschied im Vergleich der Stundenmittelwerte aller Gründer und Gründerinnen betrug acht Stunden, war jedoch durch die unterschiedlichen Anteile an Voll- und Nebenerwerbsgründungen getrieben. Aufgeteilt in Voll- und Nebenerwerbsgründungen zeigten sich geringere Unterschiede. So arbeiteten Männer im Vollerwerb durchschnittlich vier und im Nebenerwerb drei Stunden pro Woche mehr als Frauen. Im Folgejahr erhöhte sich die Differenz in den Wochenstunden bei Vollerwerbsgründungen (Männer: 53 Stunden, Frauen: 42 Stunden) und verringerte sich weiter bei Nebenerwerbsgründungen (Männer: 16 Stunden, Frauen: 15 Stunden) (Abel-Koch 2014:3).
Eine weitere Beobachtung für das Jahr 2012 waren größere Finanzierungsschwierigkeiten bei Gründungen aus der Arbeitslosigkeit für Frauen als für Männer (Metzger & Ullrich 2013a:10). Der Anteil der Frauen, die aus der Arbeitslosigkeit im Jahr 2012 gründeten war höher als in den Vorjahren.
Für das Jahr 2013 wurden in einer separaten Publikation Geschlechterunterschieden aus den Daten des KfW-Gründungsmonitors berichtet (Abel-Koch 2014). Dabei zeigten sich Geschlechterunterschiede in der Gründungsmotivation (Abel-Koch 2014:2): Die Umsetzung einer innovativen Geschäftsidee traf auf 58% der Männer und auf 46% der Frauen zu. Notwendigkeitsgründungen aufgrund einer fehlenden alternativen Beschäftigungsmöglichkeit trafen auf 35% der Frauen und 26% der Männer zu.
Frauen (45%) gründeten häufiger mit Kind als Männer (33%) (Abel-Koch 2014:1). Geschlechterunterschiede zeigten sich auch im Arbeitsmarktstatus vor der Gründung (Abel-Koch 2014:1). Frauen waren seltener abhängig erwerbstätig und seltener selbstständig, dafür jedoch häufiger nicht erwerbstätig als Männer. Eine Aufteilung der Werte für Frauen und Männer mit und ohne Kinder zeigte, dass die größte Differenz zwischen Frauen und Männern ohne Kinder in der Gründungsquote aus der Arbeitslosigkeit (Frauen: 19%, Männer 12%). Frauen und Männern mit Kind zeigten deutlich größere Unterschiede. Der stärkste Unterschied waren die Gründungen durch vorher Nicht-Erwerbstätige (Frauen: 43%, Männer: 13%).





























