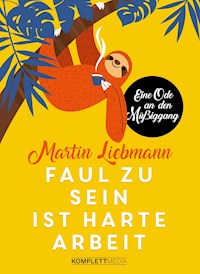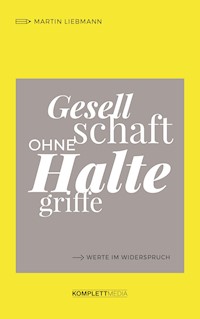
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Komplett-Media Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In unserer unübersichtlichen Welt ist der Bedarf nach Orientierung groß. Doch vielfach wird beim Diskurs über Werte die moralische Keule hervorgeholt und der Ruf nach einem allgemeingültigen Ranking wird laut. Das wird dem heutigen Leben, das sich in viele eigenständige Bereiche aufgeteilt hat, nicht gerecht. Im Gegenteil – die Vorherrschaft einiger weniger Werte unserer Gesellschaft, bringt das System aus dem Gleichgewicht und führt zu Orientierungslosigkeit. "Gesellschaft ohne Haltegriffe" ist der Entwurf einer Ethik, die dem einseitig ökonomisch ausgeprägten Denken und Handeln ein Konzept der Vielfalt entgegenstellt. Die grundsätzlich unterschiedlichen, sich gegenseitig oft widersprechenden Werte der autonomen Lebenswelten bieten neue Orientierungsmöglichkeiten für ein gutes Zusammenleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Originalausgabe
1. Auflage 2020
Verlag Komplett-Media GmbH
2020, München
www.komplett-media.de
ISBN: 978-3-8312-7053-8
Lektorat: Matthias Michel, Wiesbaden
Korrektorat: Dr. Katharina Theml, Wiesbaden
Satz und E-Book: Daniel Förster, Belgern
Umschlaggestaltung: MioMio Design und Brandingstudio, Düsseldorf
Dieses Werk sowie alle darin enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrecht zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das Rechtder öffentlichen Zugänglichmachung.
Inhalt
Der Unterschied im Kleiderschrank
Auf Augenhöhe
Privatleben – Vertrauen
Privatleben – die autonome Lebenswelt im Überblick
Religion – Sinn
Religion – die autonome Lebenswelt im Überblick
Wissenschaft und Bildung – Wahrheit
Wissenschaft und Bildung – die autonome Lebenswelt im Überblick
Künste – Ästhetik
Künste – die autonome Lebenswelt im Überblick
Wirtschaft – Wohlstand
Wirtschaft – die autonome Lebenswelt im Überblick
Öffentliche Verantwortung – Gemeinwohl
Öffentliche Verantwortung – die autonome Lebenswelt im Überblick
Freizeit – Individualität
Freizeit – die autonome Lebenswelt im Überblick
Die autonomen Lebenswelten im Überblick
Gesellschaft ohne Haltegriffe
Das Bild der Welt im Spiegel – die Medien
Teil sein statt beherrschen – Natur als allumfassende Lebenswelt
Das unfreiwillige Experiment
Berechnete Werte – die Digitalisierung
Ein Mosaik der Werte – die Stadt
Ein gutes Gespräch über Werte
Danksagung
Literaturempfehlungen
Der Unterschied im Kleiderschrank
Mit einem langgezogenen Knarzen öffnet sich die Tür des alten, kunstvoll gearbeiteten Erbstücks und gibt den Blick frei auf eine mir sonderbar erscheinende Kollektion von Kleidungsstücken aus lange vergangenen Zeiten. Auf dem ersten Bügel ganz rechts hängt etwas zerknittert ein Hausrock. Seine Form erinnert mich an einen Bademantel, seine feinen, von Hand aufgebrachten Stickereien und der edle Stoff, aus dem er gefertigt ist, zeugen allerdings von einem anderen Gebrauch, als ihn nach dem Duschen über die tropfnasse Haut zu werfen. Der Schnitt: Behaglichkeit, das Gewebe: makellos. Neben dem Hausrock hängt ein weiterer reich verzierter Mantel, nun einer für außer Haus. Der Samtbesatz am Revers verrät, dass das schwere, wollene Stück zu besonderen Anlässen getragen wurde – wahrscheinlich zum sonntäglichen Gottesdienst, warm genug, um in den kalten Gemäuern nicht zu frieren, und kunstvoll genug, um dem Anlass angemessen zu sein. Der Sonntagsmantel wirkt weit weniger abgewetzt als die anderen Kleidungsstücke und wurde wohl stets mit besonderer Sorgfalt gepflegt. Auf dem weißen Kittel daneben sind einige bunte Farbtupfer. Ich wundere mich. Dass mein Urgroßvater eine künstlerische Ader hatte, wurde mir nie erzählt. Ein wenig sentimental muss er auch gewesen sein, denn er hat seine Schuluniform aufbewahrt, sie liegt auf dem Schrankboden. Sorgsam zusammengelegt weckt sie in mir Bilder, wie er als Kind schreiben und rechnen gelernt hat. Daneben seine Ärmelschoner. Darüber das dazugehörige Hemd mit den breiten Manschetten und der Anzug, den er wohl als Kaufmann regelmäßig bei der Arbeit im Kontor getragen hat. Als ich die Bügel etwas zur Seite schiebe, entdecke ich eine kostbare Ratsrobe. Warum hat mir nie jemand von seinem Engagement im Stadtrat erzählt? Gerade will ich den Schrank zumachen, da fällt mein Blick auf eine Reithose, die im hintersten Winkel hängt. Ich schließe meine Augen und male mir aus, wie mein Urgroßvater in seiner freien Zeit durch die Heidelandschaften, Wiesen und Wälder geritten ist und die Natur genossen hat. Bedächtig lege ich die schon etwas spröde Hose zurück und schließe die Tür zu den vergangenen Zeiten.
Der Schrank meines Urgroßvaters erzählt davon, dass sich unsere Vorfahren regelmäßig umgezogen haben, wenn sie von einer Lebenswelt in eine andere traten. Der Wechsel der Kleidung war eine rituelle Unterbrechung, die auf der Haut spüren ließ, dass eine Grenze überschritten wurde, dass es im Rathaus um etwas anderes geht als bei der Arbeit, im Atelier anderes wichtig ist als in der Kirche, dass Schule und Freizeit im wörtlichen wie im übertragenen Sinn verschiedene Paar Schuhe sind, dass im Haus eine eigene Welt existiert, die sich von den Welten draußen unterscheidet.
Ein kurzer Blick in meinen eigenen Kleiderschrank reicht aus, um mir gewahr zu werden, dass das Umkleideritual verschwunden ist. Die Jeans, T-Shirts, Hemden und Pullis lassen sich zu nahezu allen Anlässen tragen – zumindest diejenigen, die nicht zerschlissen oder löchrig sind. Lediglich für den Sport gibt es eine Schublade mit Funktionskleidung, und für besondere berufliche Anlässe hängen einige Sakkos gut geschützt in einem Kleidersack. Irgendwo müsste auch meine einzige Krawatte liegen. Ich habe sie bestimmt seit mehr als 15 Jahren nicht mehr getragen. Üblicherweise bewege ich mich die Textilien betreffend ohne spürbare Übergänge durch die Tage und die verschiedenen Lebenswelten. Für meinen Beruf gibt es nicht einmal eine Arbeitskleidung. Ich gebe unumwunden zu, dass ich es auch sehr bequem finde, mich nicht ständig umziehen zu müssen. Zudem bin ich immer schon alles andere als ein Freund von Uniformen. Im Gegenteil muss ich mich selbst jedes Mal daran erinnern, dass es nicht notwendig auf gestriges, nationalistisches oder alte Zeiten verherrlichendes Denken hinweist, wenn mir jemand in Tracht auf der Straße begegnet. Nur allzu oft sind Uniformen ein Bekenntnis zu glücklicherweise weitgehend überholten Weltbildern. Es reicht, nur ein Burschenschaftskäppchen zu sehen, und schon wird mir klar, dass unsere Zivilisation und Kultur sehr wohl und sehr wichtige Fortschritte gemacht haben und ich auf eine Wiederkehr der angeblich so »guten alten Zeiten« dankend verzichten kann. Unsere heutige Praxis des Kleidens könnte aber mit dafür verantwortlich sein, oder wenigstens ein Symptom dafür, dass so viele Menschen in unserer Gesellschaft ein Gefühl von Haltlosigkeit verspüren. Deshalb fällt es uns heute so schwer, ja meist misslingt es uns sogar, ein gutes Gespräch über Werte zu führen. Wir überschreiten die Grenzen zwischen den Lebenswelten ohne das wirkmächtige Ritual des Umkleidens. Bei jedem Grenzübertritt nehmen wir das gesamte Inventar unserer Werte mit und merken nicht, dass wir dabei Denkmuster, Symbole, Haltungen und Erfahrungen im Gepäck haben, die in der einen Lebenswelt wichtig sind, in den anderen aber oft befremdliche oder gar schädliche Wirkungen entfalten. Ich komme später noch ausführlich auf diese Problematik zurück. Unterm Strich ist die Haltlosigkeit das Kernthema dieses Buches.
Wie stark der Wunsch nach Orientierung ist, kann ich aus eigener Beobachtung berichten; eine Erfahrung, die mir bis heute vergegenwärtigt, wie hilf- und haltlos wir sind, wenn es um Werte und Ethik geht, obwohl so viele kluge Persönlichkeiten sich zu diesen Themen seit tausenden Jahren die Köpfe zerbrochen, um exakte Formulierungen gerungen und wahrhaft fundierte Gedanken dazu diskutiert und aufgeschrieben haben.
Die Geschichte zu diesem Buch fing – wie so viele – ganz harmlos an. An jenem Tag saß ich mit einem Kunden in meinem Büro. Er hatte eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die nach einer Personaländerung in der Chefetage seines Unternehmens eingestellt worden war. Es war dabei um Philosophie gegangen, um Werte in unserer Gesellschaft. Was ihn bezüglich dieser Veranstaltung so bewegte, war die Resonanz bei den Menschen in der Stadt. Bei der Planung der Eröffnungsveranstaltung hatte er seinerzeit mit vielleicht ein paar dutzend Besuchern gerechnet und war eher besorgt gewesen, ob der angemietete Saal nicht viel zu groß sein würde. Geschehen war allerdings genau das Gegenteil. Bis auf den letzten Stuhl belegt war der Raum aus allen Nähten geplatzt, viele Interessierte hatten sogar nicht mehr eingelassen werden können. Eine solche Erfahrung angesichts eines philosophischen Vortrags zu machen, war mehr als ungewöhnlich. Das völlig unterschätzte Interesse der Menschen warf bei meinem Kunden und mir die Frage auf, aus welchem Grund sich so viele die Mühe gemacht hatten, eine Stunde lang den Gedanken eines Philosophen zu folgen. Auch die zwei folgenden, in einem mehr als doppelt so großen Saal durchgeführten Veranstaltungen waren restlos ausgebucht gewesen. War das Bedürfnis nach Orientierung wirklich so groß? Und auf einmal sollte dieser öffentliche Diskurs beendet werden. Für meinen Kunden war diese Vorstellung unerträglich. Fragen, die so viele Menschen der Stadt so sehr bewegen, bräuchten doch einen Platz, wo sie ausgetauscht werden können! Noch während unseres Gesprächs wurde uns klar, dass wir beide ein solches Forum zu organisieren hätten. Und so geschah es dann auch. Das Lübecker Werteforum war geboren.
Für unsere erste Veranstaltung, einen Diskurs über die Werte in der »New Economy« – so nannte man zu der Zeit die sich damals aufblähende digitale Wirtschaft – hatten wir einen streitfreudigen Referenten gefunden. Wir brauchten nur noch einen geeigneten Veranstaltungsort. Die Stadtkirche St. Petri erschien uns ideal für unser Vorhaben. Wir fragten dort an. Wir bekamen eine Zusage – unter einer Bedingung: Die Stadtkirche ohne Gemeinde, die sich als Begegnungsort der Bürgerinnen und Bürger der Stadt versteht, wollte mit als Veranstalterin auftreten. Mit dieser Vereinbarung entstand ein über mehrere Jahre geführter Diskurs, dessen Fragen, Thesen und Erkenntnisse das Fundament der in diesem Buch weitergesponnenen Gedanken bilden. Die Stadtkirche St. Petri zu Lübeck ist die Heimat des hier vorgestellten ethischen Entwurfs. Sowohl der Kirchenraum selbst als auch die Menschen, die sich uns in diesen Jahren angeschlossen haben, allen voran der im Sommer 2017 verstorbene Pastor Günter Harig, haben wesentlichen Anteil an den hier aufgeworfenen Fragen und Anregungen.
Dabei war unser erstes Lübecker Werteforum unterm Strich ein Reinfall. Trotz eines von uns erhobenen Eintrittspreises war die Kirche sehr gut besucht. Daran lag es nicht. Sogar unsere Kosten haben sich gerade so wieder eingespielt. Unser Referent war brillant. Messerscharf und mit der für eine Diskussion wunderbar belebenden Mischung aus provozierender Tonalität und ernsthafter Entschiedenheit lieferte er mit seinem Vortrag reichlich Stoff und Lust für einen Gedankenaustausch. Auch das war sehr gelungen. Was nach hinten losging, war die anschließende Diskussion – oder richtiger: der missglückte Versuch einer anschließenden Diskussion. Zwei Eindrücke blieben uns, und wir wurden sie nicht mehr los. Der erste war, dass wir in den Fragen und Stellungnahmen des Publikums – so interessant sie teilweise waren – einen gemeinsamen Grundakkord vernahmen, der sich wie ein Ruf nach der moralischen Keule, dem Begehren nach einem feststehenden Ranking der Werte, einer Erlösung aus der Orientierungslosigkeit anhörte. Der zweite Eindruck war, dass wir selbst nicht wussten, wie wir damit umgehen sollten. Wir waren hilflos und unfähig, ein gutes Gespräch über Werte zu führen. Völlig unbedarft hatten wir eine Veranstaltung durchgeführt, die nicht gelingen konnte, weil sie an ihrem Anspruch, der so einfach klingt, scheitern musste: ein gutes Gespräch über Werte zu führen.
Für diese eine Frage – Wie geht ein gutes Gespräch über Werte? – haben wir uns dann fünf Jahre Zeit in regelmäßigen Runden genommen, bevor wir uns erneut der Öffentlichkeit stellten, diesmal gewappnet mit einer Idee, wie es klappen könnte. Wir haben es »Balancen – Modell der autonomen Lebenswelten« genannt und in vielen Veranstaltungen einer Tauglichkeitsprüfung unterzogen. Bei aller Unvollständigkeit des Modells und allen offenen Fragen, die es nicht erklären konnte, erwies es sich doch als überraschend hilfreich. Und auch in anderen Umfeldern als dem öffentlichen Stadtdialog in der Lübecker Petrikirche, etwa Seminaren an Universitäten, Vorträgen und Diskursen bei Symposien, schien unser Entwurf zumindest Haltegriffe anzubieten, die es etwas leichter machen, sich in einer sehr komplexen Welt über Werte zu unterhalten, ohne sich an der Vielfalt unserer Gesellschaft und des zivilisatorischen Projekts zu vergreifen.
Wenn ich in diesem Buch das Modell der autonomen, also sich selbst bestimmenden Lebenswelten vorstelle, dann beanspruche ich damit keinesfalls, im Besitz der Wahrheit zu sein, sondern freue mich vielmehr über die Entgegnung mir nicht aufgefallener Widersprüche und Unzulänglichkeiten. Genau darum geht es in diesem Entwurf. Es ist ein sich immer wieder neu justierender, widerstreitender Balanceakt, bei dem man sich auf andere Perspektiven gern einlässt und auf sich ändernde Umfeldbedingungen mit Veränderungsbereitschaft reagiert. Der Gründer des von mir vertretenen Vereins zur Verzögerung der Zeit, der Philosoph Peter Heintel, bezeichnete unser Modell als Prozessethik, die nie fest steht, sondern immer wieder neu ausgehandelt werden muss. Damit konnte ich mich gut anfreunden.
Unser Modell setzt dort an, wo die Welt noch einigermaßen überschaubar ist: in der Stadt. Wir sind über einen sehr simplen Ansatz darauf gekommen, verschiedene Lebenswelten zu unterscheiden und zu benennen, indem wir uns einfach einen Stadtplan von Lübeck auf den Tisch legten und darauf die Stationen des Alltags markierten: die Wohnung, den Arbeitsplatz, die Schule, die Universität, das Theater, die Museen, die Kirche, das Rathaus, den Sportplatz und viele Orte mehr. Nach einigen Wochen des Austüftelns kamen wir auf sieben vom Menschen gemachte Lebenswelten: das Privatleben, die Religion, Wissenschaft und Bildung, die Künste, die Wirtschaft, die öffentliche Verantwortung und die Freizeit. Die Natur haben wir als grundlegende Lebensvoraussetzung ebenso bewusst herausgelassen wie die Medien als Vermittler und die virtuellen Lebenswelten im digitalen Netz. Offensichtlich ist jede dieser von uns verorteten Lebenswelten um einen eigenen Grundwert errichtet worden und für ganz eigenständige Erfahrungsschwerpunkte da, die so in anderen Lebenswelten nicht gemacht werden können. Schon im Augenblick dieser scheinbar banalen Erkenntnis erahnten wir die Bedeutung, die diese fundamentalen Unterschiede für unsere Orientierung bedeuten. Wenn wir alles in einen Topf werfen und daraus ein Wertesüppchen köcheln, dann kann man das Gericht nicht mehr erkennen. Wir haben dann einen ungenießbaren Einheitsbrei.
Noch schlimmer erschien es uns aber, eine universelle Rangliste der Werte aufzustellen, nach der sich dann alles zu richten habe. Sobald ein Wert, der für eine Lebenswelt noch so wichtig sein kann, die Werte in den anderen verdrängt – oder gar einen Alleinstellungsanspruch erhebt –, richtet er Zerstörung an. Ein Gespräch über die gesellschaftlichen Werte, so unsere Erkenntnis, kann nur dann gelingen, wenn wir uns darüber bewusst werden, über welche Lebenswelt wir gerade reden. Selbstverständlich orientieren wir uns an ethischen Grundsätzen und übergeordneten Werten. Sie sind so etwas wie der Grundkonsens unseres Zusammenlebens und für ein gelingendes Miteinander sehr hilf- und erfolgreich. Aber diese philosophischen Konzepte reichen aus unserer Sicht nicht aus, um modernen Gesellschaften Orientierungshilfen zu geben, mit denen sich die über viele Generationen erstrittenen zivilisatorischen Fortschritte gegen ihre Feinde verteidigen und weiterentwickeln lassen.
Dieses Buch schreibe ich in Zeiten der Coronakrise. Gerade erleben wir, was es heißt, wenn ein Lebensbereich – in diesem Fall die Gesundheit – alle anderen beherrscht, sich alles und alle einem Ziel unterordnen müssen. Für die Bewältigung der Krise und den Schutz des Lebens ist das aktuell notwendig und höchstwahrscheinlich auch richtig. Es ist aber ein zeitlich begrenzter Ausnahmezustand. Sein Ende sehnen wir uns herbei – nicht nur, um dem Elend, das die Krankheit bringt, zu entrinnen, sondern auch, um unsere Lebensqualität mit ihren vielfältigen Erfahrungsmöglichkeiten wiederherzustellen. Wenn es gut läuft, sogar weiterzuentwickeln, indem wir herausfinden, worauf wir gut verzichten können und was uns besonders wichtig ist. Die Dominanz eines einzelnen Zieles oder Wertes als Dauerzustand würden wir weder als Individuen noch als Gesellschaft ertragen wollen und auch nicht können. Die von uns in der Coronakrise gemachten Erfahrungen, wenn sich alles der Gesundheit unterordnet, sind allerdings eine – wenn auch überzeichnete – Allegorie dessen, was wir seit einigen Jahrzehnten in einem schleichenden, uns vielfach unbewussten Prozess durchmachen: die Ökonomisierung aller Lebenswelten als dauerhafte Realität. Bis das Coronavirus gekommen ist, wurde so gut wie alles nach ökonomischen Prinzipien bewertet. Im Diskurs war das Argument des Geldes immer der stärkste Trumpf, ganz gleich, worum es ging. Erst angesichts der Bekämpfung der exponentiell ansteigenden Infektionsraten und der Verhinderung eines Zusammenbruchs unserer Gesundheitsversorgung mussten sich wirtschaftliche Interessen erstmals seit langem einem höheren gesellschaftlichen Ziel unterordnen. Die Coronakrise hat insofern den Beweis dafür erbracht, dass die Wirtschaft ihre Vormachtstellung nicht natürlich oder unausweichlich eingenommen hat, sondern diese das Ergebnis einer gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung ist. Und wie alle von Menschen gemachten Systeme ist auch dieses Dominanzsystem veränderbar. Diese Erkenntnis nehme ich als Hoffnung mit auf die gedankliche Reise, zu der ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, einlade. Ich maße mir als Ihr Reiseleiter nicht an, Ihnen Vor- oder Ratschläge zu geben, wie eine gute Gesellschaft und ein gutes Zusammenleben aussehen können. Das werden wir uns immer wieder neu ausdenken und ausprobieren müssen. Vielmehr ist es mein Anliegen, den Diskurs über Werte aus einengenden, moralischen Pfaden in eine offenere, auch streitfreudigere Gedankenlandschaft zu führen, in der es eine Menge unterschiedlicher Dinge und Werte gibt, die uns wichtig sind und für die es sich zu engagieren oder gar zu kämpfen lohnt. Unser zivilisatorisches Projekt steht vor genügend großen Herausforderungen, allen voran, der Erderwärmung entgegenzuwirken und die Herausforderungen im Umgang mit künstlicher Intelligenz und Biotechnologie unter sozialen und kulturellen Gesichtspunkten zu meistern. In derart stürmischen Zeiten können ein paar Haltegriffe recht hilfreich sein. Oder zumindest eine Ahnung davon, wie ein Gespräch über Werte geführt werden kann. Dazu will dieses Buch anregen.
Auf Augenhöhe
Die Küche einer Wohngemeinschaft ist das ideale Versuchslabor für Individualethik. Einkauf, Abwasch, Müll und Ordnung in der WG-Kommunikationszentrale stellen die Beziehungen zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern regelmäßig vor große Herausforderungen. Wer hat das Stück Butter zum Kochen verbraucht, so dass ich zum Frühstück die letzte Brotscheibe staubtrocken herunterwürgen muss? Warum sind alle Töpfe und Pfannen noch schmutzig, obwohl ich meinen Besuch mit einem selbst gekochten Abendessen verwöhnen wollte? Kommt der fiese Gestank aus den drei Mülltüten, die prallvoll neben dem Eimer liegen? Wo ist der Korkenzieher, der mich vom Inhalt der Flasche Sauvignon trennt, die ich mir so gern einverleiben möchte? Und überhaupt: Wo ist die Flasche? Selbst auf kleinstem Raum in überschaubarer Gruppengröße birgt jede noch so kleine Handlung eines einzelnen Mitglieds enormes Konfliktpotenzial. Nicht ohne Grund hängen in wohl fast jeder Wohngemeinschaft diverse Pläne, wer wann was zu verrichten hat, und Listen mit Regeln, was man tunlichst unterlassen soll, um einigermaßen friedlich so etwas wie ein normales Zusammenleben hinzubekommen. Theoretisch ist das ein einfach zu lösendes Problem. Alle müssten nur die Goldene Regel befolgen. Den letzten Butterrest nicht achtlos verbrauchen, damit fürs Frühstück für alle noch etwas da ist. Das Geschirr nach dem Essen abwaschen, damit es wieder einsatzbereit ist. Den Müll herunterbringen, wenn der Eimer voll ist. Den Korkenzieher wieder zurück an seinen Platz legen. Kurz: Alles so zu hinterlassen, wie man es selbst gern vorfinden will. Was du nicht willst, was man dir tu, das füg’ auch keinem anderen zu!
Die Goldene Regel findet man weitgehend sinngetreu in fast allen Kulturen. Im jüdischen Talmud klingt sie fast identisch wie in der christlichen Bibel, in den Hadithen des Propheten Mohammed ist sie anders formuliert, meint aber dasselbe, was auch Konfuzius ähnlich geäußert hatte und was im Mahabharata der Hindus überliefert ist. In weniger komplexen Beziehungsgeflechten, auf der Ebene zwischen Individuen, funktioniert dieser moralische Kompass zumindest als Orientierung recht gut, wenngleich seine Einhaltung teilweise nur auf die Mitglieder der eigenen Gruppe begrenzt wird. Und selbst da kann es trotz konsequenter Einhaltung fürchterlich knirschen. Es reicht, wenn zum Beispiel ein Mitglied der WG ein völlig anderes Hygiene- und Ordnungsbedürfnis hat als die anderen. Wenn ich nicht möchte, dass nach einem köstlichen Gelage die ausgelassene Stimmung durch so etwas Banales wie Abwaschen zerstört wird, dann tu ich es doch in guter Absicht, wenn ich alles schmutzig liegen lasse, oder? Und schließlich fordere ich auch niemanden dazu auf, vor mir aufzustehen und das Vorabendchaos als Erster zu entdecken. Eine Tasse für einen Kaffee findet sich am nächsten Morgen garantiert, und sollte sie nicht sauber sein, ist sie schnell ausgespült. Außerdem ist die Küche kein klinischer Reinraum, sondern wird erst durch mit allen Sinnen erfahrbare Spuren des Lebens gemütlich. Die Goldene Regel braucht ein gemeinsames Verständnis von gut und schlecht, von Leid und Freude. Sonst ist ihre Reichweite sehr begrenzt.
Eine weitere wichtige Voraussetzung für den Kürzest-Kodex ist, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Sobald jemand oder eine Gruppe sich zu Höherem berufen fühlt und über andere Menschen oder Menschengruppen stellt, bricht das moralische Gebäude schnell zusammen. Fundamentalistisch ausgelegte Religionen und nationalistisch tönende Akteure belegen das eindrucksvoll. Mit wenigen Streichen können sie mühsam aufgebaute Strukturen eines guten Miteinanders zerstören. Sie versuchen es auch regelmäßig, viel zu oft mit Erfolg. Übrigens auch in der einen oder anderen Wohngemeinschaft soll es Mitglieder geben, die sich zu Höherem berufen fühlen als zu den niederen Tätigkeiten, womit sie das Prinzip der Augenhöhe außer Kraft setzen und den Wohnfrieden gefährden.
Die Philosophie hat wegen solcher Probleme immer wieder versucht, universell funktionierende Rahmen zu finden, an denen wir uns orientieren können. Einer der bekanntesten ist der Kategorische Imperativ von Immanuel Kant, der den Mensch mit seiner Würde als Selbstzweck sieht und aus der in ihm wohnenden Vernunft eine allgemeingültige Regel entwickelt: »Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.« Das trägt schon deutlich weiter, denn mit dem Wegfall des Individuums als Maßstab und den Fokus auf die Allgemeinheit kann man sich nicht mehr ganz so leicht herausreden und jeden Egoismus mit ein paar argumentativen Winkelzügen als gut und richtig darstellen. Vor allem wenn man wie Kant den Menschen dazu befähigt sieht, sich seiner Vernunft zu bemächtigen, ist der Kategorische Imperativ eine recht gute Orientierungshilfe für das Zusammenleben. Aber auch Kants Modell hat seine Grenzen. Das Problem liegt darin, dass es sowohl individuell als auch kulturell sehr unterschiedliche Haltungen und sich widersprechende Ansichten geben kann, die Menschen ernsthaft und auch reflektiert zum allgemeinen Gesetz erheben wollen. Insbesondere, wenn es sich um Glaubenssätze handelt – und die Welt ist auch jenseits religiöser Fragen voll davon –, lassen sich Maximen als allgemeingültig und moralisch einwandfrei, ja geradezu als zwingend zu befolgen behaupten. Nicht selten kommt es dann sogar dazu, dass daraus Alleinstellungsansprüche formuliert werden. Das ist mit Sicherheit nicht das, was sich der große Aufklärer und Kämpfer für die Vernunft dabei gedacht hat, aber je komplexer unsere Welt geworden ist, desto deutlicher wurde, dass sein moralisches Orientierungskonstrukt weitergedacht werden muss. Einer, der das sehr gründlich getan hat, ist Jürgen Habermas. Er hat Folgendes vorgeschlagen: »Der kategorische Imperativ bedarf einer Umformulierung (…): Statt allen anderen eine Maxime von der ich will, dass sie allgemeines Gesetz sei, als gültig vorzuschreiben, muss ich meine Maxime zum Zweck der diskursiven Prüfung ihres Universalitätsanspruchs allen anderen vorlegen. Das Gewicht verschiebt sich von dem, was jeder (einzelne) ohne Widerspruch als allgemeines Gesetz wollen kann, auf das, was alle in Übereinstimmung als universale Norm anerkennen wollen.«1
Die Diskursethik von Habermas hat für mich etwas sehr Befreiendes, weil sie uns von vorgefertigter Moral löst. Sie gibt uns einen Rahmen für den Vermittlungsprozess. Das Inhaltliche müssen wir uns immer wieder neu erarbeiten. Das Schlamassel mit der Freiheit ist halt nur, dass sie mitunter recht mühsam ist. Jede ethisch bedeutsame Frage immer wieder auszudiskutieren, erfordert viel Zeit, gedankliche Schärfe, ein ordentliches Maß an Besonnenheit und auch viel Geduld – insbesondere weil unser Zusammenleben aus mehr besteht als ein paar individuellen Beziehungen zu anderen Menschen, die ich vielleicht noch einigermaßen gelingend mit der Goldenen Regel auf die Reihe bekomme. Es wäre sehr viel bequemer, sich an ein paar vorsortierten Werten und Moralprinzipien zu orientieren, als ständig wieder vor neue Herausforderungen der Bewertung gestellt zu werden.
Selbstverständlich stehen wir nicht im werteleeren Raum. Über den modernen, aufgeklärten Gesellschaften flattert die Trikolore von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, oder moderner: Solidarität. Diese Leuchtsterne haben seit der Zeit der Aufklärung wenig an Strahlkraft verloren. Aber angesichts des nun schon länger andauernden Siegeszugs der neoliberalistischen Doktrin, der zufolge alles der freie Markt regelt, ist aus der Freiheit der Aufklärer eine Freiheit zur Selbstausbeutung geworden; mehr noch macht uns die Ökonomie der Aufmerksamkeit2 immer häufiger selbst zum Produkt. Gleichheit erfahren wir vielleicht nur noch vor dem Gesetz, während sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet. Und wenn die ertragsstärksten wirtschaftlichen Unternehmen sich auch dadurch auszeichnen, dass sie zum Gemeinwohl keine Steuerbeiträge leisten, wie steht es dann um die Solidarität? Erleben wir die nur noch, wenn wir in Krisenzeiten wie der Coronapandemie gemeinsam für die Heldinnen des Alltags klatschen? Wir haben nationalstaatliche Verfassungen, bei den Deutschen ist es das großartige Grundgesetz. Sein erster Teil, der die Grundrechte beschreibt, ist so klar und kraftvoll formuliert, dass er sich für mich wie das verfassungsrechtliche Pendant zu Beethovens »Ode an die Freude« anhört. Doch wie lebendig ist dieser Text heute noch? Wir haben einen verlässlichen, rechtsstaatlichen Rahmen und dazu noch tausende Gesetze und Verordnungen, die unser Zusammenleben klar regeln. Warum entsteht trotz dieser Fülle an zivilisatorisch hart errungenen Normen bei so vielen Bürgerinnen und Bürgern ein so tiefes Gefühl der Orientierungslosigkeit?
Im Werteforum haben wir dafür eine Begründung gefunden: Die Gesellschaft ist aus ihrer Balance geraten. Freiheit ist zu einem individuellen Gut geworden. Aus dem Recht auf einen selbstbestimmten Lebensentwurf in einer vielfältigen Gemeinschaft ist die Realität eines atomisierten Nebeneinanders3