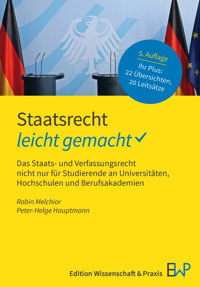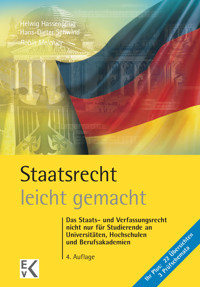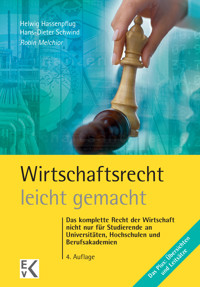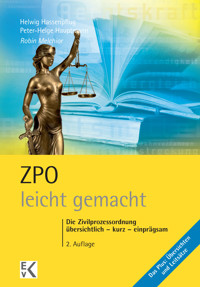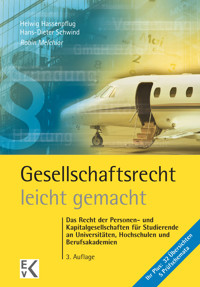
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Wissenschaft & Praxis
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In bewährt fallorientierter Weise vermittelt ein erfahrener Richter die juristischen Grundlagen. Aus dem Inhalt:
– Personengesellschaften (GbR, OHG, KG ...)
– Kapitalgesellschaften (GmbH, UG, AG ...)
– Juristische Personen (Verein, VVaG, Stiftung ...)
– Europäische Rechtsformen (SE, EWIV, SCE ...)
– Zweigniederlassungen, Konzerne, Umwandlungen
Ein Lehrbuch, das die sprichwörtlichen sieben Siegel des Gesellschaftsrechts löst.
Ihr Plus: 32 Übersichten und 5 Prüfschemata.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
leicht gemacht®
Die prägnanten, verständlichen Lehrbücher der
leicht gemacht® SERIEN
mit Beispielfällen, Übersichten und Leitsätzen
Unsere leicht gemacht® SERIEN haben Generationen von Stu-dierenden erfolgreich in die verschiedenen Themenbereiche eingeführt.
Die GELBE SERIE erläutert Inhalte aus der Rechtswissen-schaft
Die BLAUE SERIE vermittelt Themen der Bereiche Steuer und Rechnungswesen
Die Lehrbücher sind so angelegt, dass Vorkenntnisse nicht erforderlich und nach dem Durcharbeiten des Textes die wich-tigen Grundlagen vermittelt sind. Sie eignen sich als Einstieg, aber auch zur Wiederholung vor Prüfungen.
Unsere Lehrbücher wenden sich an Studierende der Universi-täten, Hochschulen und Berufsakademien, aber auch an Teil-nehmer der berufsbezogenen Ausbildungen. Die Bücher der leicht gemacht® SERIEN vermitteln ebenso jedem Interessier-ten auf verständliche und kurzweilige Weise die Grundlagen von Steuer, Rechnungswesen und Rechtswissenschaft.
Die leicht gemacht® SERIEN erscheinen im
Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
[1]
GELBE SERIE leicht gemacht®
Herausgeber: Dr. jur. Dr. jur. h.c. Helwig Hassenpflug Professor Dr. Hans-Dieter Schwind Richter am AG Dr. Peter-Helge Hauptmann
Gesellschaftsrecht
leicht gemacht
Das Recht der Personen- und Kapitalgesellschaften für Studierende an Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien
3., erweiterte und überarbeitete Auflage
von
Robin Melchior
Richter am Amtsgericht
Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
[2]
Besuchen Sie uns im Internet:www.leicht-gemacht.de
Autoren und Verlag freuen sich über Anregungen
Umwelthinweis: Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt Gestaltung: M. Haas, www.haas-satz.berlin; J. Ramminger Druck & Verarbeitung: Druck und Service GmbH, Neubrandenburg leicht gemacht® ist ein eingetragenes Warenzeichen
© 2017 Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
[3]
Inhalt
I.Grundlagen des Gesellschaftsrechts
Lektion 1: Welche Arten von Gesellschaften gibt es?
Lektion 2: Firmenrecht
Lektion 3: Publizität
II.Personengesellschaften
Lektion 4: GbR
Lektion 5: OHG
Lektion 6: KG
Lektion 7: GmbH & Co. KG
Lektion 8: Stille Gesellschaft, Partnerschaft
III.Kapitalgesellschaften und Verbände
Lektion 9: GmbH, UG
Lektion 10: AG
Lektion 11: KGaA, Verein, VVaG, Genossenschaft, Stiftung
IV.Europäische und ausländische Rechtsformen
Lektion 12: EWIV, SE, SCE
Lektion 13: Ausländische Rechtsträger und Zweigniederlassungen.
V.Verbundene Unternehmen, Umwandlungen
Lektion 14: Unternehmensverträge, Konzern
Lektion 15: Umwandlungen
Abkürzungen
Sachregister
[4]
Übersichten * Prüfschemata
Übersicht 1 Personengesellschaften und Körperschaften
Übersicht 2 Grundbegriffe und Ziele des Gesellschaftsrechts
Übersicht 3 Firmenrecht
Übersicht 4 Pflichtangaben
Übersicht 5 Handelsregister
Übersicht 6 Publizität des Handelsregisters
Übersicht 7 Jahresabschluss
Übersicht 8 Mitgliedschaft und Anteil
Übersicht 9 Vertretung bei OHG und GbR
Übersicht 10 Kommanditgesellschaft
Übersicht 11 Vererbung der Anteile eines Kommanditisten
Übersicht 12 Vererbung der Anteile eines phG
Übersicht 13 GmbH & Co. KG
Übersicht 14 Erscheinungsformen der GmbH & Co. KG
Übersicht 15 Partnerschaft
Übersicht 16 Charakteristika der Kapitalgesellschaften
Übersicht 17 Haftungsregime GmbH vor Eintragung
Übersicht 18 Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Übersicht 19 Liquidation der GmbH
Übersicht 20 Haftungsregime GmbH nach Eintragung
Übersicht 21 Aktien und Kapitalmaßnahmen
Übersicht 22 Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)
Übersicht 23 Verein
Übersicht 24 VVaG
Übersicht 25 Genossenschaft
Übersicht 26 Stiftung
Übersicht 27 EWIV
Übersicht 28 Europäische Gesellschaft (SE)
Übersicht 29 IPR / Anerkennung der Rechtsfähigkeit
Übersicht 30 Unternehmensverträge
Übersicht 31 Verbundene Unternehmen
Übersicht 32 Umwandlungen
Prüfschema 1 Ansprüche gegen Personengesellschaften
Prüfschema 2 Haftung der Gesellschafter und Komplementäre
Prüfschema 3 Haftung des Kommanditisten
Prüfschema 4 Ansprüche der Gesellschafter
Prüfschema 5 Ansprüche gegen GmbH nach Eintragung
[5]
I.Grundlagen des Gesellschaftsrechts
Lektion 1: Welche Arten von Gesellschaften gibt es?
Fall 1
Die Freundinnen Hilde und Marie verabreden, jede Woche gemeinsam einen Lottoschein auszufüllen. Hilde möchte aus dem Bauch heraus zufällige Zahlen tippen. Marie ist strikt dagegen und wertet Statistiken aus. Sie können sich nicht einigen, welche Lottozahlen sie ankreuzen.
Fall 2
Hilde hat von ihrem Vater Aktien eines deutschen Automobilherstellers geerbt. Sie geht zur Hauptversammlung und lässt sich nicht beeindrucken von der gediegenen Atmosphäre: Leute im Business-Look, üppiges Buffet. Denn Hilde hat eine Rede vorbereitet, mit der sie den „Konzern‟ überzeugen möchte, künftig statt Oberklasse-PKW nur noch umweltverträgliche Kompakt-PKW mit alternativen Antrieben zu produzieren.
Fall 3
Marie ist Wirtschaftsingenieurin und arbeitet zurzeit bei einem Wirtschaftsprüfer. Sie möchte sich selbstständig machen als Unternehmensberaterin mit dem Schwerpunkt Kalkulation, Bewertung und Einsatz energieeffizienter Kühlanlagen. Um das Haftungsrisiko zu verringern, gründet Marie eine GmbH.
Was haben die Fälle 1 bis 3 gemeinsam und was unterscheidet sie?
In allen drei Fällen geht es um Gesellschaftsrecht.
Das Gesellschaftsrecht beschreibt die privatrechtliche Struktur von Personenvereinigungen und Verbänden. Grundlage ist stets ein
Gesellschaftsvertrag
, mit dem die Gesellschafter einen gemeinsamen Zweck verfolgen, z.B. eine gewerbliche Tätigkeit oder die Berufsausübung. Gewinnerzielungsabsicht ist der Regelfall, rechtlich aber nicht zwingend (Non-Profit).
Es gibt viele Formen von Gesellschaften; auffällig sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Formen: Im Fall 1 besteht eine Gesellschaft[6] bürgerlichen Rechts (GbR) zu dem Zweck, gemeinsam mit einem Tippschein an den Ziehungen der Lotterie teilzunehmen. Die GbR tritt nach außen nicht weiter in Erscheinung und ist auch nicht rechtsfähig. Die Leitungsmacht liegt allein in den Händen der Gesellschafterinnen. Wenn sie sich nicht einigen, wird der Gesellschaftszweck nicht erreicht.
Im Fall 2 liegt eine Aktiengesellschaft (AG) vor. Die AG ist eine juristische Person, die am Wirtschaftsverkehr als Unternehmen teilnimmt. Ihre Gesellschafter (Aktionäre) erbringen eine Einlage (deshalb ist die AG eine Kapitalgesellschaft). Ansonsten liegt die Leitung der Gesellschaft nicht unmittelbar in den Händen der Aktionäre, sondern bei den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates. Wenn Hilde mit ihrer Rede weder Vorstand, Aufsichtsrat, noch die übrigen zigtausend Aktionäre überzeugen kann, dann produziert die AG weiterhin Benzin-Dinosaurier.
Im Fall 3 gründet Marie eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Die Gemeinsamkeit mit der AG besteht darin, dass die GmbH auch eine juristische Person ist, von den Gesellschaftern mit Kapital ausgestattet wird und die Haftung für Schulden auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den Personengesellschaften, wie z.B. der GbR. Damit Marie in ihrer GmbH tatsächlich das Sagen hat, muss sie auch die Funktion der Geschäftsführerin übernehmen. Schließlich fällt auf, dass hier eine Gesellschaftsform geschaffen wird, bei der nur eine Person den Gesellschaftsvertrag abschließt.
Wegen dieser Unterschiede werden die Gesellschaften grob in zwei Gruppen aufgeteilt, und zwar in die Personengesellschaften und die Verbände (vielfach Körperschaften genannt). Lesen Sie hierzu nun die Übersicht 1.
Außer im Privatrecht gibt es auch Verbände im Öffentlichen Recht: Sind sie rechtsfähig, dann handelt es sich um Körperschaften oder Stiftungen des öffentlichen Rechts (z.B. der Bund und die Länder, IHK, Berufskammern, Hochschulen, staatliche Schlösserverwaltungen). Fehlt die rechtliche Selbstständigkeit, dann handelt es sich um Anstalten oder Eigenbetriebe (z.B. Wasserwerk einer Stadt oder eines Landkreises, Friedhof, Verkehrsbetriebe).
[7]
Übersicht 1: Personengesellschaften und Körperschaften
Personengesellschaften
sind:
▶die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
▶die Offene Handelsgesellschaft (OHG)
▶die Kommanditgesellschaft (KG)
▶die stille Gesellschaft und die Partnerschaft
Gründung und Existenz von Personengesellschaften setzen mindestens zwei Gesellschafter voraus.
Prägende Merkmale sind ferner die persönliche Haftung der Gesellschafter für die Schulden der Gesellschaft und die Organisations- und Leitungsmacht in den Händen der Gesellschafter (Selbstorganschaft).
Personengesellschaften besitzen keine oder
keine
umfassende
Rechtsfähigkeit
, wie sie natürliche und juristische Personen haben.
Als Verbände organisiert (synonym: Körperschaften) sind im Privatrecht:
▶die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
▶die Aktiengesellschaft (AG)
▶die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)
▶der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)
▶die Genossenschaft
Gemeinsames Merkmal sind die Rechtsfähigkeit, weshalb sie auch juristische Personen genannt werden, und die Beschränkung der Haftung auf das Vermögen der Gesellschaft.
Die „Urform‟ der juristischen Person des Privatrechts ist der Verein (§§ 21, 22, 54 BGB).
Ist die juristische Person zugleich Unternehmensträgerin und wird sie von ihren Gesellschaftern mit Kapital ausgestattet, spricht man von einer Kapitalgesellschaft (AG, KGaA, GmbH). Zu den juristischen Personen – aber ohne verbandsmäßige Organisation – zählen die Stiftungen (§ 80 BGB).
[8]
Charakteristisch für einen Verband sind (im Unterschied zu einer Personengesellschaft):
▶die rechtliche Selbstständigkeit der Gesellschaft
▶die Beschränkung der Haftung auf das Gesellschaftsvermögen
▶die Unabhängigkeit vom Bestand der Gesellschafter
▶ferner die relativ einfache Übertragbarkeit der Mitgliedschaft
▶es können auch Nicht-Gesellschafter die Geschäfte führen (Fremdorganschaft).
Trotz der erheblichen Unterschiede zwischen den einzelnen Gesellschaftsformen des Privatrechts gibt es gemeinsame Begriffe und Normzwecke.
Diese gemeinsamen Grundbegriffe und Ziele finden Sie aufgelistet in der Übersicht 2.
Übersicht 2: Grundbegriffe und Ziele des Gesellschaftsrechts
▶Geschäftsführung und Vertretung:
Geschäftsführung ist die Organisationund Willensbildung im Innenverhältnis (z.B. Festlegung der Öffnungszeiten oder Auswahl der Lieferanten). Vertretung ist das rechtliche Handeln im Namen der Gesellschaft im Außenverhältnis (z.B. Abschluss eines Vertrages mit einem Lieferanten). Da eine Gesellschaft nicht wie ein Mensch selbstständig handeln kann, ist sie darauf angewiesen, dass Organe für sie handeln (organschaftliche Vertretung).
▶Rechtsfähigkeit und Haftung:
Das Auftreten einer Gesellschaft im Rechtsverkehr wirft die Frage auf, ob sie selbst rechtsfähig ist, also sie selbst Trägerin von Rechten und Pflichten ist und ob damit ihr selbst die Erklärungen ihrer Organe zugerechnet werden können. Daran schließt sich die Frage an, ob für die Schulden der Gesellschaft nur sie selbst mit dem Gesellschaftsvermögen oder auch ihre Gesellschafter persönlich aufkommen müssen.
[9]
▶Gläubigerschutz:
Sinn und Zweck der meisten Regelungen im Gesellschaftsrecht ist es, die Allgemeinheit und insbesondere die Gläubiger zu schützen. Letztere sind Personen, die eine Forderung gegen die Gesellschaft haben. Zum Gläubigerschutz gehören gesetzliche Regelungen über die Errichtung von Gesellschaften, Geschäftsführung, Vertretung und Haftung. Kurzum ein Gebot zur Transparenz: Ein Kunde oder Geschäftspartner, der auf eine Gesellschaft trifft, soll wissen, mit wem er sich da rechtlich einlässt. Deshalb besteht als Korrelat zur Teilnahme am Rechts- und Geschäftsverkehr aus Gründen des Gläubigerschutzes eine umfassende Pflicht zur Offenlegung der rechtlichen Strukturdaten (Angaben auf Geschäftsbriefen, Handelsregister, Firma, Rechtsform, Haftungsverhältnisse, Vertretung) und der wirtschaftlichen Verhältnisse (Jahresabschluss); s. Lektion 3 zur Unternehmenspublizität.
▶Minderheitenschutz:
Sobald eine Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, bedarf es Regeln darüber, ob die Gesellschafter sich immer einigen müssen oder ob auch Mehrheitsentscheidungen zugelassen sind. Auch bei Mehrheitsentscheidungen muss sicher gestellt sein, dass die wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen der Minderheit hinreichend geschützt sind.
Ergänzung: Kann das Gesellschaftsrecht auch definiert werden als Recht der Unternehmensträger, oder sogar als Unternehmensrecht?
Ja und nein. Ja, weil sehr viele Gesellschaften ein Unternehmen betreiben. Nein aber deshalb, weil diese Schlagworte die rechtliche Vielfalt der Gesellschaftsformen und Zwecke nicht vollständig abdecken. So liegt z.B. im Fall 1 unzweifelhaft eine Gesellschaft vor, die aber kein Unternehmen betreibt und bei der der Konflikt der Gesellschafter keine Frage der Haftung ist.
Ergänzend zu der obigen Definition ist auch der Begriff der Rechtsträgerschaft ein zentrales Thema des Gesellschaftsrechts: Wie stark ist die Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern rechtlich verselbstständigt? Das beinhaltet die Frage nach der Rechtsfähigkeit und bei Fehlen derselben die Frage, wem Handlungen im Namen der Gesellschaft zugerechnet werden und wer haftet.
[10]
Fall 4
John Kerry, irischer Staatsbürger, möchte in Deutschland eine Gesellschaft gründen oder erwerben, um eine Molkerei zu betreiben. Er fragt einen deutschen Rechtsanwalt, wie viele Formen von Gesellschaften es gibt und welche für ihn die richtige Form ist. Was wird der Anwalt antworten?
Die Anzahl der Formen für Gesellschaften ist durch Gesetz vorgegeben (Typenzwang;
numerus clausus
).
Es gehört zu den Privilegien eines Staates, durch Gesetze Gesellschaftsformen zuzulassen. Solche Normen sind u.a. §§ 705 ff. BGB, 105, 161, 233 HGB; ferner das AktG, GmbHG, GenG, PartGG. Jeder, der die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, kann sich die jeweilige Gesellschaftsform zu eigen machen. Der Staat gibt zwar die Anzahl der Formen vor, überlässt aber die Auswahl und die inhaltliche Gestaltung und Ausrichtung weitestgehend den Gesellschaftern. Auswahl und Gestaltung sind Aus-druck der Privatautonomie und der Gewerbefreiheit.
So kann im Fall 3 Marie den Gesellschaftsvertrag sehr weitgehend selbst gestalten und ihren Bedürfnissen anpassen; sie kann sogar einzelne Gesellschafttypen miteinander kombinieren (z.B. GmbH & Co. KG). Die konkrete Auswahl einer Gesellschaftsform ist dabei nicht immer allein vom Gesellschaftsrecht geprägt, sondern auch von der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit und von anderen rechtlichen Aspekten; z.B. der Besteuerung und dem kollektiven Arbeitsrecht (Unternehmensmitbestimmung).
Ergänzung: Kann John Kerry in Deutschland überhaupt mittels einer Gesellschaft ein Unternehmen betreiben?
Nein, wenn es nur nach Art. 9 Abs. 1 GG geht. Denn danach ist das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden, Deutschen vorbehalten. Es gibt aber noch die EU-Grundfreiheiten, die dem GG im Rang gleichwertig sind und jedem EU-Bürger unmittelbar Rechte geben. Die Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 49, 54, 63 AEUV gewährt John das Recht, sich in jedem EU-Mitgliedsland als Gesellschafter (Investor) zu betätigen.
[11]
Ergänzung: Ist John bei der Wahl auf deutsche Gesellschaftsformen beschränkt?
Nein, er hat die Wahl zwischen allen gesetzlich zugelassenen Gesellschaftsformen aller EU-Mitgliedsstaaten. Die Niederlassungsfreiheit wird bei ausländischen Rechtsformen in der Weise gewährt, dass diese Gesellschaften im Inland eine Zweigniederlassung betreiben können (vgl. § 13e – g HGB). John stehen zusätzlich europäische Rechtsformen zur Verfügung. Siehe hierzu die Lektionen 12 und 13.
Ergänzung: John hat zwar eine Menge Geld, aber nicht genug, um damit die Molkerei zu betreiben. Beeinflusst die Finanzierung der Gesellschaft seine Wahl der Rechtsform?
Ja, Gesellschaften, die ein Unternehmen betreiben, benötigen Geld. Dieses besorgen sich die Gesellschaften entweder bei Banken (Fremdkapital) oder bei ihren Gesellschaftern (Eigenkapital). Während die AG in ihrer rechtlichen Struktur prädestiniert ist, das notwendige Geld bei ihren Aktionären über die Börse einzusammeln (Public Equity), haben die anderen Gesellschaftsformen keinen Zugang zu diesem staatlich beaufsichtigten Markt. Was aber nicht heißt, dass ihnen der Kapitalmarkt verschlossen ist (Private Equity). Vielmehr werden Investoren außerhalb des Börsengeschehens akquiriert.
Gesellschaftsrecht ist damit auch das Recht des
Kapitalmarktes
. Die thematische Klammer bilden:
▶der Gläubigerschutz
▶der Schutz von Minderheitsgesellschaftern
▶die Rechnungslegung
[12]
Lektion 2: Firmenrecht
Fall 5
Fritz Bollmann möchte eine Tankstelle in der Rechtsform einer GmbH betreiben. Sein Anwalt führt aus, dass die GmbH Kaufmann sei und damit eine Firma im Sinne des HGB verwenden werde. Fritz ist verwirrt, weil er eigentlich nicht selbst als Kaufmann tätig werden möchte, sondern die von ihm gegründete GmbH als juristische Person. Ein Irrtum des Anwalts?
Nein, trotz eigener rechtlicher Grundlagen verweisen das GmbHG, ebenso das AktG und andere Gesetze auf das HGB. So ist die GmbH nach § 13 Abs. 3 GmbHG eine Handelsgesellschaft im Sinne des HGB, auf die nach § 6 Abs. 1 HGB die für Kaufleute geltenden Vorschriften Anwendung finden. Dazu zählen u.a. die Vorschriften zum Firmenrecht.
Das HGB spielt für das Gesellschaftsrecht eine zentrale Rolle, weil es mit den Begriffen „Firma‟, „Kaufmann‟ und „Handelsgesellschaft‟ Regelungen trifft, die über die eigentlichen Gesellschaftsformen des HGB (OHG, KG und stille Gesellschaft) hinaus Geltung beanspruchen. Deshalb trifft der Satz zu „Das Handels- und Gesellschaftsrecht ist das SonderPrivatrecht der Kaufleute‟, wenn man sich vor Augen hält, dass das HGB z.B. verbindlich festlegt, wie unternehmenstragende Gesellschaften ihren „Namen‟ zu bilden haben und wie sie ihre rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegen müssen (Handelsregister, Jahresabschluss).
Das HGB stellt – unabhängig von der Rechtsform der Gesellschaft – in §§ 18, 19, und 30 eine Reihe verbindlicher Grundsätze auf für die Bildung der
Firma
.
Gehen wir einige Gestaltungsvorschläge für die GmbH des Fritz Boll- mann durch.
–Fritz Bollmann: Der alleinige Gesellschafter verwendet hier seinen vollständigen Namen (Personenfirma). Das reicht zur Individualisierung und Kennzeichnung des Unternehmens aus, das die GmbH betreibt (§18 Abs. 1 HGB). Es fehlt aber der nach § 4 GmbHG vorgeschriebene Zusatz zur Rechtsform: „Gesellschaft mit beschränkter Haftung‟ oder „GmbH‟. Rechtsformzusätze sind zwingend vorgeschrieben bei ande [13] ren Gesellschaftsformen. Siehe § 19 HGB für OHG, KG und GmbH ft Co. KG; ferner § 4 AktG.
–F. Bollmann GmbH: In Ordnung. Bei der Verwendung einer Personenfirma besteht keine Pflicht, seinen Vornamen vollständig auszuschreiben.
–Bollm@nns GmbH: Die Firma ist der Name des Unternehmens und muss deshalb zweifelsfrei aussprechbar sein. Die Verwendung des @-Zeichens ist nur dann in der Firma zugelassen, wenn die Aussprache eindeutig ist. Das dürfte hier zurzeit noch zweifelhaft sein, wenn man die deutsche Aussprache zu Grunde legt. Wie alle Rechtsansichten unterliegen aber auch die Grundsätze für eine zulässige Firmierung dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel. Zu beachten ist aber, dass der Gesetzgeber die Absicht hatte, das Firmenrecht zu liberalisieren, die Praxis die Grundsätze aber weiterhin eher restriktiv auslegt.
–Weddinger Auto Service Center GmbH: Hier wird eine sogenannte Sachfirma verwendet. Gesellschafter sind nicht verpflichtet, ihren Namen für die Firma zu herzugeben. Aus dem Rechtsformzusatz ergibt sich zweifelsfrei, dass eine GmbH das Unternehmen betreibt. Die Firma darf aber nicht irreführend sein. Insbesondere darf sie nicht über die regionale Bedeutung des Unternehmens oder über dessen Größe täuschen (§18 Abs. 2 HGB). Das wird mit Unterstützung der IHK nachgeprüft. Bei der Verwendung von Sachfirmen gibt es häufig das Problem fehlender Kennzeichnungskraft, wenn ausschließlich allgemeine Begriffe verwendet werden: Unzulässig wäre z.B. die Firma „Tankstelle GmbH‟ oder bei einer Bäckerei die Firma „Brot GmbH‟.
–ESSO Tankstelle Seestraße GmbH: Diese Sachfirma ist deutlich und beschreibt das Unternehmen, sowie seine Lage sehr genau. Nach § 30 HGB muss eine neue Firma sich von allen an demselben Ort eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden (Unterscheidbarkeit). Die rechtliche Zulässigkeit einer Firma hängt im Übrigen nicht davon ab, ob der Inhaber tatsächlich berechtigt ist, eine bestimmte Marke oder eine sonst geschützte Bezeichnung in der Firma zu verwenden. Sollte Bollmann nicht berechtigt sein, die Marke des Mineralölkonzerns zu führen, dann setzt er sich zivilrechtlichen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen des Markeninhabers oder eines Wettbewerbers [14] aus. Davon zu unterscheiden ist das Verfahren des Registergerichts wegen Firmenmissbrauchs nach § 37 HGB.
Übersicht 3: Firmenrecht