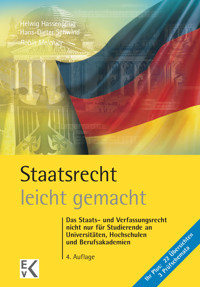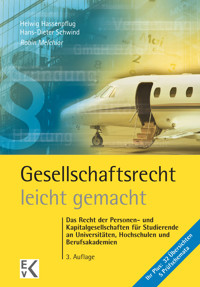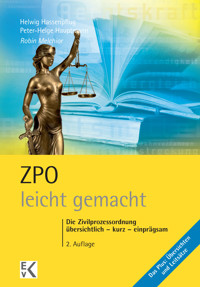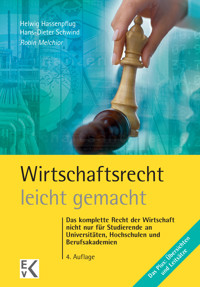
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Wissenschaft & Praxis
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In der bewährt fallorientierten Weise vermittelt ein erfahrener Richter die Organisation von Unternehmen und das Recht der Kaufleute:
Gesellschaftsrecht, Jahresabschluss, Steuern; Vertragsrecht, Marketing, Finanzen; Beteiligungen, gewerblicher Rechtsschutz; Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, Gewerberecht; Kartellrecht, Europarecht u.v.m.
Trotz der Themenvielfalt behält der Leser die Übersicht und erlernt in 23 interessanten Lektionen die Grundstrukturen des Wirtschaftsrechts
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
leicht gemacht®
Die prägnanten, verständlichen Überblicke zu
Recht und Steuer
mit Beispielen, Fällen, Übersichten und Leitsätzen.
Die leicht gemacht®-SERIEN haben Generationen von Studierenden erfolgreich in die verschiedenen Themenbereiche eingeführt. Sie richten besonderes Augenmerk auf didaktische Erfordernisse und sind auf die Bedürfnisse des Anfängers zugeschnitten.
Die Bände sind so angelegt, dass Vorkenntnisse nicht erforderlich und nach dem Durcharbeiten des Textes die wichtigen Grundlagen vermittelt sind. Sie eignen sich als Einstieg, aber auch zur Wiederholung vor der Abschlussprüfung.
Die Bände wenden sich nicht nur an diejenigen, für die die jeweiligen Themen in Recht und Steuer ein Hauptfach darstellen, sondern auch an jene, die Fachkenntnisse im Nebenfach erwerben müssen. Interessierte Leser sind Studierende an Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien, aber auch die Teilnehmer vieler weiterer berufsbezogener Ausbildungen.
Schließlich vermitteln die Bände auch jedem Interessierten auf verständliche und kurzweilige Weise die Grundlagen unseres Rechts- und Steuersystems.
Die leicht gemacht®-SERIEN erscheinen im
Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
[1]
Reihe leicht gemacht®
Herausgeber:Dr. jur. Dr. jur. h.c. Helwig HassenpflugProfessor Dr. Hans-Dieter SchwindRichter am AG Dr. Peter-Helge Hauptmann
Wirtschaftsrecht
leicht gemacht
Das komplette Recht der Wirtschaft nicht nur für Studierende an Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien
4., überarbeitete Auflage
von
Robin Melchior
Richter am Amtsgericht
Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
[2]
Besuchen Sie uns im Internet:www.leicht-gemacht.de
Umwelthinweis:Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt
Autoren und Verlag freuen sich über AnregungenGestaltung: M. Haas, www.haas-satz.berlin; J. Ramminger, BerlinDruck & Verarbeitung: Druck und Service GmbH, Neubrandenburgleicht gemacht® ist ein eingetragenes Warenzeichen© 2014 Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
ISBN 978-3-87440-319-1
[3]
Inhalt
I.Materien des Wirtschaftsrechts
Lektion 1: Was ist Wirtschaftsrecht?
II.Organisation der Unternehmen
Lektion 2: Übersicht, Einzelunternehmen
Lektion 3: Personengesellschaften
Lektion 4: Kapitalgesellschaften
Lektion 5: Andere Unternehmensformen
Lektion 6: Bücher, Bilanzen, Steuern
Lektion 7: Unternehmenspublizität
III.Vertragsrecht Marketing
Lektion 8: Kauf
Lektion 9: Marketingformen
IV.Vertragsrecht Finanzen
Lektion 10: Darlehen und Leasing
Lektion 11: Sicherheiten
Lektion 12: Forderungsmanagement
Lektion 13: Beteiligungen
V.Gewerblicher Rechtsschutz für Unternehmen
Lektion 14: Schutz des geistigen Eigentums
Lektion 15: Wettbewerbsrecht
[4]
VI.Unternehmen im Streit und in der Krise
Lektion 16: Außergerichtliche Verhaltensweisen
Lektion 17: Unternehmen vor Gericht
VII.Unternehmen und Arbeit
Lektion 18: Arbeitsrecht
VIII.Unternehmen und Öffentliches Recht
Lektion 19: Verwaltungsrecht
Lektion 20: Gewerberecht
Lektion 21: Kartellrecht
IX.Unternehmen in Europa
Lektion 22: EU-Grundfreiheiten
Lektion 23: Diskriminierungsverbot, Beihilfen
Abkürzungen
Sachregister
[5]
Leitsätze * Übersichten
Leitsatz 1 Rechtsgebiete des Wirtschaftsrechts
Leitsatz 2 Funktion des Handels- und Gesellschaftsrechts
Übersicht 1 Leitgedanken des Handels- und Gesellschaftsrechts
Leitsatz 3 Definition des Kaufmanns
Leitsatz 4 Gläubigerschutz
Leitsatz 5 GbR als Rechtsträger
Leitsatz 6 Kommanditgesellschaft
Übersicht 2 Charakteristika der Kapitalgesellschaften
Leitsatz 7 Kapitalgesellschaft und Haftungsbeschränkung
Übersicht 3 Verbundene Unternehmen und Konzern
Leitsatz 8 Zweigniederlassung
Übersicht 4 GmbH & Co. KG
Übersicht 5 Rechtsformen und Charakteristika
Leitsatz 9 Buchführung
Übersicht 6 GmbH-Bilanz
Übersicht 7 Buchführung, Bilanzierung, Ansätze
Übersicht 8 Bewertung von Unternehmen, Geschäftsanteilen und Wirtschaftsgütern
Leitsatz 10 Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer
Übersicht 9 Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)
Leitsatz 11 Unternehmenspublizität
Übersicht 10 Handelsregister
Leitsatz 12 Offenlegung des Jahresabschlusses
Leitsatz 13 Corporate Governance
Übersicht 11 Begriff des Sachmangels
Übersicht 12 Rechte bei Sachmängeln
Übersicht 13 Handelsbrauch und Handelsklauseln
Übersicht 14 Online-Handel mit Verbrauchern
Übersicht 15 Selbstständige Vertriebsunternehmen
Leitsatz 14 Vertragshändler
[6]
Leitsatz 15 Franchising
Übersicht 16 Darlehen
Leitsatz 16 Sachsicherheiten
Übersicht 17 Bürgschaft
Übersicht 18 Bürgschaftsarten
Übersicht 19 Ablauf des Erwerbs eines Unternehmens
Leitsatz 17 Gewerblicher Rechtsschutz
Übersicht 20 Urheberrecht
Übersicht 21 Recht des eingetragenen Designs
Übersicht 22 Markenrecht
Übersicht 23 Gebrauchsmuster
Übersicht 24 Patentrecht
Leitsatz 18 Wettbewerbshandlung
Leitsatz 19 Vergleich
Übersicht 25 Schiedsgericht
Übersicht 26 Zwangsvollstreckung
Übersicht 27 Zwangsvollstreckung gegen Gesellschaften und ihre Gesellschafter
Übersicht 28 Wirkungen der Insolvenzeröffnung (GmbH)
Leitsatz 20 Arbeitsvertrag
Übersicht 29 Arbeitnehmerschutz
Übersicht 30 Betriebsrat
Leitsatz 21 Wirtschaftsrecht als öffentliches Recht
Leitsatz 22 Verwaltungsakt
Leitsatz 23 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Übersicht 31 Berufs- und Gewerbefreiheit
Leitsatz 24 Gewerbe
Leitsatz 25 Gewerbeaufsicht
Leitsatz 26 Kartellrecht
Leitsatz 27 Ausnahmen vom Kartellverbot
Übersicht 32 EU-Grundfreiheiten
Leitsatz 28 Rechtsakte der EU
[15]
II. Organisation der Unternehmen
Lektion 2: Übersicht, Einzelunternehmen
Fall 2
Frau Schmidt hat auf dem Markt am Geflügelstand eine Gans gekauft. Leider war das arme Vieh mit Salmonellen verseucht und jetzt liegt die gesamte Familie Schmidt flach. Die Schmidts hoffen, dass der Brechreiz bald aufhören wird, und überlegen, wen sie verklagen können.
Spielt es eine Rolle, ob der Geflügelstand betrieben wird
a) von dem Geflügelzüchter und -händler Erwin,
b) von Erwin und seiner Schwester Hilde,
c) von der Sonnenhof Geflügel Farm GmbH oder
d) von der Goose & More Limited?
Aus Sicht der kranken Menschen spielt das keine Rolle. Wirtschaftlich betrachtet, handelt es sich bei allen Alternativen um ein Unternehmen. Aus juristischer Sicht geht es darum, wen man für den Schaden haftbar machen kann. Dafür ist der rechtliche Träger des Unternehmens zu benennen. Im Fall a) scheint das noch einfach, weil Inhaber und Verantwortlicher eine einzige natürliche Person sind. Bei b) taucht schon die Frage auf, wer haftet und mit welchem Vermögen. Im Fall c) ist der Rechtsträger des Unternehmens keine natürliche Person, sondern eine juristische Person. Wer haftet hier womit? Und zu d) stellt sich die Frage, ob denn eine ausländische Rechtsform im Inland überhaupt unternehmerisch auftreten und rechtlich anerkannt werden kann.
Leitsatz 2
Funktion des Handels- und Gesellschaftsrechts
Mit der Frage, wer Inhaber einer „Firma“, also der Rechtsträger eines Unternehmens ist, beschäftigt sich das Handels- und Gesellschaftsrecht im Handelsgesetzbuch (HGB) und in anderen Gesetzen (GmbHG, AktG u.a.). zum Schutz der Gläubiger geht es um die Fragen, wer für das Unternehmen im Rechtsverkehr handelt (Vertretung) und wer für die Schulden des Unternehmens aufkommt (Haftung).
[16]
Die Rechtsordnung gibt vor, in welchen Rechtsformen Unternehmen sich betätigen können. Die Tätigkeit von Unternehmen wird flankiert von umfassenden Vorschriften zur Transparenz und Publizität der jeweiligen Rechtsform, damit die anderen Marktteilnehmer wissen, um wen es sich handelt, wer für das Unternehmen verbindlich tätig werden kann und wer womit haftet. Der Verkehrs- und Vertrauensschutz der Allgemeinheit und insbesondere der Gläubiger ist die eine Seite der rechtlichen Organisation von Unternehmen.
Die andere Seite betrifft die Frage, welche Rechtsform ein Unternehmer auswählt. Hier geht es nicht nur um Leitungsverantwortung und Haftung, sondern auch um Steuern, Jahresabschlüsse und u.U. um die Unternehmensnachfolge.
Übersicht 1: Leitgedanken des Handels- und Gesellschaftsrechts
Das Handels- und Gesellschaftsrecht regelt die rechtlichen Strukturen von Unternehmen (
Rechtsträgern
), die Vertretung der Unternehmen im Rechtsverkehr und die Haftung für die Schulden der Unternehmen. Bei Unternehmen, die in der Rechtsform von Gesellschaften betrieben werden, geht es ferner um die Willensbildung im Innenverhältnis (Geschäftsführung).
Diese besondere Materie des Zivilrechts (man spricht auch vom
Sonderrecht der Kaufleute
) wird von folgenden Leitgedanken geprägt:
►Der Gesetzgeber bestimmt nur, welche Rechtsformen es für die Organisation von Unternehmen gibt. Das Korrelat zur freien Auswahl der Rechtsform und zur freien wirtschaftlichen Betätigung in der gewählten Rechtsform ist der Numerus clausus der Rechtsformen (Rechtsformzwang).
►Die Kodifizierung im Handels- und Gesellschaftsrecht dient vorrangig dem Gläubigerschutz (Außenverhältnis), bei Gesellschaften auch dem Minderheitenschutz (Innenverhältnis).
Nachfolgend werden vorgestellt in ihrer Struktur das Einzelunternehmen, die Personengesellschaften (GbR, OHG, KG) und die GmbH. Andere [17] Rechtsformen werden in einer Übersicht erläutert. Eine umfassendere Darstellung der Rechtsformen erfolgt im Buch „Gesellschaftsrecht - leicht gemacht®“
Abwandlung: Erwin betreibt den Geflügelstand alleine. Frau Schmidt stellt Erwin zur Rede und fragt ihn, wie er denn mit vollständigem Namen heiße und wo er postalisch erreichbar sei, ihr Rechtsanwalt wolle ihm schreiben. Erwin ist verärgert und antwortet Frau Schmidt, dass er nicht gedenke, ihr diese Informationen zu geben. Außerdem sei er Inhaber von fünf weiteren Marktständen und seit 30 Jahren in der ganzen Region für seine Qualität bekannt. Wo - außer beim Gewerbeamt und bei der Marktaufsicht - kann Frau Schmidt verlässliche Informationen zum Namen und zur Anschrift des Unternehmers Erwin einholen?
Es sieht so aus, als ob Erwin ein Gewerbetreibender ist, dessen Unternehmen nach Art und Umfang einer kaufmännischen Einrichtung bedarf (§ 1 HGB). Er ist damit - im juristischen Sinne - Kaufmann . Die Eigenschaft als Kaufmann folgt ohne weiteres Zutun allein aus der Tatsache, dass Erwin eines solches Handelsgewerbe betreibt.
Aus der Eigenschaft als Kaufmann folgt gemäß § 29 HGB zweierlei:
1. Erwin ist als Inhaber berechtigt, eine Firma als so genanntes Einzelunternehmen zu führen. Firma ist das Synonym für den Namen, unter dem der Kaufmann Erwin sein Unternehmen betreibt. Unter diesem Namen tritt er im Rechts- und Geschäftsverkehr auf, kann klagen und verklagt werden (17 HGB).
2. Erwin ist verpflichtet, seine Firma und den Ort seiner Handelsniederlassung nebst vollständiger Geschäftsanschrift bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk sich die Niederlassung befindet, zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Der Inhalt der Eintragungen und die Urkunden in das Handelsregister können von jedermann eingesehen werden. Der Ausdruck aus dem Handelsregister über die Eintragung dient als „Visitenkarte“ im Geschäftsverkehr. Vgl. § 9 Abs. 1 HGB und Lektion 7.
Abwandlung: Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn Erwin nur einen einzigen Marktstand betreibt und das auch nur gelegentlich im Herbst? [18] Wenn sein Unternehmen nach Art oder Umfang keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb bedarf, dann erwirbt Erwin die Eigenschaft als Kaufmann nicht durch seine unternehmerische Tätigkeit. Das Recht, eine Firma zu führen, und damit die Eintragung in das Handelsregister, bleiben Erwin aber nicht verwehrt. Nach § 2 HGB ist jedes gewerbliche Unternehmen berechtigt, sich als Kaufmann in das Handelsregister eintragen zu lassen. Der Unternehmer ist dann berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Eintragung herbeizuführen. Erwin darf erst mit der Eintragung in das Handelsregister die Firma eines kaufmännischen Einzelunternehmens führen.
Kein Handelsgewerbe üben die so genannten freien Berufe aus. Das sind Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Architekten, Hebammen, Statiker, Prüfingenieure, Patentanwälte, Ärzte, Zahnärzte u.a.
Leitsatz 3
Definition des Kaufmanns
Kaufmann ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, der nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Der Inhaber ist dann kraft Betätigung Kaufmann (§ 1 Abs. 2 HGB) und ist verpflichtet, seine Firma zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
Auch Kleingewerbetreibende können eine Firma führen. Sie erlangen die Eigenschaft als Kaufmann aber erst mit der Eintragung in das Handelsregister (§ 2 HGB).
Ergänzung: Welche Firma kann Erwin für sein Einzelunternehmen zur Eintragung in das Handelsregister eintragen lassen?
Das HGB stellt in §§ 18, 19, und 30 eine Reihe verbindlicher Grundsätze auf für die Bildung der Firma.
Erwin kann eine Personenfirma verwenden, die seinen vollständigen Vor- und Nachnamen oder Teile davon enthält. Er kann aber auch eine Sachfirma verwenden, die aus dem Gegenstand des Unternehmens abgeleitet wird. Er kann auch beides kombinieren (z.B. Erwins Broiler-Shop). [19] Wichtig ist, dass die Firma nicht irreführend ist (§ 18 Abs. 2 HGB; z.B. wegen geografischer Zusätze oder Größenmerkmale). Ferner muss die Firma zur Individualisierung des Unternehmens geeignet sein. Letzteres wäre z.B. nicht der Fall, wenn Erwin sein Unternehmen einfach nur allgemein „Geflügelhandel“ nennt, weil diese allgemeine Bezeichnung keine Kennzeichnungskraft hat. In jedem Fall muss Erwin der Firma den richtigen Rechtsformzusatz beifügen. Hier nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 HGB den Zusatz „eingetragener Kaufmann“ oder eine allgemein verständliche Abkürzung, z.B. „e. K.“ oder „e. Kfm.“ Außerdem sollte die Firma nicht schon von einem anderen Unternehmen verwendet werden (Unterscheidbarkeit vor Ort nach § 30 HGB).
Ergänzung: Frau Schmidt hat das Unternehmen von Erwin im Handelsregister gefunden. Dort ist auch die inländische Geschäftsanschrift eingetragen, an die zugestellt werden kann. Nach umfangreicher Korrespondenz wird Erwin zwei Jahre nach der Sache mit den Salmonellen auf Zahlung von Schadensersatz und Schmerzensgeld verklagt. Erwin lehnt eine Zahlung mit dem Hinweis ab, er habe das Geschäft inzwischen aufgegeben und habe sich zur Ruhe gesetzt.
Hat Erwin Recht?
Nein, die Schulden einer natürlichen Person bleiben seine Schulden, egal ob sie geschäftlich oder privat gemacht wurden. Das Zivilrecht kennt bei Gewerbetreibenden in der Rechtsform des Einzelunternehmens keinen Unterschied zwischen privat und geschäftlich veranlassten Verbindlichkeiten. Erwin hat den Kaufvertrag über die verseuchte Gans abgeschlossen und haftet für die Folgen, basta! Die Verwendung der Firma beim Abschluss des Kaufvertrages bedeutet nur, dass der Verkäufer unter diesem Namen handelt. Zur Haftung wegen Leistungsstörungen, Produkthaftung oder aus Delikt bleibt der Inhaber des Einzelunternehmens verpflichtet. Dabei spielt es keine Rolle, ob Erwin Kaufmann im Sinne des HGB ist oder nur Kleingewerbetreibender oder ob er inzwischen mit der Geschäftsaufgabe seine Firma im Handelsregister gelöscht hat.
Abwandlung: Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn Erwin das Geschäft an seine Nichte Edvina veräußert hat, die das Unternehmen unter der alten Bezeichnung weiterführt?
[20]
Mit dem Verkauf des Unternehmens übernimmt die Erwerberin die einzelnen Vermögensgegenstände (Assets : Waren, Ladeneinrichtung, Forderungen gegen Kunden und andere Aktiva). In dem Kaufvertrag über das Unternehmen kann Erwin mit Edvina verabreden, dass Edvina auch für die Verbindlichkeiten aus der bisherigen Geschäftstätigkeit aufkommen soll (Schuldbeitritt). Das ändert aber nichts daran, dass Erwin weiterhin selbst verpflichtet bleibt, für Folgen der von ihm verkauften Ware zu haften. Eine Schuldbefreiung können Erwin und Edvina nicht vereinbaren, da diese zulasten der Schadensersatzgläubiger ginge und Verträge zulasten Dritter nicht zulässig sind.
Ergänzung: Frau Schmidt fragt ihren Rechtsanwalt, ob sie jetzt zusätzlich auch Edvina auf Schadensersatz in Anspruch nehmen kann.
Nach § 25 Abs. 1 HGB haftet die Erwerberin eines Handelsgeschäftes für alle im Betrieb des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers dann, wenn sie die bisherige Firma fortführt. Das Gesetz ordnet die Mithaft des Erwerbers für Schulden des Erwin bei Fortführung des bisherigen Firma an. Die Waren wurden unter der Firma angekauft. Das Unternehmen besteht weiter und die Firma wird fortgeführt. Das sind Gründe genug, um zum Schutz der Gläubiger die Haftung für alte Schulden auf den Erwerber, der sich die Firma zu Nutze macht, zu erstrecken. Der gesetzlich angeordneten Mithaft bei Firmenfortführung kann Edvina nur entgehen, wenn sie unverzüglich nach der Übernahme des Unternehmens in das Handelsregister eintragen lässt, dass sie für Verbindlichkeiten des Erwin aus dem übernommenen Handelsgeschäft nicht einstehen wird (§ 25 Abs. 2 HGB). Um die Haftung nach § 25 Abs. 1 HGB auszuschließen, könnte Edvina den Betrieb des übernommenen Unternehmens unter einer neuen Firma führen. Doch Vorsicht! Neben dieser HGB-Haftungsnorm gibt es z.B. noch § 613a BGB für Arbeitsverhältnisse von Mitarbeitern und § 75 AO für Steuerschulden. Die Verpflichtung, Altschulden des bisherigen Inhabers zu begleichen, knüpft hier nicht an die Firma, sondern an die Tatsache an, dass das Unternehmen als Betrieb fortgeführt wird.
Der Wunsch der neuen Inhabers, die Haftung zu beschränken, ist ein Grundanliegen, um vernünftig kalkulieren zu können. Auf der anderen Seite ist die Rechtssicherheit das Grundanliegen der Gläubiger (Haftungskontinuität wegen Firmenfortführung).
[21]
Die widerstreitenden Interessen sind gegeneinander abzuwägen. Der Gesetzgeber hat sich im Grundsatz für die Gläubiger entschieden. Gleichzeitig wird den Kaufleuten jedoch die Möglichkeit gegeben, durch aktive Gestaltung und Publizität die Haftung zu beschränken (§ 25 Abs. 2 HGB). Edvina muss sich aber beeilen, weil eine Haftungsbeschränkung nur dann wirksam ist, wenn sie unmittelbar nach dem Wechsel des Inhabers den Gläubigern bekannt gemacht wird. Ohne eine solche Bekanntgabe dürfen die Gläubiger nämlich darauf vertrauen, dass auch der neue Inhaber des Unternehmens für die alten Schulden gerade steht.
Leitsatz 4
Gläubigerschutz
Die Rechtsnormen des Handels- und Gesellschaftsrechts beschreiben die Organisation von Unternehmen, die Vertretung und die Haftung. Diese Normen dienen vorrangig dem Gläubigerschutz.
Kannten Sie diese Aussage schon? Macht nichts, man kann ihn nicht oft genug wiederholen. Und Sie sollten sie sich jetzt merken!
[22]
Lektion 3: Personengesellschaften
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Offene Handelsgesellschaft
Fall 3
Edvina hat den aus Lektion2 bekannten Geflügelstand ihres Onkels Erwin übernommen. Das Unternehmen hatte zuletzt - u.a. wegen des schlechten Rufs in punkto Hygiene - nicht mehr allzu großen Zulauf, sodass die Firma im Handelsregister gelöscht wurde. Nun möchte Edvina das Sortiment auf Bio-Geflügel aus kontrollierten Beständen umstellen und auch Eier verkaufen. Alleine schafft Edvina das aber nicht. Sie fragt deshalb ihren Schwager Ludwig, ob er nicht in das Geschäft einsteigen und mitmachen wolle. Ludwig ist einverstanden.
Was ist hier geschehen?
Expansion und Arbeitsteilung sind wirtschaftliche Phänomene. Juristisch betrachtet vollzieht sich hier ein Wechsel in der Rechtsform des Unternehmens. Edvina und Ludwig haben einen Vertrag geschlossen, und zwar einen Gesellschaftsvertrag über die Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR ).
Gegenstand des Gesellschaftsvertrages nach § 705 BGB ist die Verabredung, einen gemeinsamen Zweck zu fördern. Dieser gemeinsame Zweck der GbR ist hier der Betrieb des Unternehmens. Der Vertragsabschluss beruht auf Willenserklärungen der beiden Personen, wobei die Interessen der Beteiligten sich decken. Hauptpflicht der Parteien ist die Förderung des gemeinsamen Zwecks.
Der Vertrag ist hier formfrei geschlossen; die GbR ist wirksam gegründet. Der Beitrag jedes Gesellschafters besteht in der Pflicht, die eigene Arbeitskraft einzubringen und darin, mit dem eigenen Verhalten in jeder Hinsicht, die Belange der Gesellschaft zu beachten (Treuepflicht).
Ergänzung: Wesentlicher Vermögensgegenstand des Unternehmens ist ein Marktwagen mit Kühlgeräten. Wem gehört jetzt dieser Marktwagen? [23] Eins ist klar: Edvina ist jetzt nicht mehr alleinige Inhaberin des Unternehmens und damit auch nicht mehr alleinige Eigentümerin der betrieblich gebundenen Vermögenswerte. Ist jetzt die GbR Eigentümerin? Nein und doch ja; ganz so einfach ist das bei der GbR nicht. Nein, weil das Gesetz der GbR nicht - wie z.B. einer GmbH oder einer anderen juristische Person - Rechtsfähigkeit verleiht. Die Sache wird verständlich, wenn man die Frage des Eigentums aus der Sicht der Gesellschafter betrachtet. Das im Unternehmen der GbR gebundene Vermögen steht allen Gesellschaftern gemeinsam zu; es ist gesamthänderisch gebunden (Gesamthandseigentum , §§ 718, 719 BGB). Mehr ist nach dem Gesetz für den Betrieb einer GbR nicht erforderlich. Da die GbR aber als Unternehmensträgerin dieses Betriebsvermögen im Geschäftsverkehr zu gewerblichen Zwecken einsetzt, ist die Rechtsprechung zu der Erkenntnis gekommen, bei der GbR den § 124 Abs. 1 HGB entsprechend anzuwenden (unbedingt lesen!)
Leitsatz 5
GbR als Rechtsträger
In entsprechender Anwendung des § 124 Abs. 1 HGB ist die nach außen hin gewerblich tätige GbR Trägerin von Rechten und Pflichten, ohne selbst de jure rechtsfähig zu sein, wenn sie als so genannte Außen-GbR am Rechts- und Geschäftsverkehr teilnimmt.
Ergänzung: Edvina und Ludwig wollen beim einem Gutshof Ware bestellen. Wer unterschreibt den Vertrag für die GbR?
Die Entscheidung, überhaupt Ware dort zu kaufen, ist eine interne Willensbildung, die der Geschäftsführung zugerechnet wird; § 709 BGB. Hingegen ist die Abgabe einer Willenserklärung, hier zum Abschluss eines Kaufvertrages ein Vorgang, der dem Außenverhältnis der Gesellschaft zugerechnet wird.
Handeln im Außenverhältnis wird Vertretung genannt. Die Vertretungsmacht beruht bei der GbR auf der Stellung als Gesellschafter. Nach dem Gesetz vertreten die GbR-Gesellschafter gemeinschaftlich, wenn der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt; § 714 BGB.
[24]
Ergänzung: Der Inhaber des Gutshofes ist skeptisch, als Ludwig erklärt, im Gesellschaftsvertrag der GbR sei festgelegt, dass er alleine die GbR vertreten könne. Ist diese Skepsis berechtigt?
Ja, weil der Geschäftspartner nichts in Händen hält, um die Behauptung des Ludwig zu überprüfen. Denn nach dem Gesetz müsste auch Edvina den Vertrag unterschreiben. Der Verkäufer könnte jetzt bei Edvina anrufen und fragen, ob das alleinige Vertreten von Ludwig so in Ordnung geht.
Ergänzung: Was können die Gesellschafter machen, damit Ludwig künftig ein Dokument vorweisen kann, aus dem sich seine Alleinvertretungsbefugnis ergibt?
Edvina und Ludwig können ihre GbR in das Handelsregister eintragen lassen.
Eine GbR, deren Zweck der Betrieb eines Handelsgewerbes ist, ist eine Offene Handelsgesellschaft (OHG; § 105 HGB) und führt als Handelsgesellschaft eine Firma.