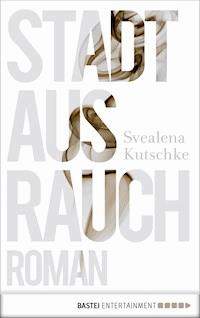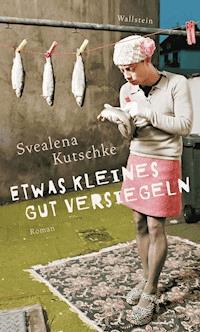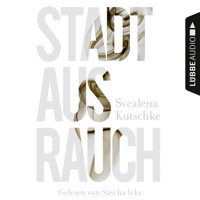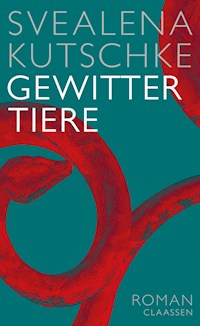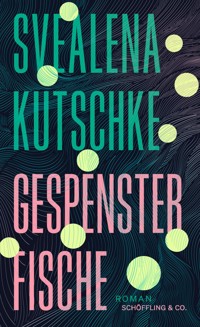
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wirklichkeit ist nur eine Vereinbarung. Dieser Satz lässt Laura Schmidt viele Jahre nicht los. Es ist das Motto ihrer Mitpatientin Noll, die Laura in den 1990ern in der Lübecker Jannsen-Klinik kennenlernte. Dort hat sich Noll in der psychiatrischen Abteilung mit ihrer Vertrauten Olga Rehfeld lesend, schreibend, zitierend ein Refugium aus Geschichten geschaffen, einen Raum aus Literatur – zum Trost oder als Flucht vor den Abgründen der Vergangenheit? Laura begreift allmählich, dass die Klinik, in der sie selbst Hilfe gefunden hat, für Rehfeld zerstörerisch war. Svealena Kutschke erzählt mit einem faszinierenden Figurenensemble aus Patient:innen und medizinischem Personal von der Psychiatrie als Ort, an dem tiefe Verwundbarkeit das Menschsein an seine Grenzen führt. Als Ort, der insbesondere während der NS- und Nachkriegszeit zum Einfallstor für Gewalt geworden ist. Als Echokammer deutscher Geschichte. Medizinische Diagnosen, führt Kutschke uns vor Augen, sagen viel über die Gesellschaft aus, in der sie gestellt werden. Und sie fragt danach, ob nicht der psychische Ausnahmezustand eine angemessene Reaktion auf die Zumutungen der Gesellschaft ist. Ein Roman, der wie ein Gespensterfisch in der Tiefsee Licht in die Dunkelheit bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Svealena Kutschke
Gespensterfische
Roman
Schöffling & Co.
1Die Neunzigerjahre – Laura Schmidt
Die Konturen eines Raumes konnten durch Routinen geschärft werden, stellte Laura fest. Wirklichkeit war nur eine Vereinbarung. Aber es war möglich, das zu vergessen, wenn man den vorgegebenen Abläufen folgte. Die Visite am Morgen, das Frühstück, die Schlange vor dem Schwesternzimmer, Lukas, der die Zigaretten und Feuerzeuge herausgab und dann mit in den Garten ging. Die unerwartet süße Erfahrung, über sich bestimmen zu lassen. Der überraschende Trost der geteilten Räume.
Als die dünnen Fäden zur Wirklichkeit rissen, war es Lauras größte Sorge gewesen, dass die Verrücktheit der anderen alles noch schlimmer machen würde. Es stellte sich heraus: Kaum etwas war beruhigender, als zum Beispiel neben Rehfeld im Gemeinschaftsraum zu sitzen, das kratzende Geräusch ihres Kugelschreibers, Rehfelds eigenartige Prosa: Es könnte Schlaf sein, wenn dich niemand dabei sieht. Das leise Schmatzen, das die Medikamente Rehfeld unter die Zunge gelegt hatten. War nicht ein Körper bei Weitem zu viel für einen Menschen? Das Zucken in Rehfelds Gesicht, die Furchen und Linien eine überraschende Zuflucht. In jede Wunde eine Tablette.
Es waren besonders die Gesichter, die Laura an der Universität nicht mehr ausgehalten hatte. Abrupt ihr zugewandt, wenn sie sich meldete und etwas sagte. Es war egal, ob sie meinte, Belustigung, Langeweile oder Interesse zu erkennen. Die Ahnung, dass sie die Mimik höchstwahrscheinlich falsch deutete, hatte immer wieder dazu geführt, dass sie nach einem Redebeitrag das Seminar verließ. Erst hier in der Klinik verstand sie, dass niemand sie beobachtete. Ein Blick, der Laura traf, bedeutete nicht, dass man sie sah. Sie alle waren ausschließlich mit dem eigenen Echo beschäftigt, und das war in der Universität mit Sicherheit nicht anders gewesen als hier.
In der Klinik wurde es überdeutlich: Der Austausch über die Ärztinnen, die Gier auf die Diagnosen der anderen, das mitfühlende Nicken bei jeder Übereinstimmung der Symptome, jedes Gespräch diente ausschließlich der Selbstvergewisserung.
Laura dachte an den Kassettenrekorder, den sie vor dem Gespräch mit einer Freundin unter dem Küchentisch ihrer Wohnung verborgen hatte. Als nach 45 Minuten die Aufnahme mit einem lauten Klicken stoppte und die Freundin sich aufregte, hatte es erstaunlicherweise nicht lange gedauert, sie zu besänftigen, die Kassette umzudrehen und ihr angetrunkenes Gespräch auf der B-Seite weiter aufzuzeichnen. Was Laura überraschte, als sie sich die Aufnahme am nächsten Abend anhörte: Das Gespräch der B-Seite unterschied sich kaum von den 45 Minuten vorher, die ohne das Wissen der Freundin aufgenommen worden waren. Ihre Unterhaltung hatte von Anfang an eine gekünstelte, ausgestellte Note gehabt, die Laura an dem Abend mit der Freundin nicht aufgefallen war. Im Gegenteil, sie hatte den Eindruck gehabt, sie wären einander unvermittelt begegnet, sich nah gewesen. Beim Anhören der Kassette aber schien ihr das empathische Nachfragen der Freundin wie Informationshunger, das Preisgeben eigener Schwächen kalkuliert. Vor allem aber schien die Freundin von einem Distinktionswillen getrieben. Ihre Neurosen schienen sie auszuzeichnen, ihre Klugheit hervorzuheben, während Laura die dumme Hässlichkeit der Depression unverschleiert ausstellte. Wie war es möglich, dass Laura sich dessen in der Situation überhaupt nicht bewusst gewesen war?
Laura hatte ein paar Extraschichten in der Würstchenbude übernommen, in der sie während des Studiums arbeitete, und kaufte sich ein Diktiergerät mit Mikrokassette. Es war kleiner als ein Walkman, sie konnte es in jeder Jackentasche verbergen. Sie führte kein Gespräch mehr, ohne es aufzuzeichnen. Sie verlor vollkommen das Interesse am Inhalt der Unterhaltungen, ihre Aufmerksamkeit galt der Kluft zwischen ihrer Wahrnehmung und der Wirklichkeit der Aufnahme.
Es war, verstand Laura, kaum vorstellbar, einander tatsächlich zu begegnen. Es war unmöglich, einen zuverlässigen Eindruck von Wirklichkeit zu speichern, im direkten Kontakt war sie vollkommen außerstande, zu sehen, was ein anderer Mensch ihr entgegenbrachte. Der Unterschied zur Aufnahme war immer gravierend.
Der Pfleger Lukas, der jung genug war in seinem Beruf, sie unbedingt verstehen zu wollen. Wenn er ihr zuhörte, war es, als richtete er einen Scheinwerfer auf sie. Sie erzählte ihm, dass sie bei ihrem Job in der Würstchenbude gefeuert worden war, weil sie nach Dienstschluss die übrig gebliebenen Hotdogs an Obdachlose ausgegeben hatte.
»Wirklich?«
»Ja, wirklich.«
Wie beruhigend, etwas als wirklich zu bezeichnen.
Es ging um die Röstzwiebeln. Wenn Laura meine, die Würstchen seien übrig und das Brot schon getoastet gewesen, dann habe sie ja doch noch Röstzwiebeln hinzugefügt, Gürkchen und höchstwahrscheinlich auch Ketchup und Remoulade. Das alles seien Zutaten, so der Vorwurf, die nicht weggeworfen werden müssten nach Dienstschluss, und vor allem sei es auch ein Teil ihrer Arbeit, den Markt einzuschätzen.
»Den Markt?« Lukas grinste.
Sie habe möglicherweise bewusst Überschuss produziert usw. Laura hatte das weiße Sweatshirt, auf das ein grinsender Hotdog gedruckt war, behalten.
Lukas war jünger als Laura, nicht einmal zwanzig, wie war das möglich, fragte Laura sich: diese empathische Durchlässigkeit und dabei im Kern immer stabil.
Am Fenster saßen Rehfeld und Noll, lesend, sie sahen dabei immer aus, als würden sie sich unterhalten. Lukas folgte ihrem Blick. »Die sind schon immer bei uns, die kann man nicht mehr umtopfen.«
Laura nickte. In der Nacht hörte sie sich unter der Bettdecke mit Kopfhörer die Aufnahmen an, die sie heimlich von ihren Gesprächen gemacht hatte.
Lukas wirkte auf den Aufnahmen immer genauso, wie sie ihn wahrgenommen hatte, während sie ihm gegenüberstand. Er rauchte hungrig, fast aggressiv, seine Stimme jedoch war sanft und ein bisschen belustigt. Er hatte eine Art, mit Laura zu reden, als würden sie sich schon lange kennen. Als sie ihm tastend erzählte, wie fremd ihr alles geworden war, nickte er, es gab dazu nichts weiter zu sagen.
Laura bekam keinen Besuch, niemand wusste, dass sie hier war. Sie erkannte die Angehörigen der anderen sofort an der Hoffnung, die in ihren Gesichtern stand, wenn sie den Aufenthaltsraum der Jannsen-Klinik betraten, an der Enttäuschung, wenn sie ihn wieder verließen. Das Versprechen der Heilung, wodurch sollte es eingelöst werden: Das Töpfern eines Aschenbechers? Das Pflanzen von Tulpenzwiebeln?
Gesprächsfetzen aus dem Arztzimmer: »Waren wir da eigentlich schon mit nem SSRI drin?«
Laura teilte sich das Zimmer mit Kathrin, einer Wissenschaftlerin, die immer Oropax trug, um die Stimmen der anderen nicht zu hören, dabei aber unablässig selbst sprach. Über das Erfinden und das Erinnern und die Unmöglichkeit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Sie sprach schnell, leise und monoton, als gäbe sie es zu Protokoll. Laura zeichnete alles auf. Ihre wispernde haltlose Stimme, die wie ein Untertitel durch alle Routinen raste.
Lukas entschuldigte sich: Bei Lauras Diagnose sei Kathrin eigentlich nicht die passende Zimmernachbarin, doch was solle man machen, zu viel Verzweiflung, zu wenig Betten. Tatsächlich aber waren Kathrins Monologe Laura ein fester Halt. Die Entfremdung, mit der Laura kämpfte, korrespondierte mit Kathrins Wahn, von der Sprache, von den eigenen Lebenserzählungen überschrieben zu werden. Die Schnittmenge ihrer Ängste verdichtete sich zu einem Bild, welches Laura half, sich die eigene Entfremdung außerhalb ihrer selbst vorzustellen. Sie hörte auf, sich mit dem Zustand des ständigen Misstrauens zu identifizieren. Stattdessen begriff sie ihn als eine Uneigentlichkeit, das Mantra von Dr. Thorsten Fellner: »Das sind nicht Ihre Gedanken, da spricht die Krankheit.«
Kathrin und Laura hatten sich nichts zu sagen. Ihre Krankheiten jedoch verstrickten sich ineinander, kommunizierten unablässig, bis Laura ihren Zustand theoretisch ausleuchten und verfolgen konnte, ihn aber nicht mehr fühlte. Auch beim Essen setzte sich Kathrin, die alle nur »die Amöbe« nannten, immer zu ihr. Man hatte sie in einem Parkhaus hinter ihrem Institut gefunden. Die Wissenschaftlerin hatte vor dem Bodenrost gekauert, überzeugt, sie wäre so klein, dass sie durch die Lücken fallen würde beim Versuch, zu ihrem Auto zu gelangen. Lauras leicht schambesetzte Erleichterung, wie gesund sie war im Vergleich. Ein Gummiband am Handgelenk, schon ein winziger Schmerz konnte sie manchmal wieder in der Realität verankern. Manchmal saß sie neben Dilek am Fenster, und sie schnippten und schnippten und schnippten an ihren Gummibändern, bis die Handgelenke rot und wund waren und die Atmung wieder tiefer. Manchmal hatte Dileks Lachen schon denselben Effekt.
Erst kurze, dann immer längere Spaziergänge über das Klinikgelände, das Knirschen der Kieswege unter den weichen Sohlen ihrer Turnschuhe, in der Nacht hörte sie sich die Aufnahmen an. Das Knirschen hatte eine besänftigende Wirkung. Sie hörte die Aufnahme, schloss die Augen und ging die Wege nach, alle Gebäude verschwanden, die Neurochirurgie, die Kardiologie, der alte Uhrenturm mit dem Hörsaal, was blieb, war ein verschlungenes Muster aus Kies, das Laura abwanderte, bis sie einschlief.
Am Nachmittag, wenn Kuchen ausgegeben wurde, setzte Laura sich manchmal zu Rehfeld und Noll ans Fenster. Die unvermittelten Zuckungen in Rehfelds Gesicht erschwerten das Essen. Reflexhaft hatte Laura das erste Mal die Sahne von Rehfelds Bluse gewischt, die aufgezwungene Intimität einer Klinik, Laura empfand darüber Erleichterung. Zwischen den Kuchentellern zerlesene Bücher und Notizhefte. Laura genoss die mäandernden Gespräche von Rehfeld und Noll. Es war kaum zu unterscheiden, ob die Anekdoten, die sie einander erzählten, aus dem eigenen Leben oder den Büchern stammten, alles war durchsetzt von Zitaten. Lose Choreografien aus flatternden Sätzen, ausgeleuchtet durch die Literatur. Sie schienen keinen Unterschied zu machen zwischen dem, was ihre Körper durchlebt, und dem, was ihr Geist gelesen hatte. Rehfelds Notizhefte, die Geräusche unserer Körper im Hallraum der Klinik.
Was Lauras größte Angst war, schien Rehfeld und Noll der verlässlichste Trost zu sein: Die Wirklichkeit war nur eine Vereinbarung.
Am Nebentisch Fritz Rosenthal, der die Zeitungen durchsuchte, aber unter dem Einfluss der Medikamente keine Botschaften mehr in ihnen fand.
Eva Holm, bei der Laura sich nachts ihre Bedarfsmedikation abholen konnte. Die resolute Art, mit der die Pflegerin nach ihrem Befinden fragte, Laura Satz um Satz abrang, bevor sie die Tropfen rausrückte. Die Angst, die Wirklichkeit usw.
»Ja nu.« Die Standardreaktion der Pflegerin signalisierte, dass Laura die Tropfen haben durfte. Manchmal war Eva Holms Tochter zu Besuch auf der Station. Schlurfte in tiefsitzenden Jeans und Basecap durch den Gemeinschaftsraum, saß dann mit ungewöhnlicher Geduld bei Rehfeld und Noll, das Gesicht plötzlich weich wie eine geöffnete Faust. Wenn Freda Holm die beiden alten Damen besuchte, hielt Laura sich fern. Die Selbstverständlichkeit, mit der Laura ihren Platz neben Rehfeld und Noll gefunden hatte, wurde durch Freda entlarvt. Es war deutlich, dass Freda eine tiefe Beziehung mit Rehfeld und Noll verband. Freda war jünger als Laura, nicht einmal achtzehn, dennoch fühlte Laura sich wie ein Kind, wenn Holms Tochter nach ihrem Besuch aufstand und die Station verließ, einfach so in die Wirklichkeit hinausging, die ihr offensichtlich nichts anhaben konnte.
2Die Zehnerjahre – Freda Holm
Das Scheinwerferlicht lag über der gefleckten Landstraße, unzählige Schlaglöcher mit Teer ausgegossen, die Baumkronen wuchsen über der Straße zu einem Dach zusammen. Eva Holm saß auf dem Beifahrersitz, die linke Hand auf dem Türöffner, Freda schaltete die Kindersicherung ein, bevor sie ihre Mutter abholte. Der Geruch von Rotwein und Zigaretten. Fredas Mutter rauchte nicht, »aber die anderen Damen, ich sach dir, die smöken wie die Seemänner!« Freda fragte, wie immer, wer gewonnen hatte, und Fredas Mutter sagte, wie immer, »ach, es geht doch um die Geselligkeit«, was bedeutete, dass sie verloren und jetzt Schulden bei Siegrid hatte.
»Wie viel Geld schuldest du Siegrid denn mittlerweile?«
»Ach, die wissen doch, dass ich ausgeraubt wurde!«
»Ach, Mama.«
»Bei Aktenzeichen XY ungelöst haben die mir sofort geglaubt. Wir haben sehr nett telefoniert, das wird dann bald auch ausgestrahlt, das werdet ihr dann noch alle sehen!«
Freda nickte und bog auf die Allee ein, die an einem Dienstagabend um halb zwölf genauso still und verwitwet dalag wie die Landstraße.
»Verwaist.«
»Bitte?«
»Verwaist sagt man, nicht verwitwet.«
Freda nickte, schaltete und hielt an einer Ampel. Rechts und links spärlicher Tannenwald, der die Abgase für die dahinterliegenden Siedlungen filterte, und plötzlich erinnerte Freda sich an eine Ausgabe der Tagesschau, die sie zusammen mit ihrer Mutter gesehen hatte, es ging um die Gesundheit des Waldes, die erst bedenklich erschien, fast sechzig Prozent des Waldes waren erkrankt, und dann plötzlich nicht mehr bedenklich: nur noch fünfzehn Prozent des Waldes waren erkrankt, wenn man eine Schadstufe strich und Bäume, die nur ein Viertel ihrer Blätter verloren, für gesund erklärte. Das war 1989 gewesen, und Eva Holm hatte auf den Bildschirm gedeutet: »So machen wir das auch in der Klinik, wenn’s keine Betten mehr gibt! Wer sich nicht gleich umbringt, wird entlassen.«
Freda fuhr an der Jannsen-Klinik vorbei, in deren Räumen sie große Teile ihrer Kindheit verbracht hatte.
»Apropos Witwe: Mit Maren und dir is also endgültig vorbei?«
Freda nickte und schaute auf die leere Straße, die mühsam beleuchtet in der Nacht lag.
»Na, dann bleibt man halt allein.«
Freda setzte den Blinker drei Querstraßen zu früh, wie immer, drei Querstraßen zu früh, als könnte das die gemeinsame Zeit verkürzen. Dabei bewunderte Freda ihre Mutter für die Selbstverständlichkeit, mit der sie immer allein gelebt hatte, nur zwischenzeitlich unterbrochen durch Fredas späten Aufenthalt in ihrem Leben. Dennoch strahlte dieser Satz seit der Trennung von Maren eine Endgültigkeit aus, ein Scheitern, als wäre es unmöglich, mit Ende dreißig noch einmal die Liebe zu finden, oder als wäre es unmöglich, nach Maren noch einmal die Liebe zu finden. Und wenn Freda ihre Mutter durch die früh schlafende Stadt fuhr, dann kam es auch ihr so vor, als wäre sehr viel unmöglich geworden in ihrem Leben. »Such doch schon mal deinen Hausschlüssel raus, bitte.«
Freda hielt in einer Seitenstraße mit aggressivem Kopfsteinpflaster, aus keinem der Häuser drang Licht.
Freda lehnte sich im Fahrersitz zurück. Ihre Mutter suchte umständlich nach ihrem Schlüssel, nestelte und friemelte, und Freda stellte sich vor, wie sie die Silhouette ihrer Mutter im warm erleuchteten Türrahmen verschwinden sah. Wie die Mutter ein Treppenhaus hinaufging, das nach dem Ruß erloschener Kerzen roch, in der Wohnungstür von der Katze begrüßt wurde, noch ein Glas Likör auf dem Sofa trank und zwei Pralinen aß, im Bett ein paar Seiten Virginia Woolf las, bevor sie das Licht ausknipste und einschlief, die Katze zusammengerollt zu ihren Füßen.
Freda seufzte und stieg aus, half ihrer Mutter aus dem Auto, wartete neben ihr, während Eva Holm in der unfassbar großen Handtasche weiter nach dem Schlüssel suchte und schließlich die Tür zum Sechzigerjahre-Mietklotz aufschloss.
Es war kein Zahnarzt im Haus, dennoch roch es danach. Es roch wie das mintfarbene Treppenhaus des Zahnarztes aus Fredas Kindheit, welches sie viel zu häufig mit ihrer Mutter hinaufgestiegen war. Dreimal am Tag jeweils sechs Minuten geputzt, und dennoch war alles voller Karies gewesen, sogar schwarze, krustige Löcher vorn auf den Schneidezähnen hatte sie. Irgendwann sagte der Zahnarzt, sie habe sich den Zahnschmelz von den Zähnen geschrubbt, da sei einfach kein Schutz mehr, da bleibe kaum etwas anderes übrig, als auf die neuen Zähne zu warten. Und Eva Holm: »Nicht, dass sie sich die neuen auch gleich kaputtputzt. Was machen wir denn da?«
Und der Zahnarzt: »Bei Ihnen hab ich ja schon bestimmt fünf Jahre nicht mehr nach dem Rechten gesehen, setzen Sie sich doch mal kurz.«
Und Fredas Mutter: »So weit kommt’s noch!«, mit einer Empörung, die auch den Zahnarzt kurz vergessen ließ, dass sein Anliegen ein angemessenes war.
Das scharfkantige Treppenhaus ihrer Mutter, diese glatten steinernen Stufen, wer hier stürzte, blieb liegen: Es war ein gnadenloses Treppenhaus. Freda verlor sofort ihre mühsame Ruhe, wenn sie dieses Treppenhaus betrat. Es wurde noch schlimmer, wenn sie sich auf die Waden ihrer Mutter konzentrierte, auf die Thrombosestrümpfe, die unter dem Knie endeten, über deren Bund leichte Hautwölkchen flockten, und es wurde am schlimmsten, wenn ihre Mutter die Wohnungstür aufschloss und von der Müllhalde dahinter umarmt wurde.
Wie immer öffnete ihre Mutter die Wohnungstür nur gerade so weit, dass sie sich durch den Spalt quetschen konnte, als könnte sie das Chaos dahinter auf diese Art verbergen. Freda hatte sich schon abgewandt, nickte der Mutter über die Schulter zu, da fragte Eva Holm, ob Freda sich noch an Laura erinnere, die ihr damals so viele Fragen gestellt habe?
»Als ich dich zum Kardiologen bringen sollte, und stattdessen hast du bei der Nienburg im Garten gesessen und Kuchen schnabuliert? Ja, daran erinnere ich mich.«
»Ja nu!« Eva Holms Lieblingsantwort.
Es war immer dasselbe: im Auto beklommenes Schweigen, bei der Verabschiedung wurde die Mutter zur Plaudertasche.
»Diese Laura wollte doch Rehfelds Manuskript illustrieren, oder? Is doch ewig her, das ist doch eh nichts geworden.« Freda.
»So ging das doch nur los, aber dann hat sie ja angefangen, sich mit der ganzen Geschichte zu beschäftigen. Ich hab sie neulich auf der Straße getroffen! Fünfzehn Jahre arbeitet sie jetzt daran, kannst du dir das vorstellen?«
»Ach komm, die erzählt dir doch was.« Freda nickte ihrer Mutter zu, auf diese norddeutsche Art, die gleichzeitig Zustimmung und Ablehnung ausdrücken konnte, in jedem Fall aber auch einen Abschied signalisierte.
Freda stieg die Stufen hinunter, das nassgelbe Neonlicht, die toten Fliegen in den Röhren.
Man durfte den Dingen keine Macht geben, dachte Freda, während das alte Auto wieder über das Kopfsteinpflaster holperte. Irgendwo zwischen den Halden in der Wohnung würde die Katze den Weg zur Mutter finden. Irgendwo zwischen den Katalogen und Schachteln und Glühbirnen waren die Bücher, die aus Nolls Bibliothek den Weg zu Eva gefunden hatten. War es nicht vollkommen egal, in welcher Umgebung man sich in die Literatur zurückzog? Verlor Virginia Woolf etwa dadurch, dass sie zwischen toten Fernsehapparaten gelesen wurde? Zwischen all den Fernsehapparaten, die ein Leben in sich zu versammeln mochte, von den ersten Schwarz-Weiß-Röhren zum letzten Flachbildfernseher.
Nein, beschloss Freda und lenkte das Auto die Ratzeburger Allee hinunter, über den Kreisverkehr, über die Mühlentorbrücke in den Stadtkern hinein.
Freda parkte das Auto und ging mit schlechtem Gewissen durch den sargschmalen Gang in den Hinterhof. Rechts und links jeweils drei Häuschen aneinandergepresst, jedes mit einer Grundfläche von vier Briefmarken, dafür drei Stockwerke hoch, wenn man das Dach mitzählte, was jeder mitzählte, ansonsten wurde man irre. Wo keine Rosen rankten, da wucherte mit Sicherheit der Efeu, es war alles sehr niedlich, Freda liebte das greise Haus.
Sie schloss die Haustür auf, zog ihre Schuhe aus, stellte den Wasserkocher an und nahm das Buch, das auf der Arbeitsplatte lag, las, bis das Wasser kochte, you´ve punctured my solitude. Maggie Nelson. Jeder Satz ein tiefer Schnitt.
Dass Eva Holm immer alles hergegeben hatte, sogar das eigene Haus, Eva Holm, nun ganz ohne Efeu, dafür Zahnarztgeruch und ein scharfkantig poliertes potthässliches Treppenhaus, ob das der Grund war, dass sie jetzt hortete, aber so einfach war das alles nicht, natürlich. Das Haus war immer bis zur Decke vollgestopft gewesen, die Wände sah Freda zum ersten Mal nach dem Auszug ihrer Mutter. Aber als Eva Holm ihr Haus hergab und in die Mietwohnung außerhalb des Stadtkerns zog, da begann das Sammeln nicht nur von Erinnerungen, sondern auch von Verpackungsmaterial. Schuhkartons, Cornflakes-Packungen, selbst leere Konservendosen, alles konnte irgendwann einmal nützlich, man weiß nie wozu, das ist doch noch gut, das kann noch nicht weg, das ist viel zu schade, um –
Maren hatte immer gesagt, Freda habe das Haus in Pflege. Das Haus sei ein Körper, mit der Mutter so sehr verwachsen, es würde nie dort einen Platz für Freda geben.
Nachdem Eva Holm ausgezogen war, war das Haus noch immer voller Dinge, die einmal nützlich sein könnten, die man immer mal brauche, man wisse nie. Nicht ein Korkenzieher, sondern drei. Ein Kessel und ein Wasserkocher. Ein zweiter Toaster in den Eingeweiden des Küchenschrankes, ein Sandwichmaker, ein Waffeleisen, eine Crêpespfanne, alles ohne menschlichen Kontakt seit der Jahrtausendwende. Ein Eierschneider, der seit Helmut Kohl nicht benutzt worden war. Unfassbare Mengen von Kleiderbügeln. Eine absurde Anzahl an Regenschirmen, Übertöpfen, Töpfen und Pfannen, die Dinge schienen aus den Schränken hinauszuwachsen, Plattenspieler, Kassettenrekorder, CD-Spieler, Walkmen, MP3-Player usw.
Es brauchte erstaunlichen Mut, sich von diesen Relikten zu trennen. In this way I edit myself into a boldness. Maggie Nelson.
3Die Nullerjahre – Lukas Weber
Gespensterfische hatten einen durchsichtigen Kopf, in dem die grün schillernden Augäpfel vollständig zu sehen waren. Der hohe Druck, der Mangel an Sauerstoff und Pflanzen, die dauerhafte Kälte und die fast vollständige Dunkelheit brachte unwirklich anmutende Wesen hervor. Im Laufe der Evolution hatten die Tiere sich an die unwirtlichen Bedingungen angepasst, manche generierten sogar ihr eigenes Licht.
Lukas Weber sah die meisten Neurosen oder Psychosen als Anpassungsleistung an ein unwirtliches Umfeld. Aber geh mit solchen Gedanken mal zur diensthabenden Psychologin.
Lukas nahm die Kanne aus der Maschine, schenkte sich eine Tasse ein, während in der Mikrowelle schon das Abendessen seiner Mutter rotierte. Spätdienst. Zehn Tage am Stück, dann drei Tage frei, dann in die Frühschicht. Lukas war Mitte zwanzig und dennoch setzte ihm der Schichtdienst zu, er fragte sich, wie Eva Holm das machte, die hart auf die Rente zuging und nie müde wirkte. Selbstverständlich hatte er begonnen zu rauchen. Es war die beste Möglichkeit, den Tag zu strukturieren, in Einheiten zu unterteilen.
Er ging mit dem Kaffee und seiner ersten Zigarette auf den Balkon, weit unten der Spielplatz, auf dem sich allmählich, wie jeden Abend, die Teenager der Siedlung versammelten.
Tobias und er hatten nie dort gesessen. Ihre Mutter hatte es nicht erlaubt. Ihre Mutter hatte ihnen von klein auf zu verstehen gegeben, dass sie sich mehr anstrengen mussten, als Kinder die, na ja, zum Beispiel in der Königsstraße oder der Sternsiedlung wohnten.
Und auf dem Gymnasium dann: WO wohnst du?
HU-DE-KAMP.
Geburtstagseinladungen nahmen nur die ganz Mutigen an. Und die wurden vor Einbruch der Dunkelheit von ihren Eltern abgeholt. Das fiel Lukas besonders auf. Dass Kinder abgeholt wurden, war nicht ungewöhnlich, meist aber kamen die Mütter allein und blieben auf einen Kaffee, bevor sie ihre überdrehten Bälger ins Auto stopften. Nach Hudekamp aber kam man zu zweit. Klingelte unten und bestellte sein Kind über die Gegensprechanlage. Einmal hatte Lukas gehört, wie ein Mitschüler die Hochhaussiedlung als »Hochschule« bezeichnete. »Da wohnen die ganz Schlauen.«
Als Zwölfjähriger entdeckte Lukas das Dach. Der Hausmeister hatte den Schlüssel stecken lassen, Lukas schlich sich mit seinen Comics aufs Dach, saß mit einer Dose Fanta auf der warmen Teerpappe – und ihm gehörte die Stadt. Er lauschte den Geräuschen des Hudekamp. Das Klappern von Geschirr, Musik, Waschmaschinen im Schleudergang, das Surren der Skateboards, das Quietschen der Schaukeln. Die Stimmen der Nachbarn, die sich mit den Stimmen aus den Fernsehern und Radioapparaten mischten. Ein dichter Schwarm von Schallpartikeln. Geräuschplankton, dachte Lukas. Er lag auf dem Dach, das riesige Maul geöffnet, schluckte literweise Luft, die zwischen den Barten wieder ausströmte, zurückblieb ein Maul voll Plankton und Krill. Am Abend setzte er einen kleinen Schnitt in den Bezug seiner Matratze und schob den Schlüssel unter den Stoff.
Hudekamp war Sozialhilfeabo. Einer wie Lukas, einer der Meeresbiologie studieren wollte, gehörte dort nicht hin, es war seiner Mutter wichtig, ihm das bewusst zu machen. Wichtiger noch, es allen anderen bewusst zu machen. Lukas aber gehörte dorthin. Fliege auf Dachpappe.
Eines Abends war er auf dem Dach eingeschlafen, und als er aufwachte: Sternschnuppenregen. Eine nach der anderen, Schnuppe, Lichtschweif, der komplette Zauber. Lieg mal auf dem Dach eines 18-stöckigen Hochhauses unter einem Meteorschauer in einer warmen dickflüssigen Augustnacht, und in der Fanta ist auch noch ein Schluck drin. Premium. Wenn Leute von Hudekamp redeten, dachte Lukas an Schnuppenregen.
Lukas trank seinen letzten Schluck Kaffee, Himmel über Hudekamp, Balkonbalustrade, my heart will go on, später August 2001, eine Jahreszahl, die für jemanden seiner Generation nicht dafür gemacht war, anders als in der Zukunft zu existieren. Friederike Weber hatte einen denkwürdigen pädagogischen Stil gehabt, wenn es um die cineastische Erziehung der Söhne ging. Wolltest du Rocky, musstest du erst durch 2001: A Space Odyssey. Wolltest du Rambo, bitte, sehr gern, nachdem wir gemeinsam Solaris gesehen haben.
Lukas schloss die Balkontür, stellte den Kaffeebecher in die Spülmaschine, nahm den Teller aus der Mikrowelle und brachte ihn seiner Mutter ins Wohnzimmer. »Geht’s dir gut?«
»Mach dir um mich mal keine Sorgen.«
Nee, is klar. Die meisten 26-Jährigen wohnten bei ihrer Mutter, normal.
»Du rufst an, wenn was ist.« Sie nickte. Sie hatte ihn noch nie angerufen. Nicht einmal, als sie am Nachmittag gestürzt war, über Lukas’ Schuhe auch noch, und dann bis zum Abend liegen bleiben musste. Sie hatte sich nichts gebrochen. Sie konnte ihr eigenes Körpergewicht nicht mehr stemmen.
Drei Tage, nachdem damals die Zusage fürs Meeresbiologiestudium aus Husum gekommen war, musste der Notarzt kommen. Der Atem zu schwer, als würde ihr jemand die Lunge mit der Faust zudrücken, in Gegenwart des Arztes ging es gleich wieder. Lukas stand am Fußende des Bettes, und der Arzt: »Ich sag mal so: Wenn jetzt wirklich was wär, wenn wir Sie jetzt mitnehmen müssten, wir hätten ein Problem, Sie hier rauszukriegen. Durchs Fenster geht ja nicht mal eben, dafür ist’s hier zu hoch. 11. Stock, oder?«
Seine Mutter nickte. Ja. 11. Stock. Nein, das stimmt. Das wär zu hoch.
Lukas verließ wortlos das Schlafzimmer, die Wohnung, das Haus, Hudekamp. Erst auf der Allee merkte er, dass er sein Rennrad noch immer auf der Schulter trug. Er setzte sich auf den Sattel und fuhr los. Die Trave entlang bis zur Wiese an der Au. Und dort eine Flasche Wein bei Aldi, die er runtertrank, als hätte er Durst. Seine Mutter passte nicht mehr durch die Wohnungstür. Und anders als ihm, schien ihr das bewusst gewesen zu sein. Für das Studium in eine andere Stadt ziehen: unmöglich. Mit 18 Jahren verstand Lukas, dass sein Leben nie etwas anderes sein würde, als ein Kompromiss im Resonanzraum seiner Mutter. Er zerriss die Zusage aus Husum in kleine Fetzen. Aber das mit der Meeresbiologie war ja sowieso naiv gewesen. Ihm ging es ja nicht um Wattwürmer. Er hatte von Korallenriffen, Orcas oder dem Marianengraben geträumt. Seine frühen Idole: Walsh und Piccard. Die beiden Nerds waren in einem selbst zusammengeschraubten U-Boot in den Marianengraben getaucht. Bei einem Wasserdruck, der Metall bog, als wäre es Papier. Sie entdeckten Leben, wo man keines vermutet hatte, und verhinderten so die geplante Atommüllentsorgung in der Tiefsee. Lukas Weber war bewusst, dass man als Meeresbiologe nicht täglich einen unbekannten Urfisch (manche behaupteten, es wäre bloß eine Seegurke gewesen) in der Tiefsee entdeckte. Aber auch die Artenvielfalt eines Korallenriffs konnte ihn begeistern. Im Watt hocken und die Anzahl der Wurmhaufen pro Quadratmeter zu bestimmen war weniger spannend. Sand fressen, zehn Prozent organisches Material rausfiltern, neunzig Prozent Sand ausscheiden. Jeder Wattwurm kam alle 45 Minuten an die Oberfläche und schied Sand aus. Im Jahr filterte ein Wurm 25 Kilo Sand. Lukas wusste nicht, wie lange er sich dafür würde begeistern können.
Lange Streitigkeiten mit seiner Mutter, er solle bitteschön nach Husum gehen, der Rest wäre ihre Sache, sie käme schon zurecht.
Ob sie sich mittlerweile doch vorstellen könne, eine Therapie zu machen?
Auf gar keinen Fall.
Vielleicht eine Kur?
Sei er wahnsinnig? Man könne ja glauben, sie habe ihm nie erzählt von den Grausamkeiten, die –
O doch. Mehr als ihm lieb sei.
Für die Ausbildung zum Pfleger bewarb er sich nach dem letzten Streit. Wenn er schon gezwungen war, sie zu pflegen, dann wollte er zumindest genauer wissen, was er tat. Das schlechte Gewissen seiner Mutter beflügelte ihn, bis er in der Realität landete, also auf dem Flur der psychiatrischen Station der Jannsen-Klinik. Mit dem Gesicht auf dem Linoleum, seine Wange quietschte über den mintfarbenen Bodenbelag. Und Eva Holm: »Was für Kaffee? Du bist drei Minuten zu spät, da warten schon fünf Leute auf dich, und das Telefon klingelt.« Das Dienstzimmer vollgestopft mit Stühlen, die Tische mit Kladden übersät, Stapel von Formularen, die er theoretisch auszufüllen wusste, hier aber vergaß er alles. Formulare und Akten bis unter die Decke, halb offene Aktenschränke, zwei Monitore, die Flur und Speisesaal überwachten, die Übergabe lief gerade, Kaffee und Zigarettenrauch, ein Pfleger in seinem Alter, Emre, eine Schwester, Sylvia, die vielleicht Mitte dreißig war, dann noch die furchterregende Holm, und das war schon die große Besetzung, wie man ihm mitteilte. Lukas sah kaum etwas vor Aufregung, setzte sich auf den letzten freien Stuhl und riss einen Stapel Kladden herunter.
Sage mal, hat man euch das nicht beigebracht / sach ma, das ja wohl nich die Möglichkeit, dann treck di man warm an / nu aber, krieg ma die Hacken ausm Teer, wir haben hier nicht den ganzen Tag Zeit.
Neben dem Dienstzimmer der Medikamentenschrank, die Türen klemmten, die Schubladen schlossen nicht, natürlich fielen ihm direkt drei Tabletts mit den vorsortierten Pillen runter. Am Nachmittag schaute er auf seine Hände und wusste nicht, wann er das letzte Mal seine Handschuhe gewechselt hatte. Er schwitzte und zettelte und notierte und rannte, trockene Augen, pappiger Mund, zitternde Hände. Als Emre ihm irgendwann tröstend die Hand auf die Schulter legte, das wird schon, hätte er fast geweint.
Aber als er ein paar Jahre später in einer Gruppe von Bezugspatientinnen und -patienten barfuß unter dem Nordseehimmel stand: »Am Brustpanzer der Krabbe können Sie erkennen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist, hier, wenn die Platten wie ein Bienenstock angeordnet sind …«, da durchströmte ihn eine melancholische Freude. »Wir stehen hier auf dem Meeresgrund. Macht euch das mal klar.« Aus Versehen geduzt. Egal. »Jetzt kommt ein bisschen Schlick. Wir werden gut zwanzig Zentimeter einsinken. Aber: Falls ich plötzlich verschwunden sein sollte, wählen Sie eine andere Route.« Alter Wattführerwitz. Die Stille weit und flach, winzige Krabben, die ihnen über die Zehen kletterten und ganz zart ein ungewohntes Geräusch, als würde man Luftpolsterfolie aufknacken, nur leiser. Überall platzten die kleinen Luftblasen, die die Gänge der winzigen Wattschnecke verschlossen. Ein Tier wie schwarzer Kies. Nur Menschen versteinerten nicht.
4Die Achtzigerjahre – Olga Rehfeld
Am frühen Morgen schrieb Rehfeld mit der Hand. Das Klappern der Schreibmaschine war zu laut für alle, deren Schlaf nicht von Medikamenten getränkt war.
Das Wetter: norddeutsches Dienstgrau. Die Regentropfen schlugen Krater in die dünne Schneedecke vor dem Fenster. Um sechs Uhr die erste Raucherin unter einem tropfenden Baum, junge Frau unter tränender Birke, Tennissocken in offenen Latschen. Auch Noll würde bald unter der Birke stehen mit verschatteten Augen, einen Schal elegant um Kopf und Nacken gelegt. Manchmal auch Fritz Rosenthal mit der Wüste in den Augen. Der versteinerte Wald, von dem er Rehfeld erzählt hatte. Vom glühenden Sand geformt, Pinselstrich für Pinselstrich freigelegt von einer Archäologin.
Rehfeld schlug das Heft zu und setzte sich in den Stuhl unter dem Fenster.
Vor dem Frühstück las sie meist noch eine Stunde. Die Welt durch den Filter der Literatur schicken. Sprache wie scharfes Glas. Der Rhythmus der Prosa würde sich auf die Gesichter der anderen legen, die müde von sich selbst ihren Kaffee tranken. Nach einer Stunde klappte sie das Buch zu, zog die Pantoffeln an, wusch sich am Waschbecken, hob Lage um Lage an, der hängende Bauch, die Brüste, dieser Körper, dem sie so lange schon entronnen war, und verließ das Zimmer. Im Flur der vertraute Geruch atmender Haut, dieser weiche, etwas schale Dunst vieler Menschen am Ende der Nacht.
Rehfeld trug das Tablett mit Kaffee, Käsebrot und Orangensaft zu dem Tisch am Fenster. Sie nahm mit jedem Schluck Saft eine Pille. Einige Medikamente waren nur notwendig, um die Verheerungen der früheren Behandlungen auszugleichen. Ein Begriff des Krieges, dachte Rehfeld. Früher hatte sie damit gehadert: Nicht zu wissen, wie ihr Geist arbeiten würde, wenn sich niemals jemand daran zu schaffen –
»Meine Liebe.« Noll. Das Zittern in der rechten Hand heute stärker, die Kaffeetasse hielt Noll in der linken. Der Lippenstift heute dezent, auch die Make-up-Ränder waren verblendet, in letzter Zeit hatte sie die Lippen häufig übermalt, die Augen wurden schlechter. Noll lächelte, Eva Holm habe ihr geholfen. Noll und Rehfeld aßen jeden Morgen das Gleiche, ein Brot mit Marmelade, eines mit Käse. Am Nebentisch die Klage über das Essen. Ein Mann, jung wie Schnee. Noll und Rehfeld waren keine Generation, die über das Essen jammerte.
»Was ein Schneewittchen.« Noll.
Und Rehfeld fragte sich nicht einmal, ob sie wirklich gerade jung wie Schnee gedacht hatte, kurz bevor Noll –
Es riss jeder Gedanke irgendwann ab, noch viel mehr aber verschlang er sich mit Nolls Gedanken, die Räume der Anstalt waren Rehfelds Echokammer, woher sollte Rehfeld wissen, wer sie gewesen wäre –
Ob ihre Gedanken eine andere Schärfe? Wenn nicht das Haldol Jahrzehnte in ihr brachgelegt –
Wäre sie dann in der Lage, mit ihren Sätzen die Wirklichkeit zu perforieren?
Noll warf jeden Morgen ihren Schatten über den Tisch, damit Rehfeld lächelte. Ein Schluck Kaffee und Nolls Geruch von Zigaretten und der blumig-holzige Duft ihres Parfums, das sie sich jeden Morgen aus dem Schwesternzimmer abholte. Nolls Lippenstift, der leicht in den feinen Linien um die Lippen herum verlief. Nolls Gesicht war ihr Zuhause.
Als Thorsten Fellner Anfang der Achtzigerjahre bei Rehfeld das Haldol abgesetzt hatte: Wetterleuchten. Einschläge in verdorrte Neuronen. Ihre Hände zitterten, ihr Gesicht zuckte, ihre Beine schnellten in unwillkürlichen Bewegungen vor. Falls es ihre Beine waren. Rehfeld erinnerte sich an einen anderen Körper. Ihre Brust, ihr Bauch, ihre Arme, alles in unbekanntem Volumen, ihr Gesicht aus einer vergessenen Nacht war jetzt ein teigiger Tag.
Rehfeld musste sich in einem Körper zurechtfinden, der innerhalb eines Augenblicks Jahrzehnte gealtert war und doppelt so schwer. Im Gesicht die Spuren des Neuroleptikums, ein unkontrollierbares Zucken und Schmatzen und züngeln.
Und da, zum ersten Mal in ihrem Leben, wurde Rehfeld tatsächlich depressiv. Ein Zustand, den Rehfeld selbst mit gereizter Distanz beobachtete. Es war Noll, die den Griff der Depression etwas lockerte, indem sie ihr von Büchern erzählte, die sie, Noll, gelesen hatte und damit Rehfeld an die Literatur erinnerte. Rehfeld begann wieder zu lesen. Ein Aufruhr fast erloschener Gedanken. Dort, wo kaum noch eigene Gedanken waren: Prosa. Ingeborg Bachmanns Sätze der Efeu, der die Klinik durchwucherte, lohendes Laub, genesene Häuser usw. Da lichterte also wieder etwas, tief unter der Asche von Rehfelds Gedanken. Sie erinnerte kaum ihr eigenes Schreiben, erinnerte ja auch kaum das eigene Gesicht, aber der stille verschrobene Atem der Literatur, dem konnte sie sich jetzt genauso wenig widersetzen, wie sie es als junge Frau gekonnt hatte.
Rehfeld wusste jetzt mehr. Ließ sich nichts mehr einfach so verordnen, verwickelte die Ärzte in lange Gespräche, trieb Handel mit ihren Synapsen. Es gab bessere Medikamente. Das Zittern der Hände war zurückgegangen, vieles andere nicht. Aber die Raubzüge an ihrem Geist lagen hinter ihr. Jetzt ließ man sie gleißen, auch mal irrlichtern. Es lohnte sie nicht, vielleicht. Rehfeld entschied sich, Respekt darin zu erkennen.
Der Kaffee süß. Holm kam vorbei, setzte sich zu ihnen, die Füße geschwollen von der Nachtschicht: Min Deerns.