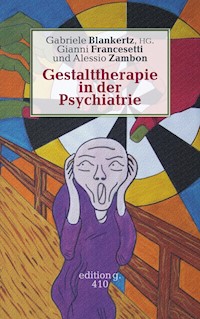
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Vorurteil besagt, Gestalttherapie sei ungeeignet für schweres psychisches Leiden. Dieser Band versammelt vier Beiträge, die dagegen aufzeigen, wie Gestalttherapeuten im Rahmen der psychiatrischen Versorgung einen großen Beitrag zu einer Verbesserung der psychischen Gesundheit ihrer Patienten zu leisten vermögen. In seinem Beitrag »Ungesichert in den Seilen hängend halten wir uns an Fixierungen: Zwangsstörungen gestalt-phänomenologisch untersuchen« skizziert Gianni Francesetti einen Rahmen der Theorie, in welchem Zwangsstörungen verstanden werden können, und macht damit möglich, sie aus der Perspektive der Leidenden heraus zu verstehen und nicht nur von außen zu diagnostizieren. So vermögen Therapeuten zu Verbündeten der Leidenden zu werden, ohne ihre Perspektive übernehmen zu müssen. An dieser Stelle helfen die ebenso einfachen wie wirksamen Übungen, die Alessio Zambon in seinem Beitrag »Gestalttherapie in der Psychiatrie: Empathie bei schwerem psychischen Leid entwickeln, zwischen Regression und Erdung« vorschlägt, um die Empathie, Vorbedingung für alles Verstehen, mit psychisch schwer Kranken zu entwickeln. Diese Übungen sind erste Vorschläge, und Alessio Zambon hofft, dass sie den Anstoß geben, weitere und neue Übungen hervorzubringen. Zudem gewährt er in einem Beitrag über das Projekt An-Arché im Rahmen der Reform der italienischen Psychiatrie und anti-psychiatrischen Bewegung aus eigener Erfahrung Einblick in die Herausforderungen, die aus einem respektvolleren Umgang mit psychisch schwer kranken Menschen resultieren. Der Beitrag »Kontakt - Der Weg zur Heilung: Gestalttherapeutische Langzeit-Begleitung« der Herausgeberin des Bandes Gabriele Blankertz betrifft die Frage, wie Kontakt mit Menschen herzustellen ist, deren Handeln jenseits dessen liegen, was wir in unserem normalen Alltag nachvollziehen können. Aller psychotherapeutischen Wirksamkeit hinterliegt Kontakt, ob das in der jeweilig angewendeten Methode nun reflektiert wird oder nicht. Der immense Vorteil, den ich in der Gestalttherapie sehe, ist, dass sie genau das leistet, nämlich in der Ausbildung und in der täglichen Praxis die Qualität des Kontakt auch zu reflektieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GABRIELE BLANKERTZ | Gestalttherapeutin DVG | Gestalt-Praxis in Berlin | Gründung des Berliner Gestaltsalons und Aufbau des InKontakt Gestaltinstituts Berlin.
GIANNI FRANCESETTI | Psychiater | Gestalttherapeut | Professor für den phänomenologischen und existenziellen Ansatz, Universität Turin | internationaler Trainer und Supervisor.
ALESSIO ZAMBON | Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie | Gestalttherapeut | Ausbildner am InKontakt Gestaltinstitut Berlin.
INHALT
Gabriele Blankertz
Zum Geleit
Gianni Francesetti
Ungesichert in den Seilen hängend halten wir uns an Fixierungen
Zwangsstörungen gestalt-phänomenologisch untersuchen
Literaturverzeichnis
Alessio Zambon
An-Arché
Eine systemische Anwendung der Gestalttherapie in der Psychiatrie
Alessio Zambon
Gestalttherapie in der Psychiatrie
Empathie bei schwerem psychischen Leid entwickeln, zwischen Regression und Erdung
Gabriele Blankertz
Kontakt: Der Weg zur Heilung
Gestalttherapeutische Langzeit-Begleitung
Personenindex
Sachindex
Gabriele Blankertz
ZUM GELEIT
Die hartnäckige Weigerung, Gestalttherapie in Deutschland als psychotherapeutisches Verfahren offiziell anzuerkennen und nicht nur zähneknirschend zu dulden, führt zu dem hartnäckigen Vorurteil, sie sei für schwere psychische Leiden auch nicht geeignet: So lautet ja auch die bürokratische Regel, dass nämlich alles, was in den medizinischen, also ernsthaften Bereich fällt, Gestalttherapeuten vorenthalten bleibt (es sei denn, sie verfügen über eine andere Art der Berechtigung).
Gianni Francesetti und Alessio Zambon sind Italiener und von solchen Bedenken nicht angekränkelt. Gestalttherapie mit ihrem Ansatz, psychisches Leid, auch in schwerster Form, aus dem Feld heraus zu verstehen, das die Person inklusive ihrer Biografie und ihrer Gegenwart mit ihrer Umgebung bildet, ist prädestiniert dafür, bei den Therapeuten die Fähigkeit herauszubilden, sich in die Leidenden hineinversetzen zu können. Die Empathie ist Voraussetzung, um Kontakt aufzunehmen. Und nur in einem unterstützenden Kontakt liegt die Möglichkeit einer Heilung oder wenigsten Linderung des Leids.
In seinem Beitrag skizziert Gianni Francesetti einen Rahmen der Theorie, in welchem Zwangsstörungen verstanden werden können, und macht damit möglich, sie aus der Perspektive der Leidenden heraus zu verstehen und nicht nur von außen zu diagnostizieren. So vermögen Therapeuten zu Verbündeten der Leidenden zu werden, ohne ihre Perspektive übernehmen zu müssen. An dieser Stelle helfen die ebenso einfachen wie wirksamen Übungen, die Alessio Zambon vorschlägt, um die Empathie, Vorbedingung für alles Verstehen, mit psychisch schwer Kranken zu entwickeln. Diese Übungen sind erste Vorschläge, und Alessio Zambon hofft, dass sie den Anstoß geben, weitere und neue Übungen hervorzubringen. Zudem gewährt er in einem Beitrag über das Projekt An-Arché im Rahmen der Reform der italienischen Psychiatrie und antipsychiatrischen Bewegung aus eigener Erfahrung Einblick in die Herausforderungen, die aus einem respektvolleren Umgang mit psychisch schwer kranken Menschen resultieren.
Meine eigenen Überlegungen betreffen die Frage, wie Kontakt mit Menschen herzustellen ist, deren Handeln jenseits dessen liegt, was wir in unserem »normalen« Alltag nachvollziehen können. Aller psychotherapeutischen Wirksamkeit hinterliegt Kontakt, ob das in der jeweilig angewendeten Methode nun reflektiert wird oder nicht. Der immense Vorteil, den ich in der Gestalttherapie sehe, ist, dass sie genau das leistet, nämlich in der Ausbildung und in der täglichen Praxis die Qualität des Kontakts auch zu reflektieren.
Ich freue mich, dass wir diese Denkanstöße in der Schriftenreihe des Berliner Gestaltsalons veröffentlichen können und bedanke mich bei Gianni und Alessio sehr herzlich dafür, dass sie ihre Beiträge zur Verfügung gestellt haben.
Gianni Francesetti
UNGESICHERT IN DEN SEILEN HÄNGEND HALTEN WIR UNS AN FIXIERUNGEN01
Zwangsstörungen gestalt-phänomenologisch untersuchen
In folgendem Essay02 schlage ich vor, die Erfahrungen derer zu untersuchen, die an einer Zwangsstörung [obsessive-compulsive disorder, OCD] leiden, mit dem Ziel, Therapeuten bei ihrem praktischen Vorgehen zu unterstützen. Meine Untersuchung basiert auf konkreter klinischer Realität und auf vorhandener Literatur und nimmt insbesondere konzeptionellen Bezug auf phänomenologische Methoden,03 auf die phänomenologische Psychiatrie,04 sodann auf empirische Methoden der Gestaltpsychologie05 und die Theorie und Praxis der Gestalttherapie.06 Mit diesem Ansatzhoffe ich, ein strukturelles07 und relationales Verständnis dieses Leidens entwickeln und einen Rahmen schaffen zu können, der den verschiedenartigen Erfahrungen, die die Patienten machen und über die sie berichten, Bedeutung verleiht. Zur Untermauerung der therapeutischen Arbeit mit solchen Menschen, die unter Zwangsgedanken [obsessions] und Zwangshandlungen [compulsions] leiden, ziehe ich darüber hinaus die Feldperspektive heran; sie bietet ein Beispiel für die gestalttherapeutische Analyse in der Psychopathologie und dafür, wie die phänomenologische Psychiatrie diesen Weg auf frühere Arbeiten aufbauend unterstützen kann.08 Es finden sich in der Literatur nur wenige Schriften zu einem gestalttherapeutischen Ansatz bei Zwängen.09 Der systematischste ist der von Giovanni Salonia (2013), der den Ausgangspunkt meiner Untersuchung bildet; dann aber schlage ich ein etwas anderes Verständnis davon vor, wie Zwangsgedanken und wie Zwangshandlungen entstehen.
I. Vorbemerkungen zur »extrinsischen« Diagnose10
Eine »extrinsische« Diagnose basiert auf dem Prozess des Abgleichens dessen, was der Experte verzeichnet, mit den nosographischen (bewertungsfreien) Kategorien in einem System von Formulierungen der Symptome. Die Diagnosekriterien für Zwänge laut DSM 5 (APA, 2013) sind:
A) Zwangsgedanken [obsessions], -handlungen [compulsions] oder beides sind vorhanden;
B) diese sind zeitintensiv oder sie verursachen Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen;
C) sie sind nicht die Folge der physiologischen Wirkung einer Substanz oder eines medizinischen Krankheitsfaktors.
D) Das Störungsbild lässt sich nicht besser mit dem Vorliegen einer anderen psychischen Störung erklären.
Die ICD-Klassifikation unterscheidet sich nicht wesentlich.11 12 Die Zwangsstörung ist eine häufige und schwerwiegende Störung, die ihren Betroffenen und den ihnen nahestehenden Personen das Leben sehr schwer machen kann: Etwa 2-3 % der erwachsenen Bevölkerung leiden an dieser Störung,12 wobei die Zahl der Betroffenen weltweit auf über 100 Millionen Menschen geschätzt wird. Sie ist durch zwei Hauptsymptome gekennzeichnet: Zwangsgedanken und Zwangshandlungen.
Zwangsgedanken sind unerwünschte und aufdringliche Gedanken, Bilder, Impulse oder Ideen, die als bedrohlich, abstoßend, sinnlos, obszön oder blasphemisch erlebt werden. Die Themen können variieren und betreffen typischerweise Schmutz, verantwortlich zu sein für Anderen zugefügte Schäden, Sex, Religion, Gewalt sowie Störung von Ordnung oder Symmetrie. – Drei Merkmale unterscheiden Zwangsgedanken von anderen wiederkehrenden Gedanken:
1. Sie sind unerwünscht und
2. unvereinbar mit dem Wertesystem des Betroffenen.
3. Sie rufen bei dem Betroffenen Widerstand hervor, wenn er versucht, sie zu beseitigen oder die Folgen zu bewältigen.
Zwangshandlungen sind zielgerichtete und absichtliche Verhaltensweisen, die der Betroffene als Reaktion auf die Zwangsgedanken vornimmt, um die Angst, die sie hervorrufen, und ihre katastrophalen Folgen zu begrenzen. Zwanghafte Rituale drehen sich typischerweise um Reinigung, Kontrolle, Wiederholung und Denkakte.
Symptome von Zwangsgedanken und Zwangshandlungen können auf unterschiedlichen funktionellen Ebenen von Erkrankung auftreten, einschließlich der neurotischen und der psychotischen Ebene sowie der Borderline-Erkrankung. Alle aktuellen Diagnosesysteme unterscheiden Zwänge von einem psychotischen Erleben, aber obwohl es einen Unterschied gibt, sind beide nicht weit voneinander entfernt. Einigen Autoren zufolge13 und in dem Modell, das ich hier vorstelle, können Zwänge trotz des Unterschieds als der Psychose nahestehend betrachtet werden; in einigen Fällen bilden sie das Bollwerk, das den Betroffenen gegen ein Abgleiten in psychotisches Erleben sichert. Wir können also sagen, dass Zwänge zwar im Allgemeinen auf einer neurotischen Ebene der Organisation der Persönlichkeit entstehen, aber wenn die zwanghafte Anpassung nicht ausreicht, um die Angst einzudämmen, können die zwanghaften Symptome in ein psychotisches Erleben umschlagen. Die Diagnose einer Zwangsstörung sollte auch von der einer sogenannten »zwanghaften Persönlichkeitsstörung« differenziert werden, die sich von der Zwangsstörung dadurch unterscheidet, dass sie ich-synton ist, d.h. der Betroffene fühlt sich nicht durch sein perfektionistisches, starres, stures oder ordnungssuchendes Verhalten gestört und sucht deshalb auch keine Hilfe. Die Zwangsstörung kann, muss aber nicht mit dem zwanghaften Stil der Persönlichkeit einhergehen.
II. Eine phänomenologische Analyse: Die Erfahrung des Leids
Andrea hat Angst, dass er seine zweijährige Tochter umbringen oder dass jemand ihr etwas Schreckliches antun könne. Er wird von sich aufdrängenden Bildern gequält, wie sie körperlich und sexuell missbraucht wird. Er versteckt alle Messer und alle scharfen Gegenstände im Haus. Er zählt die Sekunden, die er braucht, um in die Garage zu kommen und das Auto zu starten, nachdem er die Haustür verriegelt hat – und wenn es nicht die richtige Zahl ist, wiederholt er die Aktion, bis die Zeit stimmt. Wenn dann die vorbei ziehenden Nummernschilder sich nicht mit Hilfe einer komplizierten Formel zu einer Zahl innerhalb eines bestimmten Bereichs addieren lassen, nimmt er eine Reihe von mühsamen mathematischen Operationen vor, um die nun möglichen tragischen Folgen für seine Tochter wieder abzuwenden.
Anna lebt in einer kontaminierten Welt, und um sich vor ihr zu schützen, muss sie ihre Wohnung ständig dekontaminieren. Das bedeutet, dass alles, was in sie gelangt, nach bestimmten Prozeduren gewaschen und für eine bestimmte Zeit in »Quarantäne« gehalten werden muss – auch sie selber. Ihre Haut ist zu einer hauchdünnen Hülle geworden, die immer stärker mit Schadstoffen belastet ist. Sie lebt in ständiger Angst und Verzweiflung.
Cristina kann nicht mehr Auto fahren, weil der Gedanke, jemanden zu überfahren, sie zwingt, ständig anzuhalten und zurückzufahren, um zu überprüfen, dass sie keinen verletzt habe. Selbst ihre Arbeit als Verkäuferin ist unerträglich geworden, denn immer wenn jemand etwas Kleinteiliges kauft, hat Cristina Angst, dass ein Kind es verschlucken und ersticken könnte. Diese Gedanken sind unaufhörlich geworden und führen dazu, dass sie immer wieder innehält und überprüft; das lindert ihre Angst, aber nur vorübergehend.
Diejenigen, die an einer schweren Zwangsstörung leiden, beginnen jeden Tag mit einer übermenschlichen Aufgabe, die sie niemals zu Ende bringen werden. Der Kampf gegen die Unordnung, die Verunreinigung, den Schmutz, die Ungewissheit, den Schaden, das Risiko oder den Kontrollverlust beansprucht ihre ganze Energie ohne Pause oder Ende und zehrt sie bis zur Erschöpfung aus. In der Erfahrung dieser Betroffenen ist die Welt erschreckend, ständig drohen schwerwiegende Tragödien und Katastrophen. Zwangshandlungen sind das Gegenmittel, Talismane, die vorübergehend das Schlimmste abwenden.14 Ich werde versuchen, diese Erfahrungen anhand von vier Themen zu beschreiben, die bei Zwängen von besonderer Bedeutung sind:
(II.1) Raum und Zeit;
(II.2) die Beziehung der Teile zum Ganzem;
(11.3) die Erfahrung der Grenze, sowie
(11.4) der Dinge.
II.1 Raum und Zeit
Der Raum zieht sich zusammen. Wie bei jeder Erfahrung von Angst ist das bedrückend: (sich) ängstigen, vom lateinischen angere, bedeutet etymologisch »einengen«, »(er)würgen«. Die Welt greift denjenigen, der Zwangsgedanken [obsessions] erfährt, von allen Seiten her an und schränkt den Raum der Person auf das ein, was kontrolliert und reinlich gehalten werden kann. Je obsessiver das Bedürfnis ist, zu kontrollieren und zu reinigen, desto mehr Raum ist verbotenes Territorium. »Obsession« leitet sich etymologisch gesehen vom lateinischen obsessio ab, was »Einschließung« bedeutet. Es gibt also eine räumliche Implikation in der ursprünglichen Bedeutung von Obsession.15 Eine von einer Obsession besessene Person wird belagert, spürt, dass ihr der Raum fehlt und ihr die Dinge zu nahe kommen.16 Das Bedürfnis und die Strategien, Symmetrie herzustellen, erzeugen ein Gefühl der Kontrolle über den Raum, sein unaufhaltsames und chaotisches Herannahen zu stoppen, den Zustand der Belagerung aufzuheben. Der Raum ist bedrohlich nicht in dem Sinne, dass er ein Ort ist, an dem ich mich der Welt schutzlos ausgeliefert sehe, wie bei Agoraphobie,17 sondern in dem Sinne, dass er ein Ort ist, an dem die Distanz zu den Dingen fehlt. Die Erfahrung des Mangels an Distanz ist die Basis, von der aus die Bemühungen des an Zwangsgedanken Leidenden zu verstehen sind, Distanz zu schaffen, wie wir weiter unten sehen werden. Die Bevorzugung des distanzierendsten und objektivierendsten aller Sinne, des Sehens, steht ebenfalls im Dienst dieses Bedürfnisses. So ist das Subjekt mit Rückzugsgefechten beschäftigt, sieht sich einer Belagerung ausgesetzt, die kein Ende findet, einer Zeit, die fließt, ohne dass dem Anstieg der Erregung und dem Höhepunkt der Handlung eine Befriedung folgt – Zeit fließt linear, gleichförmig und unaufhaltsam dahin, aber ohne etwas zu erreichen, das durch einen Seufzer abgeschlossen werden kann, der es erlaubt, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Eine Pause einzulegen und innezuhalten, ist notwendig und gleichzeitig unmöglich: Innehalten ist notwendig, um die Erfahrung auszukosten; hier in dieser Welt hieße auskosten aber, Ekel zu empfinden. Zeit fließt dahin, ohne zu einem Ereignis zu werden, und erzeugt eine körperliche Spannung, die sich nie in einem Höhepunkt auflöst, eine Spannung, die nur dann nachlässt, wenn die aufwendbare Energie erschöpft ist, nicht weil ein Ziel erreicht ist, an dem man ausruhen kann, Zeit erlaubt keine Reifung und kein Innehalten; darum kommt es nicht zur Assimilation, Anhalten hieße aufgeben; es gibt kein Ruhen und kein Rasten, keinen Endpunkt.
II.2 Beziehung der Teile zum Ganzen
Wer an einer Zwangsstörung leidet, fängt mit seinen Netzen die kleinen, lässt aber die großen Fische entkommen. Details treten in den Vordergrund, werden zur Figur, werden vergrößert und immer wieder analysiert, ohne dass das Gefühl entsteht, etwas geschafft zu haben. Der Mangel an Distanz führt die Betroffenen dazu, räumliche Details so stark zu vergrößern, dass sie Ekel erregen oder Gefahr anzeigen.18 Das, was uns belagert, muss weggeschoben werden, und eine Möglichkeit, das zu tun, liegt darin, es visuell zu objektivieren, zu einem Objekt zu machen, einem Objekt, das freilich unweigerlich zu nahe rückt und damit ekelhaft oder gefährlich wird. Das Detail überwiegt und tritt in den Vordergrund, aber die Figur wird nie zufriedenstellend vollendet. Bei solchen Erfahrungen ist es schwierig, zu einer letztendlichen Gestalt zu gelangen, die man als vollständig und alle bedeutenden Elemente umfassend empfindet. Stattdessen sind Figuren wie Windmühlen – da sie nicht in einem Boden verwurzelt sind, der sie trägt, werden sie notwendigerweise repetitiv und bleiben unvollendet; denn was unvollendet ist, wird wiederholt.19 Die fehlende Erfahrung der Vollendung hilft uns, die krampfhafte Suche nach Vollendung zu verstehen, welche nie erreicht werden kann. Hier taucht der nur scheinbar sinnlose Sinn des Perfektionismus auf – im Lateinischen bedeutet perfectus etymologisch vollkommen, vollendet, vollständig. Es ist ein ständiger Drang nach einer Erfahrung der Vollendung – das ist der Durst, der Betroffene von Zwangsgedanken antreibt, ohne jemals Erleichterung zu finden; perfects bedeutet aber auch »tot«,20 und bezeichnenderweise ist die Art, in der an Zwangsstörungen Leidende an Selbstmord denken, eine Möglichkeit, dem endlosen Kampf ein Ende zu setzen: »Oft denke ich auf der Autobahn, dass es genügen würde, in der Kurve nicht zu lenken. Dann hätte endlich alles ein Ende, und jeder würde denken, es sei nur ein Unfall gewesen.«
II.3 Die Erfahrung der Grenze
Grenzen, Räume, Einfassungen, Barrieren und Dämme sind immer wiederkehrende Themen im Kampf gegen Enge und Verunreinigung, im Bemühen um Abgrenzung gegen Zerfall, Fäulnis und Bedrohung. Es ist ein endloser Kampf gegen das »Böse« in all seinen verschiedenen Formen: Gewalt, Schicksal, Verfall des Fleisches, Krankheit, Keime und Würmer, Gefahr, Schaden, schlechte Einflüsse. Ein Merkmal des Bösen besteht aber darin, dass es sich nicht wirklich eindämmen lässt. Verfallsprozesse sind nicht aufzuhalten. Keime dringen in jede noch so kleine Ritze ein; Gewalt und Schicksal schlagen jederzeit zu. Das Böse fließt; es ist eine Flüssigkeit, welche durch alle Hindernisse sickert. Die Grenze muss also befestigt, neu markiert und fixiert sowie verbreitert werden; sie bleibt aber brüchig und voller Löcher. Die Hände werden gewaschen, um den Gestank des Bösen, der an ihnen klebt, zu entfernen; aber die Haut wird immer dünner, die Barriere immer schwächer und erfordert immer mehr Reinigung, in einem unendlichen, teuflischen Kreislauf. Ein wachsames Auge obsessiv auf jede Barriere zu werfen, reicht nicht aus; sie kriegen Risse, bröckeln und verrotten. Der unaufhaltsame Fluss der Zeit, der alles in sich hinein schlingt, verzehrt und auflöst, korrumpiert sie. Der Ekel, den manche Autoren21 als die zentrale Erfahrung bei Zwangsgedanken ansehen, entsteht aus dieser engen Begegnung mit der Materialität, die sich nicht wegschieben lässt. Wie bei Swift gesehen, macht das Fehlen einer breiten räumlichen Dimension, das Zerquetscht-Werden durch die Dinge, sie ekelhaft. Die Erkenntnis, dass der Patient keine sichere Grenze zwischen sich und dem Hadern damit, was jederzeit passieren könnte, etablieren kann, hilft bei der Entwicklung einer Phänomenologie des Unvermögens, Grenzen zufriedenstellend weitläufig zu gestalten und aufrecht zu erhalten. Dies gestattet es uns auch, Praktiken des Hortens zu verstehen. Beseitigen heißt etymologisch, etwas über die Seite – über die eingrenzende Linie einer Fläche, Grenzfläche eines Körpers – hinaus wegzuschaffen, zu entfernen, verschwinden zulassen;22 das aber ist etwas, das zugleich ersehnt wird und unmöglich ist. Aggressivität, die manchmal in Gewalt münden kann, ist oftmals ein extremer Versuch, eine Barriere an der Stelle zu erzwingen, an der jemand sie durchbrochen hat; dadurch war ein bedrohlicher Riss in dem Sicherheitsgürtel entstanden, den der Patient ständig aufbaut und kontrolliert. Die Angst, man könne Schaden anrichten, entspringt hier keinem »verdrängten Wunsch«, jemandem zu schaden. Es handelt sich vielmehr um eine reale Angst, in der sowohl das Risiko einer extremen Abwehr (wenn keine Distanz geschaffen oder die Grenze auf andere Weise verteidigt werden kann) als auch das Risiko eines unfreiwilligen Kontrollverlusts ausgedrückt ist.
II.4 Die Erfahrung der Dinge
In einer Welt voller Zwangsgedanken haben die Dinge Leben. Sie bewegen sich; sie sind unkontrollierbar und unvorhersehbar. Sie kennzeichnet das, was Gestaltpsychologen als physiognomische Qualitäten23 bezeichnet haben: »Physiognomische Qualitäten« rufen sofort sensorische und emotionale Erfahrungen hervor,24 in der Regel beunruhigen sie, ja erschrecken sogar. Dinge befinden sich nicht in Ruhe; daher lösen sie Rastlosigkeit aus. Dinge, wenn man sie genau betrachtet, schauen einen an. Dinge sind Lebewesen, und so unterliegen auch sie einem Prozess des entropischen Zerfalls. Materie ist keine stabile Einheit; unaufhaltsam zerfällt sie. In derartigen Erfahrungen sind die Dinge nicht dort drüben, klar getrennt und distanziert vom Betrachter, der auf einem mehr oder weniger neutralen Posten der Beobachtung steht. Ein solcher Posten wird angestrebt, aber nie ganz erreicht, denn die Dinge sind immer da; sie stören und können nicht beiseite geschoben werden. Es gibt keine klare und beständige Grenze. Immer ist irgendetwas flutschig, übertrieben. Ein Kratzer an der Tür des Autos, Staub auf der gestern Abend geputzten Anrichte, ein verwelktes Blatt zwischen den Geranien, in die Hand genommene Münzen, die man hätte verschlucken können – all dies legt lebendiges Zeugnis davon ab, wie vieles sich unserer Kontrolle entzieht; es ist ein entropischer Kampf ohne Ende, ohne Atempause, in dem wir niemals siegen können.
Wer unter Zwangsgedanken leidet, lebt im Belagerungszustand, ist in jedem Moment der Gefahr ausgesetzt, Schaden zu erleiden, provoziert durch Dinge oder, ohne Absicht, durch sich selbst. Belagert, kämpft man weiter. Ohne Pause. Ohne Frieden.
III. Eine Gestaltanalyse der Erfahrung: Zwangsstörung als kreative Anpassung
Die Frage, die ich in diesem Abschnitt versuchen möchte zu beantworten, lautet: Wie ist zwanghaftes Erleben strukturiert? Es geht um die





























