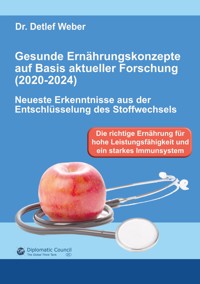
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist einzigartig, weil es die Essenz aus hunderten aktueller Forschungsberichte der Jahre 2020 bis 2024 über gesunde Ernährung zusammenfasst. Daher ist es eine Pflichtlektüre für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind oder sich beruflich mit Ernährung im engen oder weiteren Sinne befassen. Zudem werden Menschen, denen ihre eigene gesunde Ernährung ernsthaft am Herzen liegt, in diesem Buch unzählige wissenschaftlich fundierte Ratschläge zur Eigenoptimierung finden. Um dieses einzigartige Werk zu erschaffen, hat der Autor Dr. Detlef Weber die Fortschritte bei den Ernährungswissenschaft rund um den Globus lückenlos verfolgt. Mit wissenschaftlicher Akribie hat er alle relevanten Studien und Fachberichte gesichtet und analysiert, die sich mit der Entschlüsselung des Stoffwechsels befassen. Alle wesentlichen Ergebnisse über die richtige Ernährung für hohe Leistungsfähigkeit und ein starkes Immunsystem hat er in diesem Buch zusammengefasst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweis zu gendergerechter Sprache
In diesem Werk wie in allen Büchern des Verlages ist mit dem generischen Maskulinum, zum Beispiel „Wissenschaftler“ oder „Entscheider“, stets die sexusindifferente Bezeichnung gemeint, also alle Geschlechter. Abweichungen von dieser Regel werden sprachlich eindeutig gekennzeichnet, zum Beispiel durch Worte wie „männlich“ oder „weiblich“.
Inhalt
Vorwort
Grundlagen der Ernährung
Ernährungsbericht 2020 der DGE
Ernährung im Wandel der Zeit, Functional Food
Functional Food
Superfood
Essen und Leistungskraft
Versorgung des Gehirns, Sättigung
Was Ihr Gehirn für Höchstleistungen benötigt
Die Blut-Hirn-Schranke (Blood-Brain-Barrier)
Psychologie beeinflusst die Lebensmittelauswahl
Sättigungsgefühl, Energiedichte von Lebensmitteln
Essen und Altern, Zellerneuerung
Vier Grundsätze zum gesunden Älterwerden
Schutzstoffe der Pflanzen Resveratrol, Quercetin, Sulforafan
Ausgeschlafene Menschen altern langsamer
Täglicher Stoffwechselrhythmus, „zirkadiane Uhr“
Die Autophagie und ihre Rolle im Alterungsprozess
Der Weg zu den Erkenntnissen über Autophagie
Der Verdauungsprozess – die biochemischen Grundlagen
Grundlagen der Verdauung
Aufbau und Funktion des Magen-Darm-Trakts
Verdauungsvorgänge
Verdauungsvorgänge im Dünndarm
Die Aufnahme und Sekretion von Nährstoffen
Physiologie der Ernährung und Bioverfügbarkeit
Klassifizierung der Nährstoffe
Die Körperreserven sind sehr unterschiedlich
Kohlenhydrate und Ballaststoffe
Fette
Proteine
Mineralien
Vitamine
Wechselwirkungen zwischen Darmmikrobiom und Stoffwechsel
Neue Analysetechniken – neue Erkenntnisse
Der Stoffwechsel – individuell wie ein Fingerabdruck
Aktuelle Forschungsarbeiten
Wechselwirkungen in der Achse: Gehirn – Darm – Mikrobiom
Makronährstoffe
Ernährung, Makronährstoffe und mikrobielles Profil
Ballaststoffe und Stoffwechselgesundheit
Nahrungsproteine
Nahrungsfette und Polyphenole
Die Darmschleimhaut
Einflüsse auf die Darmschleimhaut
Die Barrieren im Stoffwechselsystem
Regulierung der Stoffwechselbarrieren
Störungen im Gehirn als Folge von Entzündungen im Darm
Krankheiten des Magen-Darm-Trakts und mögliche Therapien
Behandlung bei entzündlichen Darmerkrankungen
Wertigkeit der Studien zum Mikrobiom
Bioaktive Mikronährstoffe aus Pflanzen und Mikroalgen
Omega-3/Omega-6 mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFAs)
Polyphenole und ihre Funktionsweise
Phytosterole
Mikroalgen als funktionelle Lebensmittel
Functional Food
Mikroalgen als funktionelle Lebensmittel
„Personalisierte Ernährung“ als Konzept der Zukunft
Konzept 1
Konzept 2
Umweltfragen und Kosten gesunder Ernährung
Auswirkungen der Ernährung auf Treibhausgas-Emissionen
Die Kosten einer gesunden Ernährung
Ausblick auf das nachfolgende Buch
Annex: Mikroalgen
Potential bei Vorsorge und Therapie
Polysaccharide der Mikroalgen
Carotinoide zur Vorbeugung und Hemmung von Krebs
Therapeutische Anwendungen der Proteine und Peptide
Fettsäuren und Polyphenole mit antibakterieller Aktivität
Antivirale Aktivitäten von Mikroalgen
Antibakterielle Aktivitäten von Mikroalgen
Mikroalgen und Phytoverbindungen mit Therapie-Potential
Mehrfach gesättigte Fettsäuren und Lipide
Phenylethylamin (PEA) als Neurostimulator
Mikroalgen – neue Ansätze zur Behandlung von AD
Schlussfolgerung
Literaturverzeichnis
Über den Autor
Bücher im DC Verlag
Über Diplomatic Council
Vorwort
Liebe Leserschaft!
Dieses Buch richtet sich an Personen in Gesundheitsberufen und an Studierende der Ernährungswissenschaft. Es ist ein Navigator für alle, die ein Interesse an ihrer persönlichen gesunden und nachhaltigen Ernährung haben, und zugleich ein festes Fundament für alle, die im engen oder weiteren Sinne in der Ernährungsberatung tätig sind.
Das Buch zeigt auf Basis der neuesten wissenschaftlich fundierten Studien und Forschungsergebnisse auf, wie unser Körper in Bezug auf Ernährung, Verdauung und Stoffwechsel („Ernährungsphysiologie“) funktioniert. Parallel dazu wird dargestellt, welchen Einfluss unterschiedliche Konzepte der Ernährung auf die individuelle Leistungsfähigkeit und Gesundheit haben.
Wer dieses Buch studiert, erhält weit über den reinen Kalorienbedarf hinaus Orientierung, wie er sich in den verschiedenen Lebensphasen angepasst optimal ernähren kann, ohne verschiedene Diäten ausprobieren zu müssen, deren Erfolgsaussichten und Risiken schwer einzuschätzen sind. Dieses Wissen ist auch für alle wichtig, die bei Ernährungsfragen professionell beraten.
Bei der Erarbeitung des vorliegenden Buches wurden wissenschaftliche Forschungsergebnisse berücksichtigt, die weit über die allgemein zugänglichen Quellen hinausgehen. Dementsprechend reicht das Buch deutlich über die üblichen „Lehrpläne“ hinaus. Der wissenschaftliche Inhalt wird stellenweise vereinfacht, aber ohne dabei die Kernbotschaft zu verkürzen. Im umfangreichen Literaturverzeichnis sind die Quellen aus Forschung und Entwicklung aufgeführt.
Das vorliegende Buch ist in vier Teile gegliedert.
Der erste Teil stellt die aktuelle Situation der Ernährungsgewohnheiten dar, wie sie statistisch regelmäßig erfasst werden.
Im zweiten Teil werden die Zusammenhänge zwischen der „Nahrungsauswahl“, der Funktion der Verdauung und den Inhaltsstoffen der Nahrung erklärt.
Im dritten Teil wird – mit Schwerpunkt auf der Ernährungsphysiologie – erläutert, warum der Körper welche Inhaltsstoffe braucht, und wie er die einzelnen Makro- und Mikronährstoffe im Verdauungsprozess so aufarbeitet, dass diese in die verschiedenen Körperbereiche transportiert, dort aufgenommen und „funktionsgerecht“ verwendet werden können.
In diesem dritten Teil wird die essenzielle Bedeutung des Mikrobioms für die Darmgesundheit eingehend erklärt. Der Stoffwechsel, seine Entschlüsselung, und die sich daraus ergebenden Perspektiven zur Abwehr von Entzündungen und Krankheiten des Darms werden detailliert erläutert.
Dabei stützen sich die Ausführungen auf die neuesten wissenschaftlichen Studien und Forschungsergebnisse, in denen die verschiedenen Parameter und Einflüsse auf eine gesunde Ernährung untersucht werden – und die damit mögliche Prävention gegen Krankheiten. Dazu wurden hunderte aktuelle Studien und Fachberichte, die seit dem Jahr 2020 erschienen sind, gegenübergestellt, ausgewertet und zusammengefasst.
Einige der Studien reichen weit bis in das Jahr 2024 hinein. Dabei wird deutlich, wie unentbehrlich die neuesten Analysetechnologien bei der Sequenzierung der genomischen DNA für die Mikrobiom-Bestimmung sind.
Im vierten Teil werden die Mikronährstoffe einzeln aufgeschlüsselt, deren „Vorkommen“ aufgelistet, und die Empfehlungen zur Einnahme kommentiert. Daraus werden konkrete Ernährungskonzepte abgeleitet.
Dabei geht es neben den verschiedenen Polyphenolen und Phytosterolen auch um die Gruppe der Mikroalgen, die ihre eigenen Charakteristika in Bezug auf Nachhaltigkeit, Gewinnung und Spektrum der Inhaltsstoffe aufweisen.
Im Annex wird anhand neuester Forschungsergebnisse die besondere Stellung der Mikroalgen bei der Vorbeugung gegen bestimmte Krankheiten detailliert beschrieben.
Ich wünsche Ihnen nun eine erkenntnisreiche Lektüre!
Dr. Detlef Weber
Grundlagen der Ernährung
Wir brauchen Nahrung zum Leben. Es gibt eine Vielzahl von Nahrungsquellen, Nahrungsmittel unterschiedlicher Herkunft und verschiedene Möglichkeiten, Speisen zum Essen zuzubereiten. Welche Lebensmittel zur Verfügung stehen, hängt von der Region ab, in der wir leben, und jede Region hat je nach Klima- und Umweltbedingungen ihre eigene Esskultur geschaffen.
Einige Lebensmittel müssen nicht zwingend weiter zubereitet werden (z. B. Gemüse und Obst), während man Fleisch (sowie einige stärkehaltige Produkte) erhitzen muss, um sie verdaubar zu machen. Zusammen mit der Nahrung nehmen wir Flüssigkeit zu uns, entweder durch den Verzehr wasserreicher Nahrung oder durch das Trinken von Flüssigkeiten, die natürlichen Ursprungs sind oder durch Lebensmittelprozesse gewonnen werden (z. B. Bier, Wein, Soft-Limonaden).
Unsere Ernährung ist also bestimmt durch unsere eigene Wahl. Die Vielfalt und Diversität der Lebensmittelauswahl hat zugenommen, seit die Beförderung durch Kühltransporte, Luftfracht und die Steuerung durch internationale Lieferketten optimiert wurde.
Darüber hinaus haben sich die hygienischen Bedingungen bei der Verarbeitung von Lebensmitteln verbessert, so dass Lebensmittel ein wesentlich längeres Mindesthaltbarkeitsdatum aufweisen. Durch den Einsatz dafür geeigneter Verpackungen, z. B. aluminiumbeschichtete Kunststoffverpackungen, Sterilisationsverfahren nach dem Verpacken, oder „aktive Verpackungsverfahren“ (Zugabe von Inertgasen beim Verpacken, vor dem Verschließen der Verpackung) behalten Lebensmittel über einige Monate hinweg ihre spezifizierte Qualität. Daher müssen Lebensmittel heutzutage nicht mehr zwingend fermentiert oder getrocknet werden, um bis zum Verzehr gelagert zu werden. So wechseln in mehreren Ländern Asiens die Menschen zu selbst zubereiteten Lebensmitteln, anstatt „street-food“ zu essen, da sie über genügend Strom verfügen, um Kühlschränke aufzustellen und selbst frische Speisen zuzubereiten.
In den letzten Jahrzehnten wird Essen nicht mehr nur als Energiespender oder als Unterstützung beim Wachstum wahrgenommen, sondern es muss auch Convenience-Kriterien erfüllen und den Geschmack befriedigen. Außerdem ist Essen ein Teil des „lustigen und geselligen“ Lebens.
Immer mehr Menschen betrachten Lebensmittel sehr bewusst als Nahrung, die sich auf Geist und Körper auswirkt, insbesondere diejenigen, die Sport treiben oder auf Schönheit Wert legen. Sie streben danach, ihre Leistung und ihr Aussehen durch die Auswahl spezieller Zutaten zu optimieren, um dadurch ihre persönlichen Ziele zu erreichen.
Es ist gängige Praxis, dass „eine Einheits-Mahlzeit für alle“ eben nicht für alle funktioniert. Unterschiedliche Arbeitszeiten (oder Schulstundenpläne) stellen ein Hindernis für das gemeinsame Essen als Familie dar. Das tägliche Kochen zu Hause, um eine komplette Mahlzeit für die ganze Familie zuzubereiten, wird oft durch den Gang zur Kantine und durch Fertiggerichte ersetzt. Man mag das einerseits beklagen. Andererseits gibt diese Veränderung dem Einzelnen die volle Verantwortung, selbst zu entscheiden, wie er seinen Körper richtig ernährt. Essen hat die Kraft, unsere Leistungsfähigkeit anzukurbeln und unsere Stimmung zu beeinflussen – um es mit einem Slogan zu sagen: „Wir sind, was wir essen“.
Ernährungsbericht 2020 der DGE
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) ist eine unabhängige wissenschaftliche deutsche Fachgesellschaft in der Rechtsform eines gemeinnützigen eingetragenen Vereins.
Sie wurde 1953 gegründet und wird zu etwa 70 Prozent von Bund und Ländern über öffentliche Mittel finanziert. Die restlichen 30 Prozent werden durch eigene Einnahmen, Gebühren für Schriften und Medien, Beratungen und Lehrgänge sowie Mitgliedsbeiträge gedeckt.
Die Gesellschaft ist gemäß ihrer Satzung[1] dem Gemeinwohl und der Wissenschaft verpflichtet und verfolgt vor allem zwei Ziele: Förderung, Auswertung und Publikation ernährungswissenschaftlicher Forschung sowie Ernährungsberatung und -aufklärung im Dienste der Gesundheit der Bevölkerung.
Die DGE fördert die vollwertige Ernährung. Sie stellt Forschungsbedarf in ernährungsrelevanten Fragen fest, sammelt Ergebnisse, wertet sie aus und veröffentlicht diese. Die DGE gibt Empfehlungen, Leitlinien und Stellungnahmen anhand wissenschaftlicher Forschung heraus. Sie veranstaltet wissenschaftliche Tagungen, Seminare und Lehrgänge.[2]
Zu ihren Richtlinien gehören die zehn Regeln der DGE, die seit 1956 mehrfach überarbeitet und verändert wurden.
Erhebungen zur Ernährung in der Bevölkerung bieten eine wertvolle Möglichkeit, Datenbanken zum Lebensmittelkonsum in Deutschland aus der Sicht der Ernährungswissenschaft zu erstellen, auszuwerten und über die Jahre hinweg Trends zu analysieren. Der Ernährungsreport wird alle vier Jahre neu erstellt. Die Methodik der Erhebung – ein Fragenkatalog mit „Selbstbeantwortung“ – ist allerdings nicht ganz frei von Schwächen bzgl. der Objektivität der Antworten; dennoch sind diese von hoher Bedeutung.
Erkenntnisse des Ernährungsreports 2020 der DGE
Die Auswertung des Ernährungsreports 2020 der DGE ergibt folgende Kernaussagen:[3]
Aus Sicht der öffentlichen Gesundheit ist der erhöhte Gemüsekonsum und der geringere Konsum von Schweinefleisch und Alkohol
[gegenüber den Vorjahren]
positiv zu bewerten.
Ein Rückgang des Verzehrs von Obst, Getreideprodukten und frischen Kartoffeln, sowie ein erhöhter Verzehr von Käse, Rind-, Kalb- und Hühnerfleisch
[gegenüber den Vorjahren]
steht allerdings nicht im Einklang mit dem Ziel einer pflanzenbasierten Ernährung.
Um die ernährungsphysiologischen und hedonistischen Qualitäten in der Ernährung zu unterstützen und die Nachhaltigkeit für Gesundheit und Umwelt, die mit dem Verzehr verbunden sind, zu fördern, sollte der Schwerpunkt bei Produkten tierischen Ursprungs in dieser Produktgruppe von
Quantität
auf
Qualität
umgestellt werden.
Der Report bietet einen Überblick über die verfügbaren Metaanalysen zum Zeitpunkt der Erhebung und Bewertung der Daten zum Zusammenhang zwischen der Aufnahme verschiedener Lebensmittelgruppen (Gemüse, Obst, rotes und weißes Fleisch) und des Auftretens von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Schlaganfall und koronare Herzerkrankungen), Diabetes mellitus Typ 2, Darmkrebs, Brustkrebs und anderen Krebsarten.
Es wurde ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem höheren Verzehr von
Gemüse
und dem geringeren Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Schlaganfall und Herzkranzgefäße) und einem geringeren Risiko für Darmkrebs beobachtet.
Es konnte kein Zusammenhang festgestellt werden zwischen dem Verzehr von
Gemüse
und dem Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, und die meisten Metaanalysen ergaben keinen Zusammenhang mit Typ-2-Diabetes mellitus.
Es wurde ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem höheren Verzehr von
Obst
und dem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Schlaganfall und koronare Herzerkrankungen), sowie eines niedrigeren Brustkrebsrisikos beobachtet.
Dahingegen wurde kein eindeutiger Zusammenhang festgestellt zwischen dem Verzehr von
Obst
und dem Risiko für Typ-2-Diabetes mellitus und Darmkrebs.
Mit anderen Worten: Ein erhöhter Verzehr von Gemüse und Obst wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Diese Erkenntnisse bestätigen damit die aktuellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Gemüse- und Obstverzehr.
Die Mehrzahl der ausgewerteten Studien zeigte einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem stärkeren Konsum von rotem Fleisch, verarbeitetem Fleisch und Fleisch insgesamt und dem erhöhten Risiko der untersuchten Krankheiten.
Es wurde kein Zusammenhang zwischen dem Verbrauch von weißem (Geflügel-)Fleisch und den untersuchten Krankheiten beobachtet.
Daher unterstützen diese Ergebnisse die aktuellen Lebensmittelbasierten Ernährungsrichtlinien (FBDGs) der Deutschen Ernährungsgesellschaft.
Ernährung im Wandel der Zeit, Functional Food
Die Zeiten sind größtenteils vorbei, in denen die Familie ihre Mahlzeiten gemeinsam einnahm. Es waren die Zeiten, in denen es vorzugsweise das zu essen gab, was aus der Landwirtschaft „um die Ecke“ kam. Über die Zusammenhänge zwischen Ernährung, Gesundheit, und eventuell dem Altern (Lebenserwartung) machte man sich damals nicht viele Gedanken. Schwächeperioden, Gebrechen und Krankheiten wurden nicht mit Ernährungsgewohnheiten in Verbindung gebracht.
Das hat sich im Laufe der Zeit deutlich geändert. Heutzutage gibt es sehr unterschiedliche Haltungen zum Umgang mit der eigenen Ernährung:
Man versorgt sich vorwiegend „mit Kalorien“ – bis zur Sättigung, mit möglichst schnellem Genuss. Die körperlichen und gesundheitlichen Veränderungen werden „hingenommen“.
In der Grundeinstellung hat man ein „Gefühl“ davon, was sinnvoll wäre. Allerdings gibt man dem Genuss immer wieder mehr Raum zugunsten einer guten Figur. In der Folge versucht man die Anwendung verschiedener Diäten, auch wiederholt.
Man strebt nach einer Optimierung der körperlichen und gesundheitlichen Verfassung und informiert sich, was man besser machen kann, um leistungsfähiger und länger bei guter Gesundheit zu bleiben.
„Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein.“ (Hippokrates)
Vor diesem Hintergrund ist es äußerst sinnvoll,
auf den unauflösbaren Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit hinzuweisen,
die gesunde Wirkung von speziellen oder in besonderem Maße vielseitigen Inhaltsstoffen in bestimmten Lebensmittel(-gruppen) besonders herauszustellen und zu „bewerben“,
Forschung zu fördern, um den Stoffwechsel und die metabolischen Zusammenhänge in der Interaktion von Makro- und Mikronährstoffen, den körpereigenen Molekülen und der Kommunikation zwischen Darm-Blut-Hirn tiefer zu erfassen, und dadurch die Vorbeugung und die Heilung in Bezug auf Krankheiten mit wissenschaftlicher Erkenntnis zu stärken.
Der Preisträger des Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preises 2024, Dennis Kasper, hat auf genau diesem Gebiet eine bahnbrechende Forschungsarbeit geleistet, deren Ergebnisse in das vorliegende Buch eingeflossen sind.[4]
Functional Food
So begibt man sich auf die Suche nach Lebensmitteln, die besonders reich an geeigneten Molekülen für eine wertvolle, das Immunsystem stärkende Ernährung sind. Es gibt keine international vereinbarte Definition von Functional Food, aber die von mehreren Ländern erlassenen Vorschriften teilen die Annahme, dass Functional Food „die Fähigkeit besitzt, Wohlbefinden und Gesundheit über die grundlegenden Ernährungseigenschaften hinaus zu fördern“.[5]
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) legt fest, dass die Auswirkungen funktioneller Lebensmittel folgende Kriterien aufweisen müssen: „… entweder für eine Verbesserung des Gesundheitszustands und des Wohlbefindens und/oder eine Verringerung des Krankheitsrisikos relevant sind. [. . . ] und sie müssen ihre Wirkung in Mengen nachweisen, mit denen normalerweise zu rechnen ist, dass sie mit der Nahrung aufgenommen werden“.[6] Hingegen spezifizieren Experten des Functional Food Center in den USA dahingehend, dass aktive Lebensmittelverbindungen „… einen klinisch nachgewiesenen und dokumentierten Nutzen für die Gesundheit bieten unter Verwendung spezifischer Biomarker zur Vorbeugung oder Behandlung chronischer Krankheiten oder ihrer Symptome“.[7]
Über diese Definitionen hinaus besteht ein gemeinsames Konzept darin, dass ein funktionelles Lebensmittel Verbindungen enthalten muss, die für die menschliche Ernährung als nicht wesentlich gelten, aber dennoch in der Lage sind, Stoffwechselprozesse und Zellfunktionen positiv zu modulieren sowie vor schädlichen Veränderungen des Wohlbefindens zu schützen. Letzteres kann mit dem altersbedingten Funktionsverfall oder sogar mit tatsächlichen pathologischen Zuständen in Zusammenhang stehen.
Darüber hinaus könnten einige in funktionellen Lebensmitteln vorkommende Verbindungen in eine weitere funktionelle Kategorie mit relativ neuer und ziemlich unsicherer Definition aufgenommen werden, nämlich nutrazeutische Verbindungen. Dieser Begriff impliziert eine biologische Aktivität, die zwischen der eines Nährstoffs und der eines Arzneimittels liegt. Die hierzu vorgeschlagenen Definitionen basieren wiederum auf der Wirksamkeit der Vorbeugung oder Behandlung von Pathologien oder Stoffwechselstörungen.[8] Die erhebliche Überschneidung mit der Definition von Functional Food ist offensichtlich, und diese „Nutraceuticals“ müssen nicht unbedingt Lebensmittel oder Teile davon sein. Im Allgemeinen werden „Nutraceuticals“ als ein oder mehrere natürliche Nährstoffe in Pulver- oder Tablettenform angeboten, ähneln also typischen Arzneimittelzubereitungen, fallen jedoch nicht in diese Kategorie.[9] Das ist insofern erwähnenswert, als sie keiner spezifischen Zulassung unterliegen.
Die Konzepte, die diesen Definitionen zugrunde liegen und oft von kommerziellen Überlegungen beeinflusst werden, sind nicht wirklich neu, da sie bereits implizit von verschiedenen Formen der traditionellen oder alternativen Medizin eingeführt wurden – wie beispielsweise der traditionellen chinesischen Medizin, der indischen ayurvedischen Medizin oder für einige Aspekte der homöopathischen Medizin.[10]
Der interessanteste Punkt dieser Konzepte, der über die impliziten Interpretationen vieler Definitionen hinausgeht, beruht auf einem neuartigen Ansatz für die Wechselwirkung zwischen Ernährung, Stoffwechsel und Gesundheitszustand. Das immer tiefere Verständnis der Wirkmechanismen biologisch aktiver Substanzen wie Polyphenole, Carotinoide, mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren (PUFAs), Polysaccharide, Alkaloide usw. hat die Suche nach neuen Quellen für Verbindungen gefördert – seien sie natürlichen oder synthetischen (chemischen ) Ursprungs.
Funktionelle Lebensmittel unterscheiden sich von originärem „Superfood“ durch ihre industrielle Herstellung und somit durch ihre synthetische Kombination.
Superfood
Der Begriff „Superfood“ wird seit einigen Jahren immer häufiger verwendet. Allerdings gibt es keine rechtlich verbindliche Definition. Im Allgemeinen werden mit „Superfood“ natürliche Lebensmittel bezeichnet, die einen besonders hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und/oder sekundären Pflanzenstoffen aufweisen.
War dieses Superfood ursprünglich überwiegend exotischer Natur, so werden mehr und mehr heimische Lebensmittel mit einbezogen. Die Angebotspalette reicht von der Frucht, beziehungsweise Pflanze als solche über getrocknete Produkte und Saft bis hin zu Extrakten und Pulvern aus diesen Pflanzen. Auch Lebensmittel, denen (kleine) Anteile von Superfood beigemischt werden, wie Müsli, Brot oder Smoothies, werben zusätzlich mit diesem Begriff.
Gemeinsam ist allen Superfoods, dass ihnen besondere gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben werden. Wissenschaftliche Beweise für diese Eigenschaften gibt es jedoch kaum.
Essen und Leistungskraft
Wenn es um Leistungskraft geht, stellen Sie sich Ihren Körper wie ein Auto mit Verbrennungsmotor vor: Sie achten darauf, den richtigen Kraftstoff bzw. ausreichend Wasser hineinzufüllen, beobachten den Ölstand und wechseln dieses regelmäßig. Vor einer längeren Fahrt wird eine Kontrolle durchgeführt, im Winter werden dem Kraftstoff und dem Wasser Additive zugesetzt, um ein Einfrieren zu verhindern.
Auf diese Weise wird Ihr Auto mit Verbrennungsmotor die bestmögliche Leistung erbringen.
Wann haben Sie das letzte Mal über Ihren Energiebedarf im Laufe des Tages nachgedacht? Wie oft kommt es vor, dass der Energiebedarf mit den Tagen schwankt? Wie haben Sie sich darauf vorbereitet bzw. wie haben Sie reagiert, als Ihnen die Kraft fehlte oder die Konzentration?
Eine gute geistige Leistungsfähigkeit bedeutet nicht nur „starke Konzentrationsfähigkeit“, sondern auch eine starke und belastbare „Kraft“ in Bezug auf eine stabile Stimmungslage und geistige Ausgeglichenheit.
Eine gute körperliche Leistungsfähigkeit bedeutet nicht nur, stark genug für eine bestimmte Aktivität zu sein (um Kraft auszuüben), sondern auch, dass Ihr Körper gesund genug ist, um Angriffen durch Bakterien oder Viren standzuhalten, und resistent genug ist, um gegenüber sogenannten „nicht-übertragbaren Krankheiten“ wie Herz-Kreislauf- oder neurologischen Krankheiten sowie auch einigen Krebsarten gewappnet zu sein.
Entwickeln und erhalten Sie die Struktur Ihrer Muskulatur auch mit zunehmendem Alter?
Wissen Sie, welche besonderen Inhaltsstoffe Ihr Körper mit dem Alter besonders benötigt?
Das richtige Essen bestimmt Ihre Leistung. Es kommt auf die Art der Nahrung an, darauf, wann Sie tagsüber essen, und darauf, wie Ihre Mahlzeit zusammengesetzt ist. Naschen Sie, oder nehmen Sie sich Zeit für geregeltes Essen? Setzen Sie sich hin und genießen Sie Ihr Essen – auch das spielt eine Rolle.
Wie hängt „Leistung“ in den unterschiedlichen Bedeutungen mit der Ernährung und damit der täglichen Nahrungsauswahl zusammen?
Untersuchen wir im nächsten Kapitel die Auswirkungen unserer Ernährung auf das Gehirn.
Versorgung des Gehirns, Sättigung
In diesem Kapitel geht es darum, den Zusammenhang zwischen Essen, Versorgung des Gehirns und Sättigungsgefühl sowie der Energiedichte der Nahrung zu erklären.
Was Ihr Gehirn für Höchstleistungen benötigt
Stimmungen wie etwa Angstzustände oder Depressionen sind bis zu einem gewissen Grad das Ergebnis der Funktionsweise Ihres Gehirns. Wie Ihr Gehirn funktioniert, hängt von der Vielfalt der Mikronährstoffe ab, die Sie tagsüber zu sich nehmen.
Das Gewicht des dehydrierten Gehirns stammt hauptsächlich aus Fetten und Lipiden. Die restliche Gehirnmasse besteht aus Proteinen und Aminosäuren, Spuren von Mikronährstoffen und Glukose.
Jeder Bestandteil Ihrer Ernährung hat eine spezifische Funktion und damit einen deutlichen Einfluss auf Funktion und Entwicklung des Gehirns, auf Stimmungslage und Energieniveau. Beispielsweise können Schlafstörungen ebenso wie Angstzustände oder Depressionen schlichtweg auf die Nahrung zurückzuführen sein, die Sie tagsüber zu sich genommen haben.
Die wichtigsten Mikronährstoffe, die Ihr Gehirn benötigt, sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren Omega3 und Omega6 als essenzielle Fettsäuren. Sie stammen aus unserer Ernährung und beugen degenerativen Erkrankungen des Gehirns vor. Sie stammen aus Nüssen, Samen und Fisch, bilden die Zellmembranen aus und erhalten diese.
Proteine und Aminosäuren sind die Bausteine für die Entwicklung unserer Gehirnzellen und bestimmen, wie wir uns fühlen und verhalten. Die Aminosäuren enthalten die Vorläufer von Neurotransmittern, den chemischen Botenstoffen, die die Signale zwischen Neuronen übertragen, und die sich auf unsere Stimmung, unseren Schlaf, unsere Aufmerksamkeit – und unser Gewicht – auswirken.
Die Kombinationen von Nahrungsnährstoffen sind komplex und stimulieren die Gehirnzellfunktionen, um stimmungsverändernde Hormone wie Noradrenalin, Dopamin und Serotonin freizusetzen.[11]
Für Aminosäuren ist es jedoch schwierig, zu den Gehirnzellen zu gelangen, und sie müssen um einen begrenzten Zugang konkurrieren. Aus diesem Grund ist eine abwechslungsreiche Ernährung wichtig für eine ausgewogene Kombination der Gehirnbotenstoffe. Dies verhindert, dass Ihre Stimmung von einer Richtung in die andere schwankt. Darüber hinaus profitiert das Gehirn, wie auch andere Organe unseres Körpers, von einer stetigen Versorgung mit Mikronährstoffen.
Antioxidantien in Obst und Gemüse stärken das Gehirn bei der Bekämpfung freier Radikale, die Gehirnzellen zerstören, und sorgen dafür, dass Ihr Gehirn über einen längeren Zeitraum gut funktioniert. Darüber hinaus wäre unser Gehirn ohne die essenziellen Vitamine B6, B12 und Folsäure nicht stark genug, um Hirnkrankheiten und geistigem Verfall zu widerstehen. Die Aufnahme von Spurenelementen wie Eisen, Zink, Kupfer und Natrium ist ebenfalls wichtig für die Gesundheit des Gehirns und die kognitive Entwicklung insgesamt.[12]
Um diese Mikronährstoffe umzuwandeln und zu synthetisieren, braucht es Treibstoff – und zwar viel davon.
Obwohl das Gehirn nur zwei Prozent unseres Körpergewichts ausmacht, verbraucht es etwa 20 Prozent unserer Energieressourcen. Der Großteil dieser Energie stammt aus Kohlenhydraten, die unser Körper in Glukose oder Blutzucker verarbeitet. Hafer, Getreide und Hülsenfrüchte weisen eine langsamere Glukosefreisetzung auf als Weißbrot und ermöglichen eine gleichmäßigere Aufmerksamkeit.
Die Vorderlappen des Gehirns reagieren sehr empfindlich auf einen Rückgang der Glukose, sodass eine Abnahme der geistigen Funktion eines der Hauptsignale für einen Nährstoffmangel ist.
Die Blut-Hirn-Schranke (Blood-Brain-Barrier)
Eine gesunde, ordnungsgemäß funktionierende Blut-Hirn-Schranke ist für eine optimale Gehirn- und Geistesgesundheit von entscheidender Bedeutung.
Die Blut-Hirn-Schranke ist wie ein Schutzschild, der das Gehirn umgibt. Sie fungiert als „Torwächter“ und Filter, so dass nützliche Nährstoffe in das Gehirn gelangen und unerwünschte Moleküle aus dem Gehirn ferngehalten werden.
Dieses Schutzschild verhindert, dass schädliche Substanzen in Ihr Gehirn gelangen und zu Gehirnentzündungen beitragen, die nachweislich kognitive Probleme und psychische Erkrankungen verursachen.
Eine hohe Durchlässigkeit („Hyperpermeabilität“) der Blut-Hirn-Schranke und Neuroinflammation werden mit einer Reihe verschiedener Probleme und Symptome der Gehirn- und psychischen Gesundheit in Verbindung gebracht.[13, 14, 15]
Ein Mangel an Vitamin B1 (Thiamin) stört die Blut-Hirn-Schranke, wohingegen eine ausgewogene Ernährung mit Mikronährstoffen ihre Integrität wieder herstellt.[16, 17] Forscher haben außerdem herausgefunden, dass die Vitamine B12, B6 und B9 (Folat) die Integrität der Blut-Hirn-Schranke bei Erwachsenen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung und erhöhtem Homocystein wiederherstellen können.[18]
Psychologie beeinflusst die Lebensmittelauswahl
Überlegen Sie sich einmal, wie Sie die folgenden Fragen beantworten:
Greifen Sie zu süßen oder kalorienreichen Lebensmitteln, wenn Sie viel zu tun haben?
Nutzen Sie Essen als „Leckerbissen“ nach einem stressigen Tag?
Verwenden Sie einen Slogan, um sich zu gesunden Entscheidungen zu ermutigen!
Sind Sie überzeugt: „Ich entscheide mich für eine gesunde Ernährung“?
Beachten Sie beim Einkaufen „Regenbogenfarbenes Essen ist gut für mich“?
Leben Sie gemäß „Ich bin ein Mensch, der für sich selbst sorgt, indem er sich gut ernährt“?
Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Schlaf bekommen?
Schlaf beeinflusst Ihre Entscheidungen – Schlafmangel kann das Verlangen nach Süßem und Salzigem um bis zu 40 Prozent steigern.
[
598
]
Sättigungsgefühl, Energiedichte von Lebensmitteln
Das Essverhalten wird durch die Wirkung von Peptidhormonen gesteuert, die vom Darm und vom Hypothalamus freigesetzt werden. Bevor die eigentliche Nahrungsaufnahme beginnt, wird das Nahrungsverhalten durch eine erhöhte Ausschüttung des „Hungerhormons“ Ghrelin durch den Magen stimuliert.[597] Dies geschieht im Einklang mit der Kopfphase der Nahrungsaufnahme, die durch Signale der Nahrungserwartung sowie durch Sehen, Riechen, Schmecken und Mundempfindungen der Nahrung eingeleitet wird.[346]
Essen Sie sich mit den richtigen Lebensmitteln satt.
Dabei ist weniger der reine Kaloriengehalt entscheidend als vielmehr die Energiedichte. Damit ist die Anzahl der Kalorien pro Gewichtseinheit gemeint.
Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Wasser und Ballaststoffen haben in der Regel eine niedrige Energiedichte. Eine hohe Dichte an Energie haben dagegen Produkte, die viel Zucker, Fett und Stärke enthalten.
Die Energiedichte gibt an, wie viele Kilokalorien ein Gramm eines Lebensmittels enthalten. Sie wird berechnet, indem der Kaloriengehalt einer bestimmten Menge eines Lebensmittels durch sein Gewicht geteilt wird.
Ein Gramm Apfel enthält 0,5 kcal. Ein Gramm Croissant hingegen hat 5,1 kcal, also die zehnfache Energiedichte. Erkennen Sie den „Trick“? Sie „dürfen“ für die gleichen „Kalorien“ mehr (Menge, Volumen) essen und werden satter, wenn Sie bei Ihrer Nahrungsauswahl auf die Energiedichte achten. In diesem Fall: Sie dürfen zehn Äpfel essen für die gleiche Kalorienmenge eines Croissants.
Tatsächlich wurde in Studien und Laborexperimenten bewiesen, dass die treibende Kraft für die Sättigung die Gesamtmenge an verzehrter Nahrung ist – und nicht die zugeführte Energie. So sättigt zum Beispiel ein großer Teller Gemüsesuppe besser und nachhaltiger als eine Handvoll Kartoffelchips, die weitaus mehr Kalorien enthalten.[19]
Die treibende Kraft für die Sättigung ist die Gesamtmenge an verzehrter Nahrung – und nicht die zugeführte Energie.
Lebensmittel mit niedriger Energiedichte (unter 1,5 kcal/g)
Obst, Gemüse, Salat, Kartoffeln, mageres Fleisch wie Hühnerbrust oder Rinderfilet, fettarme Milch und Milchprodukte wie Joghurt, Quark, oder Buttermilch. Achtung: Mit steigendem Fettgehalt steigt auch die Energiedichte. Eine Avocado fällt ebenso wenig in diese Kategorie wie ein Camembert oder Sahnejoghurt.
Lebensmittel mit mittlerer Energiedichte (1,5 bis 2,5 kcal/g)
Getreideprodukte wie Brot, Brötchen, Müsli, Nudeln, Reis, Linsen, Fleisch.
Lebensmittel mit hoher Energiedichte (über 2,5 kcal/g)
Wurst, Käse, Butter, Schlagsahne, Öl, Nüsse, Kuchen, Croissant, Kekse, Schokolade und andere Süßigkeiten, Knabbergebäck, Chips, Pommes Frites. Generell fallen Fastfood und stark verarbeitete Lebensmittel in diese Kategorie.
Ein gesunder Erwachsener, der sich nur moderat bewegt, benötigt etwa 2.000 kcal am Tag. Nach den aktuellen Ernährungsempfehlungen sollte sich seine Nahrung aus rund 250 g Kohlenhydraten (64%), 65 g Fett (17%) und bis zu 75 g Eiweiß (19%) zusammensetzen.
Der Zusammenhang zwischen sofortigem Sättigungsgefühl und Nährstoffspeichern ist komplexer. Dies liegt daran, dass das Essverhalten zwischen akuten und chronischen Regulierungssystemen liegt, die den unmittelbaren Bedarf an Substraten (z. B. Glukose) und die langfristige Aufrechterhaltung der Energiespeicher des Körpers sicherstellen. Die psychologischen Aspekte sind komplex und Gegenstand weiterer Untersuchungen. Das System weist insgesamt eine enorme Anpassungsfähigkeit auf, teilweise aufgrund der Duplizierung von Aktionen durch verschiedene Hormone, und teilweise, weil Hormone die Wirkungsempfindlichkeit anderer neuronaler und hormoneller Bahnen modulieren.
Essen und Altern, Zellerneuerung
Der Traum der Langlebigkeit fasziniert die Menschen seit jeher. Hinter dieser Phantasie steckt oftmals im Grunde der Wunsch nach Gesundheit bis ins hohe Alter.
Älter werden und dabei gesund bleiben – das ist nicht unmöglich. Weltweit erforschen Wissenschaftler, welche Faktoren den Alterungsprozess aufhalten. Neue wissenschaftliche Studien kommen zu erstaunlichen Ergebnissen. Wer seinen Lebenswandel entsprechend anpasse, kann demnach über zehn Jahre gesunde Lebenszeit hinzugewinnen.[20]
Es ist nicht ganz klar, ob es an den besseren Lebens- und Hygienebedingungen in modernen Gesellschaften liegt, aber sicher ist, dass dem Lebensstil eine enorme Bedeutung zukommt. Eine Gruppe von norwegischen Forschern hat herausgefunden, dass bei optimaler Ernährung eine Lebensverlängerung von zehn bis 13 Jahren möglich ist. Aus zahlreichen tierexperimentellen Forschungen ist bekannt, dass man durch eine verringerte Nahrungsaufnahme oder wiederholtes Fasten sein Leben zusätzlich verlängern kann.[21]
Wir sprechen dabei über gesundes Leben. Ein Siechtum möchte niemand verlängern. Offenbar ist entscheidend, die Umstellung zwischen zwei biologischen Programmen optimal einzustellen, wie nachfolgend erklärt.
Zum einen will die Natur, dass wir wachsen und uns fortpflanzen. Dieses Programm macht uns stark, aber nicht langlebig.
Zum anderen gibt es bei sparsamer, aber guter Ernährung in Kombination mit wenig Stress und einer guten Lebensbalance ein Erhaltungsprogramm, das uns gesund alt werden lassen kann.
Grundsätzlich muss die Zelle nicht zu einem festgelegten Zeitpunkt sterben. Es gibt Quallen-Arten, die Tausende Jahre leben.[22] Warum die Natur ausgerechnet bei uns (derzeit) im Schnitt 80 Jahre eingestellt hat, weiß niemand. Es stellt sich unweigerlich die Frage: Sollte es ein Lebensziel sein, viel älter zu werden – und wenn ja, wie? Alle wollen alt werden, aber niemand will alt sein, weil der Mensch das Alter auch mit einer Abnahme der Lebensqualität und weniger Autonomie in Verbindung bringt.
Vier Grundsätze zum gesunden Älterwerden
Wichtig sind diese vier Grundsäulen:
Über die Ernährung kann man viele Alterungsprozesse positiv beeinflussen. Fasten ist immer noch der wichtigste Faktor, Sport dagegen nicht in dem Maße, wie es die Wissenschaft bisher immer vermutet hatte.
Natürlich ist regelmäßige Bewegung für die Gesundheit und Fitness wichtig, aber für die Lebensverlängerung eben nicht so effektiv wie eine gesunde Ernährungsweise und temporärer Essensverzicht.
Darüber hinaus spielen Temperaturreize nachweislich eine Rolle. Der menschliche Körper sollte sich mit Kälte und Hitzereizen auseinandersetzen: Kältekammern, kaltes Duschen oder Saunagänge.
Weiterhin gibt es neue Erkenntnisse über die enorme Wirkung von erholsamem Schlaf.
[
23
]
Wenn man konsequent fastet, kann man die meisten körperlichen Aspekte der Alterung verbessern bzw. verjüngen: erhöhten Blutdruck und Blutzucker senken, sowie Bauchfett und Entzündungen reduzieren. Nachgewiesen ist auch, dass Fasten die Stammzellen-Neubildung und die Zellreinigung (Autophagie) ankurbelt, also Alterungsprozesse in den Zellen nachweislich bremst.
Die Wissenschaft hat in den vergangenen Jahren entscheidende molekulare Signalwege, die für den Alterungsvorgang hauptverantwortlich sind, identifiziert. Die menschliche Zelle ist ein riesiges Steuerungs-Kommunikations-System. Es gibt ein paar wenige Hauptmechanismen, die dafür sorgen, dass beispielsweise defekte DNS-Abschnitte und alte Proteine repariert werden, Zellen sich reinigen und Zellorganellen wie Mitochondrien sich neu bilden.
Schutzstoffe der Pflanzen Resveratrol, Quercetin, Sulforafan
Viele der Stoffe, die den menschlichen Alterungsprozess aufhalten sollen, kommen aus der Natur. Die meisten dieser Substanzen sind Schutzstoffe der Pflanzen. Wenn man über den Schutzstoff bei Weintrauben oder Rotwein redet, also über Resveratrol, dann steckt dieses in der Traubenschale. In der Apfelschale ist es beispielsweise Quercetin, beim Brokkoli das Sulforafan, bei Blaubeeren die Anthocyane. Weil die Pflanze nicht weglaufen kann, muss sie sich gegen schädliche Einflüsse wie Insekten, Pilzbefall oder UV-Licht schützen, indem sie möglichst viele Schutzstoffe in ihre äußere Hülle und dicht darunter konzentriert. Diese Stoffe sind nachweislich Aktivierer der Schutz- und Reparaturstoffe in unseren Zellen. Das ist im Übrigen ein entscheidender Vorteil von Bio-Gemüse und Obst.
Dadurch, dass Bio-Gemüse nicht synthetisch gedüngt wird, wächst es langsamer; und da keine Pestizide ausgebracht werden, muss die Pflanze die eigene Abwehr verstärken. Die Pflanze hat mehr Stress und bildet folglich mehr Schutzstoffe.
Darüber hinaus sind die grundlagenwissenschaftlichen Daten einiger Schutzstoffe wie Spermidin, Metformin, Glukosamin, Fisetin in diesem Zusammenhang durchaus bedeutsam.[24, 25, 26]
Ausgeschlafene Menschen altern langsamer
Zwei Faktoren sind beim Schlaf überwiegend genetisch bedingt: Die Schlafdauer und der sogenannte Chronotyp, also ob man Frühaufsteher oder Nachteule ist.
Die Faustregel lautet: Man sollte versuchen, zumindest an den meisten Tagen der Woche, seinem Biorhythmus entsprechend ausgeschlafen zu sein. Denn im Schlaf reinigen sich die Gehirnzellen; dafür sorgt das glymphatische System, das aus Zellen besteht, welche die eigentlichen Nervenzellen umgeben. Diese schrumpfen im Schlaf und geben dabei unbrauchbare Zellen und Proteine ab, die durch das glymphatische System abtransportiert werden. Diese Reinigungsfunktion des Gehirns muss in Ruhe seiner Arbeit nachgehen können. Im Prinzip gilt: Man hat zu kurz geschlafen, wenn man zum Aufstehen einen Wecker braucht.
Das bedeutet im Umkehrschluss: Man kann guten Gewissens sofort aufstehen, wenn man morgens von allein aufwacht: Wenn man sich zum Beispiel für 7.30 Uhr einen Wecker gestellt hatte und eine Stunde vorher spontan aufwacht, dann ist es ratsam, gleich aufzustehen. Die Tiefschlafphasen sind am frühen Morgen in der Regel ohnehin vorüber. Wichtig ist, dass man weiß, wie viel Schlaf man ungefähr braucht und sich diese Zeit ohne Wecker auch zugesteht.
Schlaf ist nebenbei noch erholsamer und für die Gehirnzellen schützender, wenn man am Abend früher ins Bett geht. Wenn es draußen dunkel wird, schüttet der Körper das Hormon Melatonin aus. Vor allem die ersten Stunden nach dem Einschlafen sind aus wissenschaftlicher Sicht besonders relevant für die Erholungsprozesse im Körper.[27]
Täglicher Stoffwechselrhythmus, „zirkadiane Uhr“
Die Darmmikrobiota induziert den täglichen Stoffwechselrhythmus und steuert die Lipidaufnahme durch das Darmmikrobiota-Enzym Histon-Deacetylase (HDAC3).[358]
Die zirkadiane Rhythmik ist ein bestimmendes Merkmal des Stoffwechsels von Säugetieren, das die Expression der zellulären Stoffwechselmaschinerie mit den Lichtzyklen der Umgebung koordiniert. Dieser Befund, dass die Darmmikrobiota die tägliche rhythmische Expression der Stoffwechselnetzwerke des Dünndarms programmiert, verdeutlicht die wesentliche Rolle der Mikrobiota bei der Regulierung des Wirtsstoffwechsels und weist darauf hin, dass das Mikrobiom, die zirkadiane Uhr und das Stoffwechselsystem der Säugetiere eng miteinander verbunden sind. Das epitheliale HDAC3 wurde als ein Schlüsselmechanismus identifiziert, der Eingaben aus der Mikrobiota und den zirkadianen Lichtzyklen integriert und diese Signale an metabolische Gene des Wirts weiterleitet. Die durch HDAC3 vermittelte Wechselwirkung zwischen Mikrobiota und zirkadianer Uhr reguliert die Lipidaufnahme im Darm und hat sich wahrscheinlich als Mechanismus zur Verbesserung der Effizienz der Lipidabsorption über die Nahrung entwickelt. Im Kontext einer fett- und zuckerreichen Ernährung nach westlichem Vorbild führt diese Wechselwirkung jedoch zu Fettleibigkeit und einer Verschlimmerung der Fettleibigkeit durch eine Störung der zirkadianen Uhr. Die Ergebnisse der hier zitierten Studie deuten auch darauf hin, dass eine Störung der Mikrobiota-Uhr-Interaktionen, beispielsweise durch eine Antibiotikabehandlung oder chronische zirkadiane Störungen (einschließlich Jetlag), Stoffwechselerkrankungen beim Menschen verschlimmern könnte.
Zur Erklärung:
HDAC3 vermittelt die Mikrobiota-abhängige Regulation im Darm. Epithel-intrinsisches HDAC3 ist zur Abwehr bakterieller Infektionen notwendig. HDAC3 steuert die epitheliale Zytokinvermittelte Aktivierung lokaler Immunzellen.
Ein zirkadianer Rhythmus bezeichnet z. B. die Schwankungen von Körperfunktionen, die durch exogene (Tag-Nacht-Wechsel) oder endogene Einflüsse (Hormone) gesteuert werden. Beispiele sind Schwankungen der Herzfrequenz, des Schlaf-Wach-Rhythmus, des Blutdrucks und der Körpertemperatur. Der Organismus ist fähig, derartige physiologische Vorgänge auf eine Periodenlänge von etwa 24 Stunden zu synchronisieren.[364]
Die Autophagie und ihre Rolle im Alterungsprozess
Der japanische Zellbiologe Yoshinori Ohsumi wurde 2016 für das erweiterte Verständnis der Autophagie mit dem Nobelpreis für Physiologie / Medizin ausgezeichnet.[28]
Ohsumi konnte erstmals nachweisen, dass Zellen den evolutionären Vorgang der Autophagie aktivieren, wenn sie „hungern“. Bei einer Kalorienrestriktion ab 14 oder mehr Stunden wird der sogenannte autophagische Prozess eingeleitet, bei dem beschädigte Zellorganellen von einer Membran überzogen und „verdaut“ werden. Dadurch erlangen vor allem gealterte Zellen nicht nur ihre vollständige Funktionsfähigkeit zurück, sondern der „Selbstverzehr“ produziert noch zusätzlich Energie, die dem Körper zur Verfügung steht. So können gealterte Zellen, die faktisch am Ende ihres Lebenszyklus stehen, den bevorstehenden Zelltod durch dieses „Recycling-Programm“ hinauszögern, indem die ganzheitliche Funktionalität wiederhergestellt wird.
Diese Erkenntnisse fanden vor allem in der Alterungsforschung Eingang und haben rasch zu einem völlig neuen Verständnis des menschlichen Alterungsprozesses beigetragen.[29, 30]
„Ich bin zutiefst berührt von dem Interesse, das der Autophagieforschung entgegengebracht wird, die für mich eine unglaubliche Reise in den letzten 28 Jahren darstellte. Es ist für mich als Grundlagenwissenschaftler die größte Freude und Ehre, wenn unsere Arbeit eine Entwicklung in Gang setzen konnte. … Unser Verständnis vom Leben. Ich erwarte mit großer Vorfreude die weitere Entwicklung des Fachgebiets in den kommenden Jahren.“ (Ohsumi)[31]
Der Weg zu den Erkenntnissen über Autophagie
Die mit dem Nobelpreis honorierten Experimente begann Ohsumi Ende der 1980er Jahre. Damals war bekannt, dass die Zellen aller Organismen ein Organell enthalten, das zur Verdauung von Zellinhalten in der Lage ist und als Lysosom bezeichnet wird. Sein Entdecker, der belgische Wissenschaftler Christian de Duve, hatte 1974 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten. Den Selbstverdauungsprozess der Zellen bezeichnet de Duve als Autophagie nach den altgriechischen Wörtern für selbst (autos) und fressen (phagein).[32]
Damals war bekannt, dass die Lysosomen Enzyme enthalten, mit denen sie Kohlenhydrate, Fette und Proteine zerlegen können. Die Endprodukte stehen dann für die Energiegewinnung oder als Bausteine für neue Zellstrukturen zur Verfügung, weshalb die Autophagie besser als Zellrecycling bezeichnet werden könnte. Die genauen Vorgänge bei der Autophagie und ihre Regulierung waren nicht bekannt. Die Forschung hatte lediglich herausgefunden, dass die zur Autophagie bestimmten Zellbestandteile zunächst von Zellmembranen umschlossen werden. Dabei kommt es zur Bildung eines Autophagosoms, das in der Zelle nur für zehn bis 20 Minuten existiert. Danach fusioniert es mit dem Lysosom, das die für die Autophagie verantwortlichen Enzyme enthält.





























