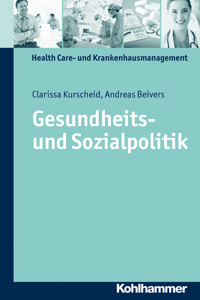
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Gesundheitspolitik hat sich in den letzten zwanzig Jahren als ein wichtiger Bestandteil der wirtschaftspolitischen Debatte etabliert. Nichtsdestotrotz lässt sich der Paradigmenwechsel der deutschen Sozialpolitik, der sich u.a. im Rückzug des Solidarprinzips in unserer Gesellschaft ausdrückt, auch im Gesundheitswesen beobachten. Dies führt zu Zielkonflikten und Problemfeldern in den einzelnen Bereichen der Leistungserbringung, Finanzierung wie auch der Versorgung. Die Autoren stellen die Entwicklung im Bereich der Gesundheits- und Sozialpolitik aus unterschiedlichen Perspektiven und die daraus resultierenden Allokations- und Distributionsfolgen detailliert dar und zeigen neue, zukunftsweisende Wege auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Health Care- und Krankenhaus-Management
Herausgegeben von Udo Janßen, Axel Olaf Kern, Clarissa Kurscheid, Thomas Schlegel, Birgit Vosseler und Winfried Zapp
Die geplanten und bereits erschienenen Bände in der Übersicht:
Modul I: Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik
• Gesundheitsökonomie
• Clarissa Kurscheid/Andreas Beivers:»Gesundheits- und Sozialpolitik«
Modul II: Betriebswirtschaftslehre und Management in stationären und ambulanten Gesundheitseinrichtungen
• Winfried Zapp/Julia Oswald/Uwe Bettig/Christine Fuchs:»Betriebswirtschaftliche Grundlagen im Krankenhaus«
• Logistik, IT, Facility Management und Services
• Rechnungswesen und Finanzierung
• Controlling und Reporting
• Personalwirtschaft
• Qualitäts- und Risikomanagement
• Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
Modul III: Gestaltung von Managementsystemen in Gesundheitseinrichtungen
• Normatives Management und Strategie
• Leadership und Führung
• Netzwerke und Strukturen
• Projektmanagement
Modul IV: Recht in der Gesundheitswirtschaft
• Unternehmensrecht im Krankenhaus
Clarissa KurscheidAndreas Beivers
Gesundheits- und Sozialpolitik
Verlag W. Kohlhammer
Wichtiger Hinweis
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
1. Auflage 2014
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Umschlagabbildung: © Yuri Arcurs – Fotolia.com, © istockphoto.com/Abel Mitja Varela,© BK – Fotolia.com, © michaeljung – Fotolia.com
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-022610-4
E-Book Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-023866-4
epub: ISBN 978-3-17-025962-1
mobi: ISBN 978-3-17-025963-8
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Geleitwort zur Reihe
Die Autorinnen und Autoren
1 Architektur des Buches
2 Gesundheits- und Sozialpolitik in Deutschland
Clarissa Kurscheid und Andreas Beivers
2.1 Die Ursprünge der Gesundheitspolitik und Sozialpolitik in Deutschland
2.2 Die Gesundheits- und Sozialpolitik seit Ende des Zweiten Weltkriegs
2.3 Strukturmerkmale der Gesundheits- und Sozialpolitik
2.4 Ausgaben- und Steuerungsprobleme am Beispiel der Gesundheitsversorgung
2.5 Sozialstaat zwischen Umbau und Reformen
2.5.1 Gestaltungsprinzipien für eine Wettbewerbsordnung
2.5.2 Die ordnungspolitische Konzeption für eine Neugestaltung
2.5.3 Privateigentum
2.5.4 Vertragsfreiheit und Wettbewerbsaufsicht
2.5.5 Wettbewerbliche Preissteuerung und Markttransparenz für die Nachfrager
2.5.6 Offener Marktzutritt für die Anbieter
2.5.7 Umsetzung des Sozialprinzips
2.5.8 Versicherungsfremde Leistungen
2.6 Blick auf die Probleme – Fazit und Ausblick
Fragen zum Text
Literatur
3 Gesundheitspolitik – Herausforderungen für die Zukunft
Eva-Marie Torhorst
3.1 Zusammenfassung
3.2 Einleitung
3.3 Problemfelder der Gesundheitsversorgung
3.3.1 Fehlanreize im Gesundheitswesen
3.3.2 Stationärer Bereich – Beispiel Total-Endoprothesen (TEP)
3.3.3 Fehlanreize im ambulanten Bereich
3.4 Auf zu neuen Ufern – Gesundheitspolitik am Steuer. Anreizgestaltung mit dem Fokus auf dem Patientennutzen
3.4.1 Qualitätstransparenz als Dreh- und Angelpunkt
3.4.2 Ebene der Versicherer
3.5 Gesundheitsfonds: morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich (morbi-RSA)
3.6 Wettbewerbsverzerrungen im Versicherungsmarkt – Zusammenführen von gesetzlicher (GKV) und privater Krankenversicherung (PKV)
3.7 Zusammenführung von SGBV und SGBXI
3.7.1 Ebene der Patientinnen und Patienten
3.7.2 Ebene der Leistungserbringer. Versorgungsintegration – Versorgungsbrüche an den Sektorengrenzen überwinden
3.7.3 Versorgungsintegration benötigt Vergütungsinnovation
3.8 Schlussfolgerung
Fragen zum Text
Literatur
4 Ethische Dilemmata im Gesundheitswesen
Lilia Waehlert
4.1 Problemstellung
4.2 Gründe für die Existenz ethischer Dilemmata aus philosophischer Sicht
4.2.1 Das ethische Fundamentalproblem
4.2.2 Individuelle Entscheidungsfreiheit und Opportunismus als Grundbedingung für ethische Dilemmata
4.3 Merkmale und Rahmenbedingungen des deutschen Gesundheitssystems und ihre Auswirkungen auf ethische Dilemmata
4.4 Lösungsansätze
4.5 Fazit
Fragen zum Text
Literatur
5 Qualität und Wettbewerb – Die guten Leistungserbringer müssen profitieren!
Stefan Weber
5.1 Vorbemerkung
5.2 Qualität und deren Messung
5.2.1 Qualitätsbegriff
5.2.2 Messbarkeit von Qualität – Qualitätsindikatoren
5.3 Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsprüfungen (Institutioneller Rahmen)
5.4 Qualität und Wettbewerb
5.4.1 Qualitätswettbewerb – Status Quo
5.4.2 Pay for Performance als Lösungsweg?
5.5 Rahmenbedingungen für Qualitätswettbewerb – Selektivverträge
5.5.1 Selektivvertragliche Regelungen
5.5.2 Verbesserungspotenziale bei den selektivvertraglichen Regelungen
5.6 Rahmenbedingungen für Qualitätswettbewerb: Verbindung von Regelversorgung (Kollektivvertragssystem) und Selektivverträgen
5.7 Die Rolle der Krankenkassen
Fragen zum Text
Literatur
6 Gesundheits- und Sozialpolitik aus Sicht der forschenden Arzneimittelindustrie
Roger Jaeckel und Philipp Zeitler
6.1 Einleitung: Marktregulierung als gesundheitspolitische Handlungsmaxime in der Arzneimittelversorgung
6.2 Arzneimittelsteuerung als ordnungspolitisches Prinzip staatlichen Handelns
6.3 Arzneimittelsteuerung in der gesetzlichen Krankenversicherung –- ein reformpolitischer Hort staatlicher Interventionen
6.4 Die Komplexität staatlichen Handelns am Beispiel des AMNOG
6.4.1 Ausgangssituation
6.4.2 Der Blick zurück: Kostenexplosion in der GKV?
6.4.3 Reformpolitische Zielsetzung und Instrumente
6.4.4 Wirkungsweise der AMNOG-Regulierungsinstrumente
6.4.5 Zwischenbilanz
6.5 Quo vadis Pharmaindustrie – Fazit und Ausblick
Fragen zum Text
Literatur
7 Gesundheits- und Sozialpolitik aus Sicht des ambulanten Sektors
Christof Minartz
7.1 Gesundheits- und Sozialpolitik als Rahmen für die ambulante ärztliche Versorgung
7.1.1 Vertragsärztliche Versorgung
7.1.2 Privatärztliche Versorgung
7.2 Einengung der Freiberuflichkeit in der ambulanten Versorgung durch die Gesundheitspolitik
7.3 Sektorale Abgrenzung der ambulanten Versorgung
7.4 Ambulante spezialfachärztliche Versorgung als neuer Weg der Gesundheitspolitik
7.5 Fazit und Ausblick
Fragen zum Text
Literatur
8 Ordnungspolitisches Spannungsfeld der deutschen Krankenhausversorgung am Beispiel der Mengensteuerung
Andreas Beivers
8.1 Zentrale Regulierungen der deutschen Krankenhausversorgung
8.2 Das DRG-Vergütungssystem
8.3 Mengendynamik im deutschen Krankenhausmarkt
8.4 Hat die klassische Angebotsfunktion auch im Krankenhausmarkt Gültigkeit?
8.5 Versagen des Preismechanismus und die Theorie der externen Effekte
8.6 Lösungsansätze zur Internalisierung der externen Effekte
8.6.1 Lösungen mit staatlicher Einflussnahme
8.6.2 Private Lösungen bei externen Effekten
8.7 Ausblick
Fragen zum Text
Literatur
9 Europäisierung der Gesundheits- und Sozialpolitik
Remi Maier-Rigaud, Michael Sauer und Frank Schulz-Nieswandt
9.1 Einleitung
9.1.1 Dimensionen einer »Europäisierung« der Gesundheits- und Sozialpolitik
9.1.2 Sozialmodell-Denken
9.1.3 Das Mehr-Ebenen-System des Verfassungsvertragsverbundes
9.1.4 Die Emergenz der geteilten Kompetenz
9.1.5 Reine und unreine Gewährleistungsstaatlichkeit
9.1.6 Der Algorithmus des Beihilferegimes
9.1.7 Erosionen an allen Ecken
9.1.8 Offene Zukunft, erkennbare Konturen
9.2 Grundrechte
9.3 DA(W)I
9.3.1 Differenz von DAI und DA(W)I?
9.3.2 Differente Verständnisse von Marktversagen
9.3.3 Hybridizitäten und Ambivalenzen
9.3.4 Quasi-Märkte: Regulierter Privatisierungs-Liberalismus
9.4 Verbraucherschutz
9.4.1 Entstehung und Aufgaben der Europäischen Verbraucherpolitik
9.4.2 Europäische Verbraucherpolitik zwischen Paternalismus und Lobbyismus anhand der Beispiele Regulierung des Tabakkonsums und Lebensmittelkennzeichnung
9.5 Offene Methode der Koordinierung
9.5.1 Steuerungslogik
9.5.2 Genese
9.5.3 Prozess
9.5.4 Mechanismen
9.5.5 Interpretation
9.6 Kohäsionspolitik
9.7 Fazit
Fragen zum Text
Literatur
Geleitwort zur Reihe
In der dynamisch wachsenden und zunehmend komplexer werdenden Gesundheitswirtschaft ist in den letzten Jahren der Bedarf stark gestiegen, Management bezogenes theoretisches Wissen und praxisrelevantes Know-how zu beherrschen und zu vermitteln. Dieser Bedarf spiegelt sich u. a. in zahlreichen neuen Hochschulstudiengängen und vielfältigen Angeboten der beruflichen Fort- und Weiterbildung wider.
Die Reihe »Health Care- und Krankenhaus-Management«, die auf den Curricula einschlägiger Hochschulen und wichtiger Fortbildungseinrichtungen aufbaut, setzt hier an. Inhaltlich und didaktisch systematisch angelegt, erhebt sie den Anspruch, das breite Themenfeld weitgehend vollständig abzudecken.
Die in 14 Bänden modular aufgebaute Reihe möchte allen Studierenden und Dozenten der auf das Management in der Gesundheitswirtschaft bezogenen Studiengänge, Berufstätigen in Fort- und Weiterbildung aus Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens und insbesondere (zukünftigen) Führungskräften und leitenden Mitarbeitern aus Ärztlichem Dienst, Medizin-Controlling, Pflegedienst, Marketing und Verwaltung ein hilfreiches Werkzeug für Studium und professionelle Praxis sein.
Die Herausgeberinnen und Herausgeber:
Udo Janßen, Axel Olaf Kern, Clarissa Kurscheid, Thomas Schlegel, Birgit Vosseler, Winfried Zapp.
Die Autorinnen und Autoren
Prof. Dr. rer. pol. Andreas Beivers
Als Studiendekan Leitung des Bachelorstudiengangs Health Economics und Studiengangsleiter des Master-Studiengangs »Management im Gesundheitswesen und Gesundheitsökonomie« an der Hochschule Fresenius in München. Nach seiner Tätigkeit als Bereichsleiter für stationäre Versorgung am Institut für Gesundheitsökonomik (IfG) Wechsel an die Hochschule Fresenius. Lehrauftrag an der Technischen Universität München (TUM) und Mitglied des Editorial Boards des Krankenhausreports des Wissenschaftlichen Instituts der AOK.
Dipl. Verwaltungswissenschaft, European Master in Social Security Roger Jaeckel
Leiter Gesundheitspolitik GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG.
Lehrbeauftragter der Hochschule Neu-Ulm im MBA-Studiengang »Betriebswirtschaft für Ärztinnen und Ärzte« mit den Themenschwerpunkten Arzneimittelpolitik und Internationalisierung des Gesundheitswesens am Beispiel der EU-Länder.
Prof. Dr. Clarissa Kurscheid
Clarissa Kurscheid ist Studiendekanin für den Bachelor- und Masterstudiengang Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fresenius Köln. Nach dem Studium der BWL und Gesundheitsökonomie promovierte sie am Seminar für Sozialpolitik der Universität Köln. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Versorgungsforschung, alternative Versorgungsformen, Integrationsversorgung, Organisation von Gesundheitsbetrieben, Kooperationen und Konflikte in Organisationen. Daneben ist Sie noch als Beraterin für Projekte mit integrativem Versorgungsansatz aktiv. So begleitet Sie u. a. die Stadt Zürich seit 2006 in der Fortentwicklung neuer Versorgungskonzepte.
Dr. rer. pol. Remi Maier-Rigaud
Akademischer Rat am Lehrstuhl für Sozialpolitik und Methoden der qualitativen Sozialforschung im Institut für Soziologie und Sozialpsychologie (ISS) an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Davor drei Jahre in der Task Force zur Untersuchung des pharmazeutischen Sektors und in der Antitrust-Abteilung für Arzneimittel und gesundheitsbezogene Märkte der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission in Brüssel.
Forschungsschwerpunkte: Verbraucherpolitik und Sozialpolitik (insbesondere im europäischen Kontext), Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemvergleich.
Dr. Christof Minartz
Berater im Gesundheitswesen und wissenschaftlicher Leiter der e:los Akademie.
Arbeitsschwerpunkte: Ambulante ärztliche und zahnärztliche Versorgung, Gesundheitsökonomische Evaluationen, Health Technology Assessment (HTA), Vergütungssysteme.
Dipl.-Pol.-Wiss. und Dipl. Betriebswirt (BA) Michael Sauer
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sozialpolitik und Methoden der qualitativen Sozialforschung im Institut für Soziologie und Sozialpsychologie (ISS) an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, Gastdozent an den Universitäten Sofia sowie Ljubljana und freiberuflich als Landeskundeexperte Südosteuropa tätig.
Forschungsschwerpunkte: Transnationale Fragen der Sozialpolitik, Entwicklung und Vergleich von Wohlfahrtsstaatenregimen in Südosteuropa, Arbeitsmarktpolitik, Langzeitpflege.
Univ.-Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt
Professur für Sozialpolitik und Methoden der qualitativen Sozialforschung im Institut für Soziologie und Sozialpsychologie (ISS), Honorarprofessor für Sozialökonomie der Pflege an der PTH Vallendar, Geschäftsführender Direktor des Seminars für Genossenschaften an der Universität zu Köln.
Arbeitsschwerpunkte: Anthropologie und Psychologie der Sozialpolitik und der Gegenseitigkeitshilfe, Dritter Sektor und Formen bürgerschaftlichen Engagements, Gesundheit, Pflege, Behinderung, Alter im Sozialraum, Europarecht und soziale Dienstleistungen/öffentliche Daseinsvorsorge, Methodologie der Habitushermeneutik und post-strukturale Logik qualitativer Sozialforschung.
Eva-Marie Torhorst (MBA)
Referentin für Gesundheitspolitik im Bayerischen Landtag.
Studiengangkoordinatorin Management im Gesundheitswesen der Hochschule für Ökonomie und Management (FOM) am Standort München.
Arbeitsschwerpunkte: Gesundheits- und Sozialpolitik, Integrierte Versorgung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Prozessbasierte Implementierungsstrategien für betriebliches Gesundheitsmanagement.
Prof. Dr. habil. Lilia Waehlert
Hochschule Fresenius, Fachbereich Wirtschaft und Medien.
Studiendekanin für Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fresenius in Idstein, Professorin für BWL und Gesundheitsökonomie.
Arbeitsschwerpunkte: Integrierte Patientenversorgung, Strategisches Krankenhausmanagement, Systemtheorie, Systemische Unternehmensführung und Organisation, Unternehmensethik.
Dr. jur. Stefan Weber
Aktuelle berufliche Tätigkeit und Arbeitsschwerpunkte:
Bereichsleiter Vertragspolitik und Versorgungsmanagement SBK – Siemens-Betriebskrankenkasse, mit denTätigkeitsschwerpunkten ambulante und stationäre Versorgung, Arznei- und Hilfsmittelmanagement sowie betriebliche Gesundheitsförderung.
Philipp Zeitler (MSc.)
Manager Gesundheitspolitik GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG.
Master of Science in Comparative Politics an der London School of Economics and Political Science, davor Hauptstudium im Diplomstudiengang Verwaltungswissenschaft in Potsdam.
1 Architektur des Buches
Gesundheits- und Sozialpolitik ist ein Thema, mit dem ein Politiker keine Wahl gewinnen kann. Ein Thema, das so vielschichtig ist wie kaum eines in der sozialen Sicherung. Ein Thema, welches wie kein anderes mit anderen Disziplinen verwoben ist und von vielen Seiten betrachtet werden kann. Ein Querschnittsthema, aber ein Thema mit extrem hoher Relevanz.
Gesundheits- und Sozialpolitik in Deutschland ist ein maßgeblicher Bereich unseres deutschen Sozialstaats. Gleichzeitig ist die Gesundheits- und Sozialpolitik von elementarer Bedeutung für die gesamte Bevölkerung eines Landes. Dieses Instrument schützt die Bürgerinnen und Bürger in Risikolagen und bietet die Grundlage für die gesunde Produktivität einer Volkswirtschaft.
Wir danken den Autoren der verschiedenen Artikel von ganzem Herzen, dass sie aus ihrer Perspektive sich dem Gesundheitswesen gewidmet haben und die verschiedenen Problemlagen in ihrem Bereich benennen. So ist ein vielschichtiges Werk entstanden, welches die Gesundheits- und Sozialpolitik vorstellt, Steuerungsprobleme benennt, Erfolge beleuchtet und Herausforderungen für die Zukunft aufzeigt.
In den ersten beiden Artikeln des Buches erfolgt zum einen eine temporäre Betrachtung der Gesundheitspolitik ausgehend von den Ursprüngen des 19. Jahrhunderts, und zum anderen geht der Blick über die letzten Reformen hinweg zu den großen ungelösten Problemen im Kontext des deutschen Sozialstaats. Typische Steuerungsprobleme der Gegenwart finden dabei genauso Erwähnung wie ein optionaler Blick in die Zukunft des Gesundheitswesens.
Eva-Marie Torhorst befasst sich in ihren Ausführungen u. a. mit der potenziellen Steigerung des Patientennutzens, aber auch mit dem Abbau möglicher Fehlsteuerungselemente sowie Fehlanreize, wie mit der nach wie vor bestehenden sektoralen Fragmentierung oder, wie sie es nennt, der zersplitterten Versorgungslandschaft. Dabei geht der Blick auf die Vernetzung der Akteure wie auch auf die Art und Weise der derzeitigen Versorgung mit ihren Stärken und Schwächen. Ihre Forderung konzentriert sich auf die Entwicklung systematischer Kooperationen, Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit sowie einer deutlich höheren Gesundheitskompetenz aller Beteiligten.
Lilia Waehlert schärft den Blick für eine gerechte Gesundheitsversorgung als das wesentliche Merkmal des Sozialstaats und diskutiert die Rahmenbedingungen einer gerechtigkeitsorientierten Gesundheitspolitik. Dabei widmet sie sich der Fragestellung, aus welchen Gründen ethische Dilemmata im Gesundheitswesen existieren und wie sich solche identifizierten Konflikte lösen lassen könnten.
Stefan Weber blickt aus seiner Perspektive der gesetzlichen Krankenversicherung unter besonderer Beachtung von Qualität und Wettbewerb auf das Gesundheitswesen und fokussiert hier insbesondere die Frage, wer in welchem Konkurrenzverhältnis zueinandersteht. Nachfolgend beleuchten Roger Jaeckel und Philipp Zeitler das Gesundheitswesen aus Sicht der forschenden Arzneimittelindustrie. Sie stellen die berechtigte Frage nach dem neuen Rollenverständnis der Arzneimittelindustrie. Nach einer theoretischen Einführung wird der Blick darauf gerichtet, wie sich die Pharmaindustrie in den nächsten Jahren aufstellen kann und sich möglichweise als Versorger konstituiert.
Andreas Beivers und Christof Minartz diskutieren aus der Sicht des ambulanten und stationären Sektors. Betrachtet Andreas Beivers die Krankenhausversorgung mehr aus ordnungspolitischer Sicht, geht Christof Minartz ausführlich auf die Strukturen der ambulanten Versorgung bis hin zu dem jungen Bereich der spezialärztlichen Versorgung ein.
Ein wesentlicher und immer relevanter werdender Aspekt wird von den Kollegen Remi Maier-Rigaud, Michael Sauer und Frank Schulz-Nieswandt diskutiert, die Europäisierung der Gesundheits- und Sozialpolitik. Sie zeigen in aller Ausführlichkeit die Nähe und Verknüpfungen, wie sie sich transnational durch die Entwicklungen in der EU darstellen, auf.
2 Gesundheits- und Sozialpolitik in Deutschland
Clarissa Kurscheid und Andreas Beivers
Im Folgenden sollen nun die Ursprünge der Gesundheits- und Sozialpolitik in Deutschland betrachtet werden. Dabei erfolgen zum einen eine temporäre Betrachtung des Gesundheitspolitik ausgehend von den Ursprüngen des 19. Jahrhunderts und zum anderen geht der Blick über die letzten Reformen hinweg zu den großen ungelösten Problemen im Kontext des deutschen Sozialstaats. Sozialpolitik wird inhaltlich als Querschnittsthematik betrachtet und ist per definitione eine »Intervention in Risikolagen« (Schulz-Nieswandt 2006). Gesundheitspolitik hingegen ist ein eigener Teil der Sozialpolitik und geht über die Intervention in Risikolagen hinaus, wenn beispielsweise Prävention als ein Teil von Gesundheitspolitik betrachtet wird. Bührlen u. a. gehen in ihren jüngsten Überlegungen davon aus, dass das Gesundheitswesen und die verantwortliche Politik Gesundheit als eine Wertschöpfung für die Gesellschaft betrachten sollte (Bührlen et al. 2013). Allein mit diesen Gedanken wird ein breiter Spannungsbogen aufgezeigt, der in den nachfolgenden Darstellungen keinen Anspruch auf eine vollständige Betrachtung erhebt, aber deutliche Blitzlichter setzt, Geschehnisse aus der Vergangenheit beleuchtet und vorsichtige Lösungsansätze für die Zukunft benennt.
2.1 Die Ursprünge der Gesundheitspolitik und Sozialpolitik in Deutschland
Die Gesundheits- und Sozialpolitik in Deutschland ist einerseits in hohem Maße von dem Sozialversicherungsprinzip Bismarck’scher Prägung beeinflusst und zeichnet sich andererseits durch eine starke, barmherzig geartete Fürsorge in der historischen Betrachtung aus. Dieser systemimmanente Leitgedanke spiegelt sich u. a. in dem im deutschen Sozialversicherungssystem tief verwurzelten Subsidiaritätsprinzip, aber auch im Solidaritätsgedanken wider (Schulz-Nieswandt 2006). Die Wurzeln der Subsidiarität liegen in der katholischen Soziallehre und basieren auf dem Gedanken der Nachrangigkeit, das bedeutet, dass die Lasten, die nicht vom Einzelnen übernommen werden können, im Bedarfsfall die Solidargemeinschaft mitträgt. Das Solidarprinzip hingegen ist eines der zentralen Sozialstaatsprinzipien und beinhaltet beispielsweise im Krankheitsfall, dass die Solidargemeinschaft sich gegenseitige Unterstützung leistet und Hilfe gewährt (Simon 2013).
Im Hinblick auf die Versorgung von Krankheit in Deutschland spielen zusätzlich enorme Errungenschaften herausragender Forscher (zu nennen sind Lorenz von Stein oder Robert Koch) eine große Rolle, auf die nachfolgend noch eingegangen werden soll. Bereits in Antike und Mittelalter gab es von Seiten des Staates mehrfach Versuche, die materielle Not der Bürger zu lindern (Simon 2013; Rosenbrock und Gerlinger 2009), um Unruhen und Aufstände zu verhindern und politische Stabilität zu wahren. Hierbei gilt es festzuhalten, dass eine Vielzahl geschichtlicher, religiöser und auch ökonomischer Parameter zu der Ausgestaltung der einzelnen Sozialstaaten in Deutschland und in Europa beigetragen haben (Kahl 2005; Butterwegge 2005), welche hier allerdings nicht näher beleuchtet werden.
Fürsorgeorientierte, christliche Krankenhäuser, welche noch im Mittelalter zum Teil aus Armenhäusern hervorgingen, waren in der stationären Versorgung verbreitet. Später – nach der Reformation – wurde die Krankenversorgung größtenteils kommunalisiert und es entwickelten sich immer mehr städtische Spitäler zur Versorgung kranker Menschen (Simon 2013). Hier wurden gerade in der Struktur der Leistungserbringung früh rollenbasierte Standards – wie beispielsweise die fürsorgliche Hingabe der »Schwester« und der schon früh auf ärztliche Technik fokussierte Mediziner gesetzt. Ansonsten waren die Häuser stark mit dem Anstaltswesen verhaftet, da es sich insbesondere um eine in sich geschlossene Fürsorge handelte. Es kann auch mit einer Mischung aus Versorgung und Verwahrung beschrieben werden. Allerdings bedeutete diese Form der gesellschaftlichen Trennung in erster Linie ein Schutz der anderen (gesunden) Menschen vor den Kranken. Zusätzlich herrschte ein hierarchisch orientierter, paternal geprägter Umgang der Mediziner und Pflegenden mit den Kranken (Foucault 2002 sowie 2005; Schulz-Nieswandt 2003).
Einen wichtigen Beitrag für die Gesundheitsfürsorge und darüber hinaus für die Entwicklung der sozialen Reformen in Deutschland leistete Lorenz von Stein (18. November 1815–23. September 1890). Von Stein entwickelt in seinen Schriften zur Gesellschaftspolitik (später nennt er sie auch Sozialpolitik) ein »ordnungspolitisches Verständnis«, welches in seinen Grundzügen auch heute noch der aktuellen Sicht entspricht. In diesem Sinne hat ein sozialer Staat nach der Auffassung von Lorenz von Stein die Pflicht, die Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter zu verbessern. Zu seiner Zeit standen hier insbesondere Fragen der Hygiene und der Gesundheit des Einzelnen im Vordergrund (Kaufmann 2003). Seine Motivation lag zudem in der Vermeidung möglicher Klassenkämpfe. Nach den Überlegungen von Steins war es notwendig, der nicht-herrschenden Klasse ein Minimum an sozialer Sicherheit, Gesundheitsfürsorge und Bildung zur Verfügung zu stellen (Grosseketteler 1998). Ein weiterer – im Hinblick auf die historische Betrachtung der Gesundheitsversorgung – wesentlich zu nennender Akteur ist Robert Koch (11. Dezember 1843–27. Mai 1910). Mit seiner Forschung als Bakteriologe hat er in der Gesundheitsvorsorge wesentlich zur Erkennung von Ansteckung und deren Verhinderung mittels hygienischer Maßnahmen beigetragen. Mit seiner Forschung als Mediziner und Mikrobiologe hatte er im hohen Maß Anteil daran, dass die Erreger der Tuberkulose, aber auch der Cholera entdeckt wurden.
Als Geburtsstunde des deutschen Sozialstaates heutiger Prägung können die in den Jahren 1881 bis 1888/89 gegründeten Zweige der Sozialversicherung durch die Bismarck-Administration bezeichnet werden, für die vornehmlich der sozialpolitische Gedanke prägend war. So wurde 1883 das Krankenversicherungsgesetz, 1884 das Unfallversicherungsgesetz und 1889 das Invaliden- und Altersversicherungsgesetz (später Rentenversicherung) eingeführt. Ziel war es vor allen Dingen, die industrielle Arbeitnehmerschaft, die sich mehr und mehr entwickelte, gegen die Risiken des Arbeitslebens abzusichern und so von den Gewerkschaften fernzuhalten. Um dies zu erreichen, stellten die damals führenden politischen Kräfte die solidarische Selbsthilfe in den Mittelpunkt. Damit war Deutschland weltweit wegweisend. Nicht der Staat selbst sollte die soziale Absicherung übernehmen, sondern die Betroffenen sollten sich durch solidarisches Zusammenschließen gegenseitig Hilfe gewähren. Damit entstand das Solidaritätsprinzip, das eng mit dem genossenschaftlichen Denken verwandt ist (Neubauer 2007; Butterwegge 2005).
Die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens und der Gesundheitsversorgung vollzog sich innerhalb des historischen Kontexts auf Basis der Standessicherung, wie sie zu Ende des 19. Jahrhunderts gelebt wurde. Ausgehend von dem Mitte des 19. Jahrhunderts bestehenden Hilfskassenwesen etablierte sich mit der Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung durch Bismarck 1883 die »Gesetzliche Krankenversicherung«. Mit der zunächst ausschließlichen Absicherung der Erwerbstätigen bei Krankheit wurde zu diesem Zeitpunkt das Gerüst des Gesundheitssystems gelegt, das in seinen Grundzügen bis in die Gegenwart Bestand hat (Lampert, 2007; Bäcker, Bispinck, Nägele, 2008). Die Leistungserbringung wurde bis zur Gründung der kassenärztlichen Vereinigung (1931) in Einzelverträgen verhandelt und erst nach 1931 auf Basis kollektivvertraglicher Vereinbarungen. Die Organisationsprinzipien basierten auf zunftähnlichen Strukturen, ausgehend von der Gründung der Kassen (1883), und die Finanzierung basierte aus Krankenkassenbeiträgen (Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein 2012). Insgesamt ist zu konstatieren, dass sich die Krankenversicherung durch das Solidaritätsprinzip, Bedarfsprinzip und den Aspekt der Umverteilung (Knappe et al 2002) auszeichnete. Das Solidaritätsprinzip ermöglicht die vom gesellschaftlichen Status des Einzelnen unabhängige Leistung der Krankenversicherung im Bedarfsfall. Daraus ergibt sich das Bedarfsprinzip, d. h. diese Bedarfe werden in Form von Sachleistungen gewährleistet. Die Genossenschaftsartigkeit ist durch den reziprozitären Charakter der gesetzlichen Krankenversicherung gekennzeichnet, welches sich mit dem Prinzip auf Gegenseitigkeit erklären lässt. Die Umverteilung erfolgt horizontal wie vertikal. Beispielhaft sei hier die beitragsfreie Familienmitversicherung sowie die Umverteilung von jung nach alt – im Hinblick auf das sich im Alter entwickelnde höhere Krankheitsrisiko mit einer in der posterwerbstätigen Phase verbundenen geringeren Beitragszahlung – zu nennen (Kurscheid und Hartweg 2009).
Aufgrund der geringen Mobilität in der Frühindustrialisierung war der Beitritt zu einer Solidargemeinschaft in der Regel eine lebenslange Entscheidung. Die solidarischen Gemeinschaften waren somit über eine Lebensspanne gedacht und in ihrer Zusammensetzung stabil. Der Staat seinerseits definierte die Versicherungspflicht der einzelnen Arbeitnehmer und wies sie in der Regel orientiert an den unterschiedlichen Branchen ganz bestimmten Solidargemeinschaften zu. Die Solidargemeinschaften ihrerseits waren gemeinnützig angelegt und verwalteten sich selbst. Die soziale Selbstverwaltung entstand und ist bis heute noch ein prägendes Element der deutschen Sozialversicherung (Neubauer 2007).
So ist festzuhalten, dass die Bismarckschen Sozialversicherungen deutscher Prägung bis zum Ersten Weltkrieg und auch danach Vorbild für viele Staaten waren und sind.
2.2 Die Gesundheits- und Sozialpolitik seit Ende des Zweiten Weltkriegs
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Aufbau der Bundesrepublik Deutschland als Soziale Marktwirtschaft nach dem Vorbild von Walter Eucken1, auf welchen später noch näher eingegangen wird, bestand auch unter den alliierten Siegermächten die Auffassung, dass neben dem Aufbau des Wirtschafts- und Rechtssystems auch der Aufbau einer umfassenden Sozialversicherung kommen sollte (Niehoff 2007). So wurde u. a. im Kontext der Krankenversicherung auf die Prinzipien der Bismarckschen Sozialversicherung zurückgegriffen und die Selbstverwaltung nach dem Vorbild der Weimarer Republik wiederhergestellt. In der Sozialpolitikgestaltung nach Ende des Zweiten Weltkriegs sind vor allem die ordnungspolitischen Ideen und Leitbilder kaum wegzudenken.
Somit erfährt in der weiteren historischen Betrachtung die Fortentwicklung der Sozialordnung große Beachtung. In dieser geht es um weitaus mehr, als um die Frage vom Einsatz sozialpolitischer Ziele. Die Sozialordnung ist ein Ausdruck einer zeitgemäßen politischen Anschauung, in der ethische, normative, aber auch weltanschauliche Grundlagen zusammenkommen und in praktischer Gesundheits- und Sozialpolitik niedergeschrieben werden. Wie schon in der anfänglichen Definition benannt, hat die praktische Sozialpolitik zum Ziel, in »Risikolagen zu intervenieren« (Schulz-Nieswandt 2006), das gestalterische Moment ist dann die Art und Weise, welche höchst unterschiedlich ausfallen kann (Kaufmann 2003). In den 50er bis 70er Jahren des letzten Jahrhunderts stand neben den Aufbaufragen die Stabilisierung sowie die Wiederherstellung von Strukturen im Vordergrund, entsprechende Gesetze wurden folglich verabschiedet (Neumann und Schaper 2008). So kam es u. a. durch das »Gesetz über das Kassenarztrecht« im Jahre 1955 zu einer Wiederherstellung der Strukturen der Selbstverwaltung. Mit der Rentenreform im Jahre 1957 folgte der Übergang zur Umlagefinanzierung mit der Folge deutlicher Rentenerhöhungen und dynamischer Rentenanpassungen, v. a. mit dem Hintergrund, die Kriegsgeneration, die maßgeblich zum Wiederaufbau Deutschlands beigetragen hat, mit adäquaten Rentenansprüchen zu entschädigen. Neben einer ganzen Reihe an weiteren Gesetzen und Reformen im wiederaufgebauten Deutschland ist noch das Gesetz über die Lohnfortzahlung aus dem Jahr 1969 zu nennen (Niehoff 2007), mit dem die Krankenkassen von nun an zusätzlich auch mit Lohnkompensationsleistungen konfrontiert wurden, was deren Bedeutung als Sozialversicherung bedeutend ausbaute. Bemerkenswerter Weise sind es einzelne Personen, die die sozialpolitischen Ideen maßgeblich vorantreiben. So soll an dieser Stelle Elisabeth Schwarzkopf als erste Gesundheitsministerin und Ministerin überhaupt Erwähnung finden, da sie den Prototyp von Gesundheitsministerium geschaffen hat.
Elisabeth Schwarzhaupt
Die Ministerin ist mit starken Widerständen innerhalb der Fraktion konfrontiert. Dies geht weit über die fachlichen Themen hinaus. Ihr Ministerium zeigt sich insbesondere für die Human- und Veterinärmedizin, das Arzneimittel- und Apothekenwesen, die Vorsorge, Aufklärung sowie Gewässer- und Luftreinhaltung verantwortlich. Schon kurz nach Amtsantritt wird sie mit dem wahrscheinlich größten Skandal im Gesundheitswesen in der deutschen Geschichte konfrontiert. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen 1961 den Zusammenhang des Schlafmittels Contergan mit schweren Missbildungen tausender Neugeborener. Elisabeth Schwarzhaupt fördert daraufhin zum einen die Prothesenforschung und richtet Krankenhaussonderstationen für die Kinder ein. Darüber hinaus verschärft sie die Arzneimittelkontrolle und weitet die Rezeptpflicht aus. Sie engagiert sich stark auf salutogenetischer Ebene, so stärkt sie früh die Ernährungsberatung und implementiert die Krebsvorsoge in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen, fördert den Baubeginn des Deutschen Krebsforschungszentrums und führt für Kinder die Polio-Schluckimpfung ein.
Im Weiteren sei noch erwähnt, dass sich Elisabeth Schwarzhaupt schon früh mit Umweltschutz im gesundheitlichen Kontext befasst. So folgen in Ihrer Amtszeit erste Verordnungen zur Reinhaltung des Wassers (1961) sowie der Luft (1965). Darüber hinaus geht die Ministerin mit gutem Beispiel voran und lässt ihren Ministerwagen mit einem Katalysator ausrüsten (Drummer 2001).
In der weiteren Fortentwicklung der Sozialversicherung und hier insbesondere der Krankenversicherung gibt es weitere Merkmale, die es zu nennen gilt. Ein wesentliches ist mit Sicherheit die sogenannte »doppelte Inklusion« (Alber 1992). Dabei wurden sowohl der Versichertenkreis wie auch der Leistungskatalog immer weiter ausgeweitet. Diese vormalige Entwicklung zeichnet die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts aus. Diese Ausweitungstendenzen wurden lange Zeit intensiv diskutiert, weil verschiedene Kreise mit der Ausweitung eine überdimensionierte Ausgabenentwicklung einhergehend sahen. Mitte der 70er Jahre folgte jene enorme Ausgabenentwicklung der gesetzlichen Krankenkassen, die im Nachgang auch fälschlicherweise als »Kostenexplosion« bezeichnet wurde (Reiners 2011). Die Darstellung einer überdimensionierten Kostensteigerung setze sich in Politik und Öffentlichkeit durch, obwohl es sich bei dem Phänomen um ein Missverhältnis von den konjunkturabhängigen Einnahmen und den regelmäßigen und konjunkturunabhängigen Ausgaben handelte. In diesem Kontext begann ebenfalls die Diskussion um die Bedeutung einer stärkeren Eigenverantwortung der Versicherten und Patienten im deutschen Gesundheitswesen. So wurde bereits im Jahr 1977 unter dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Herbert Ehrenberg in der sozial-liberalen Koalition das Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz beschlossen, in der die einnahmeorientierte Ausgabenpolitik mit Beitragssatzstabilität als globale Zielgröße verankert wurde. Hier fußt die noch heute in weiten Teilen geltende Orientierung der Ausgabenzuwächse der Gesetzlichen Krankenversicherung an der Grundlohnentwicklung.
Im Gesundheitsreformgesetz 1989, welches von Norbert Blüm (Arbeits- und Sozialminister der CDU in XI. Legislaturperiode 1987–1990) maßgeblich gestaltet wurde, ist jedoch ein Bruch zwischen der sich entwickelnden Krankenversicherung und der Gesundheitsversorgung festzustellen. Bei ebengenannter Reform wurden zum ersten Mal Gebühren auf Rezepte durchgesetzt sowie Leistungseingrenzungen vorgenommen. Zu weiteren, v. a. gesundheitsökonomisch geprägten Reformgesetzen kam es dann in den neunziger Jahren. Hier ist neben dem Gesundheitsreformgesetz aus dem Jahr 1989 das Gesundheitsstrukturgesetz aus dem Jahr 1993 zu nennen, welches u. a. für Patienten Zuzahlungen bei Arzneimitteln und bei Krankenhausbehandlungen einführte. Durch das 1. und 2. GKV-Neuordnungsgesetz (1996) kam es zu weitreichenden Änderungen bei den Zahnersatz-Zuschüssen, komplettiert um die Senkung des Krankengeldes auf 70 % des Bruttoentgelts durch das Beitragsentlastungsgesetz im Jahr 1997.
Dieser Trend ist bei den nachfolgenden Reformen ebenfalls zu beobachten. So wurde der Leistungskatalog während der letzten Gesundheitsreformen, von den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts beginnend, nicht mehr ausgeweitet, sondern vielmehr differenziert. Bei näherer Betrachtung der Reformen wird deutlich, dass die Frequenz der Neuerungen im Gesundheitswesen in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Dies ist ein Hinweis auf typische Steuerungsproblematiken, worauf im Folgenden noch detailliert eingegangen werden soll.
Ein neues Kapitel der Gesundheitspolitik wurde mit Beginn der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder zu Beginn der 2000er Jahre begonnen. Hier ist neben der GKV-Gesundheitsreform im Jahr 2000, in der es u. a. zur Grundentscheidung für ein DRG-basiertes Vergütungssystem und der Einführung der Integrierten Versorgung kam, das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz aus dem Jahr 2007 hervorzuheben. Dieses führte durch die Einführung einer Pflicht zur Versicherung für alle Einwohner und der Schaffung des schon angesprochenen Gesundheitsfonds mit einem einheitlichen Beitragssatz für alle Krankenassen, kombiniert mit dem morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (kurz Morbi-RSA), zu weitreichenden Veränderungen der Kassenlandschaft.
Demgegenüber hat sich die Bevölkerung in ihrem Krankheitspanorama und in ihrer gesellschaftlichen Struktur in den letzten 20 bis 30 Jahren stark gewandelt. Während Unfälle und akut erscheinende Krankheitsbilder zurückgegangen sind (was mit Sicherheit eine Leistung des medizinisch-technischen Fortschritts ist), nehmen chronische Krankheitsbilder quantitativ immer mehr Raum ein. Die Sozialstruktur hat insbesondere im Hinblick auf Migration, Schichten- und Genderaspekte einen enormen Wandel vollzogen, und die demografische Situation einer doppelten Alterung (in dem Sinne, dass es immer mehr alte Menschen gibt, die zudem immer älter werden) fordert eine andere Gesundheitsversorgung.
Im Hinblick auf die Sozialversicherung und deren Entwicklung lässt sich noch ergänzend erwähnen, dass diese aufgrund der Steuerungsprobleme auf der einen Seite wie auch des demografischen Wandels auf der anderen Seite ein Stück weit ihre Popularität eingebüßt hat. Betrachtet man die Staaten in der Europäischen Union, so kann konstatiert werden, dass die Staaten mit Sozialversicherungssystemen in der Minderheit sind. Die Mehrzahl der EU-Mitgliedsländer vertraut auf staatliche Systeme, die weitgehend aus Steuermittel finanziert werden (Neubauer 2007). Auch in Deutschland gewinnt die Steuerfinanzierung der Sozialleistungssysteme für die einzelnen Parteien an Bedeutung. Schon heute wird etwa ein Drittel der Finanzmittel der Gesetzlichen Rentenversicherung aus Steuermittel aufgebracht. Dennoch gilt das System der Sozialversicherung als spezifisch deutsche Errungenschaft, die sich u. a. durch eine weitgehende Unabhängigkeit vom Steuersystem kennzeichnet (Opielka 2004). In der Gesetzlichen Krankenversicherung ist bislang nur ein geringer Anteil der Ausgaben aus Steuermittel finanziert. Doch auch der Gesundheitsfonds, welcher mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz aus dem Jahr 2007 begründet wurde, sah bzw. sieht eine Erhöhung des Steueranteils vor.
2.3 Strukturmerkmale der Gesundheits- und Sozialpolitik
Aus dem historischen Kontext heraus sowie in der Gestaltung des Gesundheitswesens haben sich Strukturmerkmale entwickelt und manifestiert, die nun erläutert werden sollen.
Das deutsche Gesundheitswesen stellt sich in seinen Entscheidungsstrukturen auf drei Ebenen analytisch dar. Wie in der nachfolgenden Grafik vorgestellt, finden sich neben der Gesetzesebene, eine Verbandsebene sowie eine Einzelebene. Die gesetzgebende, normierende Ebene ist die Makroebene, die die Rahmenbedingungen der Gesundheitsversorgung für die gesetzlich krankenversicherten Personen in der Bevölkerung vorgibt. Dies erfolgt über die Festlegung der Finanzierungssystematik und über weit reichende Steuerungsmechanismen i. S. von Rahmenvorgaben für das Sozialrecht (Rosenbrock und Gerlinger 2009). Inwieweit die Akteure der Makroebene aktiv auf die Geschehnisse im Gesundheitswesen Einfluss nehmen, ist insbesondere eine Frage der Sozialstaatstypologie und der damit verbundenen Ausprägung des wohlfahrtsstaatlichen Netzes (Schmid 2002). In Deutschland erfolgt dies im Sinne einer dualen Ordnung, in der dann die Rahmenvorgaben wie oben benannt dargestellt werden.
Abb. 2.1: Akteurebenen. Quelle: Eigene Darstellung auf Basis: Zdrowmyslaw N, Dürig W (1997), S. 115.
Die nachfolgende staatsmittelbare Mesoebene ist die Ebene der Verbände. Diese ist mit den gebündelten Organisationseinheiten der Krankenkassen und Leistungserbringer besetzt. Sie haben in ihrer Funktion als Körperschaften öffentlichen Rechts in erster Linie die Aufgabe, Vorgaben von der Makroebene handlungsorientiert umzusetzen (Rosenbrock und Gerlinger 2009). Historisch schlossen sich die Krankenkassen zu Verbänden zusammen und füllten lobbyartig den von der Makroebene vorgegebenen Rahmen aus bzw. leisteten fachliche Unterstützung in den anstehenden Gesetzgebungsverfahren (Simon 2013). Der Status dieser Körperschaften öffentlichen Rechts wurde allerdings durch die Regelungen des GKV-WSG 2007 revidiert. Mittlerweile laufen viele der einst den Krankenkassenverbänden zugewiesenen, öffentlich-rechtlichen Aufgaben auf die Nachfolgeorganisation, den sogenannten GKV-Spitzenverband, zu. Örtlich betrachtet, orientiert sich die Ebene auch an regionalen Strukturen. Eine solche Struktur ist insbesondere in der stationären Versorgung anzutreffen. In diesem Sektor ist die Beteiligung der Bundesländer im Rahmen der so genannten, dualen Finanzierung vorgeschrieben. Danach werden die Investitionskosten durch das Land und die laufenden Betriebskosten durch die Krankenkassen getragen.
Die dritte Ebene – Mikroebene – betrifft einerseits die Arzt-Patienten- und andererseits die Arzt-Krankenkassen-Beziehungen. Hier findet die eigentliche Leistungserbringung am und mit dem Patienten bzw. die Abwicklung der Versicherungsleistungen und -gegenleistungen statt. Die ins Detail erarbeiteten Handlungsvorgaben werden hier angewendet. Das Handeln der Akteure wird dabei sektorenübergreifend als ein gesamtes Gefüge gesehen. Dabei ist der Patient von einem im hohen Maße kooperativen Handeln von den verschiedenen Leistungserbringern abhängig. Erfolgt dies nicht oder nur teilweise, kommt es zu Ineffizienzen und Redundanzen in Diagnostik und Therapie.
Über die kollektivvertragliche Steuerung war das Gesundheitssystem bis 2004 ausschließlich top-down-orientiert, sodass es verhältnismäßig wenige Spielräume für wettbewerbliche Entwicklungen sowie für einen patientenorientierten Einsatz gab. Dies wurde auch mehrfach durch den Sachverständigenrat im Gesundheitswesen (2001) bemängelt und mit Über-, Unter- und Fehlversorgung gekennzeichnet. Erst mit der Einführung neuer Versorgungsstrukturen, insbesondere der der integrierten Versorgung, erhielten die Akteure weitergehende Handlungsspielräume. Die Makroebene setzt dabei auf einen wettbewerbsorientierten Handlungsrahmen, in dem die Differenzierungsbemühungen der Einzelnen belohnt werden sollen. Dementsprechend können Ärzte zusätzliche Erlöse erzielen und Krankenkassen mit neuen Angeboten für ihre Versicherten attraktiver werden (Hartweg 2007).
2.4 Ausgaben- und Steuerungsprobleme am Beispiel der Gesundheitsversorgung
Deutschland steht, wie alle demokratischen Industriestaaten sozialpolitischer Prägung vor dem Grundproblem, dass die Ausgaben u. a. im Gesundheitswesen rascher wachsen als die Finanzierungsgrundlagen. Für Deutschland ist die Lage insoweit brisanter, da aufgrund des besonders massiven demografischen Wandels nicht nur die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in besonderem Maße ansteigen wird, sondern auch die Finanzierungssystematik, die dem deutschen System zugrunde liegt, besonders Demografie-anfällig ist (Kurscheid und Beivers 2012). So befindet sich das deutsche Gesundheitswesen seit längerem in einer Umstrukturierungsphase. In diesem Zusammenhang sind die Entwicklungsperspektiven der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) besorgniserregend. Grund hierfür sind schneller ansteigende Ausgaben als Einnahmen. Die Ursachen sind auf der Ausgabenseite insbesondere die demografische Entwicklung sowie der medizinisch-technische Fortschritt, wie auch das Problem der sogenannten angebotsinduzierten Nachfrage, beeinflusst durch die hohe Anzahl und Dichte der im deutschen Gesundheitswesen vorgehaltenen (Behandlungs-) Kapazitäten. Jedoch darf auch der Lebensstil einer Gesellschaft mit den daraus resultierenden Krankheits- Inzidenzen und –Prävalenzen nicht unterschätzt werden. Betrachtet man die in Deutschland derzeit diskutierten Probleme der chronischen Erkrankungen, wie beispielsweise Diabetes oder Herzkreislauferkrankungen, scheinen diese immer bedeutendere Einflussfaktoren zu werden (Neubauer 2007a). Nicht zuletzt deswegen ist eine nachhaltige Präventionsstrategie ein wichtiges Element der Sozial- und Gesundheitspolitik (Rosenbrock und Gerlinger 2009). Schätzungen gehen heute davon aus, dass etwa 2 bis 3 Prozent mehr Mittel aufgewendet werden müssen, um ein Gesundheitssystem konstant auf dem modernsten Versorgungsstand zu halten. Dabei sind diese Werte ohne Inflationsrate zu sehen (Neubauer 2006).
Die Einnahmeseite des deutschen Gesundheitswesen ist beschränkt durch den Zuwachs der Sozialversicherungspflichtigen Einkommen (auch Grundlohnsumme genannt, wie bereits erwähnt), welche gemäß der Bismarckaschen Konzeptionierung des umlagefinanzierten, solidarischen Systems zugrunde liegt. Erkennbar ist seit mehreren Jahren, dass der Bedarf bzw. die Ausgaben stärker steigen als die Grundlohnsumme, welche das System finanziert. Dies führt zur Mittelknappheit und zwingt zum (gesundheits-)ökonomischen Handeln (Kurscheid und Beivers 2012).
Zusammenfassend lässt sich folgern, dass die demografische Entwicklung das Kernthema im derzeitigen gesellschaftlichen Wandel ist und für gesundheitspolitische Fragestellungen eine hohe Relevanz besitzt. Dies ist jedoch nicht nur ein Thema mit dem sich bundespolitische Gesundheitspolitiken auseinandersetzen dürfen, sondern vielmehr eines, welches bis in die landespolitischen und kommunalen Institution Einzug hält. Steigende Alterung geht mit einer Veränderung der Ausgabenprofile einher und stellt die GKV vor die Herausforderung der potenziellen Ressourcenknappheit. Dies bedeutet zudem auch eine Diskussion in welchem Gesundheitszustand die Menschen altern müssen und wollen. Demografischer Wandel bedeutet auch alternde Mediziner und ein möglicher Mangel an nachrückenden jungen Medizinern (Kurscheid und Beivers 2012). Dies zeigt, dass sich Versorgung unter Beachtung von bestehenden Ressourcen in der Zukunft verändern muss.
Wie jedoch auch Blüm (2006) darstellt, ist die Frage der Reorganisation der Sozial- und Gesundheitspolitik auch immer eine Frage der Ordnungspolitik. So ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass rund 200 Reformgesetze2 in den letzten 25 Jahren nicht zu einer Stabilisierung der Gesundheitskosten und somit zu einer nachhaltigen Sicherung der Finanzierungsbasis beitragen haben (Beivers 2010). Dies zeigt den Bedarf einer grundlegenden ordnungspolitischen Neuausrichtung des Gesundheitswesens, sowohl auf der Einnahme-3 als auch auf der Ausgabenseite. Die strukturellen Reformen müssen dabei vor allem auf der Ausgaben- bzw. der Leistungserbringerseite erfolgen (Beivers 2010). Die aktuellen Reformstrategien in Deutschland zeichnen sich primär durch eine Budgetierung aus,4 in der mit Einheitspreisen versucht wird, die Ausgaben der verfügbaren knappen Mittel zu steuern.
Diese starken Eingriffe von Seiten des Staates in die Gesundheitsversorgung erfolgen primär aus meritorischen Erwägungen heraus. So hat der Staat Bedenken, dass die Verteilungswirkungen von unregulierten Gesundheitsmärkten von der Bevölkerung bzw. den Wählern nicht akzeptiert werden. Dies führt dazu, dass das deutsche Gesundheitswesen hochgradig reguliert ist. Es wird sowohl auf der Leistungserbringungs- wie auch auf der Ausgabenseite durch strikte Planungs- und Vergütungsvorgaben eingegriffen (Beivers 2010).
2.5 Sozialstaat zwischen Umbau und Reformen
Generell ist ein Rückzug des Solidarprinzips in unserer Gesellschaft zu beobachten, beispielsweise die Solidarität in der Familie, im Betrieb und auch im gesellschaftlichen Leben. Immer mehr Solidargemeinschaften werden instabil, wobei vor allem die Mobilität der Menschen eine Gefährdung der Solidargemeinschaften darstellt. Durch die Mobilität werden Solidargemeinschaften krisenanfällig, da der Abzug und der Zugang von Mitgliedern in einer Solidargruppe unter individualistischen Gesichtspunkten optimiert werden kann. So tritt man einer Solidargemeinschaft nur dann bei, solange sie einem Vorteile verspricht und verlässt sie wieder, um sich einer anderen anzuschließen, wenn diese größere Vorteile zusagt. Der Rückzug des Solidarprinzips geht einher mit einem Vordringen der Individualisierung und Differenzierung (Neubauer 2007). In der Massengesellschaft haben die Menschen einen verstärkten Drang nach Differenzierung und Individualisierung. Dies drückt sich z. B. in kleineren Familieneinheiten aus, in temporären Lebenspartnerschaften und auch in temporären Arbeitsverhältnissen. Zugleich dringen die Leistungsprinzipien immer mehr auch in den Bereich der Sozialversicherung ein. Es genügt heute nicht mehr, dass eine soziale Einrichtung gemeinnützig tätig wird, sondern von ihr wird verlangt, dass sie im Wettbewerb ihre Durchsetzungsfähigkeit beweist. Der Wettbewerb aber verlangt Differenzierung und letztlich auch Gewinnorientierung. Genau dies aber sind dem Solidarprinzip entgegen gesetzte Vorstellungen (Neubauer 2007).





























