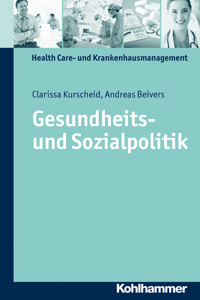Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erwartungen, Forderungen, Konzepte Eine große Zahl von Interessengruppen versucht, gesundheitspolitische Entscheidungen der Politik zu begleiten und zu beeinflussen. Alle Akteursgruppen sind mit zum Teil mehreren Interessensvertretungen aktiv und haben ein gemeinsames Ziel: zu ihren Gunsten positiven Einfluss auf die Entscheidungen in der Gesundheitspolitik zu nehmen. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass sich ein Koalitionspapier durchaus als konsequente Agenda für eine Legislaturperiode eignet. So ist es naheliegend, dass die Interessenvertreter aus dem Gesundheitswesen im Vorfeld von Wahlen ihre Forderungen, Wünsche und Anregungen in Positionspapieren festlegen und sichtbar machen. Dieses einmalige, brandaktuelle Werk untersucht und vergleicht die Positionen der verschiedenen Verbände wie auch der Parteien unmittelbar zur Bundestagswahl 2017. Dabei werden die Forderungskataloge der einzelnen Institutionen nicht einfach wiedergegeben, sondern anhand der relevanten Themenfelder bewertet und in Bezug auf Umsetzbarkeit wie auch gesellschaftliche Akzeptanz untersucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
NEUGESTALTUNG DER FINANZIERUNGSSYSTEME
B
ÜRGERVERSICHERUNG
, V
ERHÄLTNIS
PKV/GKV
B
UNDESZUSCHUSS
G
ESUNDHEITSFONDS
K
RANKENHAUSFINANZIERUNG
M
ORBI
-RSA
A
UFSICHT
A
MBULANTE UND SEKTORENÜBERGREIFENDE
V
ERSORGUNG
I
NNOVATIONSFONDS
P
OSITIONEN DER
P
ARTEIEN
SEKTORENÜBERGREIFENDE VERSORGUNG
S
TELLUNGNAHMEN UND
E
INSCHÄTZUNGEN DER
V
ERBÄNDE
Weiterentwicklung der Medizinischen Versorgungszentren
Beteiligung des stationären Sektors an der Notfallversorgung und sektorenübergreifende Gebührenordnung
Weiterentwicklung der ambulant spezialfachärztlichen Versorgung
Belegarztwesen und Praxiskliniken
Regionale Versorgungsstrukturen
S
TELLUNGNAHMEN DER
P
ARTEIEN
QUALITÄT UND TRANSPARENZ IN DER MEDIZINISCHEN VERSORGUNG
S
TELLUNGNAHMEN UND
E
INSCHÄTZUNGEN DER
V
ERBÄNDE
Instrumentarien zur Schaffung von Transparenz
Maßnahmen zur Steigerung von Qualität in der medizinischen Versorgung
Einbezug des Patienten zur Verbesserung von Transparenz und Qualität in der medizinischen Versorgung
S
TELLUNGNAHMEN DER
P
ARTEIEN
PATIENTENORIENTIERUNG
S
TELLUNGNAHME DER
V
ERBÄNDE
Patientenorientierung
Patientensouveränität/ Patientenselbstbestimmung/ Patientenautonomie
Patientenrechte
S
TELLUNGNAHME DER
K
RANKENKASSEN
S
TELLUNGNAHME DER
P
ARTEIEN
E‐HEALTH IN DER MEDIZINISCHEN VERSORGUNG UND DIE NUTZ-UNG DIGITALER INNOVATIONEN
I
NFORMATIONSAUSTAUSCH SCHAFFEN
Standards und Normen – Interoperabilität
Reform der Entscheidungsstrukturen
Elektronische Patientenakte und Datenschutz
Flächendeckende IT‐Strukturen, Datennutzung und Versorgungsforschung
Fachkräfte
Gesundheitskompetenz
Finanzierung
T
ELEMEDIZIN ALS INTEGRALER
B
ESTANDTEIL DER
V
ERSORGUNG
Prozess zur Kategorisierung, Zulassung, Bewertung und Erstattung von digitalen Anwendungen
Sichtbarmachung der Erfüllung des Kriterienkatalogs
Fernbehandlungsverbot
Haftpflicht
P
OSITIONEN DER
P
ARTEIEN
NEUORGANISATION DER GESUNDHEITSBERUFE
D
IE
W
EITERENTWICKLUNG VON
D
ELEGATIONSMODELLEN
D
ER INTERPROFESSIONELLE
G
ESUNDHEITSCAMPUS
D
IE
K
OORDINATION ÄRZTLICHER
L
EISTUNGEN
S
TELLUNGNAHME DER
P
ARTEIEN
INNOVATIVE ARZNEIMITTEL UND VERSANDHANDEL
S
TELLUNGNAHME DER
V
ERBÄNDE
S
TELLUNGNAHME DER
K
RANKENKASSEN
S
TELLUNGNAHME DER
P
ARTEIEN
POSITIONEN ZUR SELBSTVERWALTUNG
D
ER INNERE
K
REIS
Autonomie und Handlungsspielräume
Kassenorganisation
A
UßERHALB DES
E
NTSCHEIDER
-K
REISES
Entscheidungsprozesse und Stimmrechte
Kontrolle und Schiedsstelle
Beteiligungs‐/Antragsrecht
Nutzenbewertung
P
OSITIONEN DER
P
ARTEIEN
UMGANG MIT INNOVATIONEN IN DER MEDIZIN (EVALUATION UND FÖRDERUNG)
I
NNOVATIONSFONDS
W
EITERE
I
NNOVATIONEN IM
G
ESUNDHEITSWESEN
W
EITERENTWICKLUNG VON
M
EDIZINPRODUKTEN
D
IE
E
INSCHÄTZUNG DER
P
ARTEIEN
LITERATURVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Vorwort
Gesundheitspolitische Entscheidungen werden in besonderem Maße flankiert von einer großen Zahl von Interessengruppen, die versuchen, die Politik auf ihren Entscheidungswegen zu begleiten und zu beeinflussen. Alle gesundheitspolitischen Akteursgruppen sind mit einer Vielzahl von Interessensvertretungen aktiv, um einen zu ihren Gunsten positiven Einfluss auf die Entscheidungen in der Gesundheitspolitik auszuüben. Tatsächlich lebt unsere Demokratie von der politischen Organisation und Strukturierung dieser unterschiedlichen Interessen.
Es erschien uns daher als ein lohnendes und wichtiges Unterfangen, aus einer möglichst kompletten Überschau dieser in Positionspapieren artikulierten Interessen den fiktiven Mittelpunkt abzuleiten, wie er sich im Regierungshandeln der kommenden 19. Legislaturperiode widerspiegeln könnte. Dabei werden nicht einfach die Forderungskataloge der einzelnen Institutionen wiedergegeben, sondern sie werden vielmehr anhand der relevanten Themenfelder neu sortiert, bewertet und in Bezug auf Umsetzbarkeit wie auch gesellschaftliche Akzeptanz untersucht.
Insgesamt überrascht die Vielzahl der veröffentlichten Papiere. Aus dieser Detailfülle lässt sich eine wachsende Unzufriedenheit der Systembeteiligten mit den aktuellen Rahmenbedingungen ablesen. Die Überzeugung, dass demographischer Wandel, Digitalisierung und medizinisch-technischer Fortschritt das Gesundheitssystem schon in wenigen Jahren unter unausweichlichen Handlungsdruck setzen werden, durchzieht die gesamte Palette der veröffentlichen Positionspapiere. Zugleich zeigt sich aber in einem anderen, nicht unerheblichen Teil der Wortmeldungen eine tiefe Überzeugung von der Existenzberechtigung und der Zukunftsfähigkeit unseres solidarischen Gesundheitssystems. Der gemeinsame Wille zur Umgestaltung auf der bestehenden solidarischen Versorgungsbasis ist den Papieren – trotz der divergierenden Partikularinteressen – fast durchgängig ablesbar.
In auffälligem Gegensatz dazu stehen die gesundheitspolitischen Positionierungen der Parteien. Neben einem hohen Anteil an Worthülsen („das deutsche Gesundheitssystem ist eines der besten der Welt“) bleiben die Parteiprogramme in ihren gesundheitspolitischen Anteilen in ihren Handlungskorridoren eher vage. Ablesen lässt sich daraus zweierlei: Trotz des auf dem System lastenden Anpassungsdrucks ist „Gesundheit“ politisch aktuell kein Thema, weil an dieser Front derzeit augenscheinlich keine Wahl entschieden wird. Darüber hinaus sind alle Wahlprogramme deutlich davon gekennzeichnet, nicht den Zorn einzelner gesundheitspolitischer Interessengruppen auf sich zu ziehen.
Rückschlüsse auf die politischen Handlungsoptionen der nächsten Legislaturperiode lassen sich aus diesen Diskrepanzen dennoch bereits jetzt ziehen: Die partiell große Übereinstimmung wichtiger Akteursgruppen bei einzelnen anstehenden politischen Weichenstellungen setzt jede denkbare kommende Regierungskoalition unter Druck, gemeinsam mit den Partnern der GKV-Selbstverwaltung nach konsentierten Lösungskonzepten zu suchen – diese dann aber auch politisch umzusetzen. Hier wird von nahezu allen Beteiligten mehr politische Führung erwartet.
Wir haben mit unserer Studie versucht, den gesundheitspolitische Handlungsrahmen der kommenden Legislaturperiode in seinen Grenzen und Möglichkeiten einigermaßen vollständig zu kartographieren. Dem Willen zum Handeln müssen jetzt allerdings politische Taten folgen. Das zumindest erwarten die wichtigsten gesundheitspolitischen Interessengruppen.
Köln/Berlin im September 2017
Clarissa Kurscheid, Nicole Balke, Albrecht Kloepfer, Sophia Wagner
„Post scriptum“ noch einige technische Details:
Aufgrund der besseren Lesbarkeit haben sich die AutorInnen nach ausführlicher Diskussion entschieden, auf eine „gegenderte“ Schreibweise grundsätzlich zu verzichten. „Patienten“ oder „Ärzte“ meint also stets: Patientinnen
und
Patienten bzw. Ärztinnen
und
Ärzte.
Eine Legende der zahlreichen Abkürzungen findet sich am Schluss des Buches. Zitiert wird dann im Text jeweils mit der Abkürzung und der direkt dahinter gestellten Seitenangabe. „GKV-SV13“ meint also die Seite 13 im Positionspapier des GKV-Spitzenverbandes.
Begleitend zur vorliegenden Studie ist ein mehr als 700 Seiten starker Reader mit allen verwendeten Positionspapieren entstanden, der aus unserer Sicht einen Wert für sich darstellt. Diese Textsammlung wollten wir unserer Leserschaft deswegen nicht vorenthalten. Sie finden das Konvolut unter
http://www.gesundheitssystem-entwicklung.de/ix-das-institut/positionspapiere-zur-wahl/
zum Download. Es sind allerdings etwas über 50 MB geworden...
Neugestaltung der Finanzierungssysteme
Dr. Albrecht Kloepfer
Es mag überraschen, dass trotz voller Fondsreserven und trotz weitgehend gut gefüllter Kassenspeicher die Fragen der äußeren und inneren Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung einen ausgesprochen breiten Raum in den unterschiedlichen Positionspapieren einnehmen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass politische Weichenstellungen in Finanzierungsfragen einerseits extreme Hebelkräfte entwickeln können, andererseits aber nur in sehr aufwendigen politischen Diskussions- und Gutachtenprozessen wieder rückgängig zu machen sind. Gerade die seit langem und erbittert geführte Diskussion um den Morbi-RSA zeigt: Bei Finanzierungsfragen geht es schnell ums Ganze.
Das betrifft nicht nur Entscheidungen der „äußeren“ GKV-Finanzierung (also der Frage „Wie kommt das Geld ins System?“), sondern meint im besonderen Maße auch Fragen der „inneren“ Finanzierung (also alle Fragen zur Verteilung der aufgebrachten Mittel). Auch hier haben grundlegende Weichenstellungen in Verteilungsfragen (beispielsweise zwischen ambulanter und stationärer Versorgung) für die einzelnen Leistungserbringer-Einheiten schnell existenzielle Bedeutung – was die Intensität erklärt, mit der die jeweiligen Interessengruppen ihre Positionen verteidigen und, wenn möglich, Teile des Kuchens für sich reklamieren.
Bürgerversicherung, Verhältnis PKV/GKV
Die Bürgerversicherung, das einzige Thema, das gesundheitspolitisch möglicherwiese größere Wählerbewegungen zu mobilisieren vermag (so jedenfalls die Hoffnung von SPD, Grünen und Linken), spielt bei den Anregungen und Positionierungen der Systembeteiligten nahezu keine Rolle. Überlegungen, gesetzliche und private Krankenversicherung unter einen gemeinsamen Finanzierungs- und Marktrahmen zu setzen, werden nur am Rande thematisiert. Von Seiten der Leistungserbringer wird dabei stärker auf die positive Bedeutung der zweigeteilten Versorgung hingewiesen (BÄK3, NAV8, BDPK7). Der NAV-Virchow-Bund macht in diesem Zusammenhang den Vorschlag, das Wahlrecht zwischen GKV und PKV durch eine Absenkung der Versicherungspflichtgrenze zu erhöhen (NAV8). Am deutlichsten wird in dieser Frage die Bundeszahnärztekammer, die explizit formuliert, dass „alle Bestrebungen, über eine ‚Bürgerversicherung’ einen einheitlichen Krankenversicherungsmarkt zu errichten, entschieden abzulehnen“ seien (BZÄK15). Gleichzeitig fordert die BZÄK die Trennung von GKV und PKV aber auch am konsequentesten, in dem sie ein Konzept der „reformierten Dualität“ vorlegt. Hierbei wird auch die GKV über individuelle Prämien (130-170 Euro) finanziert, die in einen Fonds münden (nicht zu verwechseln mit dem bisherigen Gesundheitsfonds), aus dem individuelle Zahlungen zum Sozialausgleich sowie Rücklagen für die geburtenstarken Jahrgänge finanziert werden sollen (BZÄK16). Hiermit spricht sie die Überlegung aus, die GKV insgesamt in PKV-artige Strukturen zu überführen – ein Gedanke, der konsequent in die Forderung nach „verbindliche(n) Mindestkriterien für den Versicherungsschutz“ mündet (BZÄK16).
Auf Kassenseite finden Überlegungen zu einer grundsätzlichen Änderung im Verhältnis zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung nahezu keine Resonanz. Die Barmer fordert in ihrem Papier eine „weitere Annäherung“ der Systeme und Erleichterungen für wechselbereite PKV-Versicherte (Barmer21). Damit korrespondiert auch ihre Forderung nach einer Integration der unterschiedlichen Vergütungssysteme in der ambulanten Versorgung von Einheitlichem Bewertungsmaßstab (EBM) einerseits und Gebührenordnung der Ärzte (GOÄ) andererseits (Barmer21). Der IKK e.V. plädiert explizit für die Beibehaltung des bisherigen geteilten Systems, mahnt aber Erleichterungen in der Zusammenarbeit zwischen PKV und GKV bei der Entwicklung von Zusatztarifen an (IKK14f).
Aus Sicht der Akteure erweist sich damit die politische Diskussion um eine Bürgerversicherung zumindest in ihren Aspekten zur äußeren Systemfinanzierung als Chimäre: Der Status Quo hat sich nicht nur als recht praktikabel erwiesen, es scheint auch durchaus ungewiss, ob eine wie auch immer gestalte Bürgerversicherung der GKV zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen würde. Niemand im System, so legt die Lektüre der Positionspapiere nahe, hat Lust, das einmal auszuprobieren.
Bundeszuschuss
Das sieht mit dem Bundeszuschuss schon ganz anders aus. Naturgemäß ist das zwar kein Thema für die Leistungserbringer (Ausnahmen bilden vielleicht vereinzelte Forderungen nach staatlicher F&E-Förderung, doch betrifft dies nicht den Bundeszuschuss im engeren Sinne – VDGH22), die Krankenkassen haben hier jedoch eine ganze Reihe deutlicher Positionen.
Grundsätzlich weisen die Kassen in ihren Positionspapieren darauf hin, dass der Bundeszuschuss keine Leistung des Finanzministeriums nach Gutdünken ist, sondern dass hier seit 2003 aus dem GKV-Modernisierungsgesetz ein gesetzlicher Anspruch der Kassen zum Ausgleich gesellschaftspolitisch gewünschter Leistungen (z.B. beitragsfreie Familienversicherung) resultiert. Aus diesem Rechtsfundament eines exakt definierten und prinzipiell kalkulierbaren Bundeszuschusses finden Kassenforderungen nach einer „Dynamisierung“ (AOK25, GKV-SV17) oder einer „Verstetigung“ (Barmer18) ihre Begründung, während die DAK daraus bei Unterdeckung die Forderung nach einer „gesetzliche(n) Festschreibung eines Erstattungsanspruchs aus Bundesmittel“ ableitet (DAK20).
Neben dieser grundsätzlichen Forderung nehmen die Kassen das Thema Bundeszuschuss aber auch zum Anlass, um auf weitere „Verschiebebahnhöfe“ in der GKV-Finanzierung hinzuweisen. Vor allem die unzureichende Finanzierung von ALG-II-Empfängern ist den Kassenvertretern dabei ein Dorn im Auge. Die Forderung nach einer entsprechenden Anpassung findet sich in nahezu allen Kassenpapieren (AOK26, DAK20, IKK 18, GKV-SV18, vdek14).
Im Verhältnis von Bund und Kassen sei an dieser Stelle aber auch auf eine weitere verdeckte „Bundessubvention durch die Krankenkassen“, hingewiesen: Alle Kassenverbände fordern einmütig die sofortige Einstellung der Finanzierung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wie sie sich aus dem Präventionsgesetz ergibt (AOK34, GKV-SV29, vdek44, IKK 18). Diese Forderung findet ihre Begründung in einer Zweckentfremdung von Versichertengeldern zur Finanzierung und Aufwertung einer Bundesbehörde. Der GKV-Spitzenverband weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass „die Krankenkassen ... in der lebensweltbezogenen Prävention und Gesundheitsförderung selbst ein qualitätsgesichertes und kassenübergreifendes Vorgehen ohne Beauftragung einer Bundesbehörde sicherstellen (können)“ (GKV-SV29), Der AOK Bundesverband spricht von einem „ordnungspolitischen Sündenfall“ (AOK34).
Gesundheitsfonds
Mit dem Gesundheitsfonds scheinen sich die Akteure – bis auf den Morbi-RSA, dem nachfolgend ein eigener Abschnitt zu widmen ist – weitgehend abgefunden zu haben. Was aber nicht ihre Billigung findet, ist der „Fonds als Sparkasse“. Konsequent sind daher allgemeine und unbezifferte Forderungen, überschüssige Fondsmittel wieder an die Kassen zurückzuführen (DAK20, GKV-SV17, vdek14). Der GKV-Spitzenverband geht hier aber auch einen konkreten Schritt, indem er, analog zur bereits existierenden Mindestrücklage des Gesundheitsfonds, auch die Formulierung einer „Maximalreserve“ fordert, die „die Ausschüttung überschüssiger Liquidität im Gesundheitsfonds in einem geregelten Verfahren an die Krankenkassen sicherstellt“ (GKV-SV17).
Von großer Bedeutung bei der Speisung des Fonds sind für die Kassen darüber hinaus vor allem die Themen der paritätischen Finanzierung und der Finanzautonomie. Die Herstellung einer zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Versicherten, also paritätisch getragenen Finanzierung finden sich beim AOK Bundesverband, dem vdek, dem IKK e.V. und der Barmer – wobei der IKK e.V. in diesem Zusammenhang das Wort Parität meidet und von „Belastungsgerechtigkeit“ spricht, während die Barmer in ihrem Papier ausdrücklich in einer Fußnote darauf hinweist, dass die dort formulierte Forderung nach einer paritätischen GKV-Finanzierung „von den Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertretern im Verwaltungsrat der Barmer nicht mitgetragen“ wird (AOK14, Barmer18, IKK18, vdek14).
Krankenhausfinanzierung
Ein Feld größter Einigkeit unter den Akteuren ist die defizitäre Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser durch die Länder. Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen stimmen darin überein, dass dieses Problem endlich einer Lösung zugeführt werden muss. Dabei scheint die Position, den „Investitionsstau auf(zu)lösen“ (AOK10, Barmer11, BÄK5), als Grundforderung nicht mehr auszureichen. Diverse Ideen und Vorschläge, wie die Situation überwunden werden könnte, durchziehen die verschiedenen Positionspapiere.
Besonders aktiv sind hier der Verband der Ersatzkassen und seine Mitgliedskassen. Der vdek fordert, die Investitionsaufwendungen auf der Grundlage einer „Investitionsbewertungsrelation“ zu bestimmen, und die entsprechende Differenz über Bundesmittel zu flankieren. Zusätzlich müsse „eine Investitionsquote für die Länder gesetzlich als Untergrenze“ verankert werden (vdek27). Die TK fordert ein befristetes Sonderprogramm auf Grundlage des Artikels 14 aus dem Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung in der GKV (GSG), um den bisherigen Investitionsstau aufzulösen. Im Anschluss regt sie auf der Grundlage der vom Institut für die Entgeltfestsetzung im Krankenhaus (InEK) zu ermittelnden Investitionsbewertungsrelationen ein Modell der Teilmonistik an, das „den Krankenkassen ein Recht zur Mitgestaltung an der Krankenhausplanung der Länder“ einräumt (TK7). Die Barmer regt an, den Investitionsstau der Krankenhäuser aus Bundesmitteln zu kompensieren, um anschließend auf der Basis einer „gesetzlich bindende(n) Investitionsquote“ und analog zum Krankenhaus-Strukturfonds zu einer kombinierten Bund/Länder-Finanzierung für die Investitionsfinanzierung überzugehen (Barmer11). In diesem Zusammenhang fordert die Deutsche Krankhausgesellschaft „zwingend“ eine „Mindestinvestitionsquote von 9 Prozent“, die vom Bund zu flankieren sei, „wenn die Länder ihrer Verantwortung nicht sachgerecht nachkommen“ (DKG26).
Insgesamt, so die nicht explizit ausgesprochene Überzeugung der Kostenträger, ist das Problem allein aus der Kompetenz und Initiative der Länder augenscheinlich nicht lösbar. Der Krankenhausstrukturfonds habe hier Wege aufgezeigt, wie aus kombinierten Finanzierungsmodellen die Investitionsfinanzierung der Länder flankiert werden könne. Unabdingbar seien dafür aber die Festlegung einer Mindestinvestitionsquote per Gesetz oder durch das InEK und eine damit einhergehende Beschneidung der Länderrechte im Bereich der Krankenhausplanung.
Über weitere Details der Krankenhausfinanzierung macht sich besonders der Bundesverband Deutscher Privatkliniken Gedanken: Er fordert sowohl den mit dem Krankenhausstrukturgesetz eingeführten Fixkostendegressionsabschlag umgehend wieder abzuschaffen als auch die Streichung der Grundlohnsummenbindung (BDPK 8/11). Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert stattdessen, die tatsächlichen Versorgungskosten in den jeweiligen Landesbasisfallwerten adäquat abzubilden (DKG33).
Morbi-RSA
Wichtigstes Thema der Krankenkassen für einen wettbewerbskonformen, internen Finanzausgleich ist ohne Frage der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich, also der so genannte Morbi-RSA. Hier läuft schon seit der allerersten Konzeptionsphase dieses Instruments die lebhafte Diskussion um Auswahl und Auswahlmodalitäten der für den Ausgleich relevanten und vom Gesetzgeber vorgegebenen 50 bis 80 Krankheiten, die für die Justierung des Morbi-RSA herangezogen werden sollen. Denn der im Gesetzestext verwendete Begriff „kostenintensiv“ (SGB V §268 Absatz 1 Satz 5) erläutert nicht, ob er Kosten im Sinne der Volkswirtschaft oder Kosten im Sinne der individuellen Krankheitslast adressiert. Ersteres führt zu einer stärkeren Gewichtung vor allem von Volkskrankheiten, wie Diabetes und Hypertonie, letzteres würde vor allem seltenere Erkrankungen mit hohen individuellen Therapiekosten stärker berücksichtigen.
Das Problem erfährt zusätzliche Verschärfung dadurch, dass Krankheiten der ersten Kategorie eher an der Versorgungsbasis diagnostiziert werden und werden können (und damit als manipulationsanfällig gelten), während die Krankheiten der zweiten Kategorie in der Regel mit „harten“ Diagnosen assoziiert sind, die als „manipulationssicher“ gelten können und in der Regel auch von Fachärzten in der ambulanten oder stationären Versorgung getroffen werden. Gepaart mit dem Vorwurf, dass Ortskrankenkassen aufgrund ihrer Beaufsichtigung durch das jeweilige Bundesland (bundesweit agierende Krankenkassen werden durch das Bundesversicherungsamt beaufsichtigt) leichter über entsprechend formulierte Strukturverträge „an Diagnosen kommen“, ergibt sich aus diesem komplexen Zusammenspiel von Faktoren die Brisanz, die aus einer unterschiedlichen Gewichtung der Krankheitsauswahl zum Morbi-RSA resultiert.
Krankheitsauswahl
Nicht überraschend ist es daher, dass die Kassenforderungen rund um den Morbi-RSA ein tiefer Riss zwischen den AOKen (bzw. dem AOK-Bundesverband) und den übrigen Kassen durchzieht. Tatsächlich fordern dementsprechend alle Kassen (außer eben dem AOK-BV), die Krankheitsauswahl neu zu gewichten oder ein anderes Klassifikationsmodell zu entwickeln (Barmer20, DAK22, vdek21, IKK21, KKH2, TK13). Die Bundesärztekammer übt sich in Zurückhaltung, betont aber zumindest, dass mit Blick auf eine ausgewogene Verteilungssystematik eine Weiterentwicklung des Morbi-RSA geboten sei, da eine „einseitige politische Begünstigung einer Kassenart ... die für den Wettbewerb erforderliche Pluralität der Kassenarten gefährden (würde)“ (BÄK3). Klar ist: Die Frage noch der Gewichtung einzelner Auswahlmodelle zur Zusammenstellung des Krankheitskataloges für den Morbi-RSA kann nur politisch entschieden werden. Der Vorschlag des AOK-Bundesverbandes, „alle Krankheiten im Risikostrukturausgleich (zu) berücksichtigen“ (AOK23) mag die Problematik abschwächen, er ändert aber noch nichts an der Frage der Gewichtung.
Auch in einer anderen Frage liegt indirekte Kritik an den politischen Entscheidungsträgern auf dem Tisch: Einig sind sich nämlich die Kassen in ihrer Forderung nach einheitlichen und verbindlichen ärztlichen Kodierrichtlinien zur Erfassung der Morbidität (AOK11/23, Barmer9, DAK22, vdek29), hier wird von ihnen unisono eine stärkere politische Entschlossenheit angemahnt.
Hochrisikopool
Wie schon die Auswahl der für den Morbi-RSA relevanten Erkrankungen ging auch die im Zusammenhang mit dem Morbi-RSA umgesetzte Abschaffung des Hochrisikopools für besonders teure Erkrankungen mit Diskussionen seit Einführung des Morbi-RSA im Jahr 2009 einher. Auch hier zieht sich der bereits erwähnte Riss zwischen AOKen und anderen Kassen durch das Lager der Kostenträger. Vor allem die Ersatzkassen fordern geschlossen die Wiedereinrichtung eines Hochrisikopools – und regen vereinzelt dafür eine Kostenschwelle von 100.000 Euro Behandlungskosten pro Jahr an (Barmer19, DAK21, TK13, KKH3, vdek16). Der AOK-Bundesverband fordert zumindest, den „Umgang mit Hochkostenfällen zur Ergänzung des RSA“ zu prüfen (AOK24).
Regio-RSA
Ein Thema, dass erst nach und nach in die Diskussion um die Zielgenauigkeit der verschiedenen Parameter zum Risikostrukturausgleich gefunden hat, ist der Blick auf die unterschiedlichen Versorgungskosten in regionaler Hinsicht. In der Regel ist es so, dass Versicherte in Regionen mit einer vergleichsweise dichten Versorgungsstruktur (wie beispielsweise in Ballungsräumen) höhere Leistungsausgaben generieren als Versicherte in vergleichsweise schwach versorgten Strukturen. Hieraus ergeben sich Nachteile für Krankenkassen, die überwiegend in Ballungsgebieten „am Markt“ sind, wie beispielsweise eine Reihe von Betriebskrankenkassen. Verwunderlich ist daher, dass der BKK Dachverband dieses Thema nicht aufgreift, sondern ausschließlich auf die Überarbeitung des Morbi-RSA fokussiert. Dieser Punkt scheint dem Verband so wichtig zu sein, dass die Verbandsführung vermutlich „kein neues Fass aufmachen“ wollte.
Umso wichtiger ist die Forderung nach einer „Versorgungsstrukturkomponente“ den Ersatzkassen, die dieses Kriterium nahezu ohne Ausnahme erwähnen (Barmer19, DAK22, TK13, vdek7). Allerdings ist dieser Regionalisierungsfaktor nicht mit bestimmten Forderungen einzelner Länder (vor allem Bayern) zu verwechseln, die sich gewissermaßen von einem Regio-RSA eine Flankierung des Länderfinanzausgleichs innerhalb des GKV-Systems erhoffen: Der Regio-RSA, wie ihn die Ersatzkassen in ihren Positionspapieren anregen, ist grundsätzlich „auf Kreisebene“ gedacht, granuliert also deutlich feiner als die politischen Landesgrenzen. In diesem Kontext sieht auch der AOK-Bundesverband bei einem möglichen Regio-RSA zumindest „Forschungsbedarf“ (AOK24).
Surrogate
Eine letzte, nicht zu unterschätzende Kategorie bei einer geänderten Justierung des Morbi-RSA sind die so genannten „Surrogate“ (eine Formulierung, die der Ersatzkassenverband in die Diskussion einführt – vdek22). Gemeint sind damit Ausgleichszahlungen, die im Zusammenhang mit den Morbiditäts-Kompensationen bereits über die manifeste Morbidität ausgeglichen werden. Auch hier ist deutlich zu sehen, dass die Kassenarten augenscheinlich aus der Analyse ihrer Zahlen offenbar erkennen können, welche Surrogate ihnen nützen – und welche nicht. Konsequent fordern also die Ersatzkassen die Zuschläge für die Erwerbsminderungsrente und die DMP-Pauschale zu streichen (KKH2/3, TK13, vdek22). Der AOK-Bundesverband will stattdessen eine morbiditäts- und einkommensorientierte Anpassung des Krankengeldes erreichen. Auch hier wird politisch entschieden werden müssen. Denn klar dürfte sein, dass die Ersatzkassen nach einer Neujustierung der Krankheitsauswahl (wie gefordert) auch wieder für eine Einführung der DMP-Pauschalen plädieren würden, wenn eine DMP-fähige Diagnose dann eventuell nicht mehr Morbi-RSA-relevant wäre... Gerade im Bereich der Surrogate wird also erkennbar, dass sich einzelne Kassenforderungen nicht an reiner Versorgungsvernunft orientieren, sondern an einem klar kalkulierten Blick auf den eigenen wirtschaftlichen Nutzen. Politik kann hier nicht „das Richtige“ tun, sondern nur mehr oder weniger großen Versichertenpopulationen mehr oder weniger schaden. Dieser Mut allerdings wird von den Beteiligten im gesamten Kontext des Morbi-RSA angemahnt, um vermeintlich oder tatsächlich bestehende Schieflagen möglichst rasch zu beseitigen.