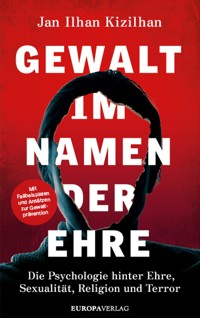
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Verbrechen aus "Ehre": Hintergründe und Strategien zur Prävention Obwohl sogenannte Ehrenmorde nur einen kleinen Teil der Tötungsdelikte hierzulande ausmachen, erschüttern sie uns besonders, wir sind kaum in der Lage, sie rational und emotional zu verstehen. Der Gedanke, einen womöglich sogar nahestehenden Menschen zu ermorden, nur um die vermeintliche Familienehre zu erhalten oder wiederherzustellen, macht uns rat- und fassungslos. Tatsächlich sind derart motivierte Taten in archaisch-patriarchalen, von Stammestraditionen bestimmten Gesellschaften am häufigsten zu finden, vor allem im Nahen und Mittleren Osten, in Pakistan und Afghanistan, aber auch in nicht-muslimischen Regionen in Indien, Lateinamerika oder Süditalien. Islamistische Terrororganisationen und die Mafia nutzen diesen Ehrbegriff ebenfalls als Legitimation, um Menschen zu töten, die nicht ihren Normen entsprechen, und Macht auszuüben. Im Zuge der Migration in dieser Tradition sozialisierter Menschen geschehen solche Taten zunehmend auch in Deutschland bzw. in Europa. Von politisch motivierten Organisationen werden Verbrechen dieser Art rasch aufgriffen, und die Debatte über Migration, Integration, Ausländer, Abschiebung etc. wird weiter angefacht. Schnell kommt es zu einer Polarisierung und zum Teil sogar Radikalisierung. Mögliche Ursachen und Hintergründe werden kaum diskutiert, sie sind politisch nicht von Interesse. Dass die Morde zu verurteilen und die Täter zu bestrafen sind, bedarf keiner Diskussion. Vielmehr geht es Jan Ilhan Kizilhan in Gewalt im Namen der Ehre um den Versuch, dieses "System" der "Ehre", der "Ehrenmorde", der Blutrache und der terroristischen Gewalt zu erkunden, damit präventives Handeln entsprechend darauf ausgerichtet werden kann mit dem Ziel, dass solche Gewalttaten in Zukunft nicht mehr passieren. Die Androhung von Haft- oder in manchen Ländern sogar der Todesstrafe reicht offenbar nicht aus. Dieses Buch liefert das vertiefte Wissen und Verständnis zu dem Thema, das es braucht, um Gewaltdelikten aufgrund eines übersteigerten Ehrbegriffs konstruktiv entgegenzutreten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Ilhan Kizilhan
GEWALT IM NAMEN DER EHRE
Die Psychologie hinter Ehre, Sexualität, Religion und Terror
1. eBook-Ausgabe 2024
© 2024 Europa Verlag in der Europa Verlage GmbH, München
Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock
Layout & Satz: Margarita Maiseyeva
Redaktion: Franz Leipold
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-629-7
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
Europa-Newsletter: Mehr zu unseren Büchern und Autoren
kostenlos per E-Mail!
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
DANKSAGUNG
EINFÜHRUNG
Ehrverletzung: ein weltweites Phänomen
Ehre in den verschiedenen Religionen und Gesellschaften
1. DIE SCHATTEN DER VERGANGENHEIT
Die Geschichte des Nahen Ostens
Ausbreitung und Entwicklung des Islams
Entwicklung des islamischen Rechtssystems
Übernahme traditioneller patriarchalischer Ehrvorstellungen
Indigene Kulturen im Nahen Osten
Einverleibung und Unterdrückung
»Osmanischer Zentrismus«
Aufleben in der Gegenwart
Eine Welt der Angst und Unsicherheit
Bedrohungen durch herrschende Mächte
Bedrohungen aus der Natur
2. DIE MACHT DER GESELLSCHAFT
Aliya – »Wenn mein Vater auf der Arbeit war […], dann ging es uns allen gut«
Ungleichheit, Hierarchie und Gehorsam als gesellschaftlicher »Rahmen«
Ungleichheit und Hierarchie als archaische Ordnungsprinzipien
Hierarchie und Gehorsam in Gruppen als Basis für Sicherheit
Solidargruppen in patriarchalischen Gesellschaften
Soziale Kontrolle
Suzan – »Für meine ›Fehlerᚲ fühlt sich die ganze Familie verantwortlich«
Familiäre Strukturen
Funktion und Strukturen von Familie
Familie als Rechtseinheit
Fatma – Paris, die Stadt der Liebe
Erziehung zum Gehorsam
Veränderung der sozialen Struktur und Erziehung im Krieg
Machtverhältnisse der Geschlechter
Die Beziehung zwischen Mann und Frau
Die Stellung der Frau im Islam
Verschleierung in islamischen Ländern
3. DIE MACHT DER FAMILIE
Ali Ibrahim – die Anatomie der Gewalt eines »Ehren-«Täters
Psychologische Erklärungen für Aggression und Gewaltbereitschaft
Unterdrückte, unkontrollierte Aggression
Ali – ohne Gewalt wird man als »ehrlos« abgestempelt
Lust an Gewalt und Aggression
Soziale Einflüsse – Ehr- und Schamverhalten
Strukturelle und kulturelle Gewalt
Krieg und gewaltsame Auseinandersetzungen
Dimensionen von »Ehre«
Die Ehre des Mannes
Roza – vergewaltigt, weil sie vergewaltigt worden war
Die Ehre der Frau
Die Ehre des Mannes in öffentlichen Beziehungen
Rechtsvorstellungen zu »Ehrenmorden« bzw. »Blutrachetaten«
Überdauern archaischer Rechtsvorstellungen
Rechtsverständnis von »Blutrachetaten«
Rechtfertigungen und Prinzipien zur Legitimierung von Gewalt
Tödliche Gerüchte
4. SEXUALITÄT ALS PATRIARCHALISCHES MACHTINSTRUMENT
Nur Schmerzen, Gewalt und Hass
Patriarchalische Normen und Wertvorstellungen zu Sexualität
Sexualität und Ehre
Sexualmoral im Islam
Sexualität und Geschlechterverhältnisse
Sexuelle Orientierung
Weibliche Genitalverstümmelung
Hataw – Schmerzen für eine Tradition, deren Grund niemand weiß
Verbreitung und Begründungen
Zwangsverheiratung
Gründe für Zwangsverheiratungen
Häufigkeiten und Formen
Zwangsverheiratung nach Vergewaltigung
Weitere Formen von Gewalt
Dilara – gegen den Willen der Familie: Durchbrennen
Tabuthema sexualisierte Gewalt
Sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen
Folgen für die Betroffenen
Sexualisierte Gewalt in Krieg und Terror
5. POLITISCHE UND RELIGIÖSE INSTRUMENTALISIERUNG DES BEGRIFFS EHRE
Hasan – wenn normale Männer töten
Der Begriff »Ehre« bei politischen und religiösen Organisationen
Das Märtyrertum in der islamisierten Ideologie
Weil sie sich liebten, mussten sie sterben
Gründe für die politisch-terroristische Gewaltbereitschaft
Nation, Blut und Ehre
Kriminelle und ihre »Ehre«
Der Mensch kann immer töten
Gewalt als Teil des menschlichen Zusammenlebens
»Ehre« als gemeinschaftliches Ordnungssystem
»Kultur der Gewalt«
6. ANSÄTZE ZUR PRÄVENTION
Mein Körper – seine »Ehre«
Ganzheitliche Gewaltprävention
Verhaltens- und Verhältnisprävention
Prävention von Gewalt »im Namen der Ehre«
Konfliktlösung bzw. -begrenzung in der »Übergangsphase«
Möglichkeiten der Vermittlung und Schlichtung durch Dritte
Voraussetzungen für Vermittler bzw. Schlichter
Gleichbehandlung aller Beteiligten
Voraussetzungen für eine gewaltfreie Konfliktlösung durch Kommunikation
Mittelaustausch und Einschalten einer höheren Hierarchie
Therapeutische und psychosoziale Hilfe
Bei Gewalt im familiären System
Bei Ehrverletzung durch sexualisierte Gewalt
Scham und sexualisierte Gewalt
Allgemeine therapeutische und traumapädagogische Interventionen bei sexualisierter Gewalt
Männerarbeit und Vorstellungen von Männlichkeit
»Es war normal zu schlagen«
Gewaltprävention mit zugewanderten Männern
Gewalt und Männlichkeit im Kontext von Migration
Die Kategorie Geschlecht als Bezugspunkt in der Männerarbeit
Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit
Förderung des gesellschaftlichen Wandels
Friedliches Zusammenleben durch demokratische Spielregeln
Migration und Vielfalt als Alltagsnormalität
Diversität in der Demokratie
Identität im Kontext kultureller Globalisierung
Identitäten in der Migration
Selbstfürsorge: Wie geht es den »Profis«?
Die schlimmen Erzählungen meiner Klienten werden zu Bildern in meinem Kopf
Ausblick
GLOSSAR
QUELLEN
ENDNOTEN
DANKSAGUNG
Es war nicht einfach, über Terror und Gewalt im Namen der Ehre zu schreiben. Als Menschen mit mir über ihre schlimmen Erfahrungen von Gewalt, Demütigung, Kränkungen, Ausgrenzungen bis zur Entmenschlichung sprachen, war ich irgendwann an der Grenze des Verstehens angelangt. Der gesunde Menschenverstand sagte mir immer wieder, »das kann doch nicht sein«, doch die Realität belehrte und belehrt mich immer wieder eines Besseren: »Ja, es passiert jeden Tag und überall!«
Daher gilt mein Dank insbesondere den vielen Menschen, die bereit waren, mir von ihren traumatischen Erlebnissen zu erzählen – ihnen ist dieses Buch gewidmet.
Abgesehen von vielen Forschungstheorien, Daten und Statistiken, waren vor allem die vielen Stunden, in denen ich mit vielen Betroffenen und Expert*innen gesprochen und diskutiert habe, für mich beeindruckend, emotional und lehrreich.
Auch Frauen, die mir besonders nahestehen, bin ich unendlich dankbar: meiner Frau Mona und meinen Töchtern Mira und Lori, die mir mit Geduld und viel Mühe eine andere Perspektive aufzeigten, die mir wahrscheinlich bis heute verschlossen geblieben wäre.
Danke meinen beiden Söhnen Heval und Robin, die das Glück haben, als Männer (fast) frei von patriarchalischen Strukturen, individuell, frei und solidarisch aufgewachsen zu sein.
EINFÜHRUNG
In den Medien weltweit wird immer wieder über sogenannte Ehrenmorde berichtet. Menschen ermorden andere Menschen, weil sie glauben, ihre persönliche Ehre oder die ihrer Familie sei verletzt worden. Die Täter geben an, sie hätten sich dazu gezwungen gesehen, diese Ehre durch den Mord wiederherzustellen. Menschen werden »im Namen der Ehre« ermordet, weil sie – tatsächlich oder vermeintlich – mit ihrem Verhalten gegen die tradierten Normen und Verhaltensregeln verstoßen und dadurch die Ehre verletzt haben. Für die Wiederherstellung der Ehre wird meist die physische Vernichtung der Person, die die Ehre verletzt haben soll, oder eines Mitglieds ihrer Familie gefordert.
Nicht nur archaisch-patriarchalische Familien und Gemeinschaften, sondern auch politische Gruppen und islamisierte Terrorgruppen bedienen sich des Ehrbegriffs. Sie legitimieren so unmenschliche Gewalttaten wie Geiselhaft, Versklavung, Köpfen und andere Formen der Ermordung von in ihrer Ideologie »unehrenhaften« Menschen.
Diese archaischen Weltanschauungen mögen veraltet und überwunden erscheinen, sie sind jedoch nach wie vor bei manchen Menschen tief verankert. In bestimmten Extremsituationen werden überflutende aggressive Emotionen aktiviert. Kommt gesellschaftlicher Druck hinzu, bleibt es nicht nur bei der emotionalen Überflutung, sondern die Emotionen werden ausgelebt. Andere Menschen werden von eigener Hand oder durch Handlanger ermordet. Die emotionale Bindung an diese Vorstellungen ist so stark und gegenwärtig, dass sogar Ehemänner, Brüder oder Väter ihre Ehefrauen, Schwestern oder Töchter töten. Im Falle einer Blutrache zwischen zwei Gruppen können Angehörige Hunderter Familien oder ganzer Gemeinschaften ohne ihr Zutun in diesen Konflikt verwickelt und in ihrer Grundsubstanz zerstört werden.
Patriarchalisch-archaische Vorstellungen haben sich in den letzten Jahren sowohl in den Herkunftsländern, wie in der Türkei, in Afghanistan, Marokko oder Ägypten, als auch in den Aufnahmeländern, wie beispielsweise in Deutschland, England oder Schweden, verstärkt. Die Zahl der getöteten Menschen im Namen der Ehre ist in den letzten Jahren gestiegen. Die ungeheuerlichen Formen von Gewalt erschrecken uns und machen uns rat- und fassungslos; wir sind kaum in der Lage, sie rational und emotional zu verstehen.
Von politisch motivierten Organisationen werden solche Taten rasch aufgriffen und dazu benutzt, die Debatte über Migration, Integration, Ausländer, Abschiebung etc. weiter anzufachen. Rasch kommt es zu einer Polarisierung und zum Teil sogar zu einer Radikalisierung, wie im aktuellen Konflikt zwischen der Hamas und Israel deutlich wird. Mögliche Gründe und Hintergründe werden kaum diskutiert, sie sind politisch nicht von Interesse. Dass die Morde zu verurteilen und die Täter zu bestrafen sind, bedarf meines Erachtens keiner Diskussion. Vielmehr geht es mir um den Versuch, dieses »System« der »Ehre«, der »Ehrenmorde«, der Blutrache und der terroristischen Gewalt zu erkunden, damit präventives Handeln entsprechend darauf ausgerichtet werden kann. Ziel muss sein, dass diese Gewalt und diese Ermordungen nicht mehr vorkommen, in Deutschland, Europa und weltweit. Scheinbar reichen die Androhungen der Rechtsstaatlichkeit mit Haftstrafen und sogar Todesstrafen nicht aus. Es braucht ein vertieftes Wissen und Verständnis zu diesem Thema.
In diesem Buch möchte ich versuchen, auf der Basis meiner zahlreichen Begutachtungen von Tätern und psychotherapeutischen Gespräche mit bedrohten Opfern Erklärungsmodelle anzubieten und Lebensvorstellungen zu beschreiben, die in Verbindung zu traditionellen Vorstellungen von »Ehre« stehen – auch um eine Grundlagendiskussion anzuregen. Neben Bezügen zu wissenschaftlichen Erkenntnissen möchte ich gleichzeitig tatsächliche Fallbeispiele vorstellen und diskutieren. Es geht dabei nicht darum, bestimmte Gruppen, Werte, Normen oder Religionen zu verurteilen oder in Misskredit zu bringen. Vielmehr sollen dieses rational so schwer fassbare Thema vor einem wissenschaftlichen Hintergrund analysiert und verschiedene Vorstellungen und Ideen vorgestellt werden, um daraus Ansätze für die Gewaltprävention auf politischer, gesellschaftlicher und praktischer Ebene abzuleiten.
Das Buch umfasst sechs Kapitel. Im ersten Kapitel werde ich auf die konfliktreiche Geschichte des Nahen Ostens eingehen, die das Fortbestehen patriarchalischer archaischer Gesellschaften und die Bewahrung der tradierten Werte und Normen bis in die Gegenwart einordenbar macht. Das zweite Kapitel widmet sich den gesellschaftlichen und familiären Strukturen dieser patriarchalischen archaischen Gesellschaften, die Gewalt im Namen der Ehre begünstigen bzw. als Teil der gesellschaftlichen Normen legitimieren. Im dritten Kapitel gehe ich auf psychologische und soziale Dynamiken und Erklärungsansätze für Aggressionen und Gewaltbereitschaft ein. Diese versuchen zu erklären, wie Menschen in der Lage sein können, selbst nahestehende Familienangehörige zu ermorden. Die Formen und Folgen der geschlechtsspezifischen und sexualisierten Gewalt, die durch die patriarchalischen archaischen Vorstellungen zu Geschlechterrollen und zu Sexualität legitimiert werden, stelle ich im vierten Kapitel dar. Der Begriff Ehre wird nicht nur in patriarchalischen archaischen Gemeinschaften verwendet, sondern er wird auch von politischen oder religiösen Organisationen instrumentalisiert, um die Gewaltbereitschaft zu fördern und Gewalt gegenüber anderen Gruppierungen zu legitimieren, wie es ganz aktuell im Konflikt zwischen der Hamas und Israel geschieht. Dem widmet sich Kapitel fünf. Im abschließenden sechsten Kapitel möchte ich schließlich Ansätze zur Prävention von Gewalt im Namen der Ehre auf der politischen, gesellschaftlichen und praktischen Ebene diskutieren und Anregungen sowie konkrete Handlungsorientierungen geben.
Ich verwende in diesem Buch bewusst das Wort »Ehrenmorde« und nicht Femizide, was für Gewaltverbrechen an Frauen steht, die durch ungleiche Geschlechterverhältnisse motiviert sind und einen Ausdruck des männlichen Dominanzbestrebens darstellen. Von »Ehrenmorden« sind, wenngleich deutlich weniger, auch Männer betroffen. Der Begriff beschreibt ein Phänomen, das seit Jahrhunderten existiert und das diese Gesellschaften in ihrem Narrativ nutzen. Dies bedeutet aber nicht, dass nicht in vielen Fällen, von denen ich hier berichte, auch der Begriff Femizide richtig wäre.
Ehrverletzung: ein weltweites Phänomen
Laut dem Weltbevölkerungsbericht der UNO werden alljährlich weltweit mindestens 5000 Mädchen und Frauen im Namen der Ehre ermordet. Diese sogenannten Ehrenmorde sind kein religiöses, sondern ein soziales Phänomen: Sie treten zwar häufig in islamisch geprägten Ländern auf, beschränken sich jedoch nicht auf diese. In manchen islamischen Staaten sind Ehrenmorde vollkommen unbekannt.
Auch Männer bringen sich im Namen der Ehre gegenseitig um, meistens spricht man in diesen Fällen von Blutrache. Von den im Bericht der UNO belegten Fällen von Ehrenmorden sind Mädchen und Frauen aus mindestens 14 Ländern betroffen, darunter Afghanistan, Bangladesch, Brasilien, Deutschland, Ecuador, Italien, Iran, Irak, Jordanien, Libanon, Palästina, Pakistan, Türkei … Die UNO geht davon aus, dass nur die wenigsten Fälle vor Gericht kommen, sodass die Dunkelziffer weitaus höher liegen muss. Nach Einschätzung der UNO bewegt sie sich zwischen 10000 und 100000 Fällen jährlich. Eine verlässliche Aussage kann jedoch nicht gemacht werden. Gleichzeitig hört man von vielen Menschenrechtsorganisationen, dass vielerorts wegen der spezifischen kulturellen Traditionen Verbrechen im Namen der Ehre von Richtern toleriert werden. In Ländern, wo das nicht so ist (wie z. B. in der Türkei), werden oft Minderjährige zur Tat angestiftet, um Strafmilderung zu erreichen.
In verschiedenen Gesellschaften international wurden bis weit in die 1990er-Jahre Ehrenmorde nicht als Menschenrechtsverletzungen behandelt, sondern als in die jeweilige nationale Gesetzgebung fallende »normale Verbrechen«. Erst auf Druck von zahlreichen Menschenrechtsorganisationen begannen in den letzten Jahren verschiedene NGOs (Non-Governmental Organisations – nichtstaatliche Organisationen), diese Problematik aus einer Menschenrechtsperspektive zu betrachten.
Im Jahr 2011 verabschiedete der Europarat ein »Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen«, im allgemeinen Sprachgebrauch als »Istanbuler Konvention« bezeichnet. 2021 verließ die Türkei die »Istanbuler Konvention«, seitdem stieg die Gewalt gegen Frauen jährlich an (vgl. Zimmer 2022). Im Jahr des Austritts, 2021, wurden nach Angaben der Plattform »Wir werden Femizide stoppen« 280 Frauen von Männern ermordet. Bei weiteren 271 Todesfällen stand der Verdacht im Raum, dass es sich um Femizide handelte – etwa, wenn Frauen während eines Streits mit dem Partner angeblich »plötzlich« vom Balkon gesprungen sein sollen.1 Nur ein Jahr später waren es bereits 334 Femizide und 245 Verdachtsfälle. Viele dieser ermordeten Frauen wurden von ihren Partnern in ihrem Zuhause getötet, obwohl sie zuvor versucht hatten, Schutz zu bekommen.2
Das Frauenzentrum in Diyarbakir3 berichtete bereits 2005, dass sich bis dahin 6902 Frauen bei ihnen wegen Gewalt in der Kern- oder Großfamilie gemeldet hatten. Nach den Angaben des Zentrums litten die Frauen zu 100% unter psychischen Problemen. Etwas 58% hätten physische Gewalt und 13,7% Vergewaltigungen erlebt. Über 65 Frauen mit einer starken Suizidalität hätten bei dem Zentrum Hilfe gesucht. Das Zentrum habe 63 Frauen, aus Angst, dass diese wegen möglicher Ehrverletzung und Blutrache getötet werden könnten, an einem unbekannten und sicheren Ort untergebracht. Laut TERRE DES FEMMES wurden 2022 mindestens 19 Personen Opfer eines mutmaßlichen (versuchten) »Ehren-«Mordes. Dabei starben sieben Personen, bei zwölf blieb es beim Mordversuch. Unter den Opfern waren 13 weiblich und sechs männlich. Sieben der 19 Opfer waren minderjährig, von ihnen wurden drei tödlich verletzt und starben.4 Leider sind die aktuellen Zahlen in der Türkei besorgniserregend. So wurden laut der türkischen Frauen-Föderation in den ersten drei Monaten 2024 insgesamt 114 Frauen getötet.5 In dem Bericht wird detailliert ausgeführt, dass 37 Frauen direkt von ihren Ehemännern getötet, 14 Frauen tot aufgefunden, 4 Frauen von ihnen bekannten Männern, 12 Frauen von Mitgliedern der eigenen Familie, 4 Frauen von ihren geschiedenen Ehemännern und eine Frau von dem Lebenspartner ermordet wurden. Bei den anderen Frauen sind die Täter nicht bekannt. Ein Jahr zuvor, also 2023, wurden 438 Frauen getötet. Davon waren 180 verheiratet, 102 ledig, 27 getrennt, 12 religiös verheiratet, und bei 117 war die Beziehung unklar. Die Frauen kamen durch Pistolen (196), scharfe Gegenstände (86), Sturz aus einer Höhe (36), Würgen (17) ums Leben bzw. bei 103 war die Todesursache unklar.6
Es ist aber auch festzuhalten, dass die toxischen Vorstellungen von Männlichkeit, Ehre, Besitz, Stolz und Herrschaft herkunftsübergreifend der Hauptgrund dafür sind, warum Männer zu Gewalttätern werden. Laut einer gemeinsamen Veröffentlichung des Familienministeriums und des BKA (Bundeskriminalamt) wurden im Jahr 2015 127457 Menschen in Deutschland Opfer von Gewalt (Mord und Totschlag, Körperverletzungen, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Bedrohung, Stalking) durch ihre Partner oder Ex-Partner, von den Betroffenen waren 82% Frauen. Davon wurden 11400 Opfer schwerer Körperverletzung, 331 von Mord oder Totschlag.7 Bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung in Partnerschaften sind die Opfer zu fast 100% weiblich, bei Stalking und Bedrohung in der Partnerschaft sind es fast 90%. Bei vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung sowie bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen sind es 80% (Partnerschaftsgewalt, kriminalstatistische Auswertung, BKA, 2015).8 Die Zahlen der Partnerschaftsgewalt stieg laut BKA im Jahr 2020 auf 143016, was u. a. mit der Pandemie im Zusammenhang gesehen wird.9
Diesen Zahlen sollte gleichermaßen unsere Aufmerksamkeit gelten, egal, ob die Gewalt im Namen der »Ehre« oder innerhalb eines »Familiendramas« geschieht. Und dennoch sind sogenannte »Ehrenmorde« eine andere Form von Gewalt und Beziehung. Wie kann es sein, dass ein Vater aufgrund geglaubter Norm- oder Werteverletzung seine zuvor geliebte Tochter töten kann? Wie kann ein Bruder seine eigene Schwester aus diesen gleichen Gründen töten und zu einem Mörder werden? Dies ist mehr als »nur« Gewalt. Eine tiefe archaische Vorstellung von Rationalität und Bosheit, gekoppelt mit Kultur und Religion, verändern den Menschen in seiner Psyche. Und so wird geglaubtes Fehlverhalten oder – in deren Sprache – eine »Ehrverletzung« mit psychischer und physischer Vernichtung bestraft.
Ehre in den verschiedenen Religionen und Gesellschaften
In den großen Religionen der Welt ist die »Ehre« ebenfalls Gegenstand vieler Diskussionen. So zeigt die Verwendung des Wortes Ehre in den Sprachen der Antike eine Gemeinsamkeit auf, die trotz unterschiedlichster Ehrbegriffe konstant ist: Ehre steht immer in Relation, im Verhältnis zu einer Größe, von der sie zuerkannt oder von der sie als Anerkennung empfangen wird. Ohne diese Beziehung ist Ehre nicht zu fassen. Diese Eigenschaft macht sie zugleich anfällig und ambivalent. In dem einen Lebensbereich kann sie zuerkannt, in einem anderen gleichzeitig aberkannt sein (z. B. politische Morde für die nationalen Interessen, Morden für die Befreiung, Religion etc.). Ehre existiert nicht absolut, sondern immer nur relativ, in Beziehung: zu den Menschen, zur Gemeinschaft, zu mir selber, zu Gott.
Die hebräische Bibel spricht vielfältig von Ehre und bezieht diese fast ausschließlich auf Gott. Ihm und nur ihm kommt Ehre zu: »Die Himmel erzählen die Ehre Gottes« (Psalm 16,11). Die biblische Rede von der Ehre ist aufs Engste mit der Rede von der Herrlichkeit Gottes verbunden, die beiden Begriffe werden synonym verwendet. Die Herrlichkeit strahlt in der Schöpfung auf, sie strahlt in Jesus Christus auf (Joh 1,14), deshalb geben alle Geschöpfe Gott Lobpreis und Ehre, Verherrlichung und Anbetung (Ps 19,1; Jes 6,3; Sir 43,1f). Und in diese Herrlichkeit, diese Ehre werden sie endgültig einbezogen sein, sie wird an ihnen offenbar werden (so Paulus in Röm 8,18). Gott gibt in Schöpfung, Erlösung und Vollendung Anteil an seinem Leben, wendet den Geschöpfen die Ehre des Daseins zu. Der Mensch »ehrt«, verherrlicht Gott, gibt Gott die Ehre, indem er ihm allein seine Achtung erweist, sein Staunen, Dank, Lob, Erschrecken und Anbetung. So ist »die Ehre [Gottes] … der lebendige Mensch«.
Solcherart abgeleitet von der Ehre, der Herrlichkeit Gottes, spricht die Bibel dann weiter von der Ehre des Menschen: »Der Herr gibt Gnade und Ehre« (Ps 84,12, Sir 1,11), das heißt, Gott erkennt sie zu. Nur darum aber kann im Land Ehre wohnen (Ps 85,10), ergibt sich eine Gemeinschaft, die auf Ehr-Erbietung beruht, und zwar untereinander, zueinander, zu den anderen Menschen. Die horizontale Ebene, die Beziehung zwischen den Menschen, wird bestimmt, ja eigentlich erst möglich, durch die vertikale Ebene, die Beziehung zwischen Gott und Mensch.
Die Ehre ist z. B. in Deutschland bis heute ein Rechtsgut, das durch das Strafrecht geschützt wird (§ 185– § 188 StGB). Ehrenrührige Behauptungen, Darstellungen und Meinungsäußerungen können mit Geld oder Freiheitsstrafen geahndet werden. Dabei steht dies, rechtlich gesehen, in einem Spannungsverhältnis zur Meinungsfreiheit (Artikel 5 Grundgesetz), die in der heutigen Gesellschaft für viel wichtiger erachtet wird als die persönliche Ehre. Dabei war die Ehre bis in die Neuzeit hinein ein persönliches Gut, das jeder auch persönlich zu schützen hatte. Versuche innerhalb der feudalen Staatsordnungen, den Schutz der Ehre in das staatliche Gewaltmonopol aufzunehmen, scheiterten trotz der Androhung allerhärtester Strafen. Bekannt sein dürften noch die zahlreichen Duelle aufgrund der Ehre, die bis in die 1920er-Jahre stattfanden. Zu mächtig war die Vorstellung, dass verletzte Ehre nur mit Blut abgewaschen werden kann. Ehrverlust führte zum Verstoß aus der Gemeinschaft und betraf Männer vor allen in Bezug auf mangelnde Tapferkeit und Frauen in Bezug auf mangelnde sexuelle Zurückhaltung. Aus diesen Tatsachen sind viele Tragödien entstanden, wirkliche persönliche und künstlerisch aufbereitete, die noch heute auf den Theaterbühnen aufgeführt werden.
Der Begriff »Ehre« ist etymologisch sehr alt und ursprünglich im religiösen Rahmen zu Hause. Aber schon im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung beschreibt Homer die Ehre als ein Wort aus der Kampfessphäre. Dem, der gewonnen hat, gebührte die Ehre. Verletzte bzw. beleidigte Ehre konnte schon damals nur im Kampf zwischen Männern wiederhergestellt werden. Ehre stand auch immer im Zusammenhang mit Besitz. Nur wer über Besitz verfügte, konnte Ehre haben. Je größer der Besitz, umso größer die Ehre. Die ritterliche Ehre des frühen und hohen Mittelalters stand der Bedeutung des Wortes in der homerischen Zeit noch sehr nah. Im 13. Jahrhundert bedeutete Ehre Anerkennung und Erfolg. Für Feudalherrn und Lehnsmann waren mit der Ehre auch vielseitige Verpflichtungen verbunden. Es gehörte zwingend zu einem gottgefälligen Leben, ehrbar zu leben und jedem seine standesgemäße Ehre zu erweisen.
Im 18. und 19. Jahrhundert stand dann auch das Bürgertum durch den gesellschaftlichen Aufstieg unter den strengen Regeln der Ehre und deren Verteidigung. Verschiedene Beispiele der Ehrverletzung werden sicherlich den Leser*innen durch den Kopf gehen. Man denke nur an eine öffentliche Beleidigung, Beschimpfung oder gar eine Ohrfeige. Die Öffentlichkeit ist ein wichtiges Element, das für den Drang und gesellschaftlichen Zwang zur Wiederherstellung der Ehre überaus wichtig ist. Wurde eine Beleidigung und Ehrverletzung in der Öffentlichkeit erfahren, ist es auch notwendig, die Ehre in der Öffentlichkeit wiederherzustellen. Es könnte sonst die Gefahr bestehen, von der Gesellschaft als schwach angesehen und ausgegrenzt zu werden. Zu Ehrverletzungen wurden und werden auch Misshandlung und Unterdrückung gezählt, um die gefährdete Familienehre zu schützen. Die Handelnden nehmen lieber eine lange Haftstrafe auf sich, als geächtet mit der Schmach zu leben. Sie stehen dabei unter einem enormen Zwang und handeln mitunter sogar gegen ihre eigene Überzeugung. Ehrenmorde werden von männlichen Familienmitgliedern ausgeführt, aber bei der Planung und Vorbereitung sind in vielen Fällen auch weibliche Familienangehörige beteiligt.
In diesem Buch werden viele reale Geschichten von Menschen wiedergegeben, damit die Leser*innen neben fundierter Theorie auch eine Vorstellung davon bekommen, was es bedeutet, Grausamkeiten aufgrund geglaubter Werte- und Normverletzung zu erleben, aber auch Täter dieser Grausamkeiten sein. Ich habe Namen und Orte geändert, damit die Menschen anonym bleiben und nicht gefährdet werden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Egal, wie sehr und wie schnell wir uns technisch und gesellschaftlich weiterentwickeln, die Erfahrungen und Lebensweisen unserer Vorfahren, ihre Normen und Werte »sitzen uns in den Knochen«. Sie sind tief verwurzelt in unserem kollektiven Gedächtnis, meist ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Unsere Vergangenheit spiegelt sich auch in den komplexen gesellschaftlichen Strukturen wider, die unserem Leben heute den Rahmen geben. Diese sind das Ergebnis einer jahrhundertelangen, wenn nicht sogar jahrtausendelangen Entwicklung. Wenn wir uns mit zum Teil brutalster Gewalt bis hin zu Ermordungen im Namen der »Ehre« beschäftigen, dann ist das Betrachten der gesellschaftlichen Macht- und Gewaltstrukturen in ihrer historischen Entstehung hilfreich für eine erste Annäherung.
In diesem Kapitel gehen wir der Frage nach, wie sich »Ehre« als Gewalt legitimierendes bzw. sogar einforderndes Konzept in manchen Gesellschaften entwickeln und verselbstständigen konnte. Wir versuchen zu verstehen, wie es sich so tief in das Bewusstsein von Millionen Menschen einprägen konnte, dass diese ihr Verhalten und Handeln danach ausrichten und sogar bereit sind, nahestehende Familienmitglieder dafür zu töten. Der Fokus der folgenden Kapitel liegt dabei auf dem Nahen Osten10.
Die Geschichte des Nahen Ostens
Ein Großteil des Nahen Ostens war über viele Jahrhunderte hinweg Teil des Römischen Reichs11. In dieser Zeit vor mehr als 2000 Jahren nahmen die Lebensweisen der römischen, aber auch der griechischen Gesellschaft Einfluss auf das nahöstliche städtische Leben, vor allem in den an das Mittelmeer angrenzenden Ländern. Die dortigen Eliten diskutierten die römische und griechische Philosophie, sie setzten sich mit der Literatur auseinander und praktizierten die Sprachen. Im Gegenzug nahmen die Römer verschiedene nahöstliche Rituale und Werte mit ins damalige »Zentrum der Welt« nach Rom. So hatten z. B. zahlreiche römische Soldaten die Mithrasreligion angenommen, die vor allem im persischen Raum stark verbreitet war. Sie versuchten, diese mit der römischen Kultur zu verbinden.
Im 4. Jh. n. Chr. veränderten sich die politischen und militärischen Machtkonstellationen, und das Machtzentrum verschob sich von Rom nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Unter Kaiser Konstantin wurden griechischsprachige Beamte eingesetzt. Die großen Städte im östlichen Mittelmeerraum, Antiochia in Syrien und Alexandria in Ägypten, wurden Zentren der griechischen Kultur. Etwa zur gleichen Zeit wuchsen die christlichen Enklaven, an manchen Orten war sogar die Mehrheit der Menschen christlich. Neben der jüdischen Religion und anderen Glaubensrichtungen floss auch der christliche Glaube, unterstützt durch den Kaiser, in die Kultur mit ihrer Symbolik und Lebensweise ein. Als Sprachen für die Verbreitung des Christentums dienten Armenisch in Ostanatolien, Syrisch in Syrien und Koptisch in Ägypten. Diese Entwicklung brachte Spannungen und Konflikte mit sich. Der Einfluss und die Macht der Bischöfe weiteten sich aus, und mit der Zeit übernahmen sie die weltliche Macht des Kaisers. An den Randgebieten ihrer Machtzentren entstanden immer wieder Konflikte zwischen Anhänger*innen des Christentums und den bestehenden Naturreligionen. Auch innerhalb des Christentums selbst kam es zu Spaltungen, und es entstanden verschiedene Glaubenskirchen.
Im Osten, das heißt auf der anderen Seite des Euphrats, lag zu dieser Zeit das Sasanidenreich. Es reichte vom heutigen Iran und Irak bis nach Zentralasien. Unter der Herrschaft der Sasaniden lebten zahlreiche unterschiedliche Kulturen und ethnische Gruppen, zum Teil durch Wüsten, Steppen und Berge voneinander getrennt. Die Sasaniden errichteten einen Familienstaat mit einer hierarchisch gegliederten Beamtenschaft. Sie versuchten, Loyalität und Einheit zu schaffen, indem sie die altiranische Religion wieder zum Leben erweckten, die auf den Religionsstifter Zarathustra, auch Zoroaster genannt, zurückgeführt wird. Zarathustra gilt als erster Prophet in diesem Gebiet, der das System von Gut und Böse entwickelt und verbreitet hatte. Er ging davon aus, dass es, bezogen auf das ganze Universum, einen Kampf zwischen bösen und guten Kräften gibt. Die guten Kräfte würden schließlich gewinnen, durch die Kraft tugendhafter Menschen. Die Religion des Zarathustra geht, unterschiedlichen Angaben zufolge, zurück bis ca. 2400 oder ca. 600 v. Chr. Die Sasaniden nutzten diese Religion als ein Instrument, um die verschiedenen Gruppen in ihrem Herrschaftsgebiet zu vereinigen.
Weiter südlich, zu beiden Seiten des Roten Meeres, grenzten andere Gesellschaften an, die von Landwirtschaft und Handel lebten und durch traditionelle Machtstrukturen organisiert waren. Westlich des Roten Meeres lag Äthiopien, ein altes Königreich mit dem koptischen Christentum als Staatsreligion; östlich davon, im Südwesten der Arabischen Halbinsel, lag der Jemen. Der Jemen hatte eine eigene Sprache, die sich vom Arabischen unterschied, das sonst überall in Arabien gesprochen wurde. Er hatte außerdem eine eigene Religion mit Priestern und einer Vielzahl von Göttern. Der größere Teil der Arabischen Halbinsel bestand aus Steppengebieten oder Wüste mit Oasen. Die Menschen dort sprachen verschiedene arabische Dialekte und unterschieden sich auch in ihrer Lebensweise voneinander. Ein Teil lebte als Nomaden mit Tierherden aus Kamelen, Schafen oder Ziegen, die im Umkreis der spärlichen Wasserstellen in der Wüste weideten. Daneben gab es sesshafte Bauern, die in den Oasen Getreide anbauten und Palmen pflanzten, sowie Händler oder Handwerker, die in kleinen Ortschaften lebten. Zwischen den verschiedenen Gruppen gab es immer wieder Konflikte und Kämpfe um die spärlichen Weiden, Wasserstellen oder Oasen. Die politische Situation auf der Arabischen Halbinsel war instabil. Daher war die Loyalität zur Familie oder zum Stamm lebensbestimmend. Insbesondere für die Nomaden war der Zusammenschluss zu Stämmen Voraussetzung für das Überleben. Als ein Ausdruck für Zusammenhalt und Loyalität galt dabei der charakteristische Dialekt der gemeinsamen Herkunft.
Die Stammesführer hatten einen enormen Einfluss auf das gesellschaftliche und familiäre Leben, sie regelten das Handeln und Verhalten der Stammesmitglieder bis in die kleinste Angelegenheit der Familien hinein. Ihre Macht ging meist von den Oasen aus, wo sie enge Verbindungen zu den Kaufleuten unterhielten, die den Handel im Stammesgebiet organisierten. In der vorislamischen Zeit hatten die Religionen in diesem Gebiet offenbar keine klaren Formen und waren sehr mit Naturphänomenen verbunden. Man sah in Steinen, Bäumen, Felsen und anderen Gegebenheiten der Natur die Verkörperungen örtlicher Gottheiten; auch wurden Gestirnkulte praktiziert. Gute und böse Geister, sogenannte Dschinn, durchzogen nach diesen Vorstellungen die Welt in Gestalt von Tieren und anderen Wesen (vgl. Çinar 2007).
Mit dem Beginn des 7. Jh. n. Chr. änderte sich vieles im Nahen Osten. Das Byzantinische Reich, das sich aus dem östlichen Teil des Römischen Reichs entwickelt hatte, und das Sasanidenreich führten lange Kriege gegeneinander, die mit Unterbrechungen von 540 bis 629 n. Chr. andauerten. Die hauptsächlichen Kampfgebiete dieser Kriege lagen im heutigen Syrien und Irak. Das Sasanidenreich führte gleichzeitig auch einen Krieg gegen das Jemenitische Reich und konnte sich letztendlich nicht behaupten. Zudem besiedelten zunehmend Araber weite Gebiete Iraks und Syriens und brachten ihre gesellschaftlichen Organisationsformen mit. Manche der Stammesführer, die ihre Macht von Oasenstädten ausgehend ausübten, hielten im Auftrag der Reichsregierungen andere Nomaden von den besiedelten Gebieten fern und zogen Steuern ein. So konnten diese Reiche nach außen hin stabilere politische Gemeinschaften schaffen. Die »kulturelle Autonomie« blieb erhalten, damit aber auch der Kulturwechsel und -austausch zwischen den vielen Gruppen mit unterschiedlichen Lebensvorstellungen und Werten.
In der Mitte des 7. Jh. n. Chr. begann sich eine neue politische Ordnung im Nahen Osten zu etablieren, die sich rasch über die gesamte Arabische Halbinsel, das ganze Sasanidische Reich und einen Großteil des Byzantinischen Reichs im Osten, vor allem Syrien und Ägypten, ausbreitete. Diese neue Herrschaft entwickelte und rekrutierte sich nicht in Byzanz, Griechenland, Rom oder Persien, sondern im westlichen Arabien, zu einem großen Teil in Mekka, einer Stadt im heutigen Saudi-Arabien. Diese Herrschaft legitimierte ihre gesellschaftliche Ordnung durch eine göttliche Offenbarung, die Mohammed zuteilwurde. Diese bildete die Grundlage für den Islam und wurde in Form eines heiligen Buches, des Korans, verschriftlicht. Mohammed versuchte, durch die Verbreitung seiner Lehren eine neue Gemeinschaft mit alten und neuen Regeln zu gestalten. Allerdings war bei der »islamischen Eroberung« immer auch Gewalt dabei. Viele Gemeinschaften konvertierten zum Islam, behielten aber ihre präislamischen Rituale bei oder wurden in diesen durch den Islam bestärkt.
Ausbreitung und Entwicklung des Islams
Auf das Leben Mohammeds und auf den Islam an sich wird im Folgenden nur insoweit eingegangen, wie es für ein Verständnis der Vorstellungen von »Ehre« wichtig ist. Es geht dabei nicht darum, den Islam in irgendeiner Weise infrage zu stellen. Vielmehr soll Wissen darüber vermittelt werden, welche »Reise« der Begriff »Ehre« genommen hat und wie er auch im Islam verstanden und umgesetzt wird, da wir vor allem aus vielen islamisch geprägten Ländern von »Ehrverletzungen« und »Ehrenmorden« hören.
Der Islam war fast von Beginn an eine machtpolitische »Erfolgsgeschichte«. Nachdem Mohammed und seine muslimischen Gefolgschaften in Mohammeds Heimatstadt Mekka unter starken Druck geraten waren, konnten sie nach der Auswanderung nach Medina, ca. 350 km nördlich von Mekka, im Jahr 622 n. Chr. dort die weltliche Herrschaft übernehmen. Von Medina aus verbreitete sich der Islam innerhalb weniger Jahre über die gesamte Arabische Halbinsel. Nur 100 Jahre später reichte der Herrschaftsbereich der islamischen Staatsgewalt von Spanien bis Indien und vom Kaukasus bis zur Sahara. Die Ausbreitung der religiösen Gemeinschaft war immer auch mit der Ausbreitung der weltlichen Herrschaft verbunden. Dieser Umstand hat die Entwicklung des Islams ebenso nachhaltig beeinflusst wie die Vielgestaltigkeit der Lebensverhältnisse in dem riesigen Herrschaftsgebiet.
Für die militärische Ausbreitung des von Muslimen beherrschten Territoriums wird in den klassischen Interpretationen des Korans vielfach der Begriff »Cihad« verwendet, der heute zum Teil mit »Heiliger Krieg« übersetzt wird. Der Begriff ist sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart sehr stark politisch instrumentalisiert worden. Ein Beispiel dafür ist der von Saddam Hussein erklärte Krieg gegen den Iran und Kuwait, den er zum »Cihad« ausrief. Viele Islamgelehrte verstehen den Cihad eher als einen Kampf gegen die eigenen schlechten Eigenschaften im Menschen. Zum anderen wird auch vom »kleinen Cihad« gesprochen, im Sinne des Kampfes zur Verteidigung gegen Aggressoren, ein Abwehrkampf, der aber selbst zur Aggression ausufern kann, so das Islamische Zentrum in Hamburg 1984.
Entwicklung des islamischen Rechtssystems
Das Wort »Islam« im eigentlichen Sinne heißt »Unterwerfung unter Gott«. Diese Unterwerfung wird umfassend verstanden. Sie betrifft die innere Glaubensüberzeugung ebenso wie die religiöse Praxis und die Lebenspraxis, die sowohl auf das Diesseits wie auch auf das Jenseits ausgerichtet sind. Entsprechend gibt es im Islam einen gemeinsamen Oberbegriff für Religion und Recht, den Begriff »Scharia«. »Scharia« bedeutet so viel wie der »gebahnte Weg« und umfasst mehr, als mit der häufigen Übersetzung »islamisches Recht« ausgedrückt wird.
Das Regel- und Sanktionssystem der Scharia beruht auf Bewertungen (Geboten), Erlaubnissen und Verboten sowie auf Empfehlungen und Missbilligungen. Diese betreffen sowohl die Beziehungen von Menschen und anderen Rechtssubjekten untereinander wie auch deren Verhältnis zu den Trägern der Rechtsordnung, was heute vor allem der Staat und seine Organe sind. Es stellt eine Verbindlichkeit für die gesamte menschliche Lebensführung dar und beansprucht, dass der zugrunde liegende Bestand von Geboten und Verboten nicht nur religiös, sondern auch durch die Rechtsgebung gesellschaftlich verankert ist. Rein religiöse Vorschriften sind im Gegensatz dazu nicht rechtlich erzwingbar, sondern allenfalls durch sozialen Druck. Ihre Missachtung hat neben sozialen nur jenseitige Folgen, sofern nicht der Staat aus Gründen der öffentlichen Ordnung auch diesseitige Sanktionen vorsieht.
In diesem umfassenden Geltungsanspruch unterscheidet sich der Islam im Grunde nicht vom Christentum oder von anderen Religionen. Das Vorhandensein religiöser und rechtlicher Regelungen bedeutet zudem nicht, dass nicht zwischen beiden getrennt werden könnte (vgl. Rohe 2013). In einigen Ländern des Nahen Ostens wird der Islam bzw. die Scharia jedoch als Instrument eingesetzt, um bestimmte politische Interessen durchzusetzen. In der Türkei versuchte beispielsweise die islamisch geprägte Regierungspartei AKP (»Adalet ve Kalkınma Partisi«, türkisch für »Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung«) 2004 die außereheliche Beziehung nach dem Vorbild des Islams unter Strafe zu stellen, ließ dies jedoch aufgrund zahlreicher Proteste im In- und Ausland und wegen der angestrebten EU-Mitgliedschaft wieder fallen.
Insgesamt lässt sich als Exkurs hier festhalten, dass von den heute weltweit 50 muslimischen Ländern etwa 30 Länder eine Verfassung haben, die sich strikt oder zum Teil auf die Scharia als Rechtsquelle berufen. Alle diese Länder sind autoritär geführt, Frauen haben in ihnen deutliche Nachteile, Menschen werden als Strafe ausgepeitscht oder hingerichtet.12 Im Iran werden insbesondere Frauen schwer bestraft oder gar getötet, wenn sie sich für ihre Freiheit und gegen die Unterdrückung durch das Patriarchat im Namen der Scharia wehren. So wurden nach den Protesten, nachdem die 22-jährige Kurdin Jina Mahsa Amini am 16. September 2022 in Polizeigewahrsam gestorben war und Tausende Frauen im Iran ihr Kopftuch als Zeichen der Unterdrückung ablegten, die Verschleierungsgesetze laut der UNO verstärkt.13 Frauen in Afghanistan werden vom Bildungssystem ausgeschlossen, und Bilder von Steinigungen lassen einen den Atem stocken und sprachlos werden.
Ein Großteil des klassischen islamischen Rechts der sunnitischen und schiitischen Glaubensrichtungen beruht auf »sekundärer Rechtsempfindung« durch Auslegung und Schlussfolgerung, also auf menschlicher Logik. In der Frühzeit des Islams, nach dem Tod Mohammeds im Jahr 632 n. Chr., mussten die rechtlichen Angelegenheiten des neu entstandenen und expandierenden islamischen Reichs zunächst mit viel Improvisation geregelt werden. Unmissverständliche rechtliche Vorgaben gab es nur wenige. Deshalb hatte die verstandesgestützte Rechtsempfindung viel Raum. Gleichzeitig war es das Bestreben der muslimischen Gemeinschaft, auch diesen Bereich stärker zu systematisieren. Bis zum 9. Jh. bildeten sich mehrere Rechtsschulen heraus, die sich in ihrer Autorität gegenseitig anerkannten. Sie widmeten sich zwei für das Verständnis des islamischen Rechts wichtigen Lehrbereichen, den Rechtsquellen sowie den Rechtsfindungsmethoden. Bei der Rechtsfindung im Hinblick auf das islamische Recht (Rohe 2013) geht es nicht um eine rein juristische, sondern vielmehr um eine normative Lehre. Es geht hier um »Normen«, um allgemein ethisch-religiöse Regeln, bei denen eine Vorstellung vom richtigen, im Sinne von gottgefälligem Handeln mitgedacht werden soll (vgl. Rohe 2013). Die islamische Normenlehre ist sowohl mit weltlichen als auch mit religiösen Dimensionen menschlichen Daseins verwoben. Sie bietet so eine Projektionsfläche, die in hohem Maße anfällig für Fehldeutungen und Verkürzungsfehler ist, wenn sie nicht als ganzheitlicher Komplex wahrgenommen und erklärt wird. Diese »Normen« können natürlich sehr subjektiv ausgelegt und zur politischen Instrumentalisierung genutzt werden, wie wir das heute im Iran, in Saudi-Arabien, Afghanistan etc. beobachten.
In seiner Bedeutung als Rechtsquelle unumstritten war und ist nur der Koran. Diese erste Rechtsquelle wird ergänzt durch die Worte und Taten Mohammeds, die die zweite Quelle darstellen. Schon diese war und ist nicht ohne Schwierigkeiten handzuhaben und wird von Sunniten und Schiiten unterschiedlich gesehen. Nach dem Tod Mohammeds wurde eine Vielzahl gefälschter angeblicher Überlieferungen über ihn in die Welt gesetzt, mutmaßlich um sich Vorteile zu verschaffen.
Gleichzeitig waren die Nachfolger Mohammeds gezwungen, verschiedene archaische und patriarchalische Wertvorstellungen und Strukturen, die in einigen ursprünglichen Kulturen in dem großen Herrschaftsgebiet des Islams Bestand hatten, in die Rechtsauslegung mit einzubeziehen. Nur so konnten die Menschen gewonnen und das Einflussgebiet ausgeweitet werden. Diese beeinflussten auch die Vorstellungen und Haltungen des Islams zu Sexualität und deren Verknüpfung mit einem archaischen und patriarchalischen Verständnis von »Ehre«, was später noch ausführlich beschrieben wird.
WICHTIG
Auch wenn dieses Verständnis von Ehre nicht seinen Ursprung in der islamischen Denkweise hat, so ist es doch zweifelsfrei ein Bestandteil des Islams geworden. Je nach kultureller Entwicklung und konservativer Haltung werden diese Formen von Ehre weiterhin praktiziert, wie die zahlreichen »Ehrenmorde« in Europa und weltweit zeigen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Islam bzw. die islamische Gemeinschaft diese »Ehrenmorde« begrüßt oder unterstützt. Vielmehr glauben manche Muslime, dass diese zur islamischen Religion gehörten. Gleichzeitig gibt es in den verschiedenen Ländern der Welt aber auch unterschiedliche nicht islamische Gruppen, wie orientalische Christen, Eziden, Ahl-Haqs, Zarathustra etc., die ähnliche Vorstellungen von Ehre haben und bei einer Ehrverletzung auch die Tötung oder Verletzung eines Menschen als eine Wiederherstellung der Ehre betrachten.
Übernahme traditioneller patriarchalischer Ehrvorstellungen
Die islamische Eroberung, also eine politische Machtübernahme im Namen der Religion, wurde in der Anfangszeit des Islams nicht als Widerspruch gesehen. Der Islam verstand sich immer als eine gesellschaftsformende und -entwickelnde Kraft, die keine Teilung von Religion und Staat vorsah. Neben dem Kampf nach außen wurde genauso erbittert ein Kampf innerhalb des Islams zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen geführt. Dieser brachte zahlreiche Kriege mit sich und Tötungen von Kalifen, die die Nachfolge Mohammeds antreten wollten. Die bestehenden Stammesführer in den eroberten Gebieten wurden in ihrer Position anerkannt und für die jeweiligen innerislamischen Kämpfe als Verbündete genutzt. Im Gegenzug wurden ihre patriarchalischen Stammesstrukturen und Vorstellungen von »Ehre« toleriert.
Der Einfluss der Kalifen und ihrer Vertreter war selbst auf dem Höhepunkt ihrer Macht begrenzt. Er erstreckte sich hauptsächlich auf die Städte und die sie umgebenden fruchtbaren Gebiete. Entlegene Bergregionen und Steppengebiete waren praktisch nicht zu unterwerfen. Die Beziehungen zwischen den bestehenden Gemeinschaften und Stämmen der Bauern und Nomaden waren, wie schon beschrieben, instabil und geprägt von Konflikten. Unterschiedliche Interessen, wie zum Beispiel bezüglich Weiden, Wasserstellen oder Handelswegen, sowie unterschiedliche Lebensbedingungen und Wertvorstellungen führten immer wieder auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Bergvölker, die den Kampf nicht gewinnen konnten, zogen sich weiter in die Berge zurück und hielten an ihren traditionellen Riten und Werten fest, die bis heute in den verschiedenen Bergregionen des Nahen Ostens zu beobachten sind. Ohne Eingriffe und Einflüsse von außen führten die ökonomischen und gesellschaftlichen Prozesse in solchen ländlichen Gegenden oft zum Fortbestehen der patriarchalischen Gesellschaftsformen, die stark »tribal«, also durch das Zusammenleben als »Stamm«, geprägt waren.
Die fundamentale Einheit in Nomaden- und Dorfgemeinschaften war die Kernfamilie über drei Generationen: Großeltern, Eltern und Kinder. Sie lebten gemeinsam in einem aus Stein oder Lehm erbauten Haus im Dorf oder in einem gewebten Zelt als Nomaden. Die Männer waren für die Landwirtschaft, die Bearbeitung der Felder und die Viehzucht zuständig, die Frauen für den Haushalt und die Erziehung der Kinder. Aber auch die Kinder halfen bereits auf den Feldern oder betreuten die Herden. Kontakte zur Außenwelt waren den Männern vorbehalten. Es ist davon auszugehen, dass sich die Wertvorstellungen und Normen, die in dem traditionellen patriarchalischen Konzept von »Ehre« zum Ausdruck kommen, bereits vor dieser Zeit entwickelt hatten. Dieser »Ehrenkodex« hatte schon immer eine größere Bedeutung für die Menschen in den ländlichen Gebieten als für diejenigen in den Städten. Er diente zur Sicherung und Stabilisierung der Dorfgemeinschaft, auf die wir später noch eingehen werden (siehe Kapitel 2, Die Macht der Gesellschaft).
Die Frauen waren in den meisten Gebieten verschleiert und den Männern untergeordnet. Nach weit verbreitetem Brauch – allerdings nicht nach islamischem Gesetz – gehörte der Grundbesitz dem Mann und wurde von ihm an die männlichen Nachkommen vererbt. Die Ehre des Mannes verlangte, dass er seinen Besitz verteidigte und die Ansprüche der Mitglieder seines Haushalts, seiner Sippe oder einer größeren Gruppe, der er angehörte, erfüllte; die Zugehörigkeit zu einem größeren Ganzen gereichte dem Einzelnen zur Ehre.
Die Frauen der Familie – Mutter, Ehefrauen, Schwestern, Töchter, Schwiegertöchter – standen unter seinem Schutz. Gleichzeitig war von diesem Schutzauftrag auch seine Ehre abhängig. Sie konnte »befleckt« werden durch (angeblich) mangelnde Keuschheit der Mädchen und Frauen bzw. durch ein Verhalten, das bei Männern, die keine Ansprüche auf sie hatten, Gefühle wecken und so die soziale Ordnung infrage stellten könnte. In die Achtung eines Mannes vor den Frauen seiner Familie mischte sich deshalb unter Umständen ein gewisser Argwohn oder sogar Furcht, da sie eine Gefahrenquelle sein konnten. Wurde eine Frau älter, konnte sie als Mutter von Söhnen oder als Hauptfrau (nach den Regeln des Islams kann ein Mann bis zu vier Frauen heiraten) an Autorität gegenüber den jüngeren Frauen der Familie gewinnen, aber auch gegenüber den jüngeren Männern.
In der Regel war die Kernfamilie weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich selbstständig in ihren Entscheidungen. Sie war entweder direkt in die Großfamilie integriert oder mit der Sippe verbunden, beides gleichzeitig war ebenfalls möglich. Die Verbundenheit zu den Verwandten bis zur fünften zurückliegenden Generation führte zu bestimmten Aufgaben und Pflichten. Bei der Bedrohung eines Mitglieds der Sippe waren alle anderen Mitglieder verpflichtet, ihre Hilfe anzubieten und sich notfalls an einem Kampf gegen die bedrohende Gruppe zu beteiligen. In Dorfgemeinschaften ging die patriarchalische Organisation so weit, dass auch die Nutzung der Felder und die Wasserverteilung von möglicherweise in der Nähe liegenden Flüssen genau organisiert wurde. Dem Stamm stand in der Regel ein Viertel aller Einkünfte einer Familie zu, was natürlich zur wirtschaftlichen und politischen Stärkung des Stammesführers führte, der im Gegenzug für den Schutz des Stammes verantwortlich war. Zwischen den beiden Grundformen der sozialen Einheit – die eine basierte auf verwandtschaftlichen Beziehungen, die andere auf gemeinsamen Interessen – bestand eine komplexe Beziehung. In schriftlosen Gesellschaften erinnerten sich nur wenige Menschen an die fünf Generationen ihrer Vorfahren, und es war deshalb eher ein symbolischer Ausdruck gemeinsamer Interessen, Anspruch auf eine gemeinsame Abstammung zu erheben; man wollte der Gruppenzusammengehörigkeit dadurch eine Stärke geben, die sie sonst nicht gehabt hätte (vgl. Hourani 2000). Der Stamm konnte einen Gemeinschaftsgeist erzeugen, der seine Mitglieder dazu brachte, sich in Notzeiten gegenseitig beizustehen. Er hatte potenziell Einfluss auf ihr Handeln, beispielsweise wenn Gefahr »von außen« drohte oder sie gezwungen waren auszuwandern. Die Zugehörigkeit zu einem Stamm wurde in erster Linie durch einen gemeinsamen Dialekt und Namen ausgedrückt. Und alle, die einen gemeinsamen Namen trugen, teilten auch den Glauben an das gleiche hierarchische Ehrsystem.
Die islamischen Eroberer waren natürlich daran interessiert, fruchtbare Böden zu bewirtschaften und regelmäßige Einkünfte für den Staat zu bekommen, was bei den Nomaden schwieriger war als bei den sesshaften Bauern. Frühere Grundbesitzer wurden entweder enteignet oder gingen in der neuen herrschenden Klasse auf, die Bauernschaft aber blieb. Soldaten und Einwanderer siedelten sich auf dem Land oder in den neu gegründeten Städten an. Diese neue gesellschaftliche Form hatte etwa bis zum 11. Jh. Bestand, bis sie durch türkische Nomadenstämme aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Diese drangen zunächst in den Iran ein und erweiterten ihr Gebiet bis nach Anatolien. Später entwickelte sich hier das Osmanische Reich, das über 500 Jahre das Leben im Nahen Osten und auch in Europa beeinflussen sollte.
Indigene Kulturen im Nahen Osten
In einem über Jahrhunderte hinweg erbittert geführten Kampf um die kulturelle Vorherrschaft im Nahen Osten wurden die indigenen Kulturen weitgehend zerstört bzw. deformiert. Es blieben nur wenige Spuren von ihnen übrig, die zudem oft von den Eroberern verfälscht wurden; oder sie übernahmen die indigenen Kulturen nach außen hin als ihre eigenen, ohne den Geist und den wahren Hintergrund einer lebendigen Kultur zu erkennen und diese wirklich zu leben.
An dieser Stelle seien beispielhaft für viele indigenen Völker die Eziden





























