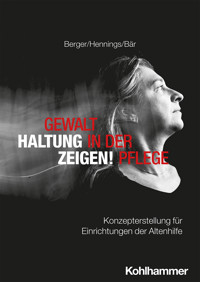
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Gewalt ist ein Thema, das in allen Bereichen der Pflege präsent ist. Wenn ein Vorfall eintritt, sind Leitungen, Mitarbeitende, Betroffene und deren Angehörige meist unvorbereitet. Die Folgen sind Scham, Angst, Verunsicherung und Überforderung sowie die Frage, was nun zu tun ist. Dieses Buch bietet eine praxisnahe Aufbereitung des Themas Gewalt in der Pflege, basierend auf einem Projekt der Wilhelmshilfe e. V. Im Jahr 2019 wurde der Altenhilfeträger mit Gewaltvorfällen an Bewohnern mit schwerer Demenz konfrontiert, was zur Verurteilung einer Mitarbeiterin u. a. wegen sexuellem Missbrauch führte. Dieser Vorfall war Auslöser für einen umfassenden Organisationsentwicklungsprozess, der das Thema Gewalt in den Blick nimmt und in diesem Buch beschrieben wird. Ziel des Buches ist es, Wissen zum Thema Gewalt in der Pflege zu vermitteln und aufzuzeigen: Gewalt kann alle Akteure betreffen! Im praktischen Teil werden Verfahren zur Erkennung und Prävention von Gewalt in der Altenhilfe vorgestellt und erläutert, wie man bei Gewaltvorfällen vorgehen kann. Die Erkenntnisse sollen Einrichtungen dabei unterstützen, ein eigenes Konzept zum Umgang mit und zur Prävention von Gewalt zu entwickeln, denn um Gewalt in der Pflege aus der Tabuzone zu holen, ist die Entwicklung einer Haltung notwendig, die im Alltag spürbar wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Zum Anfang steht der Dank!
Geleitwort von Angelika Zegelin
Geleitwort von Kornelius Knapp
Einführung – wie eine Krise den Alltag verändern kann
Anlass für dieses Buch
Wie ist das Buch aufgebaut oder Wege zur »Halt!(-ung)«
Teil I
1 Gewalt – Definition – Oder: worüber sprechen wir eigentlich?
1.1 »Gewalt in der Pflege« – eine gemeinsame Definition finden
1.2 Die Definition der Wilhelmshilfe
1.3 Fazit und To Do´s
2 Wie äußert sich Gewalt im Alltag?
2.1 »Gewaltdreieck nach Galtung« – Wechselwirkungen erkennen und verstehen
2.2 Wie zeigt sich Gewalt im Alltag (der Pflege)?
2.3 Fazit und To Do´s
3 Anzeichen und Vorboten von Gewalt
3.1 Anzeichen von Gewaltausübung gegenüber Bewohner*innen/Klient*innen
3.2 Anzeichen von Gewaltausübung gegenüber Mitarbeitenden/Angehörigen
3.3 Vorboten von Gewaltbereitschaft von Mitarbeitenden
3.4 Vorboten von Gewaltbereitschaft von Angehörigen
3.5 Fazit und To Do´s
4 Gewaltfallen
4.1 »Die Skandalisierungsfalle«
4.2 »Die Inflationsfalle«
4.3 »Die Umdeutungsfalle«
4.4 »Die Moralisierungsfalle«
4.5 »Die Normalisierungsfalle«
4.6 »Die Reduktionsfalle«
4.7 Fazit und To Do´s
5 Erklärungsmodelle – wie erklärt man sich, dass Gewalt ausgeübt wird?
5.1 Intrapersonale Theorien
5.2 Interpersonale Theorien
5.2.1 Stresstheorie
5.2.2 Theorie des sozialen Austauschs
5.2.3 Die Theorie der dyadischen Uneinigkeit
5.2.4 Theorie des Sozialen Lernens
5.2.5 Bidirektionale Theorie
5.3 Soziokulturelle Theorien
5.4 Multisystem Theorien
5.5 Fazit und To Do´s
6 Gewaltkonstellation Bewohner*in gegenüber Bewohner*in
6.1 Formen von Gewalt von »Bewohner*in gegenüber Bewohner*in«
6.2 Prävalenz Gewaltkonstellation »Bewohner*in gegenüber Bewohner*in«
6.3 Auslöser und Risikofaktoren sowie mögliche Strategien
6.3.1 Umwelt und Organisationsbezogene Auslöser und Risikofaktoren
6.3.2 Bewohner*innenbezogene Auslöser und Risikofaktoren
6.3.3 Mitarbeiter*innenbezogene Auslöser und Risikofaktoren
6.4 Umgang mit Gewalterfahrungen und Folgen
6.5 Fazit und To Do´s
7 Gewaltkonstellation Bewohner*innen/Klient*innen gegenüber Mitarbeitenden
7.1 Formen von Gewalt von »Bewohner*in gegenüber Mitarbeiter*in
7.2 Prävalenz Gewaltkonstellation »Bewohner*in gegenüber Mitarbeiter*in«
7.3 Auslöser und Risikofaktoren sowie mögliche Strategien
7.3.1 Umwelt- und organisationsbezogene Auslöser und Risikofaktoren
7.3.2 Bewohner*innenbezogene Auslöser und Risikofaktoren
7.3.3 Mitarbeiter*innenbezogene Auslöser und Risikofaktoren
7.4 Umgang mit Gewalterfahrungen und Folgen
7.5 Umgang mit Gewalt gegenüber Mitarbeitenden
7.6 Fazit und To Do´s
8 Gewaltkonstellation Mitarbeiter*innen gegenüber Bewohner*innen oder Kund*innen
8.1 Formen von Gewalt von Mitarbeiter*innen gegenüber Bewohner*innen oder Kunden*innen
8.2 Prävalenz Gewaltkonstellation Mitarbeiter*innen gegenüber Bewohner*innen/Kunden*innen
8.3 Auslöser und Risikofaktoren sowie mögliche Strategien
8.3.1 Umwelt- und organisationsbezogene Auslöser und Risikofaktoren
8.3.2 Bewohner*innen/Kund*innen bezogene Auslöser und Risikofaktoren
8.3.3 Mitarbeiter*innenbezogene Auslöser und Risikofaktoren
8.4 Umgang mit Gewalterfahrungen und Folgen
8.5 Fazit und To Do´s
9 Gewaltkonstellation Mitarbeiter*innen gegenüber Mitarbeiter*innen
9.1 Formen von Gewalt von Mitarbeite*innen gegenüber Mitarbeiter*innen (Mobbing)
9.2 Prävalenz Gewaltkonstellation Mitarbeiter*innen gegenüber Mitarbeiter*innen
9.3 Auslöser und Risikofaktoren sowie mögliche Strategien
9.3.1 Umwelt- und organisationsbezogene Auslöser und Risikofaktoren
9.3.2 Auslöser und Risikofaktoren bei Mitarbeitenden
9.4 Umgang mit Gewalterfahrungen und Folgen
9.5 Fazit und To Do´s
10 Gewaltkonstellation Gewalt in der Häuslichkeit
10.1 Formen von Gewalt in der Häuslichkeit gegenüber alten Menschen
10.2 Prävalenz von Gewalt gegenüber alten Menschen in der Kommune und in der Häuslichkeit
10.3 Prävalenz von Gewalt gegenüber Pflegenden in der Kommune und in der Häuslichkeit
10.4 Auslöser, Risikofaktoren und Ansatzpunkte für Strategien
10.4.1 Umweltbezogene Auslöser und Risikofaktoren
10.4.2 Menschen mit Pflegebedarf und entsprechende Auslöser und Risikofaktoren
10.4.3 Zu- und Angehörige bezogene Auslöser und Risikofaktoren
10.4.4 Mitarbeiter*innen bezogene Auslöser und Risikofaktoren
10.4.5 Umgang mit Gewalterfahrungen und Folgen
10.5 Mögliche Strategien und Maßnahmen
10.5.1 Fokus Maßnahmen in der Kommune
10.5.2 Fokus Umgang mit alten Menschen, die Gewalt erfahren und die Gewalt ausüben
10.5.3 Fokus ambulante Pflegedienste im Umgang mit pflegenden Zu- und Angehörigen, die Gewalt ausüben oder gefährdet sind, diese auszuüben
10.6 Fazit und To Do´s
11 Rechtliche Rahmenbedingungen zum Thema Gewalt
11.1 Zentrale Rechte aller Akteur*innen
11.2 Rechte von Menschen mit Pflegebedarf auf Landes- und Bundesebene sowie Pflichten der Einrichtungen und Dienste
11.3 Charta der Rechte und Pflichten hilfe- und pflegebedürftiger Menschen
11.4 Strafrecht und Straftatbestände
11.5 Gewalt im »Speziellen« – Notwehr und Nothilfe
11.6 Ins Gespräch zu Rechten und Pflichten kommen
11.7 Fazit und To Do´s
Teil II
12 Erst der Schock, dann die Aufarbeitung – Anlass für unser Projekt und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit (medial wirksamen) Gewaltvorfällen
12.1 Darstellung der Geschehnisse: Festnahme und Vorwürfe
12.2 Befragungen und Auswertungen der Polizei
12.3 Gerichtsverfahren und Urteil
12.4 Darstellung der Geschehnisse: Sofortmaßnahmen nach Festnahme – Interne und externe Kommunikation
12.5 Unsere Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen: Sofortmaßnahmen
12.6 Das Projekt »Halt!(-ung) bei Gewalt«
12.7 Eine Besonderheit: Das »Ethische Votum«
12.8 Fazit und To Do´s
13 Haltungs- und Schutzkonzepte entwickeln – ein Organisationsentwicklungsprozess
13.1 Leitbild als Rahmung
13.2 Leitsätze entwickeln und ins Gespräch kommen – »Halt!« und »Haltung!«
13.3 Die Leitsätze
13.3.1 Halt – Innehalten – Handeln bei Gewalt!
13.3.2 Haltung
13.4 Leitsätze als Strukturierungsfolie für das Projekt »Halt!(-ung) bei Gewalt in der Pflege«
13.5 Leitsätze und Hände – als Wegbegleiter und Leitplanken
13.6 Die Bausteine des Konzepts und deren Darstellung
13.7 Fazit und To Do´s
14 Verfahren zum Umgang mit Gewalt & Prävention
14.1 Verfahren Gewalt(-verdacht) Mitarbeitende gegenüber Bewohner*innen oder Klient*innen
14.2 Verfahren Gewalt(-verdacht) Bewohner*innen gegenüber Bewohner*innen
14.3 Verfahren Gewalt(-verdacht) Bewohner*innen/Klient*innen gegenüber Mitarbeitenden
14.4 Verfahren Gewalt(-verdacht) in Kurzform
14.5 Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Gewalt
14.6 Stoppkarte und kollegiale Fallberatung nach dem Stopp-Modell
14.6.1 Stufe 1: Beobachtung von Kolleg*-innen – Vorboten, Mut fassen und Person ansprechen
14.6.2 Stufe 2: Selbstbeobachtung/-wahrnehmung – Stopp-Karte in Anspruch nehmen & Innehalten!
14.6.3 Stufe 3: Kollegiale Beratung nach dem »Stopp Modell« – Innehalten!
14.6.4 Durchführung und Ablauf der kollegialen Fallberatung
14.7 (Kurz)-Fallbesprechungen
14.8 Skill-Boxen
14.9 Komplimente-to-go
14.10 Fazit und To Do´s
15 Qualifizierung & Ausbildung – Bildungsmaßnahmen und -strategien
15.1 Strukturen schaffen
15.2 Praxisentwicklung & -begleitung – Praxisanleitung & Wohnbereichsleitung als zentrale Personen
15.3 Kompetenzverortung und Praxisentwicklung neu denken
15.4 Basis-Schulung zum Thema Gewalt für alle Akteur*innen
15.5 »Let´s Talk about« – im Gespräch bleiben
15.6 Deeskalationstraining für Pflege und Betreuung
15.7 Fallbesprechung und kollegiale Fallberatung – Fokus Bildung
15.8 Teilnahme an Fachtagen – Mitarbeitende als Referent*innen
15.9 E-Learning – Bildung digitalisieren
15.10 Fazit und To Do´s
16 Qualitätsmanagement & Gewalt – Der Mensch im Mittelpunkt
16.1 Beschwerdemanagement
16.2 Mitarbeitendengespräche – Kommunikations- und Gesprächskultur
16.2.1 (Anlassbezogene) Gespräche mit Mitarbeitenden
16.2.2 Rückkehrgespräche und Wiedereingliederung
16.2.3 Jahresgespräche
16.3 Pflegebesuch als aktives miteinander in Gespräch kommen
16.4 Dokumentation von Gewaltvorfällen – eine kritische Reflexion
16.5 Fazit und To Do´s
17 Miteinander im Einklang: Rechte und Pflichten für alle Beteiligten
17.1 Bewohner*innen, Gäste, Klient*innen sowie An- und Zugehörige
17.1.1 Charta der Rechte für Pflegebedürftige und das Integrationsgespräch
17.1.2 Pflegebesuch als Ausdruck von Wertschätzung
17.1.3 Heimbeiräte als Unterstützende – Aktive Information
17.1.4 Anlassbezogene Gespräche mit Bewohner*innen/Klient*innen/ Gästen und Angehörigen
17.2 Mitarbeitende und Ehrenamtliche
17.2.1 Vorstellungsgespräch und Einarbeitung – Möglichkeiten ins Gespräch zu kommen
17.2.2 Pflegebesuch bei Mitarbeitenden als Zeichen von Wertschätzung
17.2.3 Hilfsquellen und Ansprechpersonen
17.2.4 Supervision und Coaching für Mitarbeitende
17.2.5 Anlassbezogene Gespräche mit Mitarbeitenden
17.3 Fazit und To Do´s
18 Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis & Selbstverpflichtungserklärung
18.1 Inhalte eines (einfachen) Führungszeugnisses, eines erweiterten Führungszeugnisses und eines Europäischen Führungszeugnisses
18.2 Mögliche Rechtsgrundlagen für die Abfrage eines Führungszeugnisses und Umgang damit
18.3 Regelungen der Kirchen (Land oder Bund)
18.4 Heimrechtliche und sozialrechtliche Vorgaben auf Landesebene
18.5 Fazit und To Do´s
19 Stressoren (Verhalten und Verhältnisse) in den Blick nehmen
19.1 Ausfallmanagement & Springerpool
19.2 Fehlzeiten-Analyse, Gesundheitsbericht der AOK & Überlastungsanzeigen
19.3 Digitalisierung oder Erleichterung im Arbeitsalltag schaffen
19.4 Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen des Arbeitsschutzes
19.5 Dienstvereinbarungen Mobbing – Wie man sich bei Mobbing verhält
19.6 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
19.7 Fazit und To Do´s
20 Innen- und Außenwahrnehmung und -darstellung des Trägers/der Einrichtung
20.1 Kommunale Strukturen – Ethisches Votum als Bürger*innenbeteiligung
20.2 Schulung von Ehrenamtlichen & Mitarbeitenden – Angebote öffnen
20.3 Dialog zur Enttabuisierung
20.4 Schaffung einer Ombudsstelle
20.4.1 Verständnis von Ombudsstellen bzw. -personen
20.4.2 Anforderungen an die Ombudsperson
20.4.3 Anforderung an die Leitung
20.4.4 Vorgehen bei Anfragen und Dokumentation
20.4.5 Bericht und Evaluation
20.4.6 Rahmenbedingungen, Verortung und Vergütung
20.4.7 Bekanntmachen der Ombudsperson
20.4.8 Haltung, wenn die Ombudsperson tätig wird
20.5 Fazit und To Do´s
21 Resümee und Ausblick
Teil III
22 Elektronisches Zusatzmaterial zum Download
23 Literatur
Seitenangaben der gedruckten Ausgabe
1
2
3
4
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Die Autor:innen
Bianca Berger, Pflegewissenschaftlerin, Mediatorin, Deeskalationstrainerin, Coach, freiberufliche Referentin, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Hochschule Esslingen
Dagmar Hennings, Altenpflegerin, Pflegewissenschaftlerin, Vorständin der Wilhelmshilfe e. V., Göppingen
Matthias Bär, Betriebswirt, Vorsitzender des Vorstandes der Wilhelmshilfe e. V., Göppingen
Bianca BergerDagmar HenningsMatthias Bär
Gewalt in der Pflege – Haltung zeigen
Konzepterstellung für Einrichtungen der Altenhilfe
illustriert von Mathea Berger
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-043497-4
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-043498-1epub:ISBN 978-3-17-043499-8
Abbildungsverzeichnis
Abb. 2.1:
Gewaltdreieck nach Galtung (Hirsch 2012, S. 64).
44
Abb. 5.1:
Psychopathologische Erkrankungen.
60
Abb. 5.2:
Stresstheorie
61
Abb. 5.3:
Bidirektionale Theorie.
64
Abb. 5.4:
Umwelt- und Systemtheorie.
66
Abb. 6.1:
Gewalt von Bewohner*innen gegenüber Bewohner*innen.
68
Abb. 6.2:
Kapitel zur Umsetzung rund um das Thema Gewalt von Bewohner*innen gegenüber Bewohner*innen.
82
Abb. 7.1:
Gewalt von Menschen mit Pflegebedarf gegenüber Mitarbeitenden oder pflegenden Angehörigen.
83
Abb. 7.2:
Kapitel zur Umsetzung rund um das Thema Gewalt von Bewohner*innen gegenüber Mitarbeitenden.
98
Abb. 8.1:
Mitarbeiter*innen gegenüber Bewohner*innen/Klient*innen.
99
Abb. 8.2:
Kapitel zur Umsetzung rund um das Thema Gewalt von Mitarbeiter*innen gegenüber Menschen mit Pflegebedarf.
113
Abb. 9.1:
Gewalt von Mitarbeiter*innen gegenüberMitarbeiter*innen – Feindseligkeit.
114
Abb. 9.2:
Kapitel zur Umsetzung rund um das Thema Gewalt von Mitarbeitenden gegenüber Mitarbeitenden.
129
Abb. 10.1:
Gewalt in der Häuslichkeit.
130
Abb. 10.2:
Kapitel zur Umsetzung rund um das Thema Gewalt in der Häuslichkeit.
153
Abb. 11.1:
Rechtliche Rahmenbedingungen.
154
Abb. 11.2:
Kapitel zur Umsetzung rund um das Thema rechtliche Rahmenbedingungen (Rechte und Pflichten).
166
Abb. 12.1:
Übersicht zum Verlauf der Presseaktivitäten.
176
Abb. 13.1:
Leitbild der Wilhelmshilfe (2021).
184
Abb. 13.2:
»Halt!« (a) und »Haltung!« (b).
187
Abb. 13.3:
»Halt«.
188
Abb. 13.4:
»Haltung«.
190
Abb. 13.5:
Bausteine des Konzepts »Halt!(-ung) bei Gewalt«.
197
Abb. 14.1:
Gewalt gegenüber Bewohner*innen, Gästen oder Kund*innen.
203
Abb. 14.2:
Gewalt gegenüber Mitarbeitenden.
205
Abb. 14.3:
Kollegiale Fallberatung nach dem Stopp-Modell.
219
Abb. 15.1:
Praxisentwicklung Ideen und Fragen.
231
Abb. 15.2:
Pädagogisches Konzept der Basisschulung.
233
Abb. 15.3:
Inhalte der Fortbildung Deeskalationstrainer*innen in der Altenhilfe.
241
Abb. 16.1:
Erfassung von Gewalt und deren möglichen Folgen (angelehnt an Registered Nurses' Associaton of Ontario, 2014, 2019).
257
Abb. 17.1:
Die Pflegecharta in Anlehnung an BMFSFJ und BMG, 2018.
264
Abb. 18.1:
Kapitel zur Umsetzung rund um das Thema Polizeiliches Führungszeugnis.
285
Abb. 20.1:
Zeitliche Abfolge der Gewaltvorfälle und Maßnahmen/Vorstellung.
299
Abb. 20.2:
Konsensentscheidung.
300
Tabellenverzeichnis
Tab. 2.1:
Kategorien von Gewalt (eigene Beispiele den Kategorien des ZQP 2020 zugeordnet).
46
Tab. 6.1:
Prävalenz der Gewaltkonstellation Bewohner*innen gegenüber Bewohner*innen.
72
Tab. 7.1:
Prävalenz der Gewaltkonstellation Bewohner*innen/Kunden*innen gegenüber Mitarbeitenden.
85
Tab. 8.1:
Prävalenz Mitarbeiter*in gegenüber Bewohner*innen/Klienten*innen.
101
Tab. 9.1:
Prävalenz Mitarbeitende gegenüber Mitarbeitenden.
118
Tab. 10.1:
Formen von Gewalt gegenüber alten Menschen in der Häuslichkeit.
132
Tab. 10.2:
Prävalenz Gewalt in der Häuslichkeit gegenüber alten Menschen.
133
Tab. 10.3:
Prävalenz Gewalt in der Häuslichkeit gegenüber Pflegenden.
135
Tab. 10.4:
Risikofaktoren für Misshandlung an älteren Menschen.
138
Tab. 12.1:
Analyse der Pflegedokumentation.
172
Tab. 13.1:
Leitsätze und inhaltliche Projektplanung.
194
Tab. 14.1:
Übersicht Verfahren/Kurzform (siehe auch
▸ Kap. 22
).
209
Tab. 14.2:
Basismethoden und Zielsetzungen nach Tietze (2003, zit. n. Kocks et al. 2012, S. 9.), exemplarisch.
221
Tab. 17.1:
Gesprächsleitfaden für einen Pflegebesuch bei Bewohner*innen/Gäste und Klienten*innen.
266
Zum Anfang steht der Dank!
Das vorliegende Buch beschreibt die Bemühungen aller Mitarbeitenden der Wilhelmshilfe gegen Gewalt in der Pflege und berichtet über das umfangreiche Projekt »Halt!(-ung)«.
Unser Dank gilt insbesondere den Leitungen, die bei der Entwicklung von Verfahren mitgewirkt haben. Sie haben diese in den Einrichtungen umgesetzt und die Mitarbeitenden eingebunden. Sie haben sich neuen Herausforderungen gestellt, sich für neue Verfahren und Ideen geöffnet und waren bereit, diese auszuprobieren. Ansätze wurden verworfen und neue entwickelt oder gemeinsam weiterentwickelt. Sie haben den Weg mit viel Ausdauer und Herzblut mitbereitet – was für ein Engagement!
Carina Burger, Olga Deis, Marion Doll, Nicole Eisele, Milica Grubesa, Nikolas Hartdegen, Michaela Holke, Danica Korenic, Melanie Kutschke-Frye, Christina Lude, Steffi Möser, Jutta Müller, Brigitte Rapp, Marianne Richter, Wolfgang Röder, Roma Rusch, Anna Schall, Ute Schmitt, Larissa Schreck, Corinna Ziegelin, Adelina Zuka, gilt ein herzliches Dankeschön
Wir möchten auch der Personalleitung und der Mitarbeitendenvertretung danken. Sie haben an Verfahren mitgearbeitet, diskutiert und um Lösungen und gute Wege gerungen. Es geht nur gemeinsam. Das war wirklich bemerkenswert! Stellvertretend danken wir:Stefan Krazer und Andreas Kielkopf, Erika Gülch, Janet Gazza, Constanze Kothy.
Was wären wir ohne Mitarbeitende, die von Beginn an interessiert waren, die sich geöffnet, mitgestaltet und -diskutiert haben und damit einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Projekts geleistet haben. Es sind sie ALLE, die täglich mit den Menschen mit Pflegebedarf und deren Angehörigen den Alltag gestalten. Den Mitarbeitenden in allen Einrichtungen gilt unser besonderer Dank.
Wir danken Anna Hunkemöller (Bildungsreferentin) für ihre intensive Begleitung, wertvolle Unterstützung bei der Umsetzung der Verfahren sowie bei der Organisation und Durchführung von Schulungen und Fortbildungen. Viele der Verfahren und kreativen Ideen wurden von ihr auf den Weg gebracht – das war und ist beeindruckend.
Wir danken Katja Thiele (Pflegereferentin), insbesondere für die grundlegende Neugestaltung der Pflegevisite zum Pflegebesuch. Danke, für das Mitdenken, das gemeinsame Reflektieren im Prozess sowie für die Unterstützung bei der Umsetzung in den Einrichtungen.
Wir möchten unseren Dank an die Referentinnen für Personal-, Unternehmens- und Organisationsentwicklung und Unternehmenskommunikation, Renate Müller-Birk und Kristina Kramer, aussprechen. Ihr Engagement hat es ermöglicht, dass das Thema nach innen und außen Wirkung zeigen konnte. Susanne Ruhland, dass sie alles in die QM-Form bringt und ihr Mitdenken und -bewegen. Ebenso danken wir Regina Weiß, die durch Beiträge zur Digitalisierung unterstützt hat. Das anhaltende Engagement, dieses Anliegen über die Jahre mitzutragen und immer wieder zu befördern und alle Akteure einzubeziehen, ist bemerkenswert.
Praxisanleitung und -entwicklung sind unverzichtbar. Sie befördern, dass Schulungsinhalte, Verfahren oder eine Haltung bei den Mitarbeitenden ankommt. Durch Besuche bei Pflegenden und durch Ausbildung vermitteln sie Haltung im Alltag. Ohne die Bemühungen von Anna Hunkemöller und den Kollegen*innen wären wir nicht dort, wo wir heute sind. Den engagierten Wohnbereichsleitungen danken wir gleichermaßen für Ihr großes Engagement in diesem Bereich! Sie alle tragen dazu bei, dass unsere Werte erlebbar werden. Insbesondere sind folgende Personen zu nennen:
Stephan Abt, Magdalena Bosch, Madlen Bleher, Cornelia Gaissert, Cornelia Geiger, Elke Goller, Azra Hadzic, Aida Karabegovic, Constanze Kothy, Susanne Lobner, Willy Röckel, Christina Schüler, Andrea Sipot, Hella Spohn, Elke Stange, Franziska Sturm, Franziska Regaard, Denise Zocher, Aida Tengler und Sofia Walz.
Unserer Ombudsfrau, die mit Herzblut und ehrenamtlichem Engagement die Sorgen und Nöte aufnimmt und weiterbearbeitet, verdient besondere Anerkennung. Sie schenkt den Menschen ihre Zeit und bringt sich immer wieder im Projekt ein. Was wäre die Diakonie ohne solche Menschen! Unser Dank gilt auch den Ehrenamtlichen, die sich Zeit für Schulungen genommen haben und mit uns diskutiert und reflektiert haben. Stellvertretend möchten wir hier die Ombudsfrau, Frau Magdalene Lutz-Rolf, nennen.
Herzlich bedanken wir uns bei unserem Rechtsanwalt Herr Dr. Reinhard Sieler für seine Unterstützung beim Formulieren des Kapitels »Notwehr und Nothilfe«.
Für den Vertrauensvorschuss nach den Gewaltvorfällen im Jahre 2019 bedanken wir uns herzlich bei den Bewohner*innen und Angehörigen. Ihre Unterstützung, Ermutigung und aktive Beteiligung im Heimbeirat waren und sind keineswegs selbstverständlich.
Dieser Prozess stellt einen fortlaufenden Organisationsentwicklungsprozess dar, der ohne die Unterstützung des Aufsichtsrates nicht möglich wäre. Die ideelle Unterstützung, die inhaltliche Diskussion und das Mittragen des Projekt »Halt!(-ung)« war wertvoll und machen diakonische Werte greifbar.
Wir sind auf Rückmeldung und Reflexion angewiesen. Die kommunalen Vertretungen haben mit uns diskutiert, mitgedacht und uns wertvolle Hinweise gegeben. Gemeinsam haben wir Fachtage vorbereitet und durchgeführt, informiert und das Thema in die Stadt und den Landkreis getragen. Ihr Engagement war eine wertvolle Unterstützung. An dieser Stelle möchten wir stellvertretend Isabell Schröder, Ralf Liebrecht sowie Wolfgang Hoffmann danken.
Einiges konnte durch finanzielle Zuwendungen realisiert werden, die es uns ermöglicht haben, das Projekt und die Schulungen etc. umzusetzen. Unser Dank gilt dem Diakonischen Werk Württemberg e. V. für seine Unterstützung und das Interesse an unserem Projekt.
Wenn jemand vergessen wurde – Sie sind in den Dank eingeschlossen.
Mit Blick auf die Zukunft möchten wir unsere Bemühungen zu diesem Thema fortsetzen. Wir sind uns bewusst, dass die Herausforderungen in der Pflege zunehmen und wir sind bereit, diese zu gestalten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen und das Leben der Menschen, die bei uns leben und arbeiten, positiv beeinflussen.
Geleitwort von Angelika Zegelin
Hier kommt ein wichtiges Buch!
Seit über 20 Jahren wird über das Tabuthema Gewalt in der Pflege offen diskutiert. Zunächst erschien dieser Bereich immun, inzwischen wissen wir von Missbrauch in Kinderheimen oder Kirchenkreisen.
Ursächlich scheinen mir die Themen Abhängigkeit einerseits und Macht andererseits. Im Buch werden zahlreiche Definitionen und Gewalttheorien vorgestellt. In der Pflege gibt es eine große Bandbreite von Gewaltausübung, etwa von sprachlichen Dingen, von Vernachlässigung bis hin zu tätlichen Ausbrüchen. Wahrscheinlich kommt auch Übermedikation an »Ruhigstellung« dazu. Diese zahlreichen Vorstufen sind wahrscheinlich Alltag, kommen nie an die Öffentlichkeit. Meistens interessieren sexuelle Übergriffe oder gar Tötungsdelikte.
Das Pflegesetting legt (zumindest) subtile Gewalt nahe. Es geht um nahe Körperlichkeit, um menschliche Ausnahmesituationen. Wer will schon völlig auf Andere angewiesen sein, seine Autonomie verlieren, in einer Institution eine*r von Vielen sein. Der Personalmangel in den letzten Jahren führt auch (und gerade) engagierte Fachpersonen an ihre Grenzen, in diesen Arbeitsbedingungen ist eine menschliche, personenzentrierte Pflege kaum möglich, Hetze und Stress bestimmen Alles. Hinzukommt herausforderndes Verhalten von Demenzkranken, die nötige Hilfeleistung wird oft abgelehnt. Trotzdem gibt es noch viele Einrichtungen, in denen ein gutes Klima herrscht.
In der häuslichen Pflege gibt es viele Angehörige. Jahrelang kümmern sie sich liebevoll und aufopfernd um die Menschen: 24 Stunden, rund um die Uhr – geben ihr eigenes Leben auf. Unsere Gesellschaft ist singulär. Irgendwann können sie nicht mehr, stoßen dann auf ein zersplittertes bürokratisches System und kaum Hilfen (außer Institutionalisierung).
Ehrlich gesagt, ich wundere mich, dass es nicht viel mehr Meldungen über Gewalt in der Pflege gibt. Es arbeiten über eine Million Menschen dort, Genaues weiß man nicht. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, selbst Gewaltopfer, verschiedene Bildungs- und Kulturhorizonte. Trotzdem ist eine »Personalisierung« der Vorfälle falsch, es geht um »systemimmanente« Vorgänge, etwa Überforderung. Allein etwa die Tatsache, dass Pflegende oft allein arbeiten – zum Beispiel im Nachtdienst verantwortlich für über hundert Menschen.
In der letzten Zeit geht es ja oft um Gewalt im Krankenhaus, besonders in den Notaufnahmen – dort sind Sicherdienste inzwischen normal, eine Änderung ist schon lange beabsichtigt.
Darum geht es in diesem Buch nicht, aber auch dort wäre eine Aufarbeitung wichtig. Ansonsten haben die Autor*innen hier die verschiedenen Gewaltkonstellationen in der Langzeitpflege bearbeitet, Mitarbeiter*innen gegen Bewohner*innen, Pflegebedürftige untereinander, Personal gegeneinander, Problematik zuhause.
Durch das Buch habe ich viel gelernt, besonders auch durch die Fallbeispiele. Auslösend waren offenbar die Ereignisse in einer Einrichtung der »Wilhelmshilfe« – dies zieht sich als Beispiel durch die Texte. Alles ist gut strukturiert, die Kapitel enden mit Fazit und Empfehlungen. Insgesamt wurden viele Quellen verarbeitet, sowohl grundlegende als auch neuzeitliche Texte.
Im Vordergrund stehen Vorschläge zur Prävention und zur Bearbeitung. In der Wilhelmshilfe wurden viele Prozesse in Gang gesetzt. Hier ist nun zu wünschen, dass viele Einrichtungen diese Ideen übernehmen – auch ohne bekanntgewordene Zwischenfälle.
Ganz wichtig erscheint mir dabei die Offenlegung – dies ist mehrmals Thema in den Texten. Ein Klima des Redens in den Teams, eine Stärkung der Leitungen. In vielen Besprechungen sollten Gewalteindrücke thematisiert und kollegiale Beratung vorgesehen werden. Ich weiß, dass dies »fromme Wünsche« sind angesichts eines großen Zeitnotstandes und einer Unterfinanzierung. Seit Jahren plädiere ich für eine Orientierung der Einrichtungen in ihrem Umfeld, Fördervereine, Bürgernähe, Ehrenamtliche. Auch eine erhöhte Aufmerksamkeit scheint mir angezeigt, Meldesysteme – bis hin zu Whistleblowing – wohlwissend, dass dies ein Klima des Misstrauens schüren kann. Auch sollten alle Berufsgruppen in (totalen) Institutionen einbezogen werden, Service, Beirat und weitere, auch die Hausmeisterei.
Vorbote gibt es fast immer, etwa sprachliche Herabsetzung. Die ersten Prozesse zu Patient*innentötungen in Kliniken habe ich verfolgt, dort ging es auch um schäbige Begriffe weit vorab. Niemand regte sich unter den Kolleg*innen auf, überhaupt wird bei Heimskandalen immer wieder später gesagt »ja, wir haben uns auch gewundert, dass nun eine Windel für 2 Tage reichen soll« und Ähnliches. Pflegenden fehlt oft der Mut, das Team hat einen hohen Stellenwert – man ergibt sich in wechselseitiger Ohnmacht.
Präventiv war in meinen Projekten in der Altenarbeit auch immer wichtig, sich an der Person und ihrer Biografie zu orientieren. Leider ist die (fachliche) Biografiearbeit vielfach verlorengegangen, die Pflegenden erleben die Bewohner nur noch als »Pflegebündel«. Vielfach habe ich dann nach der Neueinführung gehört »oh, der war früher Kapitän«, oder »Frau Schmidt war beim Ballett« usw., dadurch ergab sich ein neuer Respekt.
Gut ist sicher auch der Vorschlag, an Werten und Haltungen zu arbeiten, an ethischen Orientierungen – und dies auch mit Wertschätzung zu fördern. Inzwischen gibt es zahlreiche Muster für Fortbildungen zum Thema – diese sollten regelmäßig angeboten werden. Auch in Ausbildungen und Studiengängen ist das Thema Gewalt in der Pflege zu bearbeiten.
Nochmal: Ich halte die Gewaltgefahr in der Pflege für allgegenwärtig, aufgrund der Konstellationen, die Gewalt hat hier viele Gesichter! Durch die Beschäftigung mit diesem Thema kann Missbrauch reduziert werden. Das Buch von Berger, Hennings und Bär liefert dazu einen hervorragenden Beitrag.
Dortmund im Juli 2024
Prof. Dr. Angelika Zegelin,Krankenschwester und Pflegewissenschaftlerin (vorm. Uni Witten/Herdecke)www.angelika-zegelin.de
Geleitwort von Kornelius Knapp
Liebe Leserin, lieber Leser,
mit der vorliegenden Veröffentlichung der Wilhelmshilfe wird das sehr wichtige Thema der Gewalt aus der Perspektive der eigenen Betroffenheit in die Fachöffentlichkeit gebracht. Das ist ein wichtiger Schritt zur Anerkennung und Aufarbeitung. Ebenso ist es wichtig zur Prävention und der Entwicklung einer starken Haltung, die keinerlei Gewalt – in welcher Form auch immer – zulässt.
Die Befassung mit dem Thema ist wichtig, da Gewalt in allen gesellschaftlichen Kontexten auftreten kann, in denen es strukturell angelegte Formen von Macht gibt. Wo es Macht gibt, kann es schnell zu Machtmissbrauch kommen. Da es in allen Hilfebereichen des Sozialen ein Machtgefälle gibt, macht es erforderlich, sich dezidiert damit zu befassen und alle Formen des Machtmissbrauchs zu diskreditieren, Prozesse zu überprüfen, Risiken zu erkennen und diese bestmöglich zu unterbinden. Die Arbeit auf Augenhöhe und die Partizipation gehören ebenso dazu wie die Schaffung von Transparenz und Maßnahmen zur Intervention. Die Wilhelmshilfe geht voran, wenn sie den Blick auf dieses Thema legt und zeigt sich mit der Publikation als Vorreiterin.
Derzeit findet im Bereich der Kirche, der Diakonie sowie in der gesamten Sozialen Arbeit eine intensive Befassung mit dem Thema der sexualisierten Gewalt statt. Dies hat den Hintergrund, dass die sexualisiert Gewalt besonders menschenverachtend und entwürdigend ist. Es ist dabei zu beachten, dass erstens in der Anbahnung in aller Regel vielfältige Grenzverschiebungen stattfinden. Zweitens geht sexualisierte Gewalt immer mit anderen Formen von Gewalt, wie der körperlichen und psychischen Gewalt, einher. Aus diesem Grund ist es sehr konsequent, wenn die Wilhelmshilfe mit der vorliegenden Publikation einen sehr breiten Gewaltbegriff zugrunde legt und alle Formen von Gewalt in den Blick nimmt.
In der Vergangenheit wurde eine institutionelle Befassung mit dem Thema häufig mit dem Verweis darauf abgelehnt, weil es Einzelfälle seien. Ja, jeder Fall ist einzeln und gehört einzeln aufgearbeitet – aber auch systematisch und bezogen auf die Institution ist die Bearbeitung nötig. Werden diese Taten durch Mitarbeitende zum Nachteil Schutzbefohlener oder durch Mitarbeitende zum Nachteil anderer Mitarbeitender im Rahmen eines zu ihnen bestehenden Abhängigkeitsverhältnisses verübt, trägt die Institution aufgrund der bestehenden Asymmetrie und Machtdifferenz in besonderer Weise Verantwortung, die ihr anvertrauten Menschen zu schützen.
Deshalb ist es Aufgabe einer jeden Einrichtung, sich systematisch und präventiv mit dem Thema der Gewalt zu befassen. Dabei sind alle Formen von Gewalt und alle Täter*innenkonstellationen, auch die Gewalt durch Klient*innen, zu berücksichtigen.
In allen sozialen Einrichtungen, nicht nur in der Diakonie und nicht nur in der Altenpflege, ist es erforderlich, dass das Thema der Gewalt systematisch bearbeitet wird. Dafür ist ein Schutzkonzept auf der Basis einer Risikoanalyse zu entwickeln, das für alle Akteur*innen in der Einrichtung eine große Handlungssicherheit bedeutet. Sonst häufig unangenehme Themen und häufig schambehaftete Handlungsweisen werden damit aussprechbar, benennbar und damit sanktionierbar. Entscheidend ist bei Schutzkonzepten zweierlei: Es muss gut an die Situation in der Einrichtung angepasst sein, sodass es auf die realen Risiken eine klare Antwort gibt. Darüber hinaus muss es den Weg ins tägliche Handeln finden. Nur wenn das Schutzkonzept die Arbeit in der Einrichtung prägt, ist es lebendig. Nur dann schützt es.
Ich wünsche der Publikation, dass sie viele interessierte Leser*innen findet. Möge sie Anregung sein, bei der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten, Gewalt in der Pflege in den Blick zu nehmen und zu verhindern.
Das Thema ist zu wichtig, als dass es in Aktenordnern oder Bücherregalen verschwindet. Ein gelebtes Schutzkonzept geht in der diakonischen Haltung auf, nach der die Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen das Zentrum und das Ziel allen Handelns sind. Denn, wie es im Leitbild der Diakonie beschrieben ist, steht die Würde des Menschen – auf der Basis der biblischen Botschaft – im Mittelpunkt all unseren Handelns.
Ich danke der Wilhelmshilfe für die Publikation und die vielfältigen Impulse im Verband, die uns bei der Bearbeitung des Themas als Unterstützung dienen. Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine im besten Sinne anregende Lektüre sowie viel Erfolg bei der Entwicklung und Implementierung von einrichtungsspezifischen Schutzkonzepten.
Stuttgart im August 2024
Dr. Kornelius KnappVorstand Sozialpolitik, Diakonisches Werk Württemberg
Einführung – wie eine Krise den Alltag verändern kann
»Große Notfälle und Krisen zeigen uns, um wie viel größer unsere vitalen Ressourcen sind als wir selbst annahmen.« (W. James)
Zumeist kommen Gewaltvorkommnisse in der Pflege mit einer Schlagkraft ans Licht, die alle Beteiligten erst einmal überfordert. Dies liegt auch daran, weil Leitungen und/oder Mitarbeitende in der Altenhilfe oft davon ausgehen, dass Gewalt in ihren eigenen Einrichtungen kein Thema ist oder sein darf. Es besteht oft die Auffassung, dass Gewalt nur bei den sogenannten »schwarzen Schafen« vorkommt oder dass es sich bei »Gewalt in der Pflege« lediglich um Einzelfälle handelt. Kurzgefasst: Man ist froh, wenn man von dem Thema quasi verschont bleibt oder geblieben ist.
Das ist verständlich, spiegelt aber eine gewisse Tabuisierung dieses Themas wider. Und wenn ein Gewaltvorfall dann geschieht, kommt die Scham oder das Gefühl, versagt zu haben dazu, begleitet von einer gewissen Ohnmacht, Angst und Hilfslosigkeit, was in einem solchen Fall zu tun ist. Auf der einen Seite steht die Überforderung bei Gewaltvorkommnissen, auf der anderen Seite die Skandalisierung sowie die Tabuisierung des Vorfalls. Das ist der Dreiklang, der einen offenen Umgang mit diesem Thema, einen wirklichen Dialog in der Einrichtung und mit anderen Einrichtungen verhindert.
Da stellt sich doch zuallererst die Frage: Warum fällt es so schwer über dieses Thema ins Gespräch zu kommen oder aktiv daran zu arbeiten? Geht es um die Frage der Wahrnehmung nach außen, also darum: Was denken Andere, wenn das Thema prominent gemacht oder bearbeitet wird? Ist es die Angst vor einer Reaktion der Prüfungsinstanzen, wenn man einen Gewaltvorfall bearbeitet? Oder geht es darum, dass ein Gewaltvorfall oder die Auseinandersetzung mit dem Thema »Gewalt in der Pflege« Auswirkungen darauf haben könnte, dass die Menschen mit Pflegebedarf und ihre An-/Zugehörigen das Vertrauen verlieren?
Viele Fragen, die Sie als Leser*in vielleicht erst einmal beschäftigen. Und gleich zu Beginn: Lassen Sie sich darauf ein, sich dem Thema zu nähern und es aktiv anzugehen, denn zu agieren erlaubt es, Perspektiven zu entwickeln, wie man mit »Gewalt in der Pflege« umgehen möchte, wenn diese in der eigenen Organisation tatsächlich auftritt. Wenn man sich diesem Thema annimmt, dann entwickelt sich ein Prozess, der die Organisation verändert. Es ist legitim, sich gegen das aktiv werden, zu entscheiden. Das heißt aber auch, sich im Zweifelsfall dafür zu entscheiden, dass man reagieren muss, man völlig unvorbereitet mit einem Gewaltvorfall konfrontiert wird oder anderes gesagt, man kalt erwischt wird.
Es ist klar, dass sich jeder Gewaltvorfall anders zeigt und stets eine starke Betroffenheit auslöst. Nach der Aufarbeitung eines Gewaltvorfalls im Rahmen einer Schulung antwortete eine Einrichtungsleitung auf die Frage, was sie hierlassen würde: »Die Angst« – eine schlichte, durchdringende Antwort, denn es wird klar: Sich mit diesem Thema zu beschäftigen macht mutig(er), indem man Handlungsoptionen schafft und gemeinsam Schutzräume gestaltet.
Anlass für dieses Buch
Warum und wie kommt man dazu, sich so intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen und ein Buch darüber zu schreiben? Weil man als Träger »kalt erwischt« wurde und niemals damit gerechnet hätte, dass man als Vorstand, Leitung oder als Mitarbeitende mit derartigen Gewaltvorfällen konfrontiert werden würde.
Die Wilhelmshilfe e. V. in Göppingen wurde im Jahre 2019 mit einem Gewaltvorfall konfrontiert, der »ein Beben« in den Einrichtungen und bei den Menschen ausgelöst hat.Was war passiert? Im Februar 2019 wurde eine Altenpflegerin, die bereits 18 Jahre beim Träger tätig war, an ihrem Arbeitsplatz von der Polizei verhaftet. Der Grund für die Verhaftung: Verdacht von sexuellem Missbrauch an Bewohner*innen mit schwerer Demenz und zudem, diesen Missbrauch jeweils gefilmt zu haben. Die Ermittlungsbehörden wurden auf die Mitarbeitende aufmerksam, weil im Jahre 2017 ein Mann von der Staatsanwaltschaft Tübingen festgenommen wurde. Die Ermittler*innen waren ihm Rahmen der Untersuchung dieses Falles auf die Videoaufnahmen der Altenpflegerin gestoßen. Die Angeklagte wurde im Oktober 2019 zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Die Motive der damals 47-jährigen Altenpflegerin sind bis heute unklar.
Bei den missbrauchten Bewohner*innen handelte es sich um Personen im Alter von 75 bis 91 Jahren, die in einem »beschützenden Wohnbereich« des Pflegeheims in Bartenbach wohnten. Nach Aussagen der Kolleg*innen auf dem Wohnbereich habe es keine Hinweise auf mögliche Misshandlungen gegeben.
So die Ausgangslage – wie bereits erwähnt, man wurde »kalt erwischt«. Die Wilhelmshilfe hat sich daher bewusst dafür entschieden, diese Ereignisse gründlich aufzuarbeiten und Aussagen, wie »das ist doch ein Einzelfall« oder »das passiert doch überall« nicht gelten zu lassen. Sie gelten im Übrigen per se nicht, denn sie befördern eine Verharmlosung und man tappt in eine Normalisierungsfalle. Gewaltvorfälle passieren, das ist richtig, aber wichtiger ist, was man unternimmt, um solche zu vermeiden oder mit diesen umzugehen.
Seitdem verfolgte und verfolgt die Wilhelmshilfe drei Ziele. Erstens, diese dargestellten Gewaltereignisse aufzuarbeiten. Zweitens aus den Ereignissen zu lernen, um bei weiteren Vorfällen bzw. Verdachtsfällen adäquat handeln zu können. Drittens, alles Mögliche dafür zu tun, dass solche Vorfälle in der Wilhelmshilfe möglichst nicht mehr vorkommen.
Pflegeheime und weitere Organisationen der Altenhilfe1 scheinen Kristallisationspunkte von Gewalt zu sein. In der Auseinandersetzung mit dem Thema »Gewalt« hat der Träger eine andere »Halt!(-ung)!« entwickelt, die deutlich macht: Gewalt geht uns alle an, d. h. Mitarbeitende, An- und Zugehörige, Ehrenamtliche, Leitungen, Menschen mit Pflegebedarf sowie Mitbewerber*innen, Prüfungsinstanzen, auch Bürger*innen und die verantwortlichen Akteur*innen in der Kommune.
Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie (auch) etwas über die Gewalt an alten Menschen in der Kommune wissen und nachvollziehen können, warum bei einer Auseinandersetzung mit »Gewalt in der Pflege« sehr viele Akteur*innen einbezogen werden sollten, damit das Thema eben nicht im Sumpf der Skandalisierung stecken bleibt, sondern gemeinsam Handlungsoptionen entwickelt werden. Skandalisierung, die medial aufbereitet wird, nützt wenig, fördert das Gegenteil, nämlich dass das Thema Gewalt im Rahmen der Pflege alter Menschen weiter in der Tabuzone bleibt.
Die Wilhelmshilfe möchte den Dialog fördern und »Halt!(-ung)« zeigen, um zu einer Enttabuisierung beizutragen. Dieses Wortspiel von Halt! und Haltung weist auf einen Anspruch hin, mit dem Thema »Gewalt in der Pflege« umzugehen. So wie jede Hand fünf Finger hat, wurden jeweils fünf Ansprüche zu »Halt« und »Haltung« formuliert. Mit dem Signalwort »Halt!« soll vermittelt werden, dass bei Gewaltereignissen oder Verdachtsmomenten in den Einrichtungen der Wilhelmshilfe buchstäblich »Halt!« gemacht wird. Mit dem Wort »Haltung« hingegen wird betont, dass eine Haltung zum Thema Gewalt entwickelt werden muss, damit die fünf Aspekte zu »Halt« auch umgesetzt werden können. Die daraus entwickelten Leitsätze bilden das Fundament einer umfangreichen Projekt- und Maßnahmenplanung. Diese Leitsätze können Sie im ▸ Kap. 13 nachlesen.
Das Projekt »Halt!(-ung)« wird verständlicherweise nie gänzlich abgeschlossen sein, denn die Mitarbeitenden der Wilhelmshilfe lernen immer dazu. Denn: Nicht alles, was zu Beginn angedacht war, war gleich richtig, musste ggf. nochmals durchdacht, überarbeitet oder auch gänzlich neu bedacht und verändert werden. Das gilt bis heute. Dieser Prozess war und ist absolut lohnenswert und wir möchten Interessierte gerne an diesen Erfahrungen beteiligen. Deshalb stellt der Träger das gesamte Wissen und alle Verfahren und Dokumente zur Verfügung, die in den vergangenen Jahren, im Rahmen des Projekts, entstanden sind. Dokumente sowie Verfahrensanweisungen finden Sie im elektronischen Zusatzmaterial (▸ Kap. 22), das Ihnen online zur Verfügung steht.
Beachten Sie bitte, dass diese Materialien nicht einfach eins zu eins übernommen werden können. Die Inhalte schaffen vielmehr Anregungen für eigene Prozesse oder geben Impulse, wie man sich dem Thema nähern kann oder wie man es nicht tun möchte. Letzteres kann auch eine Entscheidung sein. Auch die Wilhelmshilfe befindet sich weiter auf dem Weg, Prozesse zu überdenken. Es gab im Rahmen der Corona-Pandemie immer wieder Verzögerungen und neue Anläufe, Mitarbeitende zu schulen oder Verfahren fertig zu stellen. Es kann nicht alles auf einmal erarbeitet und umgesetzt werden. Ein realistischer Zeitrahmen ist wichtig und wir gehen von drei bis fünf Jahren aus. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Gehen Sie langsam voran und schätzen Sie das wert, was Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen*innen schaffen oder geschafft haben.
Das Buch ist modular aufgebaut, das heißt einzelne Bausteine des Buches können herausgenommen und die Themen jeweils separat bearbeitet, besprochen oder geschult werden. Überlegen Sie, welche Themen bei Ihnen Priorität haben, und wie eine dauerhafte Umsetzung sichergestellt werden kann. In ▸ Kap. 21 geben wir Empfehlungen zur Priorisierung der einzelnen Bausteine. Zu Beginn des Buches gleich die Ermutigung: Starten Sie in Ihrem Tempo!
Wie ist das Buch aufgebaut oder Wege zur »Halt!(-ung)«
Im ▸ Teil I des Buches werden Definitionen, Formen der Gewalt sowie Erklärungsmodelle vorgestellt. Anschließend sogenannte »Fallen zum Thema Gewalt« thematisiert, wie z. B. die Skandalisierungs- oder Normalisierungsfallen. Dann folgen unterschiedliche Konstellationen von Gewalt, die die Komplexität des Themas in der Altenhilfe widerspiegeln. Denn Gewalt ist nicht nur ein Phänomen, das von Mitarbeitenden gegenüber Menschen mit Pflegebedarf ausgeübt wird, sondern auch umgekehrt. Gleichermaßen zeigt sich auch Gewalt von Menschen mit Pflegebedarf gegenüber An- oder Zugehörigen oder gegenüber anderen Pflegebedürftigen.
Der erste Teil mit den verschiedenen Kapiteln bildet das theoretische Fundament und gibt zudem Hinweise auf Prävalenzen, Ursachen und zeigt Möglichkeiten auf, erste Anzeichen oder Folgen von Gewaltausübung wahrzunehmen und zu bearbeiten.
Im ▸ Teil II des Buches starten wir – ausgehend von den Gewaltereignissen in der Wilhelmshilfe – wie man mit solch medial wirksamen Gewaltvorfällen umgehen kann. Dabei soll den Lesenden klar werden, warum wir dieses umfangreiche Projekt ins Leben gerufen haben. Wir veranschaulichen das Vorgehen der Wilhelmshilfe anhand des bereits beschriebenen Gewaltvorfalls. Daran anschließend wird die Entwicklung eines Haltungs- oder Schutzkonzeptes2 mithilfe einzelner Bausteine ausführlich beschrieben und Handlungsempfehlungen formuliert. Diese Bausteine skizzieren die Entwicklung der Leitsätze, die Erstellung von Verfahren und die Schulung aller Akteur*innen. Sie thematisieren auch das Thema »Außendarstellung« sowie die Zusammenarbeit mit der Kommune. Nicht zu vergessen: Aspekte struktureller Gewalt, die Mitarbeitende an ihre Grenzen bringen können, wie z. B. Dienst- und Einsatzplanung, Ausfallmanagement und Arbeitsverdichtung sowie das Thema Arbeitsschutz werden gleichermaßen dargestellt. Zudem werden rechtliche Rahmenbedingungen sowie konkrete Handlungsempfehlungen für das Thema »Polizeiliches Führungszeugnis« thematisiert. Dieser Teil endet mit einem Plädoyer »In alle Richtungen gesprächsoffen zu sein und zu bleiben«, damit nachhaltiges Handeln möglich ist.
Im ▸ Teil III, dem elektronischen Zusatzmaterial (▸ Kap. 22), werden alle Verfahren und Arbeitsergebnisse des Projekts dargestellt. Diese können genutzt und auf die Bedarfe der jeweiligen Einrichtung angepasst bzw. als Anregung genutzt werden. Einen Hinweis zum Umgang mit diesem Zusatzmaterial finden Sie im Ausblick und Resümee (▸ Kap. 21).
Jedes Kapitel soll für sich allein stehen können, sodass Redundanzen beabsichtigt sind.
Eine Anmerkung zum Schluss: Häufig werden wir von Einrichtungsleitungen, Trägern oder Einzelpersonen unter vorgehaltener Hand über Gewaltereignissen informiert und gebeten, diese Informationen vertraulich zu behandeln, damit nichts nach außen dringt. Schutzräume sind gut und wichtig. Und wir möchten uns mit Ihnen gemeinsam auf dem Weg machen und das Thema »Gewalt in der Pflege« aus der Tabuzone der »Vorgehaltenen Hand« holen, denn eine kontinuierliche Befassung mit dem Thema »Gewalt in der Pflege« ist für die Altenhilfe bzw. für die Menschen, die in diesem Bereich leben und arbeiten, unerlässlich.
Wir freuen uns auf einen Dialog mit Ihnen. Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen zum Thema »Gewalt in der Pflege« mit, informieren Sie uns über Ihre Projekte und geben Sie uns Rückmeldung zu diesem Buch. Der gemeinsame Lernweg geht weiter, jetzt gemeinsam, denn zusammen sind unsere vitalen Ressourcen größer als wir das selbst annehmen (s. Zitat am Anfang). Das heißt Krisen fordern uns zwar heraus, aber sie bringen innere Stärken, wie Mut und Kreativität zum Vorschein und unterstützen uns dabei, voranzukommen.
Bianca Berger Dagmar Hennings Matthias Bär
Zur besseren Orientierung im Buch
steht für Fallbeispiel
steht für Definition
⚠ steht für Hinweis
v steht für Merke
Endnoten
1Wenn in diesem Buch von Einrichtungen oder Organisationen der Altenhilfe gesprochen wird, sind damit auch ambulante Dienste oder Tagespflegen gemeint.
2In Einrichtungen der Diakonie und Caritas ist die Umsetzung von Schutzkonzepten verpflichtend. Leider wird vornehmlich sexuelle oder sexualisierte Gewalt in den Blick genommen.
Teil I
1 Gewalt – Definition – Oder: worüber sprechen wir eigentlich?
»Gewalt beginnt, wo das Reden aufhört.« (H. Arendt)
Wenn man über Gewalt oder »Gewalt in der Pflege« spricht, dann wird deutlich, dass die agierenden Personen Gewalt unterschiedlich deuten. Was bei der einen mit »ach was, das ist doch keine Gewalt« bewertet wird, wird von einer anderen bereits als das Erleben von Gewalt wahrgenommen. In dem Zitat von Hanna Arendt wird eine Definition von Gewalt benannt, die dann ihren Anfang nimmt, wenn man nicht mehr miteinander spricht oder man nicht (mehr) ins Gespräch miteinander kommen möchte. Beim Lesen dieses Zitats könnten Sie sich fragen, ob Sie dieser Aussage zustimmen oder ob sie eine andere Deutung zum Thema Gewalt haben.
Zuerst ein Beispiel dafür, wenn das Reden aufhört oder »abgewürgt« wird beziehungsweise nicht zustande kommt. Im Rahmen einer Fortbildung äußerte eine Kollegin, dass ein Bewohner ihr immer wieder an den Hintern fassen würde und sie das störe. Dem Bewohner habe sie das sehr deutlich mitgeteilt, dass er das unterlassen solle. Als sie diese Vorfälle im Team zur Sprache brachte, wurde darauf abwinkend reagiert und die Kollegin mit den folgenden Aussagen »das sei normal« und »der sei halt Südländer« konfrontiert.
Was ist in dieser Situation passiert? Die Kollegin ist betroffen, erlebt sexuelle Belästigung als eine Form der Gewalt, sie äußert ihre subjektive Betroffenheit und erwartet von ihren Kollegen*innen Empathie, zumindest eine Äußerung von Betroffenheit oder eine Form von Unterstützung. Was erlebt sie? Sie erlebt eine völlig andere Situationsdeutung: »das sei normal« und damit das Herunterspielen der eigenen Betroffenheit und der geschilderten Vorfälle.
Was lässt sich aus solchen Situationen lernen, wenn man sie nochmals reflektiert? Entweder gibt es, wie bereits dargestellt, völlig unterschiedliche Deutungen und Definitionen von Gewalt im Team oder man hat sich mit Übergriffen dieser Art arrangiert, muss diese im Alltag »herunterspielen« oder mit sich »selbst ausmachen«. Warum ist das so? Vielleicht hat man bisher über Gewaltvorkommnisse und die eigene Betroffenheit nicht gesprochen gegebenenfalls wurde man im Team selbst so sozialisiert, dass solche Vorfälle zum Alltag gehören. Es könnte auch sein, dass eine gewisse Hilfslosigkeit überspielt wird, weil man unsicher ist, was zu tun ist oder was von einem selbst erwartet wird.
Letztlich erlebt die belästigte Kollegin, dass ihre Schilderung und ihre Sorge nicht ernst genommen werden. Damit erfährt sie erneut eine Form von Abwertung, indem die Kolleg*innen die Vorfälle quasi legitimieren oder normalisieren. Mögliche Folgen: Sie wird sich künftig überlegen, ob sie solche Vorfälle noch thematisiert oder ob sie sich an das Verhalten des Teams und an deren Deutung von Gewalt und deren Legitimierung (»Normal«) anpasst. Es kann aber auch sein, dass die Kollegin sich mit weiteren Schilderungen zurücknimmt, weil sie davon ausgeht, dass sie überreagiert hat und sie diejenige ist, die nicht »normal« ist.
Verstehen Sie uns nicht falsch! Die geschilderte Situation soll nicht die Reaktion des Teams »vorführen«, sondern diese soll deutlich machen, wie wichtig es ist, Räume zu schaffen, um über Gewalt und die eigene Betroffenheit und Überforderung zu sprechen. Denn wenn sie mit Ihren Mitarbeitenden oder Kollegen*innen über das Thema »Gewalt in der Pflege« ins Gespräch kommen, dann werden Sie merken, dass es unterschiedliche Definitionen und Deutungen von Gewalt gibt, die man gemeinsam diskutieren und reflektieren muss, damit diese Unterschiedlichkeit wahrgenommen und bearbeitet wird. Idealerweise gilt es, eine gemeinsame Definition zu erarbeiten, die das Handeln im Alltag bestimmt und an der sich die Kolleg*innen orientieren können.
Mit diesen unterschiedlichen Definitionen und Deutungen von Gewalt sind Sie nicht alleine! Auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema, zeigt diesen Konflikt auf. Unter anderem kommen (Castle et al. 2015) zu dem Schluss, dass es in der Literatur zahlreiche Definitionen von »Gewalt gegen alte Menschen« gibt. Es werden 43 unterschiedliche Definitionen vorgestellt und die Autor*innen resümieren, dass es keinen Konsens darüber gibt, wie Gewalt zu definieren ist. Es wird zwar auf einen Kodex für Pflegeheime verwiesen, in dem beschrieben wird, dass dort lebende Personen das Recht haben, frei zu sein von: verbaler, sexueller, körperlicher und geistiger Misshandlung, körperlicher Bestrafung und unfreiwilliger Absonderung3.
Aber dieser Kodex müsste auf alle Organisationen der Altenhilfe sowie auf alle dort lebenden und arbeitenden Menschen übertragen werden bzw. übertragbar sein, inhaltlich abgestimmt und allen Akteur*innen bekannt sein, damit dieser wirksam werden kann.
Problematisch – so die Autor*innen – sei allerdings, dass verschiedene Kategorien von Missbrauch oder Gewalt existieren und es wird auch darauf hingewiesen, dass einzelne Typologien die Phänomene von Gewalt nicht angemessen erfassen. Beispielsweise sind »verbale Angriffe« eine wichtige und häufig vorkommende Art der Ausübung von Gewalt. Wenn diese Phänomene unter der Überschrift »Emotionale oder psychologische Misshandlung« subsummiert werden, ist eine Zuordnung jedoch schwierig. Ein weiteres Problem bei den unterschiedlichen Definitionen ist, dass jeweils unterschiedliche Begriffe genutzt werden, wie z. B. Missbrauch, Gewalt, Vernachlässigung, Aggression usw. und diese zum Teil auch synonym verwendet werden (Castle et al. 2015).
Das »Wirrwarr« an Definition bezieht sich nicht nur auf »Gewalt gegen alte Menschen«, sondern lässt sich auf alle anderen Konstellationen übertragen, wie z. B. Gewalt von Bewohnern*innen gegenüber Bewohnern und Bewohnerinnen. Es braucht daher erst einmal eine Verständigung auf eine gemeinsame Definition.
Dass unterschiedliche Definitionen ein Problem sind, haben wir bereits am oben dargestellten Fall der Kollegin auf der personalen und interpersonalen4 Ebene deutlich gemacht. Außerdem ist zu beachten: Wenn ungleiche Definitionen oder Kategorisierungen zum Thema Gewalt vorliegen, dann ist auch die Erfassung der Häufigkeit sehr schwierig. Bonnie und Wallace (2003) halten es sogar für unmöglich, die entsprechenden Ergebnisse von Studien zu vergleichen. Wenn eine Gewaltdefinition beispielsweise nur körperliche Gewalt in den Blick nimmt, dann wird die Messung, wie häufig Gewalt vorkommt anders ausfallen, als wenn Gewalt neben körperlichen auch sexuelle sowie verbale Phänomene und weitere Formen beinhaltet (u. a. Lowenstein et al. 2009).5
Außerdem betonen Castle et al. (2015), dass Definitionen je nach Land variieren bzw. abhängig von kulturellen, ethnischen und religiösen Normen oder Traditionen sind, wodurch zudem eine Erfassung von Gewalt erschwert wird. Zudem fehlt es an etablierten, standardisierten Messinstrumenten für die Altenhilfe.
Das bedeutet man kann entweder nur bedingte Aussagen dazu machen, wie häufig Gewalt in der Altenhilfe vorkommt, oder man hat eine große Bandbreite von Aussagen, wie häufig Gewalt auftritt. Diese Unterschiedlichkeit von Messergebnissen (Prävalenzen) und die damit einhergehende Dokumentation von Gewaltvorfällen wird im ▸ Kap. 16.4 nochmals aufgegriffen. Man sollte daher immer sehr genau darauf achten, was jeweils Gegenstand der Forschung ist bzw. welche Definition verwendet wurde und welche Daten oder Empfehlungen daraus abgeleitet werden. Das ist zentral, um »Äpfel nicht mit Birnen« zu vergleichen.
Diese Darstellungen sollen verdeutlichen, wie wichtig es ist, sich über »Gewalt in der Pflege « und deren Bedeutung in der pflegerischen Praxis Gedanken zu machen, um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Dieses Verständnis ist Basis dafür, im Alltag Gewaltschwellen sensibel wahrzunehmen und darüber im Gespräch zu bleiben oder zu kommen.
Wie kommt man im Team bzw. in den Einrichtungen zu einem gemeinsamen Verständnis von Gewalt und geht das überhaupt? Ja, das ist möglich! Was bleibt ist die unterschiedliche Betroffenheit oder Schwelle, die Menschen »als grenzwertig« empfinden, wie das folgende Beispiel illustriert.
Eine Kollegin erzählt, »wenn mich jemand beleidigt, dann geht das zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus«. Eine andere Kollegin hingegen gibt zu verstehen: »Mich nehmen Beleidigungen immer sehr mit und ich denke lange darüber nach, was ich falsch gemacht habe. Mich belastet das«.
Beide Personen reagieren also sehr unterschiedlich. Sie werden im Gespräch darauf aufmerksam gemacht, dass das Gegenüber ein anderes Empfinden, unterschiedliche Grenzen und Bewältigungsstrategien hat und nutzt. Diese jeweiligen Grenzen im Gespräch zu erkennen und auszutarieren und vor allem anzuerkennen ist bereits die »halbe Miete«. Abwertungen wie »Du schon wieder«, sollten vermieden werden, weil Mitarbeitende sich sonst zurückziehen. Letztlich geht es in diesem Beispiel darum, Strategien zu entwickeln, um verbale Gewalt, wie Beleidigungen oder Beschimpfungen im Team, zu thematisieren und ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen. Dabei können dann auch die individuellen Strategien angesprochen und Hilfsangebote formuliert werden. Es sollte aber Konsens sein, dass jede Form von Gewalt ein Gesprächs- und Handlungsanlass im Team ist, wenn eine Person oder mehrere Personen dies thematisieren.
Das gilt nicht nur für die Gewaltphänomene, die von Menschen mit Pflegebedarf ausgehen, sondern auch für solche die von Pflegenden, Betreuungskräften oder Angehörigen ausgehen. Das kann beispielsweise die verrohte Sprache gegenüber einem Angehörigen oder einem Mensch mit Pflegebedarf sein, die negativ auffällt und die man gegenüber den Kollegen*innen thematisiert.
1.1 »Gewalt in der Pflege« – eine gemeinsame Definition finden
In Ihrer Einrichtung werden Sie ähnliche Beispiele, wie das oben Beschriebene finden. Das kann eine ganz konkrete Situation sein, die sie selbst erlebt haben oder von der ihnen berichtet wurde. Sie können auch dem elektronischen Zusatzmaterial (▸ Kap. 22) Fallbeispiele entnehmen, die zum Gesprächseinstieg genutzt werden können. Filmausschnitte oder ein Zeitungsbericht über einen Gewaltvorfall in der Pflege bieten sich gleichermaßen an.
Nutzen Sie diese Beispiele im Rahmen einer Teamsitzung oder Besprechung, um darüber ins Gespräch zu kommen, welche Empfindungen die Schilderung, der Bericht oder der Film jeweils auslösen. Wir haben im Rahmen solcher Besprechungen und Schulungen erlebt, dass Mitarbeitende, Angehörige oder auch Ehrenamtliche Interesse an dem Thema »Gewalt in der Pflege« haben und ein großes Bedürfnis besteht, sich darüber auszutauschen.
Fragen Sie die Teammitglieder, welche Formen von Gewalt in der Schilderung erkennbar werden und welche andere Formen von Gewalt ggf. im Alltag erlebt oder gekannt werden (▸ Kap. 2.2). Lassen Sie die Personen jeweils eine Antwort auf eine Karte notieren. Denn obwohl die Definitionen von Missbrauch unterschiedlich sind, besteht unter Forschenden und Praktikern zunehmend Einigkeit darüber, dass Formen oder Handlungen, Gewalt in der Pflege beschreiben können (Gimm et al. 2018).
Zu diesen Handlungen gehören (a) körperlicher Missbrauch, unter anderem auch Handlungen, die körperliche Schmerzen oder Verletzungen verursachen; psychische Misshandlung, einschließlich Handlungen, die seelische Schmerzen oder Verletzungen verursachen; sexueller Missbrauch, als nicht einvernehmliche sexuelle Kontakte; finanzielle Ausbeutung, die jede Art von Veruntreuung von Geld oder Eigentum eines älteren Erwachsenen beinhaltet; und die (Selbst-)Vernachlässigung, oder das Versäumnis von Pflegenden, die Bedürfnisse eines abhängigen älteren Menschen zu befriedigen.
Lassen Sie die Teammitglieder die unterschiedlichen Formen/Handlungen von Gewalt nach Überschriften »clustern«. Achten Sie darauf, dass eine organisationale Bearbeitung des Themas »Gewalt in der Pflege« auf alle Gewaltkonstellationen fokussieren sollte.6
Fassen Sie die unterschiedlichen Aussagen zusammen und halten Sie die Ergebnisse fest bzw. verschriftlichen Sie diese, damit das gemeinsame Arbeitsergebnis und damit das gemeinsame Verständnis dokumentiert wird.
1.2 Die Definition der Wilhelmshilfe
Die »Wilhelmshilfe e. V.«7 hat den Diskurs zum Thema Gewalt in der Pflege in Schulungen für Mitarbeitende, Angehörige und Ehrenamtliche angeregt und führt diese Auseinandersetzung kontinuierlich weiter. Die Frage der Definition von Gewalt wurde anhand der Formen von Gewalt angebahnt. Anschließend wurden unterschiedliche Definitionen gesichtet (z. B. WHO, Galtung), miteinander verglichen und die folgende Definition konsentiert. Zudem wurde eine Differenzierung von »Gewalt« und »Grenzverletzung« vorgenommen. Diese Definitionen lauten wie folgt:
Unter Gewalt verstehen wir in der Wilhelmshilfe:
»Jedes Handeln, welches potenziell realisierbare grundlegende menschliche Bedürfnisse (Überleben, Wohlbefinden, Entwicklungsmöglichkeit, Identität und Freiheit) durch personelle, strukturelle oder kulturelle Determinanten beeinträchtigt, einschränkt oder deren Befriedigung verhindert«.
Gewalt entsteht demnach auf drei Ebenen, die sich gegenseitig beeinflussen:
Direkte (personale) Gewalt lässt sich eher objektivieren und bezieht sich auf:
Körperliches Schädigen (z. B. schlagen, grob anfassen, an den Haaren ziehen, freiheitsentziehende Maßnahmen [FEM]).
Psychisches Schädigen (z. B. anschreien, beleidigen, unangemessenes Ansprechen, ignorieren, demütigen, erpressen, unter Druck setzen).
Sexuellen Missbrauch (z. B. Intimkontakte verlangen oder erzwingen, Vergewaltigung, anzügliche Bemerkungen, Verletzung der Intimsphäre).
Finanzielle Ausbeutung oder Ausnutzung (z. B. Freundlichkeit und Dienstleistung erkaufen, über das Vermögen einer anderen Person ohne ihre Erlaubnis verfügen, zu Geschenken nötigen, Geld oder Wertgegenstände entwenden).
Einschränkung des freien Willens sowie passive und aktive Vernachlässigung (z. B. unterlassene Körperpflege, unzureichende medizinische Versorgung, Entzug von Aufmerksamkeit oder Hilfestellung im Alltag, ignorieren und übergehen von geäußerten Bedürfnissen).
Strukturelle Gewalt ist eher verdeckt und weniger fassbar als direkte Gewalt. Vorschriften und Gesetze, deren Einhaltung wenig Rückhalt findet, fördern die strukturelle Gewalt. Notwendige Maßnahmen, die durch monetäre Einschränkungen nicht erfolgen, wie etwa zu wenig Personal, mangelhafte Aus- und Fortbildung sowie zu enge Lebensräume, stützen Gewalt und missachten ethische Pflichten. Auch die nur zu oft anzutreffende Ansicht »Sicherheit« vor »Lebensqualität« und »Humanität« sind hier einzubeziehen.
Kulturelle Gewalt bezieht sich auf immanente Wertvorstellungen und kollektive Vorurteile, die eine Verringerung von Gewalt erheblich erschweren und strukturelle wie personelle Gewalt stützen wie etwa Altersdiskriminierung, Akzeptanz von Gewalt, Frauenbilder usw.« (Gewalt /Gewaltdreieck nach Galtung 1997, entnommen und angepasst nach Hirsch 2012).
Der Begriff Grenzverletzung hingegen bezeichnet ein Verhalten, das oft als unangemessen angesehen wird und manchmal unbeabsichtigt auftritt. Dabei ist die Unangemessenheit des Verhaltens insbesondere vom subjektiven Erleben des betroffenen Menschen abhängig. Grenzverletzungen können korrigiert werden, indem sich bei dem Betroffenen entschuldigt bzw. Bedauern über die Überschreitung zum Ausdruck gebracht wird und Alternativen besprochen werden. Die Person, die die Grenze überschritten hat, muss über Empathie- und Reflexionsfähigkeiten verfügen. Bei dem Betroffenen ist hingegen Mut und Wissen erforderlich, die eigenen Gefühle zu thematisieren.8





























