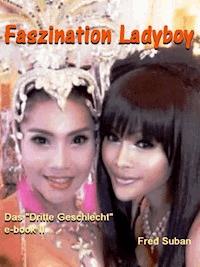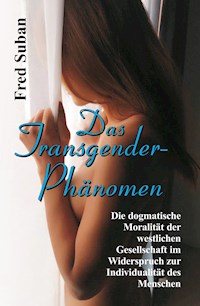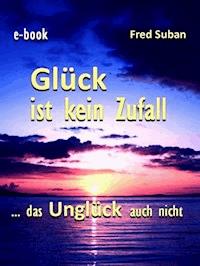
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Es ist ein gewaltiger Irrtum zu glauben, Glück und Erfolg - wie auch Misserfolge und Schicksalsschläge - seien Zufälligkeiten. Stattdessen sollten wir uns bewusster werden, dass alles, was uns umgibt, was wir erleben oder uns widerfährt, einen Grund hat (Ursache und Wirkung) oder einem tieferen Sinn entspringt. Doch anstatt die Ursachen zu erforschen, grenzen wir unser Denken, unsere Sichtweite mit Vorurteilen ein und hadern mit unserem Schicksal. Doch wenn wir verstehen lernen, dass alles eine positive wie auch eine negative Seite hat, dann können wir auch Schicksals- und Rückschläge besser bewältigen. Denn nichts ist so negativ, als dass darin nicht auch ein positiver Sinn zu finden wäre FRED SUBAN zeigt in einer leicht verständlichen, nachvollziehbaren Logik und mit authentischen Beispielen die Zusammenhänge auf, inwiefern wir - und niemand sonst - für unseren gesamten Lebensverlauf und somit für unser Schicksal verantwortlich sind. Ob wir den Weg in ein nachhaltig erfolgreiches, glückliches Leben einschlagen wollen, oder jenen wählen, der uns zeitlebens Kummer und Unglück beschert, bleibt jedoch jedem von uns selbst überlassen. So individuell die Menschen sind, so unterschiedlich ist auch das persönliche Verständnis von Glück und Erfolg. Trotzdem ist der Weg dahin für alle derselbe. FRED SUBAN scheut sich auch nicht, die Ursachen vieler gesellschaftlicher Gegenwartsprobleme, der zunehmenden Verrohung und Gewaltbereitschaft der Jugendlichen, beim Namen zu nennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Vorwort
1. Die Bedeutung der Fragen im Überblick
Einfluss und Nutzen des Unterbewusstseins
Emotion und Intellekt
2. Frageform und Fragestellung
Stellenwert der Fragen
3. Der Mensch ist das, was er denkt – der Mensch denkt, wie er ist
Der Mensch in der Gesamtheit
Die geistige Haltung und Ihre Gesundheit
Die Macht der Pharmaindustrie
Der Mensch in seiner Verantwortung
Der Mensch ist das, was er denkt, und nicht das, wovon er träumt.
4. Wege zum Erfolg
Die faktische Definition
Die Definition des wahren Erfolgs
Die Zielsetzung als Richtungsweiser
Meine erste große Enttäuschung
Ohne Zielsetzung keine Zukunft
Ein Leben in Freiheit
Die Entscheidung – erste Stufe auf dem Weg zum Ziel
5. Wie bitte geht’s zum Erfolg?
Die Suche nach der Wahrheit
Alles ist relativ – alles ist Realität (Wirklichkeit)
Glück und Zufriedenheit sind lernbar
Der beschwerliche Weg nach oben
Die Vermarktung (der Aufstieg)
Ein Musterbeispiel
Todesursachen eines Unternehmens
6. Entdecke dein Glück, denn es ruht in dir!
Carpe diem (nutze den Tag)
Ralph, das wahre Glück (Name geändert)
Eine gelungene Fishing-Tour
Caroline, das gelebte Leben (Name geändert)
Silvia, glücklich in meiner Welt (Name geändert)
Glück oder Unglück in der Partnerschaft?
Eine Ehe in Eifersucht
Alkoholsucht
Liebe und Partnerschaft
Spielsucht
7. Lüge und Wahrheit
Die römisch-katholische Kirche
Buddhismus
Anthroposophie
Die christliche Lehre im Vergleich
Glück ist kein Zufall – das Unglück auch nicht
Originalausgabe:
© 2011 novum publishing gmbh
ISBN 978-3-99003-872-7
Lektorat: Dipl.-Theol. Christiane Lober
Umschlagfoto:
Carlos Caetano | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz:
novum publishing gmbh
Impressum:
Fred Suban
Glück ist kein Zufall – das Unglück auch nicht
e-book
ISBN 978-3-8442-9323-4
© copyright 2014 Fred Suban
© Cover: Fred Suban
Website:
http://www.thailandlive.info
Vorwort
Lerne fragen – lebe besser
Anmerkung
Das Buch ist der Einfachheit halber und um den Schreib- und Verständigungsfluss nicht zu unterbrechen, in der männlichen Form geschrieben. Es sind weder rassistische noch diskriminierende Gründe dahinter zu suchen. Sollte es trotzdem jemand tun, entspringt dies dessen eigener Fantasie.
Vorkommende Namen wurden allesamt geändert. Sollte sich trotzdem jemand angesprochen fühlen, wäre dies auf reinen Zufall zurückzuführen.
Lerne wieder zu fragen – dann verstehst du das Leben
Das zentrale Thema dieses Buches ist die Frage nach dem gangbaren Weg in ein nachhaltig erfolgreiches und glückliches Leben. So individuell die Menschen sind, so unterschiedlich ist auch das persönliche Verständnis von Erfolg und Glück. Trotzdem ist der Weg dahin für alle derselbe.
Wir sollten uns dessen bewusster werden, dass alles, was uns umgibt, was wir erleben oder uns widerfährt, einen Grund hat oder einem tieferen Sinn entspringt. Doch anstatt die Ursachen zu erforschen, grenzen wir unser Denken, unsere Sichtweite mit Vorurteilen ein.
Wir müssen lernen, Fragen an uns und unsere Umwelt zu stellen. Mit Fragen erweitern wir nicht nur unser Wissen, sondern Fragen sind der unmittelbare Zugang zu unseren gespeicherten Erinnerungen und zum allgemeinen Verständnis für die Zusammenhänge des Lebens. Wenn wir uns dieser Zusammenhänge bewusst werden, verstehen wir auch, dass wir allein und niemand sonst für den Verlauf unseres Lebens verantwortlich sind. Dann beurteilen wir persönliche Misserfolge, unerwartete Krankheiten oder Schicksalsschläge aus einer anderen Perspektive und merken, dass die Ursache in uns selbst zu suchen ist.
Als Autor dieses Buches begnüge ich mich aber nicht mit theoretischen Grundsätzen, sondern möchte durch meine eigenen Erfahrungen und authentischen Erzählungen zum besseren Verständnis beitragen.
Als einziger Sohn und als jüngstes Kind wurde ich im Jahr 1941 in die Familie eines Auslandschweizers, einer deutschstämmigen Mutter und dreier Schwestern hineingeboren. 1945, kurz vor Kriegsschluss des Zweiten Weltkriegs, gelang meiner Mutter mit uns vier Kindern die Flucht in die Schweiz. Der Vater ist infolge eines tragischen Vorfalls frühzeitig gestorben. So wurde mein Leben von früher Kindheit an harten Prüfungen unterzogen und war in der Folge von manchen Höhen und Tiefen geprägt, aber auch gestärkt. Aus eigener Erfahrung habe ich gelernt, dass es nichts gibt, was nur negativ ist, sondern dass alles einem tieferen Sinn entspringt; und ich hoffe, Ihnen, verehrte Leserin, verehrter Leser, damit zu Ihrem Erfolg und Glück beitragen zu können.
1. Die Bedeutung der Fragen im Überblick
Fragen sind die großartige Chance, zuvor über das nachzudenken, was danach gesagt oder getan wird, und verpflichten gleichzeitig, Haftung dafür zu übernehmen.
Ich erinnere mich, wie ich als Kind meine Mutter und später auch noch meine Lehrer mit meiner ungebremsten Fragerei, warum dies so oder jenes anders sei, manchmal beinahe in Verlegenheit brachte. Vielleicht ist es Ihnen ebenso ergangen. Kinder und Jugendliche haben einen unbeschwerten Wissensdrang, den sie mit ebenso unbeschwerten Fragen befriedigen wollen. Später weicht diese Unbeschwertheit zunehmend einer Art Beklemmung: Wir schämen uns plötzlich, Fragen zu stellen – aus Angst, als unwissend eingestuft zu werden. Stattdessen neigen wir vermehrt zu Vorurteilen.
Neulich sah ich im TV eine Talkshow zum Thema, ob die heutige Jugend eigentlich dümmer geworden sei, was ja aus einschlägigen Studien hervorgehe. Dabei wurde, wie so üblich, über mögliche Fehler bei der Bildung diskutiert. Eines aber ist mir besonders aufgefallen: Eine Umfrage unter der Lehrerschaft habe ergeben, es sei auffallend und beängstigend, dass die Schüler keine Fragen mehr stellten, bedeutet dies doch nichts anderes als allgemeines Desinteresse. Ein weiterer Grund sei aber auch die vorherrschende Meinung, ohnehin alles bereits zu wissen, was in der heutigen Zeit für sie relevant sei.
Diese Entwicklung ist bedenklich, bedeutet Interesselosigkeit doch Stillstand der geistigen Entwicklung und der Persönlichkeitsentfaltung. Durch Fragen erweitern wir jedoch unser Wissen und fördern somit die Personalisation und das Selbstbewusstsein – unabdingbare Voraussetzungen also für persönlichen Erfolg und ein erfülltes Leben, wie wir später in diesem Buch erfahren werden. Das Leben ist voller Antworten, wir müssen sie nur erfragen und uns zunutze machen.
Fragen haben allerdings einen unterschiedlichen Stellenwert. Wir müssen deshalb wieder lernen, Fragen so zu stellen, dass wir die richtigen Antworten erhalten. Denn nicht umsonst sagt der Volksmund:
„Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.“
Warum ist das so?
Der Mensch ist ein Individuum. Alles, was er sieht, erlebt und denkt, wird so, wie er es empfindet, in seinem unbewussten Inneren, dem sogenannten Unterbewusstsein, gespeichert. Das Unterbewusstsein unterscheidet jedoch nicht, was gut oder böse, positiv oder negativ für uns ist – oder um es neuzeitlich auszudrücken: Es verhält sich ähnlich wie ein Computer, der alles, was wir eingeben, ohne Vorbehalte speichert und alles unverändert wiedergibt, was wir von ihm verlangen.
Nun ist der Mensch aber kein serienmäßiger Computer, sondern besitzt seine eigene Individualität mit eigenen Voraussetzungen, eigener Veranlagung, aber auch Vorbelastungen. Jeder Mensch hat seine eigenen Erlebnisse; vor allem beurteilt jeder Mensch diese nach seinem Empfinden. Bewusst und/oder emotional durchlebte Ereignisse und Einflüsse werden vom Unterbewusstsein intensiver aufgenommen und haben auch einen höheren Erinnerungswert als solche, die uns als weniger wichtig erscheinen. Dinge und Ereignisse, die uns als unwichtig erscheinen, werden schnell wieder vergessen, wie wir im täglichen Leben selber feststellen können. In Wirklichkeit wird jedoch nichts vergessen. Solche Ereignisse werden sozusagen einfach in die „hintere Reihe“ zurückgesetzt. Dasselbe geschieht übrigens auch mit Erfahrungen, die lange Zeit zurückliegen bzw. in der frühen Kindheit ihren Ursprung haben und denen zudem der emotionale Stellenwert fehlt. Detaillierte Rückerinnerungen an solche Ereignisse sind durchaus möglich, erfordern allerdings eine zielgerichtete Befragung oder benötigen möglicherweise die Hilfe von Fachleuten (Tiefenpsychologie).
Wenn es alles, was wir erleben, jedes Ereignis, jedes Empfinden vorbehaltlos aufnimmt, so ist das Unterbewusstsein auch manipulierbar – eine Tatsache, die übrigens oft genug missbraucht wird. Wir können es so ausrüsten, dass es Gutes und Böses unterscheiden kann, es also mit einem Gewissen versehen, wie wir es nennen; sozusagen mit einem Browser, um es wiederum in der modernen Sprache zu sagen. Das Gewissen richtet sich nach unserer Erziehung, unserer unmittelbaren Umgebung und unserem Kulturkreis, in dem wir aufwachsen. Was wir also als böse empfinden, weil es so gelehrt wird, wird als solches registriert, ebenso dasjenige, was wir als gut betrachten.
In der Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter hinein sind wir besonders aufnahmefähig dafür. Deshalb sind in dieser Zeit die Erziehung durch Eltern und Schule sowie die Auswahl des Umfelds besonders wichtig, und es ist durchaus nicht vertretbar, wenn sich sogenannte Frauenrechtlerinnen für eine antiautoritäre Erziehung einsetzen. Das Resultat dieser früheren Bewegung umgibt uns unwiderruflich bis in die heutige Zeit.
Besonders im Entwicklungsalter braucht der Mensch Vorbilder, an denen er sich orientieren kann – und wer anders als in erster Linie die Eltern, Lehrer und ein gesundes Umfeld können solche Orientierungen ermöglichen? Dieses Gewissen begleitet uns üblicherweise dann das ganze Leben lang, und es ist unsinnig zu glauben, dass Menschen, die in ein anderes Land mit einer anderen Kultur umziehen, die anerzogenen Gewohnheiten einfach abstreifen und sich einer anderen Kultur und Denkweise ersatzlos anpassen – es sei denn, die neue Umgebung werde dem Unterbewusstsein, begleitet von dem innigsten Wunsch danach, als die für ihn richtige Lebensweise einprogrammiert. Und trotzdem gelingt dies nicht immer vollends, weil der Wunsch dazu oft doch nicht innig genug ist.
Einfluss und Nutzen des Unterbewusstseins
Wir erkennen also, dass unser Unterbewusstsein alle Einflüsse, Eindrücke und Erlebnisse speichert, jedoch unterschiedlich bezüglich Intensität und Erinnerungswert. Des Weiteren erkennen wir, dass das Unterbewusstsein durch das Gewissen Gut und Böse unterscheiden kann. Diese Unterscheidung trifft allerdings nicht auf das zu, was sich auf ein erfolgreiches Leben als förderlich oder eher hemmend bzw. richtig oder falsch auswirkt, denn dies entnimmt das Unterbewusstsein unseren Erfahrungen und Erlebnissen und unserer Bewertung, ob wir diese Eindrücke also als positiv oder negativ, als für uns förderlich oder eher hemmend empfunden haben.
Wenn wir die Bedeutung des Unterbewusstseins erst einmal richtig erkennen, dann sollten wir auch daran denken, dieses mit möglichst vielen Informationen zu versorgen. Eigentlich geschieht dies unbewusst durch die täglichen Eindrücke und Erlebnisse, allerdings in unterschiedlicher Qualität, wie wir ja wissen, da das unbewusst Aufgenommene emotionslos registriert wird und somit in der Erinnerungsskala eher „hinten“ angesiedelt wird. Was wir aber bewusst und emotional tun und dazu möglichst oft wiederholen, ist stetig präsent und greift sogar für uns unbewusst in unser Handeln ein. Wenn wir beispielsweise einen Beruf oder eine Fremdsprache erlernen oder uns anderweitig weiterbilden, tun wir doch nichts anderes als die an uns gestellten Aufgaben so oft zu wiederholen, bis wir diese „automatisch“ ausüben. Selbstverständlich trifft dies auch auf all das zu, was wir täglich wiederholen, auch auf wiederholte Fehler.
Dabei ist zu beachten, dass das, was wir gerne tun, weil es uns emotional positiv berührt, einen höheren Erinnerungswert hat bzw. schneller direkten Einfluss auf unser Handeln nimmt. Ein geübter Automobilist beispielsweise wird sich kaum mehr überlegen müssen, wann zu bremsen oder zu schalten ist. Das bedeutet nichts anderes, als dass er durch stetes und emotionales Wiederholen dem Unterbewusstsein das intensive Erinnerungsvermögen eingeprägt hat.
Der Erinnerungswert wird durch unser Handeln und Denken sowie durch unsere Sinnesorgane bestimmt in der Reihenfolge: manuelle Tätigkeit, tasten, schmecken, riechen, sehen, hören. Sind dann noch Emotionen involviert, steigert sich der Erinnerungswert um ein Vielfaches.
Der Nutzen daraus ist, dass wir den Erinnerungswert sozusagen „erarbeiten“ können: Gehen Sie daher künftig bewusster durchs Leben und erweitern Sie so das Erinnerungsvermögen, damit Sie für alle Eventualitäten gerüstet sind, und denken Sie positiv, denn nur so ergeben sich auch positive Intuitionen und Perspektiven!
Emotion und Intellekt
Wie bereits oben beschrieben, ist der Mensch ein Individuum, ein Unikat mit einer eigenen Persönlichkeit, einem eigenen Ich. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Talente, Neigungen und Veranlagungen. Emotionen entspringen der persönlichen Veranlagung und werden durch äußere Einflüsse und Erlebnisse vom Unterbewusstsein ausgelöst.
Nun hat der Mensch nicht nur eine positive, sondern auch eine negative oder, anders genannt, eine weiße und eine schwarze Seite, die der gleichen Ebene des Unterbewusstseins entspringen.
Zur positiven Komponente zählen wir Liebe, Barmherzigkeit, Hilfsbereitschaft, Großmut. Zur negativen Seite werden die negativen Neigungen und Begierden, Hass, Zorn, Eifersucht, Habgier, Neid etc. gezählt.
Dazu kommen noch die „Sowohl-als-auch-Veranlagungen“ wie beispielsweise Angst, Mut, Lernbereitschaft, Wissensdrang, die sich auf der rein emotionalen Ebene in positiver oder negativer Richtung auswirken können, sofern sie nicht durch das intellektuelle, bewusste Denken geleitet werden.
Emotionen oder das unbewusste Denken, wie es auch genannt wird, müssen vom bewussten Denken, dem sogenannten Intellekt, geleitet werden. Tun wir dies nicht, werden wir unserer Veranlagung entsprechend unkontrolliert positiv oder negativ beeinflusst. Emotionen sind die stärkste Antriebskraft. Wir erleben es immer wieder, was beispielsweise Hass, Habgier oder Eifersucht anzurichten vermögen – dass aber auch die Liebe Menschen bis zur Selbstaufopferung treiben kann.
Je nach Persönlichkeit sind die positive oder negative Veranlagung sowie das unbewusste oder das bewusste Denken mehr oder minder ausgeprägt:
Ausgeprägt emotionale Menschen neigen zu unüberlegtem Handeln. Emotionen sind, wie oben beschrieben, die stärkste Kraft und dauerhafter Ansporn (Wille), ein festgesetztes Ziel zu erreichen. Leider neigen diese Menschen auch dazu, sich unrealistische Ziele zu setzen, weil diese eben durch emotionale Visionen vorgegeben werden.
Ausgeprägt intellektuell denkende Menschen sind materialistisch ausgerichtet. Sie verdrängen Emotionen, weil sie diese als Schwäche empfinden. Diese Menschen sind kaum fähig zu einem wirklich erfüllten und harmonischen Leben. Sie fühlen sich ständig im Konkurrenzkampf mit Gleichgesinnten, von deren Erfolgen sie sich anfänglich magisch angezogen fühlten. Haben sie dann die gleiche Ebene erreicht, empfinden sie diese anderen als lästige Konkurrenz.
Das Fazit: Emotionen und Visionen sind der Motor, die unerschöpfliche Antriebskraft, ein festgelegtes Ziel erreichen zu wollen, müssen jedoch mit dem bewussten, dem intellektuellen Denken auf eine reale Zielvorgabe gerichtet werden. Folglich benötigen wir für den Erfolg beides im vernünftigen Verhältnis.
Mit den geeigneten Maßnahmen und Fragen lässt sich der optimale Weg finden!
2. Frageform und Fragestellung
Wenn ich an die Bedeutung des Fragens denke, kommt mir unweigerlich die Erinnerung an einen unserer Mathematiklehrer, der uns in der Schule das Dreisatzrechnen mit folgenden Worten beibrachte:
„Die Fragestellung ist der Schlüssel zur Lösung,
richtig gestellte Fragen führen zur richtigen Lösung,
falsch gestellte Fragen zum falschen Resultat.“
Dazu 2 Beispiele zur Erinnerung für jene, denen diese Rechenart nicht mehr geläufig ist:
Beispiel 1
Sie kaufen auf dem Markt 8 Äpfel, diese wiegen zusammen 1,2 kg.
Wie viele Äpfel würde ich bekommen für 3 kg?
Lösung:
1) für 1,2 kg bekomme ich 8 Äpfel
2) für 1,0 kg bekomme ich 1,2-mal weniger
3) für 3,0 kg bekomme ich wie viele Äpfel?
Würde man die Fragen jedoch folgendermaßen formulieren:
„8 Äpfel wiegen 1,2 kg
1 Apfel wiegt 8-mal weniger
3 kg sind wie viele Äpfel?“,
Erläuterung:
Die Positionen 1 und 3 sind immer in der Klammer zuerst zu multiplizieren, Position 2 steht hinter der Klammer-Rechnung und ist mit dem Resultat aus der Klammer zu dividieren.
Beispiel 2
Die Äpfel sind in 3,0-kg-Säcken zu je 20 Stück abgepackt, Sie möchten jedoch nur 8 Stück.
Frage: Wie schwer sind denn diese 8 Stück?
Lösung:
2) 1 Stück wiegt 20-mal weniger
3) 8 Stück wiegen?
Einfachheitshalber wird bei beiden Beispielen von gleichen Zahlen ausgegangen, die Fragestellung jedoch ist sehr unterschiedlich.
Während bei Beispiel 1 die Frage lautete, wie viele Äpfel man für ein bestimmtes Gewicht erhalten würde, war beim Beispiel 2 die Frage genau umgekehrt: Man wollte wissen, wie hoch das Gewicht bei einer bestimmten Anzahl Äpfel ist.
Stellenwert der Fragen
Den Zugang zu den Erinnerungen unseres Unterbewusstseins erreichen wir durch gezielte Fragen. Dabei spielen Frageform und Fragestellung eine zentrale Rolle. Die Frageform ist der Weg, wie man auf das Erinnerungsvermögen zugeht, die Fragestellung (also wie die Frage gestellt wird) bedeutet die Eingrenzung, also die Fokussierung des Erinnerungsvermögens auf eine gewählte Thematik.
Die Antworten unseres Unterbewusstseins sind intuitiv, emotional und visionär. Wenn wir also eine Antwort erwarten, muss auch die Frageform auf dieselbe Ebene gebracht werden und die Frage so gestellt sein, dass von den gespeicherten Erinnerungen entsprechende Intuitionen, Emotionen oder Visionen ausgelöst werden können.
Die Frageform „Warum?“ beispielsweise ist universell und neutral und öffnet den Zugang zum Unterbewusstsein ohne bestimmte Vorgaben. Dem Unterbewusstsein ist sozusagen freigestellt, was es an Erinnerung aktivieren will. Somit wird es vorbehaltlos alle Erinnerungen aufzeigen, die irgendwie mit der „Anfrage“ zusammenhängen. Dass diese Frageform zudem einen ungeahnten Denkprozess auslöst, kann mühelos durch eine Selbstbefragung getestet werden. Tun Sie das, werden Sie sich einmal dessen bewusst, wie wir intuitiv geleitet werden!
Wenn Sie sich beispielsweise beruflich verändern wollen, fragen Sie sich nicht, „was“ Sie tun müssen, um sich zu verändern. Denn darauf werden Sie kaum die gewünschte Antwort erhalten. Was soll denn das Unterbewusstsein antworten, wenn Sie selber nicht wissen, was Sie wollen?
Fragen Sie stattdessen: „Warum möchte ich mich verändern?“! So werden Sie sich der vielen Gründe bewusst, die Sie möglicherweise schon lange zuvor zu diesem Entschluss bewogen haben, und zudem werden Visionen für ein neues Ziel wach.
Als ich noch Organisationsleiter in einer großen Vertriebsfirma war, wies ich in meinen Seminaren immer wieder auf die Wichtigkeit des Fragens, insbesondere auf die Frageform „warum“ als die stärkste Frageform hin – sei es, um mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen, sei es, um Vorurteilen zu begegnen – und bot auch entsprechende praktische Trainings an. Dabei zeigte ich anhand von Beispielen immer wieder auf, wie negativ sich Vorurteile auswirken. Das Resultat zeigte eindeutig, dass diejenigen, die meinen Rat befolgten und auch an meinen Trainings teilnahmen, erfolgreicher wurden.
Ein Beispiel aus einer persönlichen Begegnung, was Vorurteile bewirken können:
Ich ärgerte mich stets über eine meiner Nachbarinnen, weil diese jedes Mal, wenn ich ihr begegnete, sich nach der anderen Straßenseite umdrehte, obwohl ich immer freundlich grüßte. Eigentlich hätte es mir egal sein können. Aber da ich dazu erzogen wurde, Menschen freundlich zu begegnen und zu grüßen, wollte ich das Verhalten der Nachbarin nicht einfach hinnehmen.
So beschloss ich, mich mit gezielter Selbstbefragung dieses Problems anzunehmen. Die Frage lautete nicht etwa, warum meine Nachbarin mich nicht grüßen wollte, denn darauf hätte ja mein Unterbewusstsein keine Antwort geben können. Nein, die Frage lautete, warum ich mich eigentlich jedes Mal ärgerte. Darauf wäre eigentliche die Antwort zu erwarten gewesen, weil auf meinen Gruß auch ein Gegengruß zu erwarten sei.
Aber nein, der eigentliche Grund war, so konnte ich in Erfahrung bringen, dass ich mich in meinem männlichen Stolz getroffen fühlte. Wäre es nämlich ein Mann, dann würde mich dies weit weniger gestört haben. Außerdem wurde mir noch bewusst, dass mich plötzlich ihre ganze Erscheinung zu stören begann.
Eigentlich hätte für mich die Geschichte damit enden können. Aber ein fahler Geschmack oder ein Stachel im Fleisch, wie sich Poeten auszudrücken pflegen, wäre zurückgeblieben, und ich hätte mich weiterhin geärgert. So entschloss ich mich, der Sache auf den Grund zu gehen, und nahm mir vor, die Dame bei der nächsten Begegnung anzusprechen. Ich wollte erfahren, warum sie mir aus dem Weg gehe, obwohl ich ihr keinen Anlass dazu gab und im Gegenteil immer freundlich grüßte.
Gesagt, getan: Die Antwort, die sie mir nach einigem Zögern gab, beschämte mich zutiefst: dass sie nämlich als Jugendliche von einem Mann vergewaltigt worden sei, der sie ebenso freundlich gegrüßt hatte, und dass bei jeder Begegnung mit mir die Erinnerung daran wieder wach geworden sei.
Ein anderes Beispiel:
Hans (Name geändert) arbeitete bei der Kehrichtabfuhr in meiner ehemaligen Wohngemeinde. Alle Leute ärgerten sich an seiner schroffen Umgangsform und der Art, wie er sich manchmal über seine Mitbewohner hermachte; es war allein seiner Zuverlässigkeit zu verdanken, dass ihm noch nicht gekündigt worden war. Ich wusste aber, dass er eigentlich ein netter, junger Mann sein könnte, wenn auch geistig etwas zurückgeblieben. So beschloss ich, mich bei nächster Gelegenheit einmal mit ihm zu unterhalten. Der Dialog verlief ungefähr nach folgendem Muster:
„Hans, viele Leute beklagen sich über dein Benehmen. Eigentlich passt dies gar nicht zu dir. Warum tust du das?“
„Du bist der Erste, der mir das sagt. Die meisten, die ich kenne, betrachten mich nur als den Kübelleerer, und da soll ich noch freundlich sein? Weißt du, eigentlich möchte ich auch etwas Sinnvolleres tun, aber dazu hatte ich nie eine Chance.“
„Denkst du wirklich, dass jeder, dem du begegnest, etwas Sinnvolleres tut; dass jeder so zuverlässig ist wie du? Jeder Mensch hat seine Fähigkeiten, auch du, nämlich deine Zuverlässigkeit, im Sommer wie im Winter, bei Regen und bei Schnee den Müll der anderen wegzuräumen. Das, Hans, schafft nicht jeder. Denke einmal nach, welch wichtige Funktion du dabei ausübst! Du hast auch schon miterlebt, was passiert, wenn deine Arbeitskollegen irgendwo im Ausland streiken, wenn sich dadurch Gestank und später Krankheiten verbreiten.
Siehst du nun, dass deine Arbeit unverzichtbar ist und vor allem, dass wir alle auf solche Leute wie dich angewiesen sind? Das kannst du ruhig einmal öffentlich kundtun. Wir sollten dankbar sein, dass es solche Leute wie dich überhaupt noch gibt. Manche, die dich gering schätzen, lenken damit nur von ihren eigenen Problemen ab.“
„Du hast eigentlich recht, aber so habe ich das noch nie gesehen, und so hat auch noch niemand mit mir gesprochen. Ich fühle mich nun als ganz anderer Mensch.“
Unnötig zu sagen, dass er noch beifügte: „Eigentlich müssten mir alle einmal ein Dankeschön sagen.“
„Wann“, „wie“, „wo“, „wohin“, „wie viel“ sind subjektive, sachbezogene Fragestellungen und folgen auf die universelle, neutrale Fragestellung „warum“. Sie beziehen sich auf ein durch die Frageform „warum“ festgelegtes Thema. Mit dieser Fragestellung wird der bewusste oder intellektuelle Denkprozess angesprochen und ermöglicht so eine realistische Einschätzung bezüglich Durchführbarkeit einer Zielsetzung oder eines Vorhabens: ob beispielsweise die fachlichen Kenntnisse, der Durchhaltewille ausreichen, die finanziellen Mittel und die Bereitschaft, diese einsetzen zu wollen, vorhanden sind und vor allem, ob die emotionale Vision auch tatsächlich der Durchführbarkeit entspricht.
Wenn Ihnen also, um beim oben genannten Beispiel zu bleiben, die Gründe für eine berufliche Veränderung bekannt sind und Sie sich emotional ein visionäres Ziel gesteckt haben, ist mit dem intellektuellen Denken die Durchführbarkeit abzuklären.
Oder um es einfach zu erklären: Wenn Sie sich Bademeister als Traumjob vorstellen, selber aber nicht schwimmen können, weil Ihnen aus gesundheitlichen Gründen jeweils der Schwimmunterricht in der Schule verwehrt geblieben ist, wird diese Vision für Sie kaum realisierbar sein.
Mehr darüber im Kapitel: „Der Mensch ist, was er denkt – der Mensch denkt, wie er ist“.
3. Der Mensch ist das, was er denkt – der Mensch denkt, wie er ist
Der Mensch in der Gesamtheit
Wenn wir Erfolg, Gesundheit und ein dauerhaft ausgewogenes, glückliches Leben anstreben, müssen wir akzeptieren, dass nur der sichtbare physische (organische) Körper und der psychische (geistige) Teil zusammen den Menschen ausmachen. Weil der psychische Teil unsichtbar ist, wird er gerne ausgeklammert oder belächelt. Wenn man jedoch den Menschen in der Gesamtheit versteht und dies als Tatsache für sich akzeptiert, wird manches verständlich, was zuvor uninteressant erschien und höchstens Erstaunen oder ein achtloses Kopfschütteln verursacht hat.
Sie werden verstehen lernen, weshalb Glück und Unglück nicht ein Produkt des Zufalls sind, sondern das Resultat unserer geistigen Haltung und des daraus resultierenden Handelns. Was sich der Mensch real vorstellen kann, ist für ihn auch erreichbar. Erfahrungen