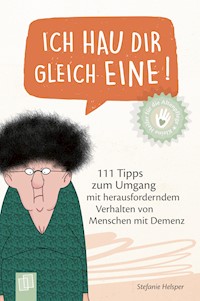18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Reinhardts Gerontologische Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Glück ist facettenreich und individuell. Mal zeigt es sich laut oder leise, aber immer verbunden mit Wohlbefinden und Zufriedenheit. Menschen mit Demenz empfinden Glück wie jeder andere, manchmal sogar noch intensiver. In fortgeschrittenem Stadium fällt es ihnen aber schwer, sich diese Glücksmomente selbst zu ermöglichen. Eine gute und sinnvolle Unterstützung zum Glücklichsein gelingt, wenn Fachkräfte typische Verhaltensweisen bei Demenz positiv umlenken können. Ein kompakter Überblick der Demenzformen als Einstieg frischt das Fachwissen auf. Neben neurophysiologischen Zusammenhängen liefern die Autorinnen konkrete Anregungen, wie das Wohlbefinden in den Alltag der Betroffenen integriert werden kann. Das Konzept der "Hand der Glücksmomente" versinnbildlicht dabei mit jedem Finger wichtige Bereiche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Ähnliche
Reinhardts Gerontologische Reihe
Band 59
Stefanie Helsper ist Ergotherapeutin mit Demenz-Schwerpunkt und leitet seit 2020 das Institut „Fortbildung mit Herz“ in Herborn, das Fortbildungen für MitarbeiterInnen aus der Geriatrie und Gerontopsychiatrie anbietet.
Dr. Harriet Heier, Dipl.-Psych., ist Psychologische Psychotherapeutin und Neuropsychologin mit eigener Praxis in Minden / Westfalen. Sie ist Vorsitzende des Vereins „Leben mit Demenz – Alzheimergesellschaft Kreis Minden-Lübbecke e. V“.
Hinweis: Soweit in diesem Werk eine Dosierung, Applikation oder Behandlungsweise erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass die Autoren große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen oder sonstige Behandlungsempfehlungen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. – Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-03062-0 (Print)
ISBN 978-3-497-61543-8 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61544-5 (EPUB)
ISSN 0939-558X
© 2021 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i. S. v. § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Printed in EU
Covermotiv: iStock.com/ideabug. Agenturfoto. Mit Models gestellt
Satz: Bernd Burkart; www.form-und-produktion.de
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort
1 Was ist eine Demenz?
1.1 Alzheimer-Demenz
1.2 Vaskuläre Demenz
1.3 Gemischte Demenz
1.4 Frontotemporale lobäre Degeneration (FTLD)
1.5 Lewy-Körperchen-Demenz
1.6 Parkinson Demenz
1.7 Andere Demenzformen
2 Was sind Glücksmomente?
2.1 Definition
2.2 Glücksmomente und Hormone
2.3 Glücksmomente und weitere Reaktionen
2.4 Ausbleiben von Glücksmomenten
3 Wie schaffe ich Glücksmomente?
3.1 Die Hand der Glücksmomente
3.2 Erklärung der fünf Handlungstipps
4 Bewegung und Betätigung
4.1 Bewegungen mit den Händen
4.2 Bewegungen mit dem ganzen Körper
4.3 Autostimulationen und deren Ursachen
4.4 Autostimulationen verringern
5 Empathische Kommunikation
5.1 Definition
5.2 Kommunikation von und mit Menschen mit Demenz
5.3 Wertschätzende Kommunikation
5.4 Deeskalierende Kommunikation
6 Bestehende Erinnerung
6.1 Individuelle Sicht der Dinge
6.2 Realitätswahrnehmung von Menschen mit Demenz
6.3 Biografiearbeit
7 Ressourcen als Potenzial
7.1 Definition
7.2 Ressourcen von Menschen mit Demenz
7.3 Ressourcenorientiert arbeiten
8 Ruhe und Entspannung
8.1 „Echte“ Ruhe
8.2 Wahrnehmungsverluste bei Menschen mit Demenz
8.3 Bedeutsamkeit von „echter“ Ruhe
9 Wie geht es Ihnen? Wagen Sie einen Selbstfürsorgecheck!
9.1 Burnout
9.2 Denkanstöße für eigene Glücksmomente
Ein paar Worte zum Ende
Literatur
Sachregister
Vorwort
Herzlich willkommen! Dieses Buch möchte Sie ermutigen, kreative Wege zu finden, wie Sie Menschen mit Demenz glücklich machen können. Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, diesen Ratgeber zu lesen.
Wir möchten Sie einladen, bei dieser Entdeckungsreise spannende Erfahrungen zu machen. Während dieser Reise erleben Sie, wie wichtig nachhaltig gestaltete Glücksmomente für Menschen mit Demenz sind und wie Sie diese mit vorliegendem Handbuch einfach und strukturiert umzusetzen können.
Die Reise beinhaltet nicht nur eine Anleitung, wie Glücksmomente geschaffen werden können, sondern blickt noch tiefer in unsere hirnorganischen Vorgänge. Das Buch verrät Ihnen leicht und verständlich erklärt, welche Vorgänge im menschlichen Gehirn stattfinden. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen – Sie werden für einen effektiven Umgang sensibilisiert und erweitern ihr Fachwissen.
Schon seit langer Zeit beschäftigen wir uns damit, wie die Betreuung, Beschäftigung und Therapie von Menschen mit Demenz nachhaltig und effektiv gestaltet werden kann. Wir kennen die Konzepte der Validation, das Pflegemodell nach Prof. Erwin Böhm und den Personzentrierten Ansatz von Tom Kitwood und von vielen weiteren Konzeptbegründern. Diese Konzepte sind weitläufig bekannt und für jeden zugängig, warum braucht es noch ein weiteres Konzept?
Nun, wir denken, dass man unser Konzept der „Hand voller Glückmomente“ als sinnvolle Ergänzung und Praxisleitfaden sehen darf. Wir haben aus unserer beruflichen Praxis heraus einen Weg gefunden, wie Menschen mit Demenz bestmöglich Lebensqualität und Wohlbefinden erlangen können. Mit einfachen und praxiserprobten Methoden wollen wir verdeutlichen, was aus unserer Erfahrung heraus Menschen mit Demenz benötigen, damit die Beschäftigung, die Betreuung oder auch die Therapie sinnvoll, nachhaltig und effektiv sein kann. Ergänzt wird der Leitfaden um Fachwissen aus Medizin, Psychologie und Neurophysiologie.
Wir wünschen uns für unsere Menschen mit Demenz Lebensqualität, emotionale Stabilität, eine Verlangsamung des Abbauprozesses und den möglichst langen Erhalt der bestehenden Fähigkeiten, kurzum: Viele Glücksmomente für Menschen mit Demenz.
In diesem Buch bekommen Sie wertvolle Tipps, wie Sie diese Wünsche in die Realität umsetzten können. Natürlich wissen wir alle, dass eine Demenz nicht heilbar ist, wir wissen alle, dass die Demenz Gewebe im Gehirn zerstört. Das Gute im Schlechten ist jedoch: Ein gutes Leben trotz Demenz ist möglich! In unserem Buch „Glücksmomente für Menschen mit Demenz“ zeigen wir Ihnen, wie das geht. Unsere Tipps für den individuellen Umgang mit von Demenz Betroffenen sollen Sie befähigen, den Menschen mit Demenz das zu geben, was sie brauchen.
Immer wieder ist zu beobachten, dass Menschen, die demenziell verändert sind, sich in ihre eigene Lebenswelt zurückziehen. Unser Job als Menschen ohne Demenz ist es, in die Lebenswelt von Menschen mit Demenz einzutauchen und diese als gültig stehen zu lassen.
Glücksmomente zu schaffen, in denen sich Menschen mit Demenz erkannt und gut fühlen, klingt schön. Das ist aber nicht immer so leicht umzusetzen – könnten Sie jetzt sagen. Da geben wir Ihnen recht. Wir haben in unserem beruflichen Kontext oder auch als betroffener Angehöriger zu Hause oft Zeitdruck, uns fehlen die Materialien, die Tagesform der Menschen mit Demenz ist nicht immer optimal. Manchmal fehlen uns auch die Ideen, was wir dem Betroffenen sonst noch anbieten könnten. Wenn Sie solche Gedanken haben, sind Sie die perfekte Reisebegleitung in diesem Buch. Kommen Sie mit. Denn diese Gedanken sind total normal.
Jeden Tag sind wir als Betreuungs- und Pflegepersonen von Menschen mit Demenz hohen Anforderungen ausgesetzt und manchmal setzen wir uns auch mit den eigenen hohen Erwartungen selbst unter Druck. Da bleibt dann und wann die Kreativität auf der Strecke und Ideen werden rar. Ist es Ihnen manchmal auch ein Rätsel, wie Sie kommunizieren sollen, wie Sie das Verhalten, das Ihr Gegenüber zeigt interpretieren können? Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie hilflos sind und nicht wissen, wie Sie den Menschen mit Demenz erreichen können? Gibt es Momente, in denen Sie sich gekränkt und abgewertet fühlen? Das ist vollkommen normal und geht vielen Menschen, die mit Demenzbetroffenen leben oder arbeiten so. Sie sind auch nur ein Mensch und haben Ihre Wahrnehmung, Ihre Erfahrungen und Ihre Gefühle.
Dieses Buch will Sie motivieren und Ihnen neue Gedankenanstöße bieten. Auch Sie und Ihr Wohlergehen sind uns wichtig! Nur wer mit sich selbst pfleglich und achtsam umgeht, kann anderen etwas geben. Nur wer selbst im eigenen Leben Glücksmomente erlebt, kann anderen Menschen Glücksmomente bescheren.
Wir wollen Ihnen im letzten Kapitel (Kapitel 9) einen kleinen Leitfaden anbieten, wie Sie Ihre Reserven füllen können und in schwierigen Situationen in Ihrem Pflege- oder Betreuungskontext mit Menschen mit Demenz achtsam mit sich selbst umgehen können.
Wir wünschen Ihnen viel Freude, gute Erfahrungen und bereichernde Glücksmomente.
Herborn und Minden
Stefanie Helsper und
im Sommer 2021
Dr. Harriet Heier
1 Was ist eine Demenz?
Bevor wir Ihnen das Konzept der „Hand voller Glücksmomente“ vorstellen, wollen wir Ihnen einige Informationen zum neurobiologischen und medizinischen Hintergrund von Demenzerkrankungen vermitteln. Dies soll Sie befähigen, Symptome und Verlauf bei den Menschen, die Sie betreuen besser einordnen zu können.
BEISPIEL
Frau I. ist 85 Jahre alt und lebt seit zwei Jahren in einem Pflegeheim. Bereits vor neun Jahren zeigten sich erste Gedächtniseinbußen. Der Familie fiel auf, dass sie immer wieder das Gleiche erzählte und mehrfach die gleichen Fragen stellte. Sie vergaß häufig Verabredungen oder ging am falschen Tag zum Arzt. Bald fielen immer öfter Wortfindungsstörungen auf. Den Haushalt, den Frau I. früher immer perfekt im Griff hatte, vernachlässigte sie zusehends. Im Kühlschrank fanden sich abgelaufene Lebensmittel und Töpfe wurden schmutzig in den Schrank gestellt. Nachdem ihr Mann verstorben war, schien sich die Symptomatik noch zu verschlimmern. Immer häufiger vergaß sie ihre Medikamente einzunehmen, sie vernachlässigte die Körperpflege und nahm ab, weil sie schlichtweg Mahlzeiten vergaß. Irgendwann konnte sie nicht mehr allein zuhause leben, sodass die Familie ihr einen Umzug in ein Pflegeheim nahelegte.
Herr G. ist 63 Jahre alt und lebt noch Zuhause. In den letzten zwei Jahren bemerkte seine Ehefrau eine Wesensveränderung. Er war plötzlich sehr aufbrausend, ließ sich nichts mehr sagen. Am Arbeitsplatz als Automechaniker hatte er zunehmend Probleme, da er immer wieder mit Kollegen aneinandergeriet. Außerdem fiel auf, dass er mit komplexen Reparaturen überfordert war. Zuhause hatte er Schwierigkeiten, das Online-Banking zu erledigen, was früher kein Problem darstellte. Seit einigen Monaten hat er die Angewohnheit, alles zu essen, was ihm in die Finger kommt. Er hat Probleme mit der Konzentration, die Merkfähigkeit hat leicht, jedoch nicht wesentlich nachgelassen. Die räumliche und zeitliche Orientierung ist nicht beeinträchtigt.
Beide oben beschriebenen Personen leiden an einer Demenz. Bei beiden stehen unterschiedliche Symptome im Vordergrund und die Verläufe unterscheiden sich. Anhand der Beispiele wird deutlich, dass Demenzen ein sehr unterschiedliches Gesicht haben können. Demenz ist nicht gleich Demenz.
Demenz ist ein Oberbegriff für verschiedene Demenzformen, mittlerweile sind um die 50 verschiedenen Formen bekannt. Gemeinsam ist allen Demenzformen, dass sie:
■eine Störung kognitiver Leistungen (Fähigkeiten, die mit Wahrnehmung, Erkennen, Gedächtnis, Sprache, Planen, räumlicher Wahrnehmung in Verbindung stehen) zur Folge haben,
■die Alltagsfähigkeiten beeinträchtigen und
■zu einer Störung des Sozialverhaltens, der emotionalen Kontrolle, des Antriebs oder der Motivation führen (Wallesch/Förstl 2017).
Die Demenz ist also keine reine Gedächtnisstörung, da neben der Fähigkeit zur Speicherung und zum Abruf von Informationen noch weitere kognitive Leistungen beeinträchtigt sein können. Die genannten Symptome müssen über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten vorhanden sind, es darf sich also um keinen vorübergehenden Zustand handeln. Sonst handelt es sich nicht um eine Demenz! Gemeinsam ist allen Demenzformen außerdem, dass es zu einer fortschreitenden Zerstörung von Nervenzellen kommt (Wallesch/Förstl 2017).
Welche Ursache diese Zerstörung hat und in welchen Hirnarealen der Verlust der Nervenzellen beginnt, ist je nach Demenzform unterschiedlich. Auch wie sich der Verlauf gestaltet, kann je nach Demenzform sehr verschieden sein. Zunächst einmal unterscheidet man zwischen primären und sekundären Demenzformen.
Primäre Demenzen machen 90 % aller Demenzformen aus (Maier et al. 2010). Bei den Demenzen, die zu dieser Kategorie gehören, kommt es zu einem fortschreitenden Abbauprozess der Nervenzellen, der durch fehlerhafte Mechanismen im Gehirn selbst verursacht wird. Der Prozess kann zwar durch Medikamente und Therapien verlangsamt, aber nicht vollkommen gestoppt werden. Bei Sekundären Demenzen liegt eine Erkrankung vor, die im Verlauf auch eine Schädigung der Nervenzellen im Gehirn verursacht. Dies kann durch Vergiftungen, langjährigen Alkohol- und Drogenmissbrauch oder Infektionen geschehen. Diese Demenzen können teilweise gestoppt werden, wenn die Ursache frühzeitig behoben werden kann (Maier et al. 2010).
Die häufigsten primären Demenzformen werden in den folgenden Kapiteln genauer betrachtet.
1.1 Alzheimer-Demenz
Alzheimer-Demenzen machen neuesten Studien zufolge etwa 55 % aller Demenzen aus (DGPPN/DGN 2016). In Deutschland sind etwa 1,3 Millionen Menschen an einer Alzheimer-Demenz erkrankt (Kurz et al. 2019). Das Risiko, an dieser Form der Demenz zu erkranken, steigt mit dem Alter exponentiell an. Während 1,9 % der 65- bis 69-Jährigen erkrankt sind, liegt der Anteil bei über 90-Jährigen bereits bei ca. 30 % (DGPPN/DGN 2016).
Bei der Alzheimer-Krankheit kommt es, vereinfacht beschrieben, im Gehirn zur Bildung von Eiweiß-Verklumpungen, die nicht mehr abtransportiert werden können. Diese Bildung von sogenannten Amyloid-Plaques zwischen den Nervenzellen sowie von Tau-Fibrillen innerhalb der Nervenzellen im Gehirn führt dazu, dass die Signalweiterleitung gestört ist. Diese Vorgänge führen nach und nach zu einem Absterben von immer mehr Nervenzellen. Durch die allmähliche Zerstörung von Nervenzellen stehen wichtige Botenstoffe, die für Lernvorgänge und für das Gedächtnis von Bedeutung sind, nicht mehr ausreichend im Gehirn zur Verfügung. Bis zu 15 Jahre bevor die Ausprägung der klinischen Symptome (z. B. Gedächtnisstörungen, Wortfindungsstörungen, Einbußen in der Orientierung) so stark geworden ist, dass die Diagnose Demenz gestellt wird, kommt es schon zu ersten Alzheimer-spezifischen Veränderungen im Gehirn (Maier et al. 2010).
Die in der Einleitung beschriebene Frau I. ist ein typisches Fallbeispiel für eine Person mit einer Alzheimer-Demenz. Im frühen Stadium der Erkrankung stehen Gedächtnisstörungen im Vordergrund. Insbesondere das „Neugedächtnis“ ist beeinträchtigt, d. h. Informationen, die neu aufgenommen werden, können nicht oder nur fehlerhaft abgespeichert werden. Dagegen kann auf Sachverhalte oder Daten, die bereits vor längerer Zeit im Gedächtnis verankert wurden, zugegriffen werden. So kommt es, dass eine Person mit einer Alzheimer-Demenz im Anfangsstadium noch weiß, wie ihre Mitschüler in der neunten Klasse hießen, aber nicht mehr sagen kann, was sie heute zum Mittag gegessen hat. Neben den Gedächtnisstörungen sind am Anfang außerdem Beeinträchtigungen der Handlungsplanung und -durchführung zu beobachten: Die Tätigung einer Überweisung gelingt nicht mehr oder die Abläufe beim Kochen geraten durcheinander. Auch machen sich oft erste zeitliche und räumliche Orientierungsschwierigkeiten bemerkbar. Erkrankte verwechseln die Wochentage, können das aktuelle Datum nicht benennen und finden sich in weniger vertrauten Umgebungen nicht mehr zurecht. Es kommt häufig zu Wortfindungsstörungen. Im Durchschnitt umfasst das beginnende Stadium drei bis vier Jahre.
Im Verlauf der Erkrankung nehmen die Symptome zu und beeinträchtigen den Alltag zunehmend. Im mittelgradigen Stadium braucht die erkrankte Person mehr Aufsicht und Hilfestellung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens wie Körperpflege, Zubereitung von Mahlzeiten und Haushaltstätigkeiten. Häufig kommt es zu „herausforderndem Verhalten“: Menschen mit Demenz entwickeln eine innere und körperliche Unruhe, die sich oft in einem Laufbedürfnis äußert. Manchmal reagieren Personen mit Demenz sehr reizbar und aggressiv. Oder Erkrankte ziehen sich stark zurück und sind sehr antriebsgemindert. Gelegentlich entwickeln Menschen im mittleren Stadium eine Inkontinenz. Diese mittlere Phase der Alzheimer-Demenz umfasst ebenfalls etwa drei bis vier Jahre, wobei es auch deutliche Abweichungen geben kann von ein bis zu zehn Jahren.
Im späten Stadium weitet sich der kognitive Abbau immer mehr aus. Die Sprache wird unzusammenhängender, beschränkt sich auf nur noch wenige Worte oder versiegt komplett. Die Motorik ist nun auch betroffen, Erkrankte verlieren die Fähigkeit zu gehen, bei manchen stellen sich Schluckstörungen ein.
Der Verlauf von Alzheimer-Demenzen kann sehr unterschiedlich sein, im Durchschnitt vergehen zehn Jahre von der Diagnosestellung bis zum Tod. Generell verläuft die Erkrankung schneller, je früher im Leben sie auftritt (Stechl et al. 2012). Grundsätzlich versterben Menschen nicht an einer Demenz, sondern mit einer Demenz. Die Todesursachen ergeben sich oft aus den Komplikationen, die mit einer Demenz im schweren Stadium einhergehen. Durch die reduzierte Mobilität kommt es oft zu einer erhöhten Infektanfälligkeit, zudem begünstigen Schluckstörungen häufig Lungenentzündungen, die dann zum Tode führen. Außerdem sterben viele Menschen mit einer Demenz, genauso wie Menschen ohne Demenz, an Krebs, einem Schlaganfall oder Herzinfarkt (Maier et al. 2010).
Tabelle 1.1 liefert einen Überblick über die Stadien der Alzheimer-Demenz.
Seit den 1990er Jahren stehen Medikamente zu Verfügung, die bei Alzheimer-Demenzen das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen. Sie wirken auf die Botenstoffe ein, die für die Signalübertragung von Nervenzelle zu Nervenzelle gebraucht werden, aber nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden sind. Bei der Alzheimer-Demenz sind es vor allem die Botenstoffe Acetylcholin und Glutamat, die aufgrund des Absterbens von Nervenzellen nicht mehr ausreichend produziert werden. Medikamente, die zur Gruppe der Acetylcholinesterase-Hemmer zählen, verbessern die Signalübertragung im Gehirn. Sie sorgen dafür, dass der Botenstoff Acetylcholin länger zur Verfügung steht, bevor er von einem Enzym wieder abgebaut wird.
Die genannten Medikamente halten den Erkrankungsprozess etwas auf, setzen allerdings an einem Zeitpunkt an, an dem schon viele Nervenzellen im Gehirn beschädigt sind.
Tabelle 1.1: Stadien der Alzheimer-Demenz
Leichtes Stadium
Mittelgradiges Stadium
Schweres Stadium
Dauer: ca. 3 – 4 Jahre
Dauer: ca. 3 Jahre
Dauer: ca. 3 Jahre
Gedächtnisstörungen, insbesondere der kurzfristigen Merkfähigkeit
Gedächtnisstörungen, auch des Langzeit-gedächtnisses
Zunahme der Gedächtnisstörungen
Verminderte Konzentrationsfähigkeit
Deutliche Wahrnehmungsveränderungen
Gestörte Körperwahrnehmung
Wortfindungsstörungen
–
Abnahme der Sprachfähigkeit (bis hin zu Verstummen)
Erste Schwierigkeiten bei der räumlichen und zeitlichen Orientierung
Zunehmende Beeinträchtigung der zeitlichen und räumlichen Orientierung
Abnahme der Mobilität
Einfache Alltagsaufgaben möglich, Aufgaben mit komplizierteren Anforderungen schwierig
Unterstützung bei der Alltagsbewältigung ist nötig, eine selbständige Lebensführung ist nicht mehr möglich
Kontrakturen
Inkontinenz
Kauen, Schlucken und Atmen wird immer mühsamer
Anfälligkeit für Infektionskrankheiten
Manchmal Bettlägerigkeit
Sozialer Rückzug
Veränderungen im Verhalten und in der Persönlichkeit
–
–
Verhaltensauffälligkeiten wie erhöhter Bewegungsdrang
Veränderung des Tag- Nachtrhythmus
–