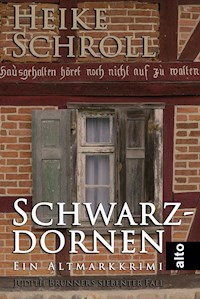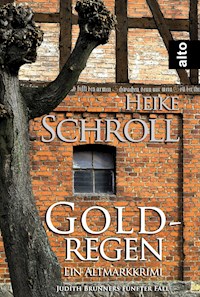
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: alto-Verlag Berlin
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Judith Brunner beneidet ihren ganz privaten Ermittler Walter Dreyer insgeheim um seinen Auftrag, das verschollene Vermögen der Gardelegener Freimaurerloge zu suchen. Sie muss sich indessen mit dem unspektakulären Diebstahl eines Gemäldes aus dem Altmark-Museum in Salzwedel befassen. Und selbst als der Mord an einem unauffälligen Mieter eines kleinen Mehrfamilienhauses gemeldet wird, ahnt sie noch nichts von den Dimensionen ihres Falles - bis sie erfährt, wer da ermordet wurde. Als kurz darauf ein weiterer Mordanschlag verübt wird, drängt die Zeit. Denn nun wird offenbar, dass es bei ihren Ermittlungen um sehr viel mehr geht, als um ein geklautes Bildchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heike Schroll
Goldregen – Ein Altmarkkrimi
Judith Brunners fünfter Fall
Kriminalroman
eBook
alto-Verlag Berlin
Die vorliegende Kriminalerzählung ist frei erfunden. Jede Übereinstimmung von Personen und Örtlichkeiten wäre rein zufällig.
Besuchen Sie bitte auch den Autorenblog:
http://www.heikeschroll.com
Impressum
Schroll, Heike
»Goldregen – Ein Altmarkkrimi«
Judith Brunners fünfter Fall
Kriminalroman
eBook-Version: (15.02) Oktober 2015
Copyright © dieser Ausgabe by alto-Verlag Berlin
Copyright © 2015 by Heike Schroll
Umschlaggestaltung und Foto: Bernd Schroll
Alle Rechte vorbehalten
© alto-Verlag Berlin 2015
ISBN 13: 978-3-944468-09-9 (epub)
ISBN 10: 3-944468-09-0 (epub)
Identische Taschenbuchausgabe:
alto-Verlag Berlin 2015
ISBN 13: 978-3-944468-08-2
ISBN 10: 3-944468-08-2
ISBN-A: 10.978.3944468/082
http://dx.doi.org/10.978.3944468/082
www.heikeschroll.com
www.alto-verlag.com
fon: +49.(0)30.654 977 32
fax: +49.(0)30.654 977 33
Altmark, Mai 1993
~ 1 ~
Er las die Namen der Toten.
Hatten sie zu lange gewartet? Ganz gleich, was sie jetzt taten, vermutlich konnte niemand mehr helfen.
Das wurde ihm schlagartig klar, als er die Liste auf dem jahrzehntealten Papier in das trübe Licht seiner Schreibtischlampe hielt und das fragile Blatt untersuchte. Er überflog die Aufzählung noch einmal.
Viktor Klose, Möbelhandlung
Anton Renz, Arzt
Emil Deutler, Angestellter
Richard Wolff, An- und Verkauf
August Bartsch, Kaufmann
Ludwig Schönborn, Kunstschlosser.
Sechs Männer, mit Vornamen, Namen und ihren Berufen. Er wusste, was sie vereinte, auch ohne zu lesen, was darüber geschrieben stand: »Beamte im Termin«. Die Druckerschwärze war seinerzeit so üppig aufgetragen worden, dass die Buchstaben noch heute reliefartig zu erfühlen waren, wenn man mit dem Finger über die Seite strich.
Fünf der Namen waren mit einem weichen Bleistift durchgestrichen und links davor war jeweils ein großer Haken gemacht worden. Der Grafit der Striche schimmerte ein wenig, wenn man das Papier leicht schräg in das Licht hielt. Es schien alt zu sein, im Gegensatz zu den roten Totenkreuzen, die mit dem feinen Strich eines Tintenrollers rechts neben die Namen gemalt worden waren.
Über die Bedeutung der jüngst hinzugefügten fünf Kreuze bestand kein Zweifel, denn Wubbo Wiesel hatte an den Gräbern all dieser Männer gestanden und sie aufrichtig betrauert.
Tief bewegt lehnte er sich zurück. Er konnte das Zittern seiner Hände nicht verhindern. Was sollte er bloß tun? Besonders ein Gedanke machte ihm Angst: Würde er auch den letzten Bruder nur als Toten wiedersehen?
~ 2 ~
Judith Brunner, Kriminaloberkommissarin bei der Polizei von Sachsen-Anhalt, staunte des Öfteren über sich selbst, wie problemlos sie die neuen Verhältnisse nicht nur hatte akzeptieren können, sondern an Vielem sogar ausgesprochenen Gefallen fand. Wie jeden Morgen fuhr sie von Waldau nach Salzwedel über die Bundesstraße 71 zur Arbeit. Mal dauerte es eine halbe Stunde, mal etwas länger. Der ständig wachsende Autoverkehr machte ein Überholen fast unmöglich. Da gab es für sie nur eine Strategie: Einreihen in die Fahrzeugschlange und völlig entspannt das Tempo von den anderen bestimmen lassen. Aus den Lautsprechern plätscherte das Violinkonzert von Brahms und sie musste wieder einmal voller Dankbarkeit daran denken, wie gut es ihr ging. Während eines Urlaubs im Oktober 1990 war sie ihren Posten als Leiterin der Gardelegener Polizeidienststelle nahezu beiläufig losgeworden – und im Nachhinein betrachtet, hätte ihr etwas Besseres kaum passieren können.
Die Wende hatte auch in ihrem eher klein zu nennenden Amt für ungewöhnliche Turbulenzen gesorgt. Ihr Bedarf an Neuorganisation, Besserwisserei und Denunziation war für immer gedeckt, wenn sie ein derartiges Verlangen überhaupt jemals verspürt haben sollte. Viele ihrer einstigen Mitarbeiter wurden ohne ihr Zutun versetzt. Ihr selbst wollte ständig jemand auf den Zahn fühlen, sehen, ob sie irgendwelche imaginären Tests bestand. Mehrfach wurde ihr angedeutet, dass auch sie wohl würde gehen müssen. In manchen Momenten erschien ihr das sogar als die sinnvollste Option. Am Ende hatte man sie während dieses Urlaubes vor zweieinhalb Jahren zu einem mehrmonatigen Anpassungskurs an die Polizeischule delegiert und damit en passant von ihrem Posten entbunden. Widerstand zwecklos, war es doch für ihren Verbleib im Polizeidienst und für ihre Ernennung zur Beamtin – zur Kriminaloberkommissarin – eine unbedingte Voraussetzung. Als man ihr danach eröffnete, dass sie in das größere Polizeirevier nach Salzwedel versetzt werden würde, war ihr das recht. Ohne von Personal- und Budgetquerelen abgehalten zu werden, ließ es sich erheblich befriedigender ermitteln und aufklären. Das war die Arbeit, die sie liebte. Das Verbrechen bekämpfen und die Täter überführen. Das tat sie für die Opfer, um ihnen Gerechtigkeit zukommen zu lassen, wenn es nicht anders ging, sogar nach ihrem Tod. Zu nicht mehr, aber auch nicht zu weniger, sah sie sich berufen.
Geschafft. Jetzt noch schnell die Schuhe gewechselt und in die eleganten Sandalen geschlüpft. Pünktlich konnte ein neuer Arbeitstag beginnen. Passend zum frühsommerlichen Wetter trug sie einen knielangen, eng geschnittenen Rock und eine luftige weiße Bluse. Der anerkennenden Blicke der Wachleute vom Eingang konnte sie sich sicher sein.
Das Revier in Salzwedel befand sich in einem großen Backsteingebäude, mit ausreichend Büros, Teeküchen, einem Fahrstuhl und genügend Parkplätzen. Letzteres war wichtig. Inzwischen hatte sich jeder, ausnahmslos jeder ihrer Kollegen, bis hin zum frischgebackensten Polizei-Anwärter, ein neues Auto gekauft. Alle waren froh, ihre Schmuckstücke unmittelbar in Reviernähe abstellen zu können. Das sparte Zeit. Oder auch nicht, wenn Judith an die nicht enden wollenden Diskussionen über Pferdestärken und Ausstattungs-Extras dachte.
Das Arbeitsumfeld hatte sich für sie in den vergangenen zwei Jahren komplett geändert. Dass sie nun wieder einen Chef vor der Nase hatte, war keine Herausforderung. Ohnehin arbeitete sie stets auf die Weise, die ihr die richtige schien. Und wenn sie das Gefühl hätte, keine gute Polizeiarbeit mehr leisten zu können, würde sie gehen und einen anderen Weg finden, sich nützlich zu machen.
Der zurückhaltende Knut Müller-Nordergreen war jedoch kein Problem. Er war gerade einmal 35, verheiratet und hatte zwei Kinder. Nur mittelgroß von Statur, mit lichtem rot-blondem Haar und etwas zur Fettleibigkeit neigend, war er nicht gerade das, wovon Frauen träumten. Zumindest aber war er das, was Schwiegermütter als »nett« bezeichnen würden. Was nicht bedeutete, dass Judith sich nicht schon mehrmals über diesen Mann geärgert hätte. An guten Tagen war sie geneigt, seine Kompetenz anzuerkennen. Auch war ihr bewusst, dass sie die ortsüblichen Vorurteile pflegte, wenn sie – an den weniger guten Tagen – nur einen Beamten aus dem Westen in ihm sah, der sein üppiges Geld dafür bekam, langjährig erfolgreichen Polizisten zu erzählen, wie man richtig arbeitete. Und überhaupt – nur durch ihn blieb der Laden am Laufen, war seine feste Überzeugung. Judith griente. Dachte nicht jeder Chef so? Bestimmt war sie ungerecht. Denn eigentlich kam sie hervorragend mit Müller-Nordergreen aus.
Ob er sich auch über so etwas den Kopf zerbrach? Immerhin hatte Judith selber einmal eine Polizeidienststelle geleitet. Ihre Personalakte hatte er gründlich gelesen, davon konnte sie ausgehen. Und wahrscheinlich hatte er auch angenommen, jemand mit einem Karriereknick würde nur Schwierigkeiten machen. Als das aber nicht geschah und sie sich aufgeschlossen und kooperativ zeigte, erinnerte er sich an die diversen Berichte und Einträge bezüglich ihrer kriminalistischen Arbeit. Er fing an, ihr Können zu nutzen. Praktisch bedeutete dies, dass sie in den seiner Auffassung nach wichtigen Fällen ermittelte, weil sie stets Ergebnisse lieferte. Gab es aktuell nichts mit hoher Priorität, konnte sie sich selbstständig ungelösten Altfällen widmen, für deren Aufklärung in der täglichen Polizeiarbeit keine Zeit mehr eingeplant war. Müller-Nordergreen schätzte ihre eigenständigen Ermittlungen und hielt sich weitestgehend aus allem heraus. Judith ihrerseits gefiel die relative Unabhängigkeit ihrer Position innerhalb des Polizeireviers. Auch intervenierte sie nicht gegen das Gerücht, die rechte Hand des Chefs zu sein. Bekam sie doch dadurch den einen oder anderen Bericht bevorzugt oder eine Zuarbeit aus den Laboren ein wenig zügiger.
Auch wenn die Versetzung nach Salzwedel seinerzeit ganz gewiss keine Gefälligkeit war, stellte sich bald heraus, dass es bei diesem Arrangement nur Gewinner gab.
Judith huschte flink hinter ein paar Kollegen in den Fahrstuhl und kämpfte sich nach hinten. Bis ganz nach oben würde nur sie fahren.
Außer ihr und dem Archiv war im Dachgeschoss des Reviergebäudes nur noch ein ehemaliger Volkspolizist untergebracht, von dem man auch nicht recht wusste, in welche Abteilung man ihn sonst stecken sollte: Albert Modersohn, der noch zwei Jahre bis zur Rente hatte, gerne arbeitete und vom angebotenen Vorruhestand nichts wissen wollte. Er war der absolute Spezialist für Verkehrsunfälle. Durch seine jahrzehntelange Erfahrung konnte er entsprechende Spuren auswerten, wie sonst keiner. Modersohn sprach gerne platt. Wohl wissend, dass Judith damit Probleme hatte, neckte er sie immer etwas mit seinen Bemerkungen. »Jutn Tach, wi geit di denn hüt?«, lautete seine tägliche Begrüßung, wenn er Punkt neun auf dem Weg in sein Büro bei ihr vorbeischaute.
Heute konnte Judith nicht auf den Gruß ihres Büronachbarn warten. Sie hatte eine handschriftliche Nachricht auf der Tastatur ihres PCs vorgefunden und würde sich sputen müssen: Probleme im Heimat-Museum. Bild geklaut. Bericht an KMN bis zum Dienstschluss. So formlos lief das meistens. Judith und die Sekretärin von Knut Müller-Nordergreen verstanden sich aufs Beste. Mit großer Souveränität beherrschte Ingeborg Siegel das Vorzimmer des Chefs. Langjährige Erfahrung und gute Menschenkenntnis ließen sie genau wissen, bei wem sie persönlich Druck machen musste und wo ein Zettelchen reichte.
Diebstahl gehörte zwar nicht gerade zu Judiths Lieblingsermittlungen, trotzdem würde sie die Sache ernst nehmen. Sie mochte das kleine, traditionelle Altmark-Museum in Salzwedel. Aber was sollte es da schon zu klauen geben? Sie fand immer, das Museumsgebäude selbst sei das beeindruckendste Ausstellungsstück. Das malerisch gelegene, wunderschöne Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert war mit seinen zwei Volletagen und dem prächtigen Renaissance-Treppenturm ein Anblick, der sie jedes Mal spüren ließ, wie wohltuend und anheimelnd diese Architektur sein konnte. Damit verband sie mittlerweile ihre Heimat.
~ 3 ~
»Aus technischen Gründen bleibt das Museum heute geschlossen«, lautete die lapidare Mitteilung, die handschriftlich auf einem Pappschild an der Eingangstür zum Fachwerkbau prangte.
Eine Mitarbeiterin stand davor und versuchte, zwei frühe Besucher zu vertrösten. »Morgen ist sicher wieder geöffnet.«
»Wir sind nur auf der Durchreise, schade. Na was soll’s.« Das enttäuschte Paar lief langsam zur Straße zurück.
»Auch Sie kann ich leider nicht reinlassen«, informierte die Wächterin schon von Weitem.
Judith trat dennoch näher. »Ich komme von der Polizei. Man hatte uns angerufen.« Im Freien wollte sie nicht deutlicher werden. Stattdessen zeigte sie ihren Dienstausweis vor.
»Ja, dann müssen Sie ja sogar rein.« Die Frau trat zur Seite, machte eine einladende Geste und ließ der Polizistin den Vortritt. Sorgsam verschloss sie hinter sich die Tür. »Ich bin Dr. Marianne Schneider. Ich leite dieses Museum. Gehen wir in mein Büro?«
»Gern. Ich bin Kriminaloberkommissarin Judith Brunner.« Noch während sie sprach, ließ sie ihren Ausweis wieder verschwinden und klärte weiter auf: »Ich werde in diesem Fall ermitteln. Wenn Sie mir zunächst zeigen würden, wo das gestohlene Bild hing?«
»Natürlich. Entschuldigen Sie bitte. Da lang geht’s.« Auffordernd wies Dr. Schneider zur Tür eines kleinen Durchgangszimmers im Erdgeschoss.
Judith folgte der Direktorin. Schon nach wenigen Metern hatten sie ihr Ziel, einen wunderschön eingerichteten Raum, erreicht.
»Das war das Musikzimmer der Familie, die im 19. Jahrhundert das Gebäude bewohnte. Wir haben versucht, es wieder so herzurichten. Ich dachte, in diesem eher behaglichen Ambiente kommt das Gemälde besonders gut zur Geltung«, erläuterte Marianne Schneider ihre Wahl, das Bild an der linken Wand über einem Cembalo aufzuhängen. Ihre Hand wies auf einen einfachen Metallhaken, der in die Wand geschlagen worden war. Sie beschrieb mit einer Geste die Entfernung zu den beiden Fenstern. »Hier hing es einigermaßen geschützt vor direktem Sonnenlicht. Und unsere Besucher wurden durch das Musikinstrument unauffällig auf Abstand gehalten. Bei nächster Gelegenheit wollte ich noch einen Spot unter der Decke anbringen lassen, damit es angemessen ausgeleuchtet wird.«
Die Rekonstruktion des alten Musikzimmers war wirklich gelungen. Der Raum war zeitgenössisch möbliert und durch die im Hof seitlich stehenden alten Bäume nur gedämpft lichtdurchflutet. »Ich kann mir ein Bild an diesem Platz gut vorstellen«, folgte Judith den Überlegungen der Museologin. »Lassen Sie uns anfangen, es zu suchen. Dann hängt es bald wieder da.«
»Das wäre schön. Na kommen Sie, besprechen wir alles.« Dr. Schneider machte kehrt. Ihr Büro befand sich gleich neben dem Kassen- und Eingangsbereich. »Bitte, nehmen Sie doch Platz.« Ein unsicheres Lächeln huschte über ihr Gesicht. Sie fragte: »Könnte ich Ihren Dienstausweis nochmals sehen?«
»Sicher«, bestätigte Judith, während sie in ihre Umhängetasche griff. »Ich bin von der Dienststelle hier in Salzwedel.«
Dr. Schneider prüfte den Ausweis und gab ihn dann zurück. »Tut mir leid, ich wollte nur sichergehen, wem ich was erzähle. Das ging vorhin alles so schnell. Entschuldigen Sie meine Nervosität. Der Diebstahl hat mich ziemlich mitgenommen.« Wieder kam ein schmales Lächeln. »Ich mache das hier noch nicht lange.«
»Keine Ursache«, versicherte Judith glaubhaft.
»Darf ich Ihnen etwas anbieten? Ich hätte noch frischen Kaffee in der Maschine.«
»Gerne. Schwarz bitte. Machen Sie sich nur keine Umstände.« Während das Geschirr herbeigeräumt wurde, hatte Judith Gelegenheit, Marianne Schneider zu mustern. Sie war ein paar Jahre jünger als sie, ungefähr Mitte dreißig. Die Frau trug mit halbhohen, weißen Pumps, dunklen Bluejeans und einer hellblauen Bluse eindeutige Freizeitkleidung. Trotzdem wirkte sie in keiner Weise unangemessen gekleidet. Vielleicht lag es an der aufwendigen Föhnfrisur, dass sie so professionell rüberkam. Als sie sich setzte und Judith direkt ansah, lag bereits eine vorsichtige Hoffnung in ihrem Blick. Marianne Schneider schenkte ein und sagte: »Ich muss mich erst einmal für Ihr schnelles Erscheinen bedanken. Wie kann ich Sie unterstützen?«
Die direkte Art der Frau gefiel Judith. Sie lächelte. »Am besten, Sie erzählen mir zunächst, wie und wann der Diebstahl bemerkt wurde.«
»Heute Morgen, kurz vor halb sieben. Unsere Putzfrau kommt immer zu dieser Zeit. Sie entdeckte ein offen stehendes Fenster im Erdgeschoss und rief mich an. Ich war zwanzig Minuten später hier und rannte durch die Räume. Sofort sah ich, dass das Bild fehlte. Mehr war nicht fort. Es ist mein Lieblingsstück. Ich hatte es erst vor zwei Monaten aufgehängt, nachdem ich es im Keller fand.« Marianne Schneider öffnete eine Mappe auf ihrem Schreibtisch. »Die Abzüge hatte ich für die Versicherung machen lassen.« Sie entnahm ein großformatiges Farbfoto und gab es Judith in die Hand. »Das ist das Bild. Goldregen, Maler unbekannt.«
Judith sah auf die Abbildung. Ihr blieb fast die Luft weg. Das Gemälde könnte ohne Zweifel von einem der englischen Präraffaeliten stammen, ihren absoluten Lieblingsmalern! Im letzten Jahr hatte sie London besucht und stundenlang in der Tate Gallery staunend vor solchen Bildern gestanden. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Foto das Farbenspiel des Originals nicht annähernd wiederzugeben vermochte, war der künstlerische Effekt überwältigend. Das Motiv wirkte, als sei ein Ausschnitt aus der realen Welt gemalt worden, aber es war alles irgendwie ins märchenhafte verschoben: Der Blick des unsichtbaren Betrachters einer idyllischen, hügeligen Landschaft folgte einer maroden Mauer über sattgrüne Wiesen in die Ferne. Am Horizont war das Meer zu erahnen. Auf den blühenden Wiesen, die hier und da von einem Bäumchen bestanden wurden, tummelten sich Lämmer im hellen Sonnenlicht. Dieses Gemälde musste sich wahrlich nicht hinter Hunts Verirrten Schafen oder Browns Hübschen Lämmchen verstecken! Am rechten Bildrand endete die Mauer an einer charmant verwitterten Scheunenwand, vor der an einem hölzernen Gestell ein alter, hoher Goldregen lehnte. Der Strauch war übervoll mit leuchtend gelben Blütentrauben besetzt. Judith meinte fast, das Summen der Bienen zu hören, so intensiv war sie in ihrer sinnlichen Aufmerksamkeit gefangen. »Zauberhaft!«
Der Rahmen war verhältnismäßig schmal, leuchtete in leicht rotem Gold. Er passte mit seinen zart erhaben geschnitzten, ornamentalen Ranken hervorragend zu den Zweigen und Blättern des Goldregens. Judith hatte dieses Bild noch nie gesehen. Richtig. Konnte sie auch nicht. Ihr letzter Museumsbesuch lag mindestens ein Jahr zurück. »Wie groß ist es im Original?«, wollte sie wissen. Das ließ sich aus dem Foto nicht erschließen.
»Nun, es ist 34 x 65 Zentimeter groß, Ölfarbe auf Leinwand, in einem mit Blattgold überzogenen Rahmen.« Dr. Schneider seufzte. »Durch die ungewöhnliche Breite gewinnt die Darstellung eine extreme Weite und Offenheit. Das Gemälde ist einfach wunderschön.«
Einigermaßen schwierig für einen Dieb, das unter einer Jacke zu verstecken, konstatierte Judith im Stillen. »Und sein Wert? Sie sagten vorhin etwas von einer Versicherung?«
»Schon, aber wir schließen keine Versicherungen für einzelne Objekte ab. Das wäre zu teuer. Und zum Wert kann ich nicht viel sagen, das hängt von so vielen Dingen ab.«
»Welchen, zum Beispiel?«
»Nun, der Person des Malers, dem Zeitgeschmack, der Menge vergleichbarer Motive, dem Bedarf des Kunstmarktes. Da ist viel zu berücksichtigen. Aber ohne den Namen des Künstlers kann ich nur raten. Ich bin keine Kunstexpertin. Der Titel für das Bild steht hinten auf der Rückseite, in alter deutscher Handschrift, mit Bleistift. Es kann sich aber auch nur um einen Inventarnamen handeln. Auf dem Bild selbst jedenfalls ist kein Name, nicht einmal eine Signatur.«
Judith Brunner schaute nochmals auf das Foto. »Dieses Gemälde würde mir auch gut in meinem Wohnzimmer gefallen«, gab sie unumwunden zu. »Haben Sie noch mehr unbekannte Kunstwerke im Keller?«
Marianne Schneider schüttelte den Kopf. »Wahrscheinlich nicht. Ich bin erst seit vier Monaten im Amt. Ich habe Herrn Dr. Weigel abgelöst. Bisher habe ich es lediglich geschafft, mir einen groben Überblick über die Sammlungen zu verschaffen. Dabei ist mir zumindest kein weiteres Bild dieser Qualität untergekommen.«
»Woher hat Ihr Museum das Gemälde?«
»Auch da muss ich passen.« Dr. Schneider wirkte aufrichtig verlegen. »Natürlich hätte ich das gleich prüfen müssen, als ich mich im März entschloss, das Bild im Musikzimmer aufzuhängen, aber irgendwie bin ich seitdem noch nicht dazu gekommen.«
»Die genauen Umstände des Erwerbs wären auf jeden Fall nützlich für meine Ermittlungen. Wo könnte es denn herstammen?«
Dr. Schneider hob die Schultern: »Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Museale Sammlungsstücke gelangen auf vielen Wegen in die Bestände. Unsere Sammlung wurde schon im letzten Jahrhundert begonnen und mit Legaten und Vermächtnissen, also Gegenständen aus Privathand, begründet. Dann gab es immer wieder Geschenke, Deposita oder ganz selten mal einen Ankauf. Auch Zuweisungen von anderen städtischen oder auch staatlichen Stellen sind möglich. Immerhin ist dieses Museum seit den Dreißigerjahren in öffentlicher Hand. Ich werde alles tun, um schnell herauszufinden, wie das gestohlene Bild in unseren Besitz kam.«
Judith Brunner stand auf. »Jeden Moment wird ein Kollege zur Spurensicherung eintreffen. Wenn Sie dem jungen Mann bitte alles zeigen würden? Ich müsste mich jetzt mit Ihren Angestellten unterhalten. Vor allem mit der Frau, die den Diebstahl heute Morgen bemerkt hat.« Judith hielt einen Moment inne und fragte sich, ob Putzfrauen wohl am häufigsten Verbrechen entdeckten.
~ 4 ~
»Sehen Sie mich nicht so an! Glauben Sie wirklich, mir ist nicht bewusst, dass wir nicht auf dem neusten Stand des Gebäudeschutzes sind?«, schimpfte Dora Kisch, die Verwaltungsleiterin des Museums. Im Gegensatz zur zurückhaltend wirkenden Direktorin strahlte sie ein enormes Selbstwertgefühl aus. »Dies hier ist ein Provinzmuseum. Und das bedeutet: Es gibt nie genug Geld für irgendwas. Alarmanlagen und gute Schlösser sind teuer. Aufsichtskräfte für die Ausstellungsräume erst recht; Nachtwächter fast unbezahlbar. Videotechnik können Sie gleich ganz vergessen. Selbst die zwei, drei Attrappen sprengen schon unser Budget. Wenn wir an den Wochenenden nicht Helfer vom Museumsverein oder der Schüler-AG hätten, könnten wir gar nicht mehr öffnen.«
Judith merkte, dass sie mit ihrer Frage nach der Sicherheitszentrale in ein Fettnäpfchen getreten war. »Verzeihen Sie, bitte. Ich wollte Ihnen keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil. Ich mag dieses Museum ganz besonders. Mir geht es persönlich sehr nahe, wenn man hier einbricht und dann auch noch so etwas Schönes stiehlt. Bitte, klären Sie mich einfach über Ihre Sicherheitsvorkehrungen auf.«
Dora Kisch schob sich eine Strähne ihres dunkelbraunen Haares hinters Ohr und war bereit, das Friedensangebot anzunehmen. »Ist schon gut. Meine Nerven liegen heute Morgen etwas blank.« Sie zupfte unauffällig an ihrem schwarzen Kleid herum und begann zu erzählen: »Also, wir können uns für die Nacht nur einen Sicherheitsdienst leisten, der ein paar Mal vorbeikommt und das Gebäude innen abläuft – durch die Ausstellungsräume und die Büros. Ihre Kollegen vom Streifendienst haben das Museum auch auf ihrer Tour. Aber die sehen nur im Vorbeifahren nach dem Rechten. Meistenteils ist das Haus quasi unbewacht. Wir müssen uns eben darauf verlassen, dass die Mechanik an Türen und Fenstern stark genug ist, um ungebetenen Besuch abzuhalten. Die Mauer zur Straße suggeriert Schutz, nach hinten aber ist das Gelände offen. Uns bleibt nur die Hoffnung, dass die Alarmklingeln im Falle eines Falles genügend Lärm machen, potenzielle Diebe abzuschrecken. Unglücklicherweise kann man sie alle leicht manipulieren, wie man heute gesehen hat.«
»Was? Sie wissen bereits, wie der Alarm ausgeschaltet wurde?« fragte Judith überrascht.
»Kommen Sie, ich zeig’s Ihnen.«
Judith folgte der resolut voranschreitenden Museumsmitarbeiterin. Dabei entdeckte sie Jurik Bellheim, der anfing, einzelne Flurbereiche abzusperren. Er war der Tatortspezialist ihres Reviers, arbeitete selbstständig und konnte dabei jederzeit auf die Ressourcen des Zentrallabors beim Landeskriminalamt zugreifen. Er war bestens ausgebildet und gut in dem, was er machte.
Am Hintereingang angekommen, wies die Frau nach oben in die Laibung einer soliden Eichentür. »Sehen Sie, so einfach ist das: Wenn man die Alarmklingel mit Bauschaum einsprüht und etwas wartet, ist sie im wahrsten Sinne des Wortes stillgelegt und die Diebe haben nichts mehr zu befürchten. Alle Fenster und Türen nach hinten raus können dann gefahrlos aufgebrochen werden. Die anderen beiden Alarmklingeln haben wir schon ausprobiert. Sie funktionieren tadellos. Und hier sehen Sie auch das Fenster, von dem aus man direkt zum Musikzimmer gelangt, ohne von der Vorderseite aus gesehen zu werden.«
Logisch, dachte Judith. Jeder Dieb würde vermeiden, von der Straßenseite her in das Gebäude einzudringen. Der offene Platz vor dem Haus war sicher nachts von den Gebäudestrahlern ausgeleuchtet. Wozu so ein Risiko eingehen? Das Fenster in der Nähe des Hintereingangs hingegen war ideal im Schatten der Bäume gelegen, selbst bei Vollmond nahezu uneinsehbar. Die kleine Bohrung im Holzrahmen fiel fast nicht auf. Judith konstatierte: »Das Werk eines Profis. Das gekonnte Stilllegen der Alarmklingel – und die Tatsache, dass sonst nichts entwendet wurde – lässt nur einen Schluss zu: Das war kein Gelegenheitsdiebstahl. Jemand hatte es genau auf dieses Gemälde abgesehen.«
»Das müssen Sie herausfinden! Aber ich kann Ihnen nur zustimmen.«
Judith nickte. »Wann könnte sich denn dieser Jemand an der Alarmklingel zu schaffen gemacht haben?« Ohne eine Leiter oder zumindest einen Stuhl war da nicht heranzureichen. Von der Verwaltungsleiterin bekam sie nur ein ratloses Gesicht und ein Achselzucken als Antwort. Sie fragte weiter: »Hatten Sie in letzter Zeit Handwerker im Haus?«
Dora Kisch verneinte.
»Wer dann?« Vielleicht war der Dieb für seine Vorbereitungen auch nur auf das Fensterbett gestiegen. Mit ein bisschen Geschick könnte man auf dem schmalen Brett einen Augenblick balancieren, überlegte Judith. Das Klingelblech abzuschrauben, den Bauschaum zu verwenden, alles wieder abzudecken und zu säubern, erschien ihr für einen Menschen, der etwas größer war, machbar. Sie bezweifelte, dass der Kollege von der Kriminaltechnik noch verwertbare Fußspuren fand, von Fingerabdrücken ganz zu schweigen. Die Manipulation der Klingel könnte Stunden, wenn nicht sogar Tage zuvor erfolgt sein. Aber vielleicht hatte der Dieb ja etwas übersehen. Jeder machte irgendeinen Fehler. Judith besah sich aufmerksam das Schloss der Hintertür. Es schien unbeschädigt zu sein. »Wie viele Schlüssel gibt es zum Gebäude?«
»Drei. Einen habe ich, einen die Chefin und einen die Putzfrau. Ach, und einen habe ich noch in meinem Büro in einer Kassette als Reserve.« Dora Kisch wandte sich um und deutete mit einem Kopfnicken an, dass sie wieder dorthin zurückkehren sollten. Sie kramte etwas in ihrem Schreibtisch und zeigte dann ihre beiden Schlüssel vor.
»Sie erwähnten vorhin einen Sicherheitsdienst?«, erinnerte Judith.
»Richtig, die haben auch noch einen«, kam zögerlich die Bestätigung.
»Schon gut«, wiegelte Judith ab. »Wann wäre der denn im Haus gewesen? Gab es da berechenbare Zeiträume?«
»Von um acht Uhr abends alle zwei Stunden, bis morgens um vier. Plus/minus zehn Minuten, glaube ich. Gute zwei Stunden später ist schon unsere Putzfrau im Haus.« Eifrig setzte die Verwaltungsleiterin hinzu: »Ich hab schon bei denen angerufen. Die haben aber letzte Nacht nichts bemerkt, sonst hätten sie schon Bescheid gegeben. Die Leute von der Nachtschicht hatten zwar schon Feierabend, aber im Schichtbuch gab es keinen Eintrag zu etwas Auffälligem.«
Judith holte ihren Notizblock hervor und fragte: »Wie viele Leute sind bei Ihnen angestellt? Ich muss mich mit dem gesamten Personal unterhalten.«
»Sicher. Außer mir und der Chefin haben wir noch einen Museologen, Wolfgang Scharne. Der ist für drei Wochen im Urlaub, seit letztem Montag bereits; hat also eine Woche schon rum. Er wollte für ein paar Tage nach Spanien, sagte er.« Ihr Mienenspiel ließ offen, ob sie ihn beneidete oder bedauerte. »Dann die Frau für die Kasse und den Museumsladen, der ich manchmal helfe, die aber auch mich vertritt, Elke Franke. Mehr feste Stellen haben wir nicht. Alles andere, von der Vorbereitung von Sonderausstellungen bis hin zu den Aufsichten, läuft über Leute, die über das Arbeitsamt kurzfristig zu uns vermittelt werden.«
Judith wusste, was das bedeutete. Da kamen zum Teil hoch qualifizierte Akademiker, die sich von Projekt zu Projekt hangeln mussten, auf die Stellen. Aber auch Leute aus prekären Verhältnissen, die Arbeiten erledigten, für die sie nicht ausgebildet worden waren. Könnte der Diebstahl durch diese Zeitkräfte begünstigt worden sein? »Wissen denn Ihre Hilfskräfte, was bei Sicherheitsproblemen zu tun ist? Worauf sie zu achten haben?«
»So richtig eigentlich nicht. Woher auch? Ich versuche, sie zu schulen, so weit es meine Zeit hergibt«, betonte Dora Kisch stolz. Wie zum Beweis zählte sie auf: »Was ist zu tun, wenn plötzlich der Strom ausfällt. Was mache ich, wenn die Alarmanlage anschlägt? Oder auch, wie muss ich regieren, wenn jemand einem Exponat zu nahe kommt? Wie beobachte ich größere Besuchergruppen? Und so weiter. Bis heute Morgen gab es – Gott sei Dank – auch noch keine Notwendigkeit, die Wirksamkeit meiner Bemühungen infrage zu stellen.«
»Ich benötige eine Namensliste all dieser Mitarbeiter. Vielleicht ist ja irgendeinem etwas aufgefallen.«
»Die Liste ist kurz! Es sind zurzeit nur drei, die sich die Öffnungszeiten teilen. Andere beschäftigen wir gerade nicht. Unsere nächste Sonderausstellung wird erst ab Herbst vorbereitet. Hier!«, reichte sie einen hurtig geschriebenen Zettel mit Namen und Anschriften über den Tisch. »Ich glaube zwar nicht, dass es was bringt. Aber man weiß ja nie.«
Die Putzfrau wartete, eine Zigarette rauchend, vor dem Hintereingang des Museums. Seitdem die Museumschefin ihr die Befragung ankündigt hatte, stand sie hier draußen. Außerdem waren drinnen die Flure abgesperrt worden. Schon drei Kippen hatte sie in den sandigen Boden getreten. Die Frau war mager, regelrecht dürr. Finster blickend sah sie zu, wie die Polizistin die Tür hinter sich schloss.
Judith Brunner stellte sich vor und bedankte sich bei der Frau für ihre Geduld. »Darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen?«
»Irma Wentzek. Mache hier schon seit Jahren sauber. Is’ nie was passiert.«
»Das weiß ich. Sehr schade, dass jetzt dieses überaus hübsche Bild gestohlen wurde. Aber wenn Sie hier schon so lange arbeiten, kennen Sie sich im Museum bestimmt gut aus.«
»Was soll die Frage?« Wentzek sah Judith lauernd an.
»Oh, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich hoffte nur, von Ihren Ortskenntnissen profitieren zu können. Sie kennen jeden Gang und jeden Winkel. Was meinen Sie, welche Möglichkeiten gibt es, außer durch den Vordereingang, ins Haus zu gelangen?«
Die Frau entspannte sich etwas. Nach einem tiefen Zug aus ihrer Zigarette zuckte sie leicht mit den Schultern. »Der Eingang hier und drüben in den Keller. Von da wieder hoch in die alte Küche im Erdgeschoss. Ganz schön aufwendig. Ich denke, der Dieb kam da rein.« Sie nickte mit dem Kopf in Richtung des hinter ihr liegenden Fensters. »Ist der kürzeste Weg zum Bild. Es stand offen, als ich heute Morgen kam.«
»Sie haben wahrscheinlich recht.«
Irma Wentzek grinste. »Ich hab mich mal wieder über die Studierten geärgert. So klug und trotzdem immer schlampig.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Das passiert nämlich nicht zum ersten Mal. Besonders der Scharne lässt im Sommer das Fenster in seinem Zimmer offen stehen; selbst das da«, sie zeigte wieder auf das Fenster neben der Tür, »schlug neulich morgens einfach auf. Ich mach die Tür auf und schon knallt’s. War bestimmt nich’ richtig zu.«
»Aber heute war das anders?«
»Genau. Da habe ich schon von Weitem gesehen, dass es offen stand. Und drinnen lag überall Dreck auf dem Fußboden. Also, denk ich so bei mir, irgendwas stimmt nicht. Ruf mal vorsichtshalber die Chefin an.«
»Da haben Sie genau richtig gehandelt. Sagen Sie, Frau Wentzek, wissen Sie noch, wann Ihnen neulich das aufgesprungene Fenster aufgefallen war?«
Nach kurzem Überlegen kam eine Antwort. »Anfang letzter Woche. Da war es stürmisch und ich kam kaum auf dem Fahrrad vorwärts. Und deswegen habe ich das auch nicht weiter erwähnt. Ich dachte, bei so einem Wind kann das schon mal vorkommen. War das falsch?«, fragte die Putzfrau verunsichert.
Judith beeilte sich, die Frau zu beruhigen. »Ich bin froh, dass Sie sich überhaupt noch daran erinnern und es erwähnt haben. Vielleicht hat es gar nichts zu bedeuten. Unter Umständen ist es aber ein wertvoller Hinweis.«
Elke Franke stand mit dem Rücken zur weit geöffneten Tür des kleinen Museumsladens. Sie füllte ein Regal auf, das breite Lücken zwischen diversen Gipsbüsten zeigte. Sie entnahm den Nachschub einem großen Karton, wickelte die Büsten vorsichtig aus ihrer schützenden Hülle aus Wellpappe und drapierte sie ordentlich in die Fächer.
»Guten Morgen«, grüße Judith.
Mit jemandem in der Hand, den Judith beim besten Willen nicht identifizieren konnte, drehte sich die Museumsangestellte zu ihr um und grüßte zurück. Sie hielt Judith die Figur entgegen und sagte freundlich, aber bestimmt: »Endlich sind sie gekommen!«
Judith wusste sofort, dass sie damit nicht gemeint sein konnte, sondern die Gipsköpfe.
»Ich habe gleich Zeit für Sie, muss nur noch drei von den Riedels auswickeln. Der olle Fritz fühlt sich schon seit Wochen ganz allein.«
Judith musste schmunzeln. Der Name des Porträtierten brachte ihr schlagartig eine Erinnerung ins Gedächtnis: den ersten unbelasteten Ausflug, den Walter mit ihr gemacht hatte. Kurz nachdem sie offiziell bei ihm eingezogen war, weil ihre Liebe nun nicht mehr vor Entdeckung geschützt werden musste. Es war Frühling gewesen, zur Zeit des Vogelzuges. Seit Tagen schnatterten Gänse am Himmel und trompeteten die Kraniche. Walter hatte ihr den Drömling gezeigt, eine ehemals sumpfige Waldlandschaft, die von eben diesem Heinrich August Riedel, den Elke Franke da mehrfach ins Regal stellte, urbar gemacht worden war. Im Auftrag von Friedrich II., dem Preußenkönig, hatte er Ende des 18. Jahrhunderts zahlreiche Gräben und Kanäle anlegen lassen. Der Ausflug würde Judith wegen der einzigartigen Landschaft und der Melodie der Vögel für immer in Erinnerung bleiben – und sie hatte bei dieser Gelegenheit von Walter eine Menge über Melioration und besagten Riedel erfahren.
Geduldig wartete Judith, bis Elke Franke meinte, mit ihrer Arbeit fertig zu sein.
»So. Geschafft. Nun haben die Busladungen wieder was zu kaufen.«
Ob das ironisch gemeint war? Judith hatte keine Vorstellung von den Besucherströmen in einem Altmark-Museum, bezweifelte aber, dass sich hier täglich mehr als ein Dutzend Personen einfanden. »Schön. Ich müsste Sie kurz sprechen, wegen des Einbruchs heute Morgen.«
»Das habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich auch gleich überall nachgesehen. Meine Kasse und auch sonst all das Zeugs im Laden, was womöglich für einen Dieb interessant gewesen wäre, ist noch da. Nicht einmal der Computer wurde geklaut. Hier im Laden fehlt jedenfalls nichts. Absolut nichts ist verschwunden!«, bekräftigte sie.
»Bis auf das Bild«, murmelte Judith und wusste nun mit Bestimmtheit, dass genau dieses Gemälde, der Goldregen, gezielt gestohlen worden war, und zwar zwischen vier Uhr morgens, als der Wachdienst das letzte Mal im Haus unterwegs war, und halb sieben, als Irma Wentzek das offen stehende Fenster bemerkte.
~ 5 ~
Walter Dreyer hatte gut zu tun. Das war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Eigentlich hatte er eine etwas gemächlichere Vorstellung von seinem zweiten Berufsleben gehabt, doch gab es erstaunlich viele Angelegenheiten, die Fremde bereit waren, diskret in seine Hände zu legen. Ein angenehmer Nebeneffekt seiner Arbeit als Privatdetektiv war das gute Geld, welches er damit verdiente; und inzwischen übertraf sein gegenwärtiges Einkommen das des ehemaligen Ortspolizisten von Waldau erheblich. Walter konnte sich seine Aufträge aussuchen, denn die Klienten, denen er seine Dienste zugesagt hatte, bekamen stets Ergebnisse geliefert und genau das sprach sich herum.
Dieses Jahr würde er sechzig werden. Er dachte immer öfter, wie seltsam sich das anhörte, denn er fühlte sich erheblich jünger, absolut fit und noch enorm tatendurstig.
Gerade hatte er einen Anruf bekommen. Es ging um Erbschaftsstreitigkeiten bei der Aufteilung einer alten Münzsammlung. Ein Bruder soll die anderen zwei Geschwister betrogen haben. Das Erfolgshonorar für den Fall, Walter könne dafür Beweise vorlegen, war üppig. Er hatte versprochen, darüber nachzudenken und bis morgen mitzuteilen, ob er den Auftrag annahm.
Neben dem Telefon saß Wilhelmina, ihren Schwanz um die aufrecht stehenden Vorderpfoten gelegt. Sie sah Walter so eindringlich an, als wolle sie ihn nötigen, unverzüglich mit der Arbeit anzufangen.
»Du brauchst gar nicht so zu schnurren, es gibt nicht schon wieder was zu fressen. Wo futterst du das bloß alles hin?« Walter schnappte sich die Katze vom Schreibtisch und setzte sie vorsichtig auf den Fußboden. »Los! Verschwinde in den Garten. Ich hab’ zu tun.«
Die Uhr zeigte kurz nach fünf. Sein Vorhaben hatte nichts mit dem Erwirtschaften von Katzenfutter zu tun. Beschwingt ging er zur schönen Glasvitrine zwischen den beiden Fenstern seines Arbeitszimmers und goss sich einen guten Whisky ein. Die Bar, eigentlich ein neoklassizistischer Bücherschrank, war – wie auch der Schreibtisch und das wandgroße Bücherregal – ein Erbstück von seinem alten Lehrer, der vor knapp drei Jahren verstorben war. Walter nahm den ersten Schluck in dankbarem Gedenken an diesen Mann. Bis zum nächsten Termin lohnte es sich wohl kaum, noch mit etwas Neuem anzufangen. Er nahm genüsslich einen weiteren Schluck. Plötzlich fühlte er sich beobachtet. Wilhelmina hatte keineswegs daran gedacht, durch die offen stehende Terrassentür ins Freie zu laufen. Sie hypnotisierte ihn nun vom Teppich aus. Jetzt setzte sie auch noch ihre stärkste Waffe ein – ein stummes Miau. Walter kapitulierte. »Na los, gehen wir in die Küche.«
Während er zum Futternapf griff, hörte er ein vertrautes Motorgeräusch. Wie von selbst legte sich ein Strahlen auf sein Gesicht. War so viel Glück normal? Diese wunderbare Frau kam heim zu ihm! Wilhelmina musste warten. Er lief zur Haustür und ging Judith ein paar Schritte entgegen.
»Ich liebe es, so zu Hause empfangen zu werden«, versicherte sie ihm leise und man konnte ihr ansehen, dass diese Bemerkung der Wahrheit entsprach.
»Und ich liebe es, dass du ›zu Hause‹ sagst«, gab Walter zurück.
In diesem Haus lebte und arbeitete Walter schon länger. Als nach der Wende für einen Ortspolizisten keine Räumlichkeiten mehr benötigt wurden, kaufte er es günstig von der Gemeinde. Die junge Bürgermeisterin, eine pragmatisch denkende Frau, die für eine der neu gegründeten Parteien kandidiert hatte, war froh gewesen, dass Walter im Ort wohnen blieb. Die Einnahmen für die Gemeindekasse vergrößerten sich sogar noch, als er auch das danebenliegende, verfallene Häuschen kaufte und durch einen Abriss das Ortsbild verschönerte.
Er nahm Judith zärtlich bei der Hand und führte sie hinein. Im Flur küssten sie sich innig.
»Ich wohne schon mehr als zwei Jahre unter diesem Dach«, erinnerte sie ihn, als sie wieder reden konnte.
»Zwei Jahre, zwei Monate und siebzehn Tage«, wusste Walter und gab ihr erneut einen Kuss. »Für die genaue Stundenzahl müsste ich mal kurz rechnen. Aber wen interessieren schon Zahlen!«
Judith seufzte theatralisch. »Es gefällt mir hier! Der Service ist unglaublich. Das Personal ist äußerst zuvorkommend. Es wird einem jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Egal, ob’s um gutes Essen oder andere Bedürfnisse geht.« Sie schenkte Walter einen unmissverständlichen Augenaufschlag. »Und den Feierabend hast du auch schon eingeläutet«, neckte sie ihn und leckte sich über die Lippen.
»Ertappt!«, gestand er ohne eine Spur von schlechtem Gewissen, »doch wird es bei dem einen Drink bleiben müssen – wir bekommen nämlich noch Besuch.«
»Oho, verrätst du mir auch, wer kommt?« Judiths Stimme klang ein klein wenig enttäuscht. Sie wäre viel lieber mit Walter allein geblieben.
»Friedrich Renz hat angerufen. Er würde gerne vorbeikommen und etwas mit uns besprechen.«
»Wirklich? Mit uns?« Judith war überrascht. »Er hat uns doch noch nie besucht. Was ist passiert?«
»Er wollte nicht am Telefon darüber reden.« Walter sah auf seine Armbanduhr. »Es schien ihm wichtig zu sein. Jeden Augenblick sollte er eintreffen.«
Wilhelmina, deren existenziellen Bedürfnisse schnöde in den Hintergrund gestellt wurden, verlor die Geduld und mauzte sich lautstark in Erinnerung.
»Musstest du wieder den ganzen Tag hungern«, hockte sich Judith neben die Katze und streichelte tröstend ihr Fell, wohl wissend, dass die kleine Tyrannin heute bereits mehr als einmal verwöhnt worden war.
Als Walter ihr gerade ein Schälchen mit sahniger Milch hinstellte, klopfte es an der Tür.
Judith ging öffnen. »Willkommen. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Kommen Sie doch bitte herein.«
Galant verbeugte Dr. Renz sich leicht und sagte: »Ich wünschte mir nur, dass es dafür einen erfreulicheren Anlass gegeben hätte.« Bedauernd hob er die Hände.
»Jetzt machen Sie mich aber neugierig«, gab Judith zu. Friedrich Renz sah wirklich besorgt aus. Und das schon bei der Begrüßung. So kannte sie ihn gar nicht. War jemand gestorben?
Der Rechtsmediziner, der in Gardelegen wohnte, befand sich schon seit fast einem Jahrzehnt im Ruhestand. Walter konsultierte ihn gelegentlich, wenn das im Rahmen seiner Recherchen nötig wurde, und auch Judith suchte ihn hin und wieder auf, wenn sie die Besonderheit eines Falles frei und vorurteilslos erörtern wollte. Friedrich Renz hatte die getuschelten Bemerkungen, dass Judith und Walter ein Paar waren, seinerzeit lediglich mit einem wissenden Schmunzeln kommentiert. Er freute sich für die beiden, hatte aber bisher auch keine Notwendigkeit gesehen, das Paar privat in seinem trauten Heim zu besuchen.
Judith führte ihren Gast ins Wohnzimmer. »Setzen Sie sich doch bitte. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Ein Glas Wasser vielleicht?«
»Gern. Eine kleine Erfrischung kann ich gut brauchen.« Dr. Renz nahm auf einem der robusten Ledersessel Platz und verzichtete auf weiteres höfliches Geplänkel. »Ich habe ein Problem«, kam er sofort zur Sache, »und fürchte, ich brauche Ihre Hilfe.«
Judith setzte sich ihm gegenüber auf das Sofa und fragte erstaunt: »Als Polizistin?«
Renz wiegte den Kopf. »Ich denke, in diesem Fall möchte ich zunächst einmal Herrn Dreyer um Unterstützung bitten.«
Walter, der auf einem Tablett Wasser, Gläser und etwas Gebäck hereinbrachte, hörte die letzten Worte. »Ich werde alles tun, was ich kann«, versicherte er Friedrich Renz umgehend, ohne zu wissen, worum er genau gebeten werden würde. Das spielte keine Rolle, denn Walter betrachtete den Mann als engen Freund, der vor allem Judith jahrelang zur Seite gestanden hatte. Er setzte sich neben sie auf die Couch. »Was ist los?«
Nach einem ersten Schluck fing Renz an: »Nun, ich bin ein Freimaurer.« Er nippte nochmals am Glas. »Diese Tatsache spielt eine maßgebliche Rolle in der Angelegenheit, die ich Ihnen vortragen werde. Nur deswegen erwähne ich es, und nicht, weil ich mich interessant machen möchte.«
Seine Offenbarung setzte großes Vertrauen voraus und Judith fühlte, wie sehr sie sich über diese Geste von Friedrich Renz freute. Schließlich handelte es sich dabei um einen Jahrhunderte alten Geheimbund, dessen Mitgliedschaft man schon wegen des Verschwiegenheitskodex nicht herausposaunte. Angeberei hätte sie Renz auch nie unterstellt, aber dass er ein Freimaurer war, vermutete sie bereits länger. Ihr war einmal ein Ring an seiner Hand aufgefallen: Silber, mit breitem Ringkopf, der in einem feinen, goldenen Kranz das Winkelmaß und den Zirkel zeigte. Sie hatte ihn nie daraufhin angesprochen, zumal er den Ring zu keiner Zeit während seiner Arbeit im Labor oder am Seziertisch trug und es damit auch keinen Anlass für eine entsprechende Bemerkung gegeben hätte. Judith mochte Männerringe nur in Ausnahmefällen, nämlich wenn ihr Träger dazu passte – egal ob der Ring die Eleganz eines Laufstegmodels oder die Präsenz eines muskelbepackten Motorradrockers unterstrich. Der Ring, den Friedrich Renz heute wieder am kleinen Finger trug, hatte ihr schon beim ersten Betrachten gefallen, eine wunderbare Goldschmiedearbeit an einem guten Mann.
»In meiner Loge bin ich seit vielen Jahren einer der sogenannten Beamten, ein von den Brüdern gewählter Mann für bestimmte Aufgaben. Ich bin der Schatzmeister. Mir obliegen sozusagen unsere Vermögensangelegenheiten. Seit es durch den Beitritt 1990 möglich schien, das vor Jahrzehnten verlorene Eigentum meiner Loge zurückzuerhalten, kümmerte ich mich darum. Darf ich etwas ausführlicher werden?«
»Nur zu!«, versicherte Walter gespannt. Das schien ein äußerst interessanter Abend zu werden.
Friedrich Renz verlor etwas von der Anspannung, die ihm bisher deutlich anzusehen war. Er lehnte sich in den Sessel zurück und begann: »Meine Loge gibt es schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals traf man sich in Gardelegen in einem Wirtshaus am Salzwedeler Tor und überlegte sich einen Namen. Drei Tore zum Licht ist es dann geworden, unter Bezug auf die drei Stadttore, die Gardelegen einmal hatte. Obwohl wir vergleichsweise nur eine kleine Loge waren, haben ihr im Laufe der Jahrzehnte viele bedeutende Männer aus unserer Gegend angehört, Gelehrte, hohe Beamte, aber auch Handwerksmeister oder Kaufleute trugen zu unser aller Wirken bei. In unserer Alltagsarbeit spielte die Herkunft eines Mannes kaum eine Rolle. Nun, wenn eine Loge so lange existiert, bleibt es kaum aus, dass sich stabile Finanzverhältnisse herausbilden und auch ein gewisses Vermögen angehäuft wird. Viele Logenbrüder spendeten großzügig oder haben uns in ihren Testamenten bedacht. Wie Sie sich denken können, wecken solche Vermögen das Interesse verschiedener Seiten. Als die Nazis an die Macht kamen, wurde uns das zum ersten Mal zum Verhängnis. Die Freimaurerlogen wurden nach 1933 verboten und ihr Vermögen eingezogen. Unsere sämtlichen Sachwerte, einschließlich der Aufzeichnungen und Bücher, wurden uns weggenommen. Zwar wurden wir nicht als Gegner des Regimes verfolgt, dennoch haben viele Brüder diese Zeit nicht überlebt oder sind emigriert, und damit ist auch viel Wissen um diese Dinge verloren gegangen. Wie andere Logen beantragte auch unsere Loge nach dem Ende der NS-Zeit ihre Wiederzulassung. Die Drei Tore zum Licht hatte Erfolg. Sie erhielt sogar ihre Immobilie zurück; aber das übrige Vermögen war schwierig wiederzubeschaffen. Niemand wusste, wo die Dinge hingelangt waren. Jedenfalls verfügte meine Loge wenige Jahre nach dem Krieg vor allem durch Spenden aus Übersee und einigen Erbschaften wieder über Besitz: unser Logenhaus mit Inventar, Wertgegenstände – Bücher, rituelle Gefäße, Schmuck, Gemälde, Teppiche – und auch über ein geringes Geldvermögen auf diversen Konten. In den Fünfzigerjahren waren diese jüngeren Erwerbungen erneut in Gefahr. Wir hatten von anderen Logen erfahren, dass staatliche Stellen versuchten, die Logen aufzulösen und ihr Vermögen zu konfiszieren. Ich möchte mich nun nicht zur Zweckmäßigkeit der damals von meinen Brüdern ergriffenen Maßnahmen äußern, doch ein mir nicht bekannter Logenbruder hatte die Aufgabe bekommen, alles verschwinden zu lassen und damit die wertvollsten Stücke vor dem Zugriff der Behörden zu retten. So weit so gut. Das Problem ist: Wir wissen bis heute nicht, wo er sie versteckt hat.«
»Ich soll das alles für Sie wiederfinden!«, vermutete Walter begeistert.
~ 6 ~
Renz bestätigte dies mit einem Nicken, wirkte dabei jedoch recht zögerlich. »Wenn Sie es so nennen wollen. Das auch. Ja.«
»Was noch?«, forderte Walter aufgeregt. »Heraus damit! Wobei kann ich Ihnen noch helfen?«
Renz blickte zu Judith und räusperte sich. »Ich habe meinen Brüdern versprochen, dass ich mich in dieser Angelegenheit an die besten Leute wenden werde, die ich kenne. Eventuell würde sich die folgende Sache mit Ihrer Unterstützung schneller klären lassen. Sie sind doch eine herausragende Kriminalistin.«
»Jederzeit. Ganz gewiss«, versicherte ihm nun auch Judith ihre Unterstützung. Sie freute sich über das Lob. Dass sie die Angelegenheit vertraulich behandeln würde, war an diesem Tisch nicht nötig zu erwähnen.
Friedrich Renz entnahm seiner Ledertasche einen festen Umschlag und zog vorsichtig ein Blatt Papier hervor, ungefähr von der doppelten Größe einer Postkarte. Er legte es so zwischen Judith und Walter auf den Tisch, dass beide es gut sehen konnten.
Altmodische, schwarze Lettern hoben sich vom vergilbten Papier ab. Unverkennbar waren fünf Namen durchgestrichen und zusätzlich mit Totenkreuzen markiert worden.
Judith reagierte bestürzt, als sie den Namen Renz entdeckte. »Oh, ist das Ihr …?«, entschlüpfte es ihr leise.
Wie zur Bestätigung ließ Renz seinen Kopf fallen. »Das ist ein Blatt, welches aus einem Mitgliederverzeichnis meiner Loge von 1948 herausgerissen wurde«, erklärte er. »Und diese Männer« – er zeigte auf die Kreuze – »sind wirklich tot. Den letzten haben wir vor zehn Jahren zu Grabe getragen. Mein Vater war einer der ersten; er starb bereits vor über zwanzig Jahren; hochbetagt, nach einem nicht immer leichten Leben. Nun, wie Sie sehen, ist nur noch ein Name übrig. Über diesen Mann, Emil Deutler, wissen wir leider so gut wie nichts. Wie wir schon herausbekamen, ging sein Kontakt zur Loge irgendwann in den Nachkriegsjahren verloren. Ich möchte Sie bitten, nach ihm zu suchen.« Renz, der zuerst Walter anblickte, ließ seinen flehenden Blick dann auf Judith verharren. »Wir würden gerne mehr über sein Schicksal erfahren. Wie Sie sich aufgrund meiner Ausführungen sicher schon denken können, steht diese Namensliste mit unserem verschwundenen Logenvermögen in Zusammenhang.«
»Inwiefern?«, fragte Judith und versuchte, nicht indiskret zu klingen.
»Dazu komme ich gleich.« Renz griff wieder in seine Ledertasche. »Hier, ich habe Ihnen ein komplettes Exemplar dieses alten Verzeichnisses mitgebracht. Vielleicht hilft das bei den Recherchen.«
Walter blätterte, überrascht, ein mehrseitiges Mitgliederverzeichnis der Drei Tore zum Licht in den Händen zu halten, ungläubig in dem dünnen Heftchen. Ein gedrucktes Verzeichnis? Er hatte angenommen, die Freimaurer machten ein größeres Geheimnis um ihre Existenz.
Als hätte Friedrich Renz seine Gedanken gelesen, erläuterte er: »Die Logen sind rechtlich gesehen Vereine. Wir wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten wieder zugelassen, für Wohltätigkeitszwecke, wie andere Vereine auch, und mussten einen Eintrag im Vereinsregister mit entsprechenden Papieren beantragen. Wie jeder Verein bestimmten wir einen Vorsitzenden, unseren Logenmeister, hatten eine Satzung, ein Vereinsabzeichen und eben auch ein Mitgliederverzeichnis. Seinerzeit schien das kein Risiko darzustellen … Zu DDR-Zeiten wurde dann die Volkspolizei für die Zulassung von Vereinen und die Führung der Vereinsregister zuständig. Das änderte vieles, nicht zuletzt auch für meine Loge. Anfang der 1950er Jahre waren die Freimaurer immer wieder Überprüfungen ausgesetzt. Die Brüder bemerkten, wie sie oder ihr Umfeld Gegenstand von Ermittlungen der Polizei wurden. Man konstruierte dann aus der Tatsache, dass die russische Kommandantur zwar von unserer Existenz wusste und seinerzeit unsere Zusammenkünfte und unser Wirken auch genehmigt hatte, aber de facto kein Eintrag ins Vereinsregister erfolgt war, die Notwendigkeit eines neuen Antrages. 1950! Die Aussicht auf Erfolg war eigentlich gleich null. Von den anderen Logen im Land hörten wir Ähnliches. In Berlin war die Situation wegen der Teilung der Stadt noch eigenartiger. Bei einem unserer überregionalen Treffen wurde ein Bericht unserer Berliner Brüder verteilt, der recht anschaulich wiedergab, wie dort die Logenveranstaltungen von Volkspolizisten besucht und überprüft wurden. Das Misstrauen des neuen Staates uns gegenüber war groß, und das, obwohl auch Partei-Mitglieder unseren Logen angehörten. Letztendlich entschied man sich, unsere Tätigkeit vorerst nicht zu unterbinden. Was aber nicht hieß, dass die Mitglieder und unsere Arbeit nicht weiterhin streng überwacht wurden.«
Walter hörte gespannt zu. Diese Seite an Friedrich Renz war ihm neu, obwohl Judith ihm vor ein paar Jahren von einigen Begegnungen mit Freimaurern erzählt hatte. Ihm imponierte, mit welcher inneren Verbundenheit Renz von seinen Brüdern sprach. »Und das wissen Sie alles aus eigener Erfahrung? Sie können damals kaum-«
»Ich war alt genug! Zudem war mein Vater ein wichtiger Mann in der Loge. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Mitgliedschaft über die Generationen einer Familie fortbesteht.« Renz richtete den Blick auf die herausgerissene Seite des alten Mitgliederverzeichnisses. »Zwei ihrer Söhne sind heute meine Brüder. Als wir die Liste sahen, beunruhigte sie uns natürlich. Ich habe versucht, in den wenigen Unterlagen, die wir noch besitzen, Anhaltspunkte zu finden, was es damit auf sich haben könnte. Ja, und ich bin dabei auf etwas gestoßen.«
»Na?«
»Alle sechs Männer gehörten demselben Ausschuss meiner Loge an: dem Wirtschaftsausschuss. Sie bereiteten alles vor, vom Vorschlag für Anschaffungen bis hin zum Begleichen von Rechnungen. Außerdem aber führte dieser Ausschuss – und das ist im Zusammenhang mit meinem Anliegen von Bedeutung – ein Inventarverzeichnis für das bewegliche Vermögen der Loge. Mit anderen Worten: Diese sechs Brüder wussten, was uns einstmals gehörte und sie wussten vielleicht auch, wo alles versteckt worden war.«
»Sie meinen, diese Männer hüteten das Geheimnis um Ihr ganzes Hab und Gut? Fünf von ihnen sind tot und der letzte wird vermisst?« Walters Ausdruck verriet, dass er auch ein unnatürliches Ableben der Logenbrüder in Betracht zog.
»Bei Ihnen hört sich das ja an, als müssten wir nach einem Serienmörder suchen«, staunte Renz, der an diese entfernte Möglichkeit allerdings auch schon mal gedacht hatte.