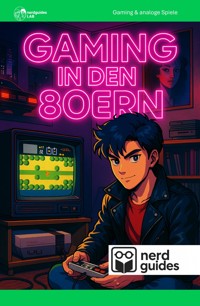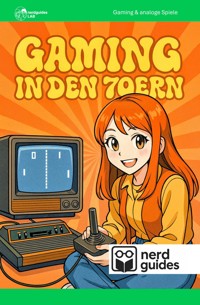Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Düster. Geheimnisvoll. Faszinierend. Gothic ist mehr als schwarze Kleidung und melancholische Musik – es ist eine Kultur voller Kreativität, Individualität und Gemeinschaft. Dieser nerdguide nimmt dich mit in die Welt der "Kinder der Nacht": von den Ursprüngen im Post-Punk und Dark Wave über Literatur und Ästhetik bis hin zu Festivals, Werten und globalen Szenen. Reich bebildert und voller Inspiration zeigt dir dieses Buch, wie du deine eigene schwarze Seite entdecken und ausleben kannst – ob durch Musik, Mode oder einfach deine besondere Geisteshaltung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GothicEine Einführung
Copyright:nerdguides,Vogelsbergstr.40,55129Mainz
Inhaltlich verantwortlich gemäß § 55 Abs. 2 RStV:Dr.MarkusHaack,derHerausgeberderReihe
SatzundLayout:Dr.MarkusHaack Lektorat: Dr. Markus Haack
TeiledesInhalts(insbesondereAbbildungen)sindmitKI generiert. Für den Text wurde KI zur Formulierungshilfe undRechercheeingesetzt.KI-generierteInhaltewurden sorgfältig überprüft.
https://nerdguides.de/[email protected]
Herstellung:Selfpublishingüberepubli (Neopubli GmbH, Berlin)
GedrucktinDeutschland2025
Inhalt
Einleitung
Kapitel 1: Wo alles begann – Die Geschichte der Gothic-Szene
Kapitel 2: Der Sound der Dunkelheit – Musik als Herz der Szene
Von Post-Punk zu Goth Rock
Vielfalt der Stile: Dark Wave, Industrial, Metal und mehr
Texte und Themen: Tiefgang und Gänsehaut
Deinen eigenen Weg in der Musik finden
Kapitel 3: Schauerromantik – Literatur, Lyrik und Hauptmotive
Die Ursprünge: Gothic Novel und Schauerliteratur
Lyrik und Poesie: Schwarze Rosen und Rabenfedern
Moderne Romane und Medien
Kapitel 4: Kleidung & Stil – Schwarze Samtträume und Nietenleder
Ausdruck der Persönlichkeit: Warum Kleidung so wichtig ist
Stile ohne Ende: Von Batcave bis Cyber
Make-up, Haare und Schmuck – die Details
Mut zur Veränderung: Deine Komfortzone erweitern
Kapitel 5: Bildästhetik & Film – Die dunkle Kunst des Sehens
Schwarze Leinwände: Filme für die Nachtkinder
Fotografie und Kunst: Schönheit des Morbiden
Ästhetik im Alltag: Wohnen und Ambiente
Warum das alles? – Die Wirkung der Bilder
Kapitel 6: Community & Events – Gemeinsam anders weltweit
Lokale Treffen: Clubs, Kneipen, Stammtische
Die großen Treffen: Festivals und Events
Anschluss finden: Dein Weg in die Community
Kapitel 7: Werte und Geisteshaltung – Tiefschwarz, aber herzlich
Toleranz und Individualismus
Melancholie und Weltschmerz – aber echt, nicht aufgesetzt
Humor und Selbstironie
Geisteshaltung: Weder Heilige noch Sünder
Authentizität und Ehrlichkeit
Gemeinschaftsgefühl und Verantwortung
Realismus und Träume
Kapitel 8: Szenekritik – Klischees, Konflikte und kein Grund zur Panik
Klischees und Vorurteile von außen
Interne Kritikpunkte: Gatekeeping, Kommerz, Zickereien
Anhang
Playlist – Must-hear Gothic Songs
Glossar – Wichtige Begriffe der Gothic-Szene
Einleitung
Bist du fasziniert von düsterer Musik, schwarzen Outfits und geheimnisvollen Geschichten? Hast du vielleicht letztens jemanden mit beeindruckendem Makeup und viktorianischem Kleid auf einem Festival gesehen und dich gefragt, was es mit dieser Gothic-Szene auf sich hat? Dann herzlich willkommen! In diesem Guide nehmen wir dich an die Hand und tauchen gemeinsam ein in die Welt der Gothic-Kultur.
Stell dir vor, du stehst in deinem Zimmer, das Licht ist gedimmt, und aus deinen Kopfhörern klingt ein melancholischer Song mit tiefen Basslinien. Ein wohliger Schauer läuft dir über den Rücken. Vielleicht spürst du zum ersten Mal: Das hier spricht mich wirklich an. Genau dieses Gefühl hatten unzählige andere, die so ihren Weg in die schwarze Szene gefunden haben. Dieses Buch möchte dir alles mitgeben, was du für deinen eigenen Einstieg brauchst – ohne Klischees, ohne Hürden, aber mit viel Herzblut.
Wir werden zusammen die Geschichte der Gothic-Bewegung erkunden – von ihren musikalischen Wurzeln bis heute. Du erfährst, welche Musik die Szene geprägt hat und warum ausgerechnet dunkle Klänge so viele Menschen begeistern. Wir streifen durch die Welt der Literatur und Lyrik, wo Romane und Gedichte voller Geheimnisse und Vergänglichkeit dich erwarten. Natürlich geht es auch um Kleidung und Stil: Wie kleidet man sich eigentlich „gothic“? Muss es immer Schwarz sein? (Kleiner Spoiler: meistens ja, aber längst nicht nur!) Wir betrachten die Bildästhetik und Filme, die Gothics lieben – von klassischen Horrorgeschichten bis zu modernen Filmen mit schaurig-schönem Flair. Außerdem lernst du die Community kennen: Wo triffst du Gleichgesinnte? Was passiert auf Festivals und in der Szene weltweit? Und ganz wichtig: Wir sprechen über die Werte und Geisteshaltung in der Szene – was den „Kindern der Nacht“ wirklich wichtig ist – und werfen auch einen ehrlichen Blick auf Kritik und Vorurteile, mit denen Gothics konfrontiert werden.
Du wirst sehen, dass niemand als allwissender Gothic geboren wird. Jeder fängt mal klein an, vielleicht etwas verloren im ersten Clubbesuch oder unsicher, welches Kleidungsstück „zu viel“ ist. Das ist normal! Gemeinsam räumen wir Hürden aus dem Weg, damit du dich ganz auf das Wesentliche konzentrieren kannst: Deine Freude an der dunklen Ästhetik und Musik.
Bereit? Dann zünde eine Kerze an (wenn du magst), mach es dir gemütlich und lass uns loslegen. Dies ist dein persönlicher Nerdguide in die Welt des Gothic – ein Wegweiser in eine Szene, die mehr als nur schwarze Kleidung ist. Ob du nur neugierig schnupperst oder schon entschlossen bist, Teil der Gothic-Community zu werden: Hier bist du richtig.
Tauchen wir ein in die Nacht – denn dort warten Melancholie, Schönheit und Gemeinschaft auf dich.
Kapitel 1: Wo alles begann – Die Geschichte der Gothic-Szene
Jede Bewegung hat ihre Ursprünge, und bei Gothic begann alles mit Musik und einem Gefühl des Andersseins. Reisen wir zurück in die späten 1970er Jahre nach England: Die Punk-Ära ebbte gerade ab, doch einige Musikerinnen wollten die Grenzen noch weiter ausloten. Aus diesem Post-Punk-Umfeld entstand ein neuer Sound – düsterer, atmosphärischer, tiefergehend. Bands wie Siouxsie and the Banshees, Joy Division und Bauhaus fingen an, melancholische Klänge mit introspektiven Texten zu verbinden. Ein ikonischer Moment war die Veröffentlichung von „Bela Lugosi’s Dead“ durch Bauhaus im Jahr 1979 – dieser Song gilt als einer der ersten Gothic-Rock-Titel überhaupt. Der Begriff „gothic“ machte schnell die Runde. Der Manager von Joy Division soll auf die Frage eines BBC-Reporters, was das für eine Musikrichtung sei, mit „gothic music“ geantwortet haben. Kurz darauf begannen auch Musikjournalistinnen, die neue Szene mit diesem Begriff zu versehen. 1983 beschrieb z.B. der Sänger Ian Astbury (von Southern Death Cult) die Fans einer befreundeten Band scherzhaft als „Goths“ – und das Wort setzte sich rasch durch. Spätestens ab 1984 sprachen die britischen Medien ständig von dieser merkwürdig dunklen Jugendkultur, die sich da formierte.
Die erste Generation von Goths (wobei sie sich damals vielleicht noch gar nicht so nannten) war jung, künstlerisch und suchte nach etwas jenseits der knallbunten Popwelt der 80er. In Großbritannien eröffneten Clubs wie das Batcave in London, wo sich 1982 die Szene traf – ein Kellerclub voller Nebelmaschine, schwarzer Kleidung und exzentrischer Gestalten. Was diese jungen Leute verband, war nicht eine klare politische Agenda, sondern das Lebensgefühl der Düsternis und das Outsider-Gefühl. Man wollte anders sein als die breite Masse. Statt der fröhlichen Discomusik suchte man Klänge, die Weltschmerz, Wut und Melancholie ausdrückten. Kein Wunder: Die späten 70er und frühen 80er waren von gesellschaftlichen Spannungen geprägt – kalter Krieg, Angst vor Atomkrieg, Umweltzerstörung. Viele Jugendliche fanden ihre eigenen Ängste und Gefühle plötzlich in dieser neuen Musik wieder. Endlich sprach jemand (wenn auch metaphorisch) über das, was sie bewegte: Einsamkeit, Unsicherheit, die dunklen Seiten des Lebens.
Dann schwappte die Bewegung schnell über den Ärmelkanal nach Deutschland. Hier entwickelte sich die Szene Anfang der 1980er sowohl in West- als auch Ostdeutschland. In der BRD nannte man die Anhänger bald liebevoll-ironisch „Gruftis“ – in Anspielung auf Gruften und Friedhöfe, die ja im Gothic-Look gern als Kulisse dienten. In der DDR hingegen gab es ganz eigene Begriffe: Dort sprach man von „Ghouls“ oder „Darks“ für die Anhänger der dunklen Mode. Die DDR-Regierung war gar nicht begeistert von diesen schwarzgekleideten Jugendlichen – sie passten so gar nicht ins sozialistische Ideal. Die Staatssicherheit (Stasi) beobachtete die ostdeutsche Gothic-Szene misstrauisch. Offene Treffen oder Konzerte waren in der DDR zunächst verboten. Trotzdem gab es auch dort Menschen, die The Cure oder Bauhaus hörten, sich dunkle Augen schminkten und versuchten, mit selbstgenähten schwarzen Klamotten ihren Idolen nachzueifern. Ja, selbst hinter der Mauer war Robert Smith von The Cure ein stilistischer Held, dem man nacheiferte.
Ein schönes Detail zeigt, wie erfinderisch die Leute damals waren: In Ostdeutschland konnte man natürlich nicht einfach in einen Laden gehen und schwarze Szenekleidung kaufen – es gab ja nichts Derartiges offiziell. Also musste man improvisieren. Priestergewänder oder sogar schwarze Schiedsrichter-Trikots wurden umfunktioniert und umgenäht, um einen möglichst „schwarzen“ Look hinzubekommen. Die Not machte erfinderisch, und genau das war Teil des Reizes: Gothic bedeutete auch, kreativ zu sein und sich vom Massenkonsum abzugrenzen.
Währenddessen formierte sich in Westdeutschland eine lebendige Szene. Erste Wave- und Gothic-Partys fanden statt, und Magazine berichteten über diese neue “schwarze Mode“. Es gab sogar Modefirmen (wie z.B. Bogey’s), die in Jugendzeitschriften düstere Outfits bewarben. Schon früh gab es unterschiedliche Strömungen innerhalb der Szene: Manche kleideten sich leichenblass in wallendes Schwarz und wurden klassisch als Gruftis bezeichnet, andere – die Waver – bevorzugten kühlere, elektronische Klänge und einen moderneren Look, wieder andere hingen an der bunten Eleganz der New Romantics, die mit Rüschenhemden, Glitzer und androgynem Stil auffielen. Und dann waren da noch die EBM-Fans, die im Military-Look herumrannten und zu harten elektronischen Industrial-Klängen tanzten. All das passierte gleichzeitig in den frühen 80ern. Die Gothic-Szene war also von Anfang an vielfältig und keine monolithische Gruppe. Was sie vereinte, war die Liebe zur Dunkelheit – optisch wie musikalisch.
Abb. 1: Gewandet in Schwarz mit Rüschen (Marc Planard, CC-Lizenz)
Natürlich blieben diese skurril gekleideten Jugendlichen der Gesellschaft nicht verborgen. Eltern und Lehrer schüttelten den Kopf: Was sollte das sein – Teenager in schwarzen Klamotten, die traurige Musik hören und Friedhöfe mögen? Für viele Außenstehende war das unheimlich. Schnell entstanden Mythen und Vorurteile: Man erzählte sich, Gothics würden dunkle Rituale abhalten, auf Friedhöfen herumlungern und sogar Gräber schänden, sie seien Satanistinnen oder gefährliche Sektenmitglieder. Einige Leute glaubten sogar, Goths würden in Särgen schlafen oder Blut trinken – das volle Gruselprogramm! Die Presse stürzte sich begeistert auf solche Geschichten. Und die Gothic-Szene? Die wehrte sich nicht sonderlich laut dagegen. Im Gegenteil, viele Goths fanden es insgeheim ganz praktisch, wenn die „Normalos“ Angst bekamen und Abstand hielten. Distanz zur normalen Gesellschaft war ja gewollt – man wollte schockieren und auffallen. Provokation gehörte zum Konzept, sei es durch umgekehrte Kreuze als Schmuck oder gruseliges Auftreten. Dabei ist wichtig zu verstehen: Es ging den meisten nicht um echte Religionskritik oder Satanismus, sondern um ein Statement. Okkulte und christliche Symbole wurden vor allem wegen ihrer mystischen Ästhetik und Tabuwirkung benutzt. Anders als etwa die Punks oder Hippies, die ja klare politische Botschaften hatten, wollte die Gothic-Szene keine Revolution anzetteln – sie wollte vor allem ihre Ruhe von der Gesellschaft. Man zog sich in die eigene Nische zurück, unter Gleichgesinnte, die einen verstanden. „Kinder der Nacht“ nannte man sich selbst poetisch – man wollte unter sich sein, die geliebte Musik hören und nicht ständig alles erklären müssen.
Während in den 80ern so manche Eltern das Ganze als „Phase“ abtaten, zeigte sich mit den Jahren, dass Gothic gekommen war, um zu bleiben. Viele, die in den 80ern als Teenager Schwarz trugen, sind der Szene heute – Jahrzehnte später – immer noch treu. Mit den 90er Jahren wuchs die Szene weiter. In Großbritannien klang Gothic-Rock langsam ab, aber in Deutschland und anderen Ländern diversifizierte sich das Ganze. Neue Musikstile kamen hinzu: zum Beispiel entwickelte sich der Dark Wave – ein Begriff, der vor allem in Deutschland benutzt wurde für dunkle, wave-orientierte Musik – und der Gothic Metal, der Metal-Klänge mit gothischer Atmosphäre verband. Bands wie Paradise Lost oder Type O Negative brachten Gitarren-Härte zusammen mit düsterer Stimmung. Auch elektronische Spielarten wie Future Pop oder Aggrotech (etwa VNV Nation oder Hocico) fanden ihren Platz in den schwarzen Clubs. Kurz: Die Szene wurde größer und vielfältiger denn je. Gleichzeitig zog sie mehr Menschen an – auch solche, die vielleicht nicht 100%ig im ursprünglichen Gothic-Rock verwurzelt waren, aber das Düstere liebten.
Leider gab es in dieser Zeit auch negative Schlagzeilen. Mitte bis Ende der 90er brachten einige tragische Ereignisse die Szene in Verruf. Es gab Fälle von Gewalt und sogar Morde, bei denen Täter als „Goths“ identifiziert wurden. Ein bekanntes Beispiel ist der Amoklauf an der Columbine High School 1999 in den USA. Die Medien stellten die beiden jugendlichen Täter damals als Teil einer „gothic Kult-Sekte“ dar – sie trugen schwarze Mäntel, hörten harte Musik, das passte ins Klischeebild. Natürlich hatte das mit der eigentlichen Gothic-Szene wenig zu tun, aber plötzlich gerieten schwarze Klamotten und dunkle Musik unter Generalverdacht. Es entstand eine regelrechte moral panic, wie Soziolog*innen sagen – Eltern und Lehrer bangten, ob Goth vielleicht gefährlich sei. In den folgenden Jahren wurden Vorfälle, in die dunkel gekleidete Jugendliche verwickelt waren, von den Medien oft aufgebauscht. Viele in der Szene fühlten sich missverstanden und unfair behandelt.
Doch die Gemeinschaft rückte enger zusammen und überstand diese Zeit. In den 2000ern erlebte das Gothic-Feeling sogar einen kleinen Popularitätsschub in der Popkultur: Bands wie Marilyn Manson oder Evanescence stürmten die Charts und brachten einen Hauch von Gothic-Optik ins Mainstream-Musikfernsehen. Auch wenn „echte“ Goths diese Acts manchmal nicht als Teil der Kernszene sehen – die Wirkung war, dass erneut viele Jugendliche neugierig auf die ganze dunkle Ästhetik wurden. Die Szene selbst blieb jedoch in ihren Grundwerten unverändert: Musik, Kleidung, Lifestyle – eine eigene kleine Welt innerhalb der Gesellschaft.
Heute, rund vierzig Jahre nach den Anfängen, ist die Gothic-Szene