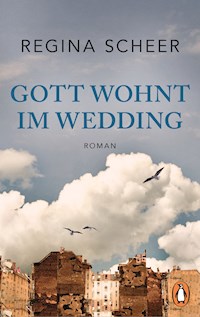
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Ein Haus. Ein Jahrhundert. So viele Lebensgeschichten.
Im ehemals roten Wedding, diesem ärmlichen Stadtteil in Berlin, steht in der Utrechter Straße ein altes Haus. Sie alle sind untereinander und schicksalhaft mit dem Gebäude verbunden: Leo, der nach 70 Jahren aus Israel nach Deutschland zurückkehrt, obwohl er das eigentlich nie wollte. Seine Enkelin Nira, die Amir liebt, der in Berlin einen Falafel-Imbiss eröffnet hat. Laila, die gar nicht weiß, dass ihre Sinti-Familie hier einst gewohnt hat. Und schließlich die alte Gertrud, die Leo und seinen Freund Manfred 1944 in ihrem Versteck auf dem Dachboden entdeckt, aber nicht verraten hat.
Regina Scheer, die großartige Erzählerin deutscher Geschichte, hat die Leben ihrer Figuren zu einem bewegenden Roman verwoben, voller Wahrhaftigkeit und menschlicher Wärme.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Ähnliche
Ein großes deutsches Epos, wahrhaftig und voller Menschlichkeit
Alle sind sie untereinander und schicksalhaft mit dem ehemals roten Wedding verbunden, diesem ärmlichen Stadtteil in Berlin. Mit dem heruntergekommenen Haus dort in der Utrechter Straße. Leo, der nach 70 Jahren aus Israel nach Deutschland zurückkehrt, obwohl er das eigentlich nie wollte. Seine Enkelin Nira, die Amir liebt, der in Berlin einen Falafel-Imbiss eröffnet hat. Laila, die gar nicht weiß, dass ihre Sinti-Familie hier einst gewohnt hat. Und schließlich die alte Gertrud, die Leo und seinen Freund Manfred 1944 in ihrem Versteck auf dem Dachboden entdeckt, aber nicht verraten hat. Regina Scheer, die großartige Erzählerin deutscher Geschichte, hat die Leben ihrer Protagonisten zu einem Epos verwoben, voller historischer Wahrheit und menschlicher Wärme.
Regina Scheer, 1950 in Berlin geboren, studierte Theater- und Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität. Von 1972–1976 arbeitete sie bei der Wochenzeitschrift »Forum«. Danach war sie freie Autorin von Reportagen, Essays und Liedtexten und Mitarbeiterin der Literaturzeitschrift »Temperamente«. Nach 1990 wirkte sie an Ausstellungen, Filmen und Anthologien mit und veröffentlichte mehrere Bücher zur deutsch-jüdischen Geschichte. Für ihren ersten Roman »Machandel« erhielt sie 2014 den Mara-Cassens-Preis.
»›Machandel‹ ist wohl vor allem ein Buch über geplatzte Träume und vergebliche Hoffnungen. Es ist ein sehr wahrhaftiges, ein wunderschönes Buch.«
Katja Eßbach, NDR Info über Machandel
»Es braucht jemanden wie Regina Scheer, der all diesen in historischen Zusammenhängen und individuellen Träumen verästelten Lebensgeschichten zuhört und sie mit dieser zurückhaltenden Emphase weitererzählt.«
Sabine Vogel, Berliner Zeitung über Machandel
»In Scheers märchenhafter Romanwelt von ›Machandel‹ entstehen aus umfangreichem historischen Material zwischen Mythos und Realität beseelte Lebensgeschichten.«
Michaela Schmitz, Deutschlandfunk »Büchermarkt« über Machandel
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
REGINA SCHEER
GOTT
WOHNT IM
WEDDING
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2019 Penguin Verlag München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: bürosüd
Covermotiv: © Gettyimages / Thorsten Gast / EyeEm
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-22536-0 V003
www.penguin-verlag.de
Dieses Buch ist ein Werk der Fiktion. Personen und Handlung sind frei erfunden. Soweit der Roman sich auf historische Gegebenheiten bezieht, erhebt er keinerlei Anspruch, diese »objektiv« darzustellen.
Jetzt kommen wieder die Zigeuner. Die erste war Laila aus der Fidler-Familie, die wurde in Polen geboren. Von dort hatte ich schon viele Bewohner. Am Anfang, vor mehr als hundert Jahren, waren es die Marciniaks, die Turowskis, Szczepanskis. Ich erinnere mich jetzt viel an den Anfang. Die meisten denken, ein Haus sei nichts als Stein und Mörtel, totes Material. Aber sie vergessen, dass in meinen Wänden der Atem von all denen hängt, die hier gewohnt haben. Ihre Tränen, ihr Blut habe ich aufgesogen, ich habe ihre Schreie gehört, ihr Flüstern, ihr endloses Gemurmel in den Nächten. All ihre Leben habe ich in mich aufgenommen, durch sie lebe ich selbst, auf meine Weise. Mich überrascht nichts mehr. Wenn man lange genug wartet, kommen alle wieder hier vorbei. Oder ihre Kinder.
Diese Laila brachte Kisten voller Bücher mit. Die Mutter ihres Großvaters Willi, Martha Fidler, die vor achtzig Jahren auf derselben Etage lebte, konnte gar nicht lesen und schreiben, sie war ja als Kind nur gereist. Aber Laila hat Marthas grüne Katzenaugen und trägt den Haarknoten wie sie.
Nach Laila kamen die Frauen vom Rand der Städte Bukarest und Craiova in Rumänien, dann die Familien aus dem Dorf, dessen Name ich vergessen habe; ihre Häuser standen an einem Kanal voller Wasserratten. Ich weiß das, sie reden oft von diesen Orten, die ihnen kein Zuhause waren und an denen sie doch etwas zurückgelassen haben, was ihnen nun fehlt. Die aus Craiova sind in die Wohnungen der russischen Mädchen gezogen. Hier gab es immer Zeiten, in denen die Leute nicht lange blieben. Aber mit den Russinnen fing ein Kommen und Gehen an, wie nicht mal ich es kannte. Ein Jahr nur haben sie hier gehaust, dann sind sie plötzlich mit ihren Kindern verschwunden. Ein Anruf kam, und sie mussten sofort weg, warum und wohin, das weiß hier keiner. In ihren beiden Wohnungen blieben die Mäntel zurück, mit denen sie handelten, Berge von Mänteln aus buntem Flausch, über die wenigen Möbel gebreitet, auf dem Fußboden gestapelt. Nur ein langer Tisch war frei, eigentlich nur ein großes Zeichenbrett, an dem machten die Kinder der Russinnen ihre Schularbeiten, darauf achteten die Mütter. Ihre Rechnungen und Auftragslisten schrieben sie am Laptop, auch an diesem Tisch. Gegessen haben sie an einem anderen, in der Küche hinter einer Kleiderstange voller Mäntel. Die wurden irgendwo in Russland genäht, die Frauen verkauften sie übers Internet, verpackten sie bei uns in flache Kartons, die sich im Hausflur stapelten. Ein Auto hatten sie, Männer habe ich selten bei ihnen gesehen. Aber es wurden mehr Mäntel geliefert, als sie verkaufen konnten, immer mehr Mäntel verstopften die Wohnungen, erst nur die rechte, dann auch die linke, in der sie alle schliefen. Auch auf ihren Betten lagen Mäntel, sie deckten sich zu mit Mänteln, sie liefen über Mäntel, wenn sie von einem Zimmer ins andere gingen, verhängten mit Mänteln die Fenster. Sie trugen selbst solche Mäntel, tailliert und mit beuligen Taschen, vielleicht ist das modern. Sogar die Kinder wurden in diese Flauschmäntel gekleidet, die die Mütter ihnen gekürzt hatten. Irgendwo zwischen den Kleiderstangen stand auch eine Nähmaschine, eine alte mit eisernem Gestell.
Die haben die rumänischen Frauen gefunden, sie freuten sich und legten ihre Säuglinge auf die Stapel von Mänteln. Die größeren Kinder begannen sofort, die Kartons vom Hausflur auf den Hof zu zerren, wo sie eine Stadt daraus bauten, Häuser mit Fenstern und Türen, aber die sind schon wieder vom Regen aufgeweicht und lösen sich auf. Ach, das kenne ich gut.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, aus Pappe gebaut zu sein, dabei hatte Kasischke ordentliche Ziegel aus Klausdorf bei Teltow kommen lassen, gebrannt im Hoffmannschen Ringofen. Nein, aus Pappe bin ich nicht, obwohl auch ich mich auflöse. Doch von mir will ich nicht reden.
Die russischen Frauen waren so eilig abgereist, dass im Kühlschrank noch gekochtes Essen stand. Auch das gefiel den Rumäninnen und ihren Männern, die nicht viel sprachen. Am nächsten Tag fuhr ein Lieferwagen auf den Hof und gleich darauf das alte Auto der Russinnen, zwei Kerle gingen in die beiden Erdgeschosswohnungen, ohne sich um die zeternden Frauen zu kümmern, zogen die Mäntel unter ihnen weg und packten beide Autos damit voll. Danach war die Wohnung leer, nur die Betten und die beiden Tische blieben zurück, auch ein großer Kühlschrank und schließlich noch die Nähmaschine, die einer der Russen schon zur Tür getragen hatte, aber die Rumäninnen protestierten und riefen, das sei ihre, schon immer gewesen.
Nun glaubten sie die Herrinnen der Wohnungen im Erdgeschoss zu sein, irgendwann erschien auch ein Bruder oder Schwager aus Buzescu oder der Bruder des Schwagers aus Craiova und baute ein neues Schloss in die Tür. In irgendeiner Ecke waren wohl doch noch ein paar dieser russischen Mäntel übrig geblieben, in grün und rosa, denn auch die Rumäninnen trugen plötzlich über ihren Röcken und Jeans die bunten Dinger und wickelten ihre Kinder darin ein.
Zigeuner hat es hier schon immer gegeben, sie waren Deutsche. Lailas Großvater Willi hat als Kind auf meinem Hof an der Teppichstange geturnt, aber das weiß sie nicht. Er ist auch später noch ein paarmal gekommen, als sie in der Laubenkolonie wohnten, zum Kriegsende dann nicht mehr. Hier in der Straße lebten noch mehr Sinti-Familien. 1936, im Jahr der Olympiade, wurden sie nach Marzahn in ein Lager gebracht, Baracken und Wohnwagen auf märkischem Sand zwischen dem Friedhof und den S-Bahngleisen sollen das gewesen sein. Die Fidlers hielt man für Wolgadeutsche, vorsichtshalber zogen sie in eine Laubenkolonie. Willis Vater hat dann als Musiker sogar in der Wehrmachtsbetreuung gearbeitet, bis nach Norwegen soll er gekommen sein. Doch dann verlor er seine Berufserlaubnis, das habe ich erfahren, ich erfahre hier alles. Er durfte nicht mehr mit Musik sein Geld verdienen, musste in Lichtenberg Kartuschen für U-Boote lackieren. Die Nachbarn aus der Laubenkolonie hatten Verdacht geschöpft und an den Polizeipräsidenten geschrieben, dass die Fidlers und die Mohrmanns, mit denen sie da hausten, waschechte Zigeuner seien. Sie selbst haben das Wort Zigeuner nie benutzt, ich sollte es auch nicht tun. Aber mich hört ja sowieso niemand. Doch, man hört mich, aber versteht nichts. Ich kann niemanden warnen, kann meinen Bewohnern nicht sagen, dass ein Unglück geschehen wird. Ich weiß es, ich spüre es, ich sehe ja die Zeichen, aber was kann ich tun, als mit den Türen zu schlagen und Putz rieseln zu lassen, mit den alten Dachbalken zu knarren oder mal einen Ziegelstein aus den Mauern fallen zu lassen. Darauf achten sie kaum, sie sind es gewohnt, dass ein altes Haus ächzt und stöhnt und dass in den Nächten der Wind sich in den Schornsteinen verfängt und winselt und heult.
Ich bin das älteste Haus in der Straße. Irgendwo hinterm Leopoldplatz soll es noch ältere geben, aber das habe ich natürlich nicht gesehen. Ich habe überhaupt nur gehört, was hier auf meinem Hof, zwischen meinen Wänden geredet wurde, und nur gesehen, was da geschehen ist, und das reicht mir auch.
1
DER MANN IM TRENCHCOAT mit Hut sieht aus wie einem alten Film entstiegen, nur ist sein Stock kein eleganter Gehstock, sondern eine gewöhnliche Krücke. Er steht vor der Liebenwalder 22 und beugt sich über das Straßenpflaster, als könne er in den buntgeäderten Steinen etwas erkennen. Der Regen war kurz und heftig, nun liegt wieder die Sommerhitze über den Straßen, das Wasser hat Plastiktüten, Papier, Zerbrochenes und Erbrochenes, auch den Hundedreck an die Ränder gespült, wo sich der Unrat staut. Die Granitpflastersteine schimmern jetzt feucht in allen Grautönen, mit rosa und bunten Adern.
Hinter dem Mann tritt ein jüngerer in die Tür, sieht den in seine Betrachtung versunkenen Alten, spricht ihn mit Mister Lehmann an und macht ihn auf Englisch darauf aufmerksam, dass die Stolpersteine aus Messing ein paar Meter weiter, vor der Nummer 16, zu finden seien. Denn die suche er doch sicher, da sei ein Judenhaus gewesen.
»Mit mir könnse Deutsch reden. Und ick suche keene Stolpersteine«, antwortet der andere.
»Ich dachte nur, weil Sie doch aus Israel …«
»Det warn hier außerdem allet Judenhäuser.«
Sein Berlinisch klingt wie aus einer anderen Zeit, er merkt es selbst. Heute redet man offenbar im Berliner Wedding anders Deutsch, durchsetzt mit schwäbischen und bayrischen Klängen, aber auch Türkisch, Englisch, Russisch, sogar Fetzen von Arabisch und Iwrith hat er gehört, als er gestern Abend ankam. Seine Enkelin Nira, die wenig Deutsch versteht, konnte sich mit dem Taxifahrer und den jungen Serviererinnen des Cafés an der Ecke mühelos verständigen. Sie zog auch noch los, nachdem sie vom Abendessen in ihre Hotelzimmer zurückgekommen waren, nach Kreuzberg wollte sie oder in den Prenzlauer Berg, ihre Freunde haben ihr die Namen von Cafés und Klubs aufgeschrieben, die sie unbedingt kennenlernen soll in den Wochen ihres Aufenthalts hier in dieser Stadt, aus der ihr Großvater kommt.
Jetzt, am Vormittag, schläft Nira noch und Leo Lehmann will ein paar Schritte gehen. Er hat nicht gewusst, dass Nira ausgerechnet im Wedding Hotelzimmer bestellte; als er hier wohnte, von seiner Geburt an immerhin knapp zwei Jahrzehnte, gab es in dieser Gegend keine Hotels. Aber Nira weiß gar nichts über den Wedding, das »Steps« hat sie im Internet gefunden, es warb mit seiner Lage in Berlin-Mitte, und die Zimmer waren billiger als anderswo. Den Wedding zählen die jetzt also zur Mitte Berlins. Und das Hotel »Steps« war früher ein normales Mietshaus, mit falschen Säulen und Simsen an der mit Klinkern verblendeten Fassade. Dass das noch erhalten ist. Leo kam hier jeden Tag auf seinem Schulweg vorbei. Eine hölzerne Gedenktafel hing damals neben der Tür, weil hier, in der Liebenwalder 22, Walter Wagnitz gewohnt hatte. Zu Tode gekommen ist er ja in der Utrechter.
Als sie gestern aus dem Taxi stiegen, erkannte Leo sofort alles, die Straße, das Haus. Das Café »Schraders« an der Ecke war die Eckkneipe von Heinrich Reim gewesen, in der Leos Vater manchmal ein Bier getrunken hatte, als Leo noch ein kleiner Junge war. Später dann nicht mehr. Ein Zufall, dass Nira ausgerechnet hier gebucht hat. Dabei war diese Gegend eine Trümmerlandschaft, als er sie zum letzten Mal sah. Sie haben manches neu gebaut und die alten Häuser wieder zusammengeflickt, die Löcher zugeschmiert, die Fassaden verputzt, das können sie ja gut, die Deutschen.
So denkt Leo Lehmann und bleibt in seinen eigenen Gedanken hängen. Ist er nicht selbst ein Deutscher? Ein deutscher Jude. Wie das klingt. Wie ein Opfer. Er ist Israeli, das hört sich schon besser an. Aber Berliner ist er eben doch.
Hier links war eine Flohkiste, Thalia-Lichtspiele, die sieht er noch vor sich, obwohl jetzt ein ganz anderes Haus hinter einem Kinderspielplatz steht. Der alte Mann weiß noch, durch welche Seitentür er ohne Bezahlung in das Kino kam, wenn er Glück und der Filmvorführer sie nicht abgeschlossen hatte. Mehr als einmal hatte er sich als Steppke kurz vor Beginn der Vorstellung, wenn der Vorführer mit seinen Apparaten beschäftigt war, hinter ihm vorbeigedrückt, war durch eine weitere Tür geschlüpft und musste sich dann nur noch schnell im abgedunkelten Zuschauerraum einen Platz suchen, bevor die Kartenabreißerin ihn entdeckte. Einmal, als alles voll war, hat Manne, sein Freund Manfred Neumann, ihm im Halbdunkel zugewinkt, und sie quetschten sich dann beide auf seinen Platz. Manne hatte Geld fürs Kino, seinem Vater gehörten damals noch zwei Mietshäuser, eines drüben in der Wagnitzstraße, wo sie ein Jahrzehnt später bis zu Manfreds Verhaftung ab und zu untergekrochen sind. Eigentlich war es ja die Utrechter. Erst 1933 wurde sie in Wagnitzstraße umbenannt. Bei der feierlichen Namensverleihung für den Blutzeugen der Bewegung mussten auch Leo und Manne mit den anderen Schülern der 27. Volksschule antreten. Dass sie Juden waren, fiel damals noch keinem auf. So wie sie hießen hier viele. Und besonders religiös waren ihre Familien auch nicht.
In der Wagnitzstraße, mehr nach vorn zu, Richtung Müllerstraße, gab es den berühmten UFA-Palast, erst hieß das Lichtspieltheater Mercedes-Palast, der Eintritt dort war selbst für Manne zu teuer. Ob es den UFA-Palast noch gibt? Die Osram-Fabrikgebäude sind noch da, von seinem Hotelzimmer aus hat Leo Lehmann sie gesehen, sie reichen bis an die Liebenwalder Straße heran, aber da wird wohl nichts mehr produziert. Die Fenster der Shisha-Bar gegenüber vom Hotel gehörten damals auch zu einer Kneipe, hier war an jeder Ecke eine. »Steppan« hieß die da drüben, in welchem Winkel seines Gehirns hat er das all die Jahrzehnte über aufbewahrt? Dabei ist er dort nie drin gewesen, aber er weiß noch, dass der Arbeiter, der gleich nach dem Reichstagsbrand in dem Lokal erschossen wurde, Segebrecht hieß, Gustav Segebrecht. Wochenlang wurde davon geredet, auch bei ihm zu Hause. Gewohnt hat dieser Segebrecht ein paar Häuser weiter. Zu der Zeit gab es hier öfter Schießereien, der Wedding war rot, aber die Nazis machten sich schon vor ’33 breit. Segebrecht war Sozialdemokrat, er arbeitete bei Osram nebenan und hatte Kinder, die auch in die 27. Volksschule gingen. Es war ein Schlagaderschuss, das Wort hat Leo als Achtjähriger zum ersten Mal gehört und nie vergessen. Schlagaderschuss. RACHEFÜRWAGNITZ stand damals an den Fenstern der Kneipe. Heute sind die Jalousien da drüben auch beschmiert, aber er kann es nicht lesen, wird wohl Türkisch sein, Arabisch nicht, das würde er erkennen.
Leo Lehmann steht vor dem »Steps« und fühlt sich, als sei er in die Kulisse eines Films über seine Jugend geraten. Alles ist vertraut, aber auch wieder nicht, hat die falschen Farben, ist zu neu oder zu alt. Er ist fremd in dieser Kulisse, und nicht nur, weil die Straße so anders aussieht. Er ist nach Berlin gekommen, weil er hier etwas zu erledigen hat, nicht um seiner Vergangenheit nachzuspüren. Mit seiner Vergangenheit ist er fertig. Mit Berlin ist er fertig. Mit diesen Häusern und den Erinnerungen. 1948 hat er Berlin verlassen.
Nachdem Manfred aufgeflogen war, im April 1944, war Leo kaum noch in diese Gegend gekommen. Und nach dem Krieg wohnte er in Tempelhof, in der Nähe seiner neuen Freunde, der Displaced Persons. Jahrelang hatte er wie alle Untergetauchten nur auf das Kriegsende hin gelebt, irgendwie geglaubt, dann würde alles wie früher werden. Die Eltern würden wiederkommen, die Schwester, die Freunde … Nein, das konnte er nicht geglaubt haben, er wollte einfach überleben und dachte nicht weit über den Tag hinaus. Aber dann war er befreit, und als er das begriff, erschien ihm diese Freiheit wie ein Abgrund, man musste sich irgendwo festhalten, um nicht ins Bodenlose zu stürzen. Manfred war noch im Februar 1945 im Gefängnis in der Schulstraße umgekommen. Leo hat nie erfahren, ob er erschossen wurde oder bei dem großen Bombenangriff starb. Nun waren Simon und Leo die einzigen Überlebenden der Gruppe vom Habonim. Der zehn Jahre ältere Simon hatte sie nach dem Verbot 1938 weiter zusammengehalten. Zusammen waren sie in den Untergrund gegangen, schlugen sich zwei Jahre lang als Untergetauchte durch. Simon haben sie schon kurz vor Manfreds Verhaftung geschnappt. Vielleicht sind sich die beiden noch im Gestapogefängnis begegnet, aber Simon redete nicht, kein Wort über das, was er nach der Verhaftung erlebt hatte. Leo besuchte ihn in den Nachkriegswochen ein paarmal in seinem Zimmer in der Ackerstraße, aber der Apotheker war nicht mehr da, den hatten sie auch weggeholt, seine Witwe guckte nur vorwurfsvoll. Und Simon war krank, kaum wiederzuerkennen. Sie hatten ihm das Haar geschoren, und es wuchs einfach nicht mehr in der Zeit, die ihm noch blieb. Der unerschrockene, wendige Simon saß mit leerem Blick glatzköpfig und aufgeschwemmt da und tat nichts. Im August 1945 brachte er sich um. Als Leo von seinem Tod erfuhr, war er schon begraben. In Weißensee brauchten sie damals viele Gräber für die Selbstmörder, deren Kraft nur zum Überleben gereicht hatte, nicht zum Leben.
Nun erst erfuhr man, was im Osten geschehen war, in den Lagern. Leos Eltern waren nach Riga deportiert worden. In der Jüdischen Gemeinde in der Oranienburger, wo die Zurückgekehrten sich meldeten, saßen eines Tages zwei Brüder, die hatten das KZ Kaiserwald bei Riga überlebt und erzählten vom Wäldchen Rumbula, in dem der ganze 18. Osttransport aus Berlin, eintausendundvier Menschen, gleich nach der Ankunft erschossen worden war. Seit dieser Begegnung ging Leo regelmäßig zu den Gottesdiensten in die Rykestraße, wo er die Worte des Rabbiners kaum verstehen konnte, weil alle heulten.
Außerhalb der Synagoge heulte er eigentlich nie. Er tat, was er in den Jahren zuvor gelernt hatte, kaufte und verkaufte, besorgte begehrte Dinge für Leute, die zahlen oder tauschen konnten. Manche konnten beides nicht. Einem Max Lewinson, der aus Auschwitz zurückgekommen war und sein Geschäft in der Danziger Straße natürlich nicht mehr vorfand, besorgte er Metallspielzeug auf dem Schwarzen Markt, das der aus einem Bauchladen verkaufen wollte. Dieser Max Lewinson war schon älter, er erinnerte Leo an seinen Vater. Er blieb nicht lange im DP-Lager, in Schönholz fand er eine Wohnung, in die er Leo manchmal zum Essen einlud. Dann brachte Leo Delikatessen vom Schwarzen Markt oder aus der Kantine der Engländer mit. Nicht für sich hamsterte er, es gab genug Überlebende, die darauf angewiesen waren, trotz der Joint-Pakete. Und er ging tanzen, seine Freundin aus dem DP-Lager hieß Halina und kam aus einem Nest bei Posen. Zuletzt war sie im Lager Neustadt-Glewe gewesen. Darüber aber wollte sie nichts erzählen, sie wollte leben und lachen. Ihretwegen besorgte er Karten für die Philharmonie, mit ihr ging er in Kabaretts und ins jüdische Revuetheater in der Baerwaldstraße. Aber dann konnte Halina plötzlich in die USA ausreisen, zu Verwandten. Wieder spürte Leo die Einsamkeit wie ein Raubtier auf der Lauer. Aber ehe es ihn ansprang, lernte er andere Mädchen kennen, jüdische Mädchen, denen die jammernden Besiegten so zuwider waren wie ihm. Er gehörte nicht mehr dazu, hatte ja auch vorher nicht zur Volksgemeinschaft gehört. Die DPs in den Lagern in Zehlendorf und in Tempelhof waren, was er war: Personen ohne Platz, Weggeschobene, Vertriebene, Entwurzelte, man kann das Wort nicht übersetzen. Leo war displaced, obwohl er seine Geburtsstadt bis dahin nie verlassen hatte. In Berlin lebte keiner mehr, zu dem er gehörte. Einmal sagten sie im Büro der Jüdischen Gemeinde, dass eine junge Frau aus dem Wedding, Gertrud Romberg, nach ihm gefragt habe. Aber die wollte er nicht sehen, gerade die nicht.
In den Tagen der Luftbrücke brachte ein amerikanisches Frachtflugzeug ihn und andere DPs von Tempelhof nach München. Sie hockten in dem Kohlentransporter auf dem Boden, und in München waren sie alle schwarz vom Kohlenstaub. Als sie sich in einer öffentlichen Toilette waschen wollten, musterte die Toilettenfrau mit ihrem Schrubber die jungen Männer verächtlich und murmelte: »Dreckerte Preißen«. Noch heute muss er grinsen, wenn er daran denkt. Vor kurzem waren sie noch Saujuden gewesen, nun Dreckspreußen. Das war der Abschiedsgruß.
Von München ging es über Frankfurt nach Marseille und dort im Morgengrauen ans Wasser, der Kapitän des maroden Kahns war ein Italiener. Nachts im Bauch des Schiffes hörte man vierhundert junge Menschen, die dicht an dicht auf den blanken Brettern lagen, im Schlaf seufzen und weinen. In allen Sprachen riefen sie nach den Toten, am Tag aber sangen sie Hatikwa und freuten sich auf das Land, das sie gerufen hatte, auf den neu gegründeten Staat, der ihrer sein sollte.
Und nun ist Leo wieder hier in der Gegend seiner Kindheit. Das Haus, in dem er aufgewachsen ist, braucht er nicht zu suchen. Er hat selbst gesehen, wie Kettenbomben im September 1943 sein Elternhaus und die daneben umfallen ließen wie Dominosteine. Elternhaus, Kettenbomben – deutsche Wörter, die er seit Jahrzehnten nicht ausgesprochen hat, nicht einmal gedacht. Seine Eltern gab es nicht mehr im September 1943, und es war auch nicht ihr Haus gewesen. In dem gewöhnlichen Berliner Mietshaus hatten sie drei Zimmer mit Küche und Innenklo gemietet, gar nicht so übel für diese Gegend. Die Kettenbomben hießen so, weil sie irgendwie aneinander befestigt waren, mehrere gingen hintereinander los, hoben die Häuser dann von unten an. Er hat zugesehen, wie das Haus in sich zusammenfiel. Da war es schon längst nicht mehr sein Zuhause, in ihrer Wohnung, das wusste er, lebten ausgebombte Volksgenossen. Die wurden nun wieder ausgebombt, er sah Menschen aus den Flammen rennen.
Von schräg gegenüber sah er es, von Gertruds Erkerfenster aus, deren Haus in der Wagnitzstraße in dieser Nacht nicht getroffen wurde. Die Fensterscheiben waren mit schwarzem Papier beklebt, aber er hatte sich ein kleines Loch hineingerissen und beobachtete wie im Kino das Geschehen, ohne Angst, das war merkwürdig. Wegen der Druckwelle oder der Hitze barsten die Fensterscheiben, sein Arm blutete, er ging nach hinten zu Manfred, der in aller Ruhe im Dunkeln saß, auch dort waren Möbel umgefallen, und Porzellanfiguren flogen ihnen um die Ohren. Manfred sagte etwas über Zitterkaffee, so dass sie beide nicht aufhören konnten zu lachen. Nach Bombenangriffen gab es oft diese Sonderrationen Bohnenkaffee für die Überlebenden, die Berliner nannten ihn Zitterkaffee. Leo und Manfred mochten gar keinen Kaffee, Gertrud trank ihn gern, doch sie war nicht auf die Durchhalteprämie angewiesen, die beiden brachten ihr immer wieder Kaffeepäckchen und auch Zigaretten. Simon hortete ihre Schätze, die Tauschwährung, bei einer Frau Wiese.
Leo findet es in der Erinnerung seltsam, wie ungerührt er sein Elternhaus und das daneben verschwinden sah. Wie er neben Manfred in der Küche sitzen blieb, ein blau-weißes Geschirrtuch um den Arm gewickelt, und wie sie ohne Angst auf die Entwarnung warteten. Später erzählten ihm andere Untergetauchte, dass auch sie während der Bombenangriffe das Gefühl hatten, unverwundbar zu sein. Diese Bomben waren ja nicht für sie bestimmt. Natürlich war das dumm, es hätte sie wie jeden treffen können. Manne und er mieden die Luftschutzkeller. Die Männer in ihrem Alter waren fast alle eingezogen, die Kettenhunde kontrollierten besonders in den Schutzräumen und Bunkern. Und sie waren ja im Wedding nicht unbekannt, sie hätten gar nicht in diese Gegend kommen dürfen, das war ja dann auch Mannes Unglück. Aber die Gruppe gab es damals schon nicht mehr, alle schlugen sich einzeln durch. Leo und Manfred blieben meistens zusammen. Doch bei Hannchen Gerbeit in Kaulsdorf konnten sie nicht bleiben, und Manne wollte in das Haus in der Wagnitzstraße, das seinem Vater gehört hatte, weil er dort jeden Winkel kannte und wusste, wie man ungesehen in den Dachverschlag kommt, nur für ein paar Nächte.
Und dann sahen sie diese Gertrud, die Wäsche aufhängte. Eine junge Frau, sieben Jahre älter als die beiden neunzehnjährigen Jungen, Mannes Schwester war wohl mit ihr befreundet gewesen, aber Rosa war schon lange in England. Gertrud nahm sie mit in ihre Wohnung, ihr Vater arbeitete in einem Vorort und schlief auch dort, die Mutter war mit der Oma wegen der Bombenangriffe bei Verwandten, in Pommern. In der Wohnung konnten sie sich waschen und im Ehebett der Eltern schlafen. Gertrud kochte sogar für die beiden, sie gaben ihr echte Lebensmittelmarken. Simon hatte Kontakt zu einem Angestellten der Reichsdruckerei, der ganze Serien beschaffen konnte. Abends saßen sie oft mit Gertrud vor dem Radioapparat. Sie hatte auch ein Grammophon, am liebsten hörte sie eine Mahler-Sinfonie. Ein paar Monate lang ging das so, drei-, viermal in der Woche schliefen sie im Schlafzimmer ihrer Eltern, später zog Leo in Gertruds Mädchenzimmer, und Manfred lag mit ihr im Ehebett, Leo hörte sie hinter der Wand keuchen und lachen. Er war besorgt, weil Manne der Blonden so vertraute, ihr sogar erzählte, woher die Brotmarken kamen, und unbefangen von der Laube in Karow sprach, die sie wieder nutzen würden, sobald der Genesungsurlaub des Mannes der Besitzerin vorbei wäre. Tagsüber mussten sie die Wohnung in der Wagnitzstraße immer verlassen, das wollte Gertrud so, und es war auch nötig, denn sie trafen sich mit Simon und den anderen, die noch übrig waren, mal bei Frau Marks in Buchholz, mal auch bei Hannchen Gerbeit in Kaulsdorf, wo sie wegen der Nachbarn nicht mehr schlafen durften, die aber immer eine Suppe auf dem Herd hatte, einmal auch bei einer Bildhauerin im Atelier in Westend. Die Adresse hatte Simon ihnen gegeben. Aber fast alle Quartiere wurden ausgehoben, auch das Bildhaueratelier war plötzlich versiegelt, und die Frau aus Karow schlug ihnen die Tür vor der Nase zu, sie wolle nicht draufgehen, so kurz vor dem Ende.
Eines Spätnachmittags waren sie wieder in die Wagnitzstraße gekommen, es war ein paar Tage nach Ostern. Sie wollten einzeln über den Hof gehen, weil sie glaubten, das fiele weniger auf. Manne ging zuerst. Leo hatte seine Mütze ins Gesicht gezogen und drückte sich an dem Schuttberg, der sein Elternhaus gewesen war, vor einer stehen gebliebenen Wand herum, als er sah, wie Manne zwischen zwei Männern aus der Haustür trat, geführt wurde er, abgeführt, obwohl die Männer ihn nicht berührten. Sie trugen Zivil, aber man sah sofort, wer sie waren. Manne hielt die Hände auf dem Rücken verschränkt, wahrscheinlich hatten sie ihm Handschellen angelegt. Über seine Schultern war locker eine Jacke drapiert, die Hausjacke von Gertruds Vater, die immer an der Garderobe hing. Gertrud war nicht zu sehen. Manfreds Blick traf für den Bruchteil einer Sekunde seinen, dann wandten beide gleichzeitig den Kopf, und die Männer hatten mit ihm schon das an der Ecke wartende Auto erreicht. Damals fuhren keine Privatautos mehr.
Leo blieb im Schatten der Mauern, lief bis zur Panke, am Flüsschen entlang bis in den Pankower Bürgerpark, wo er vor Kälte zitternd die Nacht im Ziegengehege verbrachte. Am nächsten Morgen fing er Gertrud an der Straßenbahnhaltestelle in der Seestraße ab, von dort fuhr sie immer ins Büro, sie wirkte ganz normal, war gut frisiert und ordentlich gekleidet, über ihren blauen Tuchmantel war der kleine Pelzkragen geknöpft. Einen Moment lang schoss ihm die Erinnerung an seine Mutter durch den Kopf, an den klirrend kalten Tag im Januar 1942, an dem sie ihren Fuchskragen, ihren ganzen Stolz, abliefern musste, auch den Kaninchenmuff seiner Schwester brachten sie damals zur Sammelstelle. Gertrud prallte kurz zurück, als sie Leo sah, ihre Augen gingen unruhig hin und her. Zusammen stiegen sie in die Bahn, es war die Linie 8, er weiß noch, dass die Fensterscheiben fehlten. Er sah den Schweiß auf ihrer Stirn und fragte nach Manfred, sie behauptete, nichts zu wissen, bot ihm ihren Wohnungsschlüssel an, den er nicht nahm. Wohin er denn jetzt gehen würde, fragte sie ihn noch, dann sprang er am Oskarplatz aus der schon anfahrenden Straßenbahn und lief über die Seestraße, in die Markstraße, lief und lief bis in die Rehberge.
Leo steht noch immer vor dem »Steps«, der Regen ist verdunstet, die Granitsteine schimmern nicht mehr bunt, sind stumpf und grau. Es wird ein heißer Tag, aber einem, der seit Jahrzehnten in Israel lebt, macht die Hitze nichts aus. Was ihm etwas ausmacht, das sind diese Bilder, die in ihm aufsteigen, mit denen er merkwürdigerweise nicht gerechnet hat, als er diese Reise mit seiner Enkelin antrat. Dass Nira aber ausgerechnet hier ein Quartier für sie fand! In Berlin lebt niemand mehr, den er kannte, überhaupt leben immer weniger Menschen, mit denen er jung gewesen war, auch im Kibbuz ist er längst einer der ganz Alten. Mehr als neun Jahrzehnte Leben. Ob seine Eltern so alt geworden wären, wenn man sie gelassen hätte? Seine Mutter kam aus Lemberg, sein Vater aus Stryj, einem Schtetl im tiefen Osten, Galizien oder Russisch-Polen, er hat diese Gegend nie gesehen. Dort sind die Eltern und Großeltern seiner Eltern auch jung gestorben, an Krankheiten oder im Ersten Weltkrieg, an Hunger und vielleicht auch bei Pogromen. Leo hat dem nie nachgeforscht, er war ein Berliner Junge, der in der Gegenwart lebte, seiner Gegenwart, die nun auch längst Vergangenheit ist. Und in Israel hat man auch nicht viel nach der Vergangenheit gefragt, jeder hatte eine, und was zählte, war die Zukunft.
Als er drei Tage im Land war, kamen Jeeps ins Einwandererlager Beth Lit, holten ihn und ein Dutzend junger Männer, die mit ihm auf dem Schiff gewesen waren, an die Front bei Latrun. Die aus dem DP-Lager in Tempelhof waren dabei, manche fielen schon in den ersten Tagen, weil sie die hebräischen Befehle nicht verstanden. Die hatten die Lager überlebt, sich in der Nachkriegszeit im DP-Lager durchgeschlagen, waren endlich in Israel angekommen und gingen dann gleich zugrunde. Leo wurde nur verwundet. Im Lazarett lag er neben einem der Chawerim aus Berlin-Tempelhof, Abraham, eigentlich war der aus Breslau, zusammen waren sie später auch im Kibbuz, der ein paar Monate vor ihrer Ankunft von ehemaligen Buchenwald-Häftlingen auf dem judäischen Hügelland Schefela gegründet worden war. Abraham war dort nicht der Einzige, der seine Häftlingsnummer am Unterarm trug, aber mit den Jahren verbrannte die Sonne bei der Feldarbeit ihre Haut, und das Zeichen verblasste, wurde aber nie ganz unsichtbar.
Leo war ja in keinem Lager gewesen, er war nicht auf der Haut gezeichnet, aber auch für ihn verblassten die Spuren der Berliner Jahre allmählich. Es hat Jahre gedauert, bis sie untereinander über das sprachen, was hinter ihnen lag. Sie hatten zu tun, jeden Spatenstiel mussten sie selbst schnitzen, und anfangs schliefen viele von ihnen noch in Zelten. Nachts heulten die Schakale wie kleine Kinder. Und vieles konnte man sowieso nicht erklären. Dass es möglich gewesen war, in Berlin zu überleben, dass man Hilfe bei deutschen Nichtjuden fand, schien manchen nicht vorstellbar, und es war besser, man redete nicht davon. Mit seiner Frau Edith konnte er über alles sprechen, die hatte selbst so eine sonderbare Familiengeschichte, aber Edith ist schon seit zwanzig Jahren tot, und Ruth, ihrer Tochter, haben sie nicht viel erzählt, sie sollte frei von den Dibbuks der Vergangenheit aufwachsen.
Die Enkelinnen haben gefragt, das schon, die sind neugierig, aber sie können sich erst recht nicht vorstellen, wie das damals war.
Und nun steht er hier in der Liebenwalder Straße, ein paar Schritte von der Utrechter entfernt, in der er Manfred zum letzten Mal gesehen hat. Aber da fängt das Nichtsagbare schon an. Die Utrechter Straße war ja damals die Wagnitzstraße. Und die Hennigsdorfer Straße, die heute Groninger heißt, hatten die Nazis in Utrechter umbenannt. Leo wurde in der Hennigsdorfer Straße geboren, nein, im Jüdischen Krankenhaus in der Iranischen Straße war er 1925 zur Welt gekommen, nur ein paar Hundert Meter entfernt. Aber gewohnt hat er mit seinen Eltern und der Schwester Gisela in der Hennigsdorfer, die dann die Utrechter war. Bevor er Berlin verließ, hatte er noch gehört, dass der Name Wagnitz abgeschafft worden war, die Utrechter Straße war wieder die Utrechter, die Straße seiner Kindheit die Groninger. Wie soll man das jemandem erklären? Und schon gar nicht kann man erklären, was hier geschehen ist.
Der alte Mann geht ein paar Schritte, um das Straßenschild zu lesen. Tatsächlich, es ist immer noch die Groninger Straße. Hier rechts hoch kommt man zu der Ecke Wagnitzstraße. Er geht vorbei an einer Kneipe, die sich »Kugelblitz« nennt. »Offizieller Hertha-Fanclub« steht dort. Was für ein Fanclub, wer ist Hertha? Unerwartet trifft ihn die Erinnerung an den Fußballklub seiner Kindheit, an den umzäunten Platz an der Plumpe, nicht weit von hier, zu dem Manfred und er an manchen Sonntagen gelaufen waren. Mitglieder waren sie nicht, das hätte eine Mark im Monat gekostet. Aber Manne und er kamen ab und zu umsonst auf den Platz, weil Manfreds Onkel Hermann, ein Cousin seiner Mutter, bei Hertha BSC Mannschaftsarzt war. Hermann Horwitz war schon um die fünfzig, aber selbst begeisterter Fußballer, die Jungen bewunderten ihn. Eigentlich war er Lungenarzt, in Wilmersdorf, wo er auch wohnte. Leos Schwester Gisela war bei ihm in Behandlung wegen der andauernden Bronchitis, die sie sich im Arbeitseinsatz zugezogen hatte. Irgendwann durfte Dr. Horwitz sich nur noch Krankenbehandler nennen, und nur Juden durften seine Patienten sein. Der Fußballklub hatte ihn da wohl schon rausgeschmissen.
Leo steht vor der Kneipe »Kugelblitz« und spürt wieder den Abgrund, dem er doch schon 1948 mit dem Kohlentransporter entkommen ist. Bis zu Giselas Abwanderung hatte er das Schlafzimmer mit ihr geteilt, und plötzlich hört er wieder ihren keuchenden Husten, überfällt ihn eine Mischung von Ekel und Mitleid, wenn er an die Taschentücher mit Giselas eitrigem Auswurf denkt. Mannes Onkel Hermann war noch eine Zeitlang in Berlin, einmal, als sie gerade untergetaucht waren, durften die Jungen bei ihm schlafen, im Wartezimmer, Leo auf zusammengeschobenen Stühlen und Manne auf einer grünen Behandlungsliege. Dem Arzt, der seinen Stern sogar zu Hause am weißen Kittel trug, war es nicht recht gewesen, aber er hatte sie nicht fortgeschickt. Als Manne schon aufgeflogen war, als Leo in den letzten Kriegsmonaten für jede Nacht ein anderes Quartier suchen musste, war er noch einmal in das Eckhaus Nachodstraße/Prager Straße gegangen, aber er fand die richtige Wohnung nicht, nicht das Schild mit dem Stern und der Aufschrift »Krankenbehandler«. Eine Nachbarin kam, musterte ihn und fragte, ob er Doktor Horwitz suche, der sei nicht mehr da. Dies sei jetzt die Dienstwohnung vom SS-Obergruppenführer Jedicke. Georg Jedicke. »Namen und Adressen merkt man sich, man schreibt sie nicht auf«, hatte Simon ihnen eingeschärft. Und bis heute kann er keinen Namen vergessen. Der Name Georg Jedicke ist Leo dann lange nach dem Krieg wieder begegnet, der war Chef der Ordnungspolizei in Riga gewesen. In Riga, wo im Wäldchen Rumbula …
Er will sich von diesen Gedanken losreißen, alles hier rührt an vergessen Geglaubtes, sogar diese Kneipe mit dem harmlosen Namen »Kugelblitz«. Die schräg gegenüber hat einen türkischen Namen: »Karadeniz Lokali.« In diesem Kiez scheinen heute viele Türken zu wohnen. Auch Afrikaner. Damals gab es überhaupt keine Afrikaner in Berlin. Nur bei Siemens, bei der Zwangsarbeit, bevor er untertauchte, hat Leo einen Jungen mit dunkler Hautfarbe getroffen, dessen Mutter war Köchin bei einem Diplomaten gewesen und von dem schwanger geworden. Der Junge, Bobby, kannte seinen Vater gar nicht, aber die Arier schickten ihn in die Judenabteilung, wo er neben Leo Drähte für Elektromotoren lötete. Plötzlich erinnert Leo sich mit Unbehagen, dass Bobby nicht der richtige Name des großen, kräftigen Dunkelhäutigen war, sie nannten ihn nur so, nach dem ausgestopften Gorilla im Naturkundemuseum. Sie fanden es wohl witzig. Der war ein feiner Kumpel, aber er sah eben anders aus als sie. Der deutsche Meister nannte ihn nur Neger. Was wohl aus ihm geworden ist?
Vor dem »Kugelblitz« sitzen Berliner Männer und trinken schon am Vormittag Bier und Schnaps. Leo bleibt stehen, zieht den Trenchcoat aus, legt ihn über den Arm, dabei hört er, wie die Biertrinker in dem schmerzlich vertrauten Berliner Slang über das gestrige Fußballspiel reden. Ein kleiner Lebensmittelladen, vor dem Männer und auch Frauen an Stehtischen Bier trinken, eine Spielhalle mit verhängten Fenstern, ein armseliger arabischer Gemüseladen; das hier ist keine vornehme Gegend, nie gewesen. Ein mannshoher Elektrokasten ist übersät mit Inschriften, Leo liest: »Silja, ich gebe Dier mein Gantzes Hartz.« Darunter hat jemand geschrieben: »Sie will aber dein Hartz 4.« Noch rätselhafter ist Leo die wie ein Gedicht geschriebene Inschrift: »Menschen, die / Hier mit Drogen handeln sind / Gottlos / Verlierer.« Was bedeutet das? Sind die Drogenhändler gottlose Verlierer? Oder nur gottlos und der, der den Spruch schrieb, unterzeichnet als Verlierer? Vielleicht beides. Leo betrachtet den Elektrokasten, sieht sich um und spürt seine Fremdheit. Er kann die Chiffren seiner Geburtsstadt nicht mehr entziffern. Vor einem türkischen Bäckerladen hockt ein Mann, er sitzt nicht, nur seine Füße berühren das Straßenpflaster, unbewegt hält er seinen Körper in der Schwebe, unbewegt ist auch sein Gesicht, er scheint in eine Ferne zu blicken, die nur er allein wahrnimmt. Dieser Mann kommt Leo nicht fremd vor, solche entrückten Gesichter, in denen sich Jahrhunderte spiegeln, hat er bei alten Beduinen in der Negev-Wüste gesehen.
Die Kneipe an der nächsten Ecke heißt »Biertempel bei Mario«. Biertempel. Seine Mutter nannte die Synagoge Tempel, den Ausdruck Biertempel hat er nie gehört. Aber den Begriff Schultheiss auf dem Werbeschild kennt er, so hieß das Bier damals schon. Siebzig Jahre hat er nicht daran gedacht. Die Straße hier ist die Utrechter, nichts erinnert mehr daran, dass sie vierzehn Jahre lang die Wagnitzstraße war. Gar nichts erinnert mehr an den Hitlerjungen Walter Wagnitz aus der Liebenwalder, den Blutzeugen der Bewegung. Aber Leo erinnert sich an den endlosen Trauerzug, der hier begann, an die riesigen Fahnen und den mitreißenden Klang des Horst-Wessel-Liedes. Nie zuvor hatte er mit seinen sieben oder acht Jahren so viele Menschen auf der Straße gesehen, am liebsten wäre er mitgelaufen, bis zum Luisenstädtischen Friedhof, aber seine große Schwester zerrte ihn vom Straßenrand weg, und da kam ihnen auch schon die Mutter entgegen und befahl sie nach Hause.
Die Häuser hier sehen verändert aus, der Stuck wurde abgeschlagen, das da drüben scheint ein Neubau zu sein, und mittendrin ist ein Stückchen frei, die Stelle war früher auch bebaut. Ganz oben an der Brandmauer ist mit weißer Farbe eine Inschrift gemalt: FUCKNEOLIBERALISMUS. STOPTTTIP.
An dieser Ecke hat er Manfred zum letzten Mal gesehen. Da drüben stand Gertruds Haus, das einmal Manfreds Familie gehört hat, hier steht es immer noch. Wie im Halbschlaf geht Leo Lehmann durch die Toreinfahrt auf den Hof. Neben den Mülltonnen liegt Unrat, alte fleckige Matratzen lehnen an der Wand, durchweicht von Regen. So heruntergekommen war das damals hier nicht. Das war ein für diese Gegend ansehnliches, ordentliches Haus. Und es war, soweit er sich erinnert, sauber gehalten, es gab sogar eine Hausmeisterin, vor der sie sich in Acht nehmen mussten. Jetzt scheint sich hier niemand um die Ordnung zu kümmern. Schmutzige, durchnässte Pappkartons sind überall verteilt. Leo betrachtet den Hof, sein Blick geht zu den Fenstern mit den kleinen Balkons hoch. Da erinnert er sich wieder, auch bei Gertrud hatte die Küche so einen winzigen Balkon. Lärmende Kinder spielen an den Mülltonnen. Die sprechen und rufen in einer Sprache, die Leo nicht versteht, Türkisch scheint es nicht zu sein. Ein kleiner blonder Junge, der spricht allerdings Deutsch, zeigt den Spielgefährten ein Plastikrohr, wohl eine Art Kaleidoskop, das er nicht aus den Händen lässt. Die anderen Kinder dürfen mal durchschauen, kurz nur, er hält es fest, und sein Gesicht leuchtet vor Stolz, er genießt die begehrliche Bewunderung der anderen. Jetzt wischt er das Rohr an seinem Pullover ab, putzt es wie eine Kostbarkeit.
Leo schaut den Kindern schon eine Weile zu, als eine Frau auf den Hof kommt, ihn mit harter Stimme in gebrochenem Deutsch fragt, was er hier wolle. Über ihren Röcken trägt sie eine Art Hausmantel aus grünem Flausch, ruft etwas zu den Kindern, was wie eine Warnung klingt, mustert Leo argwöhnisch und doch neugierig. Ja, was will er hier? Er geht an seinem Stock zurück in die breite Toreinfahrt mit den Prellsteinen, ihm entgegen kommt eine jüngere Frau mit einem Blumenstrauß, die ihn erstaunt anschaut. Der Boden hier ist gefliest, auch die Wand, plötzlich erkennt er das Muster der Kacheln wieder, solche hingen auch im Hausflur seines Elternhauses. Hier sind aber viele schon herausgebrochen. Der Stuck darüber ist beschädigt, doch der gipserne Kopf einer Frau mit Schlangenhaaren blickt drohend herab. Eine Medusa, die hat die Zeiten überlebt. So eine hölzerne Namenstafel wie hier gab es auch in seinem Elternhaus. Stiller Portier nannte man die in Berlin, auch so ein Wort, das er nie mehr gebraucht hat. Wie hieß Gertrud eigentlich, es war so ein gewöhnlicher deutscher Name wie sein eigener, ein Lehmann steht auch auf dieser Tafel, Leo muss lachen, als er das sieht. Doch die meisten Familiennamen hier klingen nicht gerade germanisch: Alinovic, Balov, Bekur, Ramafan, Karakoglu, Salaman. Gertruds Wohnung war ganz oben, in der vierten Etage. In dem obersten Kästchen steht ein deutscher Name: Romberg. Gertrud hieß Romberg.
2
LAILA hat, wenn sie vom U-Bahnhof hochkommt, das Gefühl, gleich zu Hause zu sein. Das war vorher nie so gewesen, in der Greifswalder Straße war sie nicht zu Hause und nicht in Wilmersdorf bei ihrer Mutter und Stachlingo, nicht in Prenzlauer Berg mit Jonas oder bei seinen Eltern in Bruchmühle, auch nicht in Hamburg und eigentlich auch nicht in Chrzanów. Sie gehörte niemals ganz dorthin, wo sie war.
Vielleicht hat es lange davor eine Zeit gegeben, in der es anders war, manchmal träumt Laila von dieser weit zurückliegenden Zeit. Schon als Kind stellte sie sich manchmal vor dem Einschlafen einen Abend an einem Seeufer vor, da sitzen sie alle um ein Feuer, Frana hält sie fest im Arm, es ist warm dort auf dem Schoß, und sie ist geborgen in der Welt, um sie herum sind die anderen, zu denen sie gehört, und wenn sie aufwacht, liegt sie im Wagen, der schaukelt so beruhigend, und die Pferde schnaufen und wiehern. Aber die Pferde wurden ihnen 1964 weggenommen und die Wagen zerstört, das war der Wielki Postoj, der große Halt. Danach war ihnen das Reisen verboten. Ihre Großmutter Frana und ihr Vater Joschko haben es ihr erzählt. Laila war gar nicht dabei, sie war noch nicht geboren in dieser Zeit, an die sie sich doch erinnert wie an einen Traum, dessen Bilder in manchen Momenten unscharf sind, in anderen wieder ganz deutlich, dessen Zusammenhang sie aber nie ganz verstanden hat. Joschko, ihr wunderbarer Vater Joschko, der nur vierundvierzig Jahre alt wurde, war gerade siebzehn, als die Polen die Wagen verbrannten, er hat es ihr so oft erzählt, dass sie vor sich sieht, wie die Miliz das Winterlager bei Chrzanów umstellte und alle aufs Revier mitgenommen wurden. Die Gesetze waren so, man musste an einem Ort bleiben, eine polizeiliche Meldeadresse vorweisen. Aber wie die Gesetze ausgelegt wurden, entschieden die Milizionäre. In Chrzanów mussten die Männer sich auf dem Revier nackt ausziehen und verspotten lassen. Auch die Frauen und Kinder hielt man fest, und als sie wieder gehen durften, war ihr Lagerplatz nur noch verbrannte Erde, alles verkohlt, was sie besessen hatten. Wo die Pferde geblieben sind, weiß kein Mensch. Die Wagen waren nur noch schwarze Balken, die Eisenteile hatten sich schon die Polen geholt. Es waren einfache, selbst gebaute Planwagen, sagte Joschko. Die schönen, die buntbemalten aus der Zeit vor dem Krieg, waren schon lange verloren. Joschko war erst 1947 geboren worden, die Eltern seines Vaters Willi haben vor dem Porajmos in Berlin gelebt und gar keinen Wohnwagen besessen. Der Wagen, den man ihrer Familie im Lager Marzahn zugewiesen hatte, gehörte ihnen nicht und verbrannte bald bei einem Bombenangriff. Trotzdem beschrieb Joschko auch die bunten Wagen mit den geschnitzten Aufsätzen, als habe er sie selbst gesehen. Laila fühlt sich ja auch so, als sei sie selbst in den Planwagen über die Landstraßen geschaukelt.
Ihre Mutter Flora spricht nicht über Dinge, die sie nicht gesehen hat, sie spricht nicht einmal gern über das, was sie selbst erlebt hat, über den Wielki Postoj möchte sie schon gar nicht sprechen. Auch nicht über das schlimme Jahr 1981 und niemals über das Jahr 1991. Dabei hat auch sie die Reste der verbrannten Planwagen gesehen, sie war 1964 neun Jahre alt und erinnert sich gut, wie die ganze Kumpania von dem Polizeigefängnis in Chrzanów zu dem verkohlten Platz zurückkam und die Milizionäre ihnen befahlen, sich in den lange schon leerstehenden Baracken am Stadtrand anzusiedeln, in denen Ratten hausten.
Wenn Joschko mit den alten Geschichten anfing, seufzte Flora nur und bedeutete ihm, Ruhe zu geben, das Vergangene sei vergangen. Sie erinnere sich gut, wie sie als Kind gefroren habe im Planwagen und wie ihre Augen dauernd tränten vom Rauch des Feuers, wie ihre Tränen sich mit dem ewigen Rotz vermischten. An den Flussufern hätten die Mücken sie beinahe aufgefressen. Nichts sei gut gewesen an der Zeit des Herumreisens, jetzt aber sei das alles vergangen, vorbei. Dann stritten sie manchmal, denn für Joschko war nichts von dem, was geschehen war, vergangen. Nicht das Schöne, schon gar nicht das Schlimme. Es könne sich immer wiederholen, sagte er. Und dann kam es auch so.
Laila denkt oft an Joschko, eigentlich immer. Sie war sechzehn, als ihr Vater ihnen tot gebracht wurde und Flora nun für immer mit ihr nach Deutschland ging, diesmal nach Berlin.
Als sie das erste Mal nach Deutschland kamen, war Laila erst sechs gewesen. Sie hatte im Zug neben ihrer Mutter Flora und der Großmutter Frana auf Joschkos Schoß gesessen und sich gefreut. Nach Hamburg wollten sie damals, zum Großvater Willi und zu Joschkos Brüdern, Lailas Onkeln.
In ihrem Kopf vermischen sich diese Bilder oft. Sie weiß manchmal nicht mehr, was sie selbst erlebt hat und was die anderen ihr erzählten, auch die Jahreszahlen gehen durcheinander. Aber dass ihr Vater Joschko wegwollte aus Polen, nach Deutschland, das weiß sie genau, obwohl sie damals ein kleines Kind war. Auch Joschkos Mutter Frana, die mit ihnen in der Baracke wohnte und mit den anderen Frauen Körbe flocht, erzählte bei ihrer Arbeit von diesem deutschen Wunderland, in dem ihre halbe Familie in schönen Wohnungen in einem Hochhaus wohnte, mit Badezimmern und heißem Wasser aus der Leitung. Zwei ihrer Kinder und ihr Mann lebten in Deutschland, seit zweiundzwanzig Jahren hatte Frana sie nicht gesehen. Warum, das war eine andere dieser alten Geschichten. Joschko erzählte manchmal davon, Frana nie. Aber Frana stellte in Chrzanów überall Fotos ihrer fernen Söhne auf, die hatten selbst schon Kinder. Zu ihnen wollte sie, obwohl es Gerüchte gab, ihr Mann Willi habe längst eine neue Frau.
»Warum ausgerechnet nach Deutschland?«, fragten die Nachbarn aus der Baracke. »In Hamburg gibt es seit langer, langer Zeit keine Pogrome mehr«, meinte Frana. Laila kannte das Wort Pogrom damals nicht, aber sie verstand, was gemeint war.
Ihre Mutter Flora wäre lieber in Polen geblieben, auch dann noch, als 1981 in Chrzanów und anderswo die Häuser der Roma brannten, nicht nur die auffälligen Villen mancher Pferdehändler und Kaufleute, sondern auch Baracken wie ihre, von der es hieß, sie wäre einst für eine Außenstelle von Auschwitz errichtet worden. Auschwitz war das Lager, aus dem sie alle kamen, auch wenn sie erst danach geboren waren. Auschwitz war der Ort, der selten genannt wurde und von dem doch jede Geschichte handelte, auch wenn sie ganz woanders stattfand, auch wenn die Schreckensorte JędrzejÓw, Krakau, Groß Rosen oder Siedlce hießen. Trotzdem wollte Flora nicht weg, nicht einmal, als Laila, die gerade zur Schule gekommen war, dort als Schwarze beschimpft wurde. Dabei ist ihre Haut ganz hell und ihr Haar auch nicht schwarz, nicht einmal ihre Augen, die sind grün. Die anderen zogen sie an den Zöpfen und bespuckten sie. »So ist es immer gewesen, und so wird es bleiben für uns. Sei froh, dass du lernen kannst«, sagte Flora nur und wischte ihrer Tochter die Tränen ab. »Aus Deutschland ist der Porajmos gekommen, dort kann es nicht gut für uns sein.«
Aber dann prügelte sich ein Sinto aus der Baracke mit einem Polen, und die polnischen Nachbarn bildeten ein Bürgerkomitee und verlangten, die Zigeuner sollten endlich verschwinden. Der Holzschuppen an der Baracke brannte, den konnten sie gerade noch löschen, aber im Fluss Soła schwamm Joschkos alter Fiat, den er doch für seine Arbeit brauchte, und Laila ging nicht mehr zur Schule, Flora verbot es ihr. An einem Tag im Dezember fuhr der Holzhändler Mitko sie mit seinem Fuhrwerk nach Trzebinia, dort stiegen sie um in den Regionalzug nach Katowice, von wo sie nach Berlin fuhren, zum Zug nach Hamburg. Es war der Tag, an dem in Polen der Kriegszustand ausgerufen wurde; nicht wegen des Pogroms, wegen der Gewerkschaft Solidarność war das Land in Aufruhr. Das alles verstand Laila damals nicht, sie verstand nur KRIEG und war froh, dass sie wegfuhren. Fast alle Sinti-Familien aus Chrzanów verließen die Stadt, sogar die, die es geschafft hatten, aus den Baracken in bessere Wohnungen zu ziehen, sogar die, die sich Villen gebaut hatten. Die meisten fuhren in Richtung Ostsee, um mit dem Schiff nach Schweden zu kommen. Man hatte ihnen die polnische Staatsbürgerschaft aberkannt, behauptete, sie seien nie Polen gewesen. »Wie im Jahr 1959, als sie uns plötzlich wieder zu Deutschen erklärten und wir ausreisen mussten und ich in Büchen von meinem Mann getrennt wurde«, hatte Frana seufzend zu ihrer Enkelin gesagt. »Dein Vater war damals erst zwölf.« Jetzt war er vierunddreißig und wollte um nichts in der Welt in Polen bleiben. Doch dann war er es, der acht Jahre später zurückwollte, unbedingt.
Das war im Sommer 1989, die Kommunisten hatten in Polen die Wahlen verloren. Laila war vierzehn, sie liebte den Blick aus dem Fenster des Hochhauses in Hamburg-Wilhelmsburg über die Dächer, obwohl in dem Haus ständig der Fahrstuhl kaputt war und das Treppenhaus nach Pisse roch und nach den undichten Müllschluckern. Sie ging gern zur Schule, und ihr war ein Platz im Blauen Gymnasium von Wilhelmsburg zugesagt. Nachmittags war sie oft in die Buchhandlung im Reiterstiegviertel gegangen und dem Buchhändler aufgefallen, weil sie so lange in den Reclamheften blätterte, bevor sie manchmal eines kaufte. Es stellte sich heraus, dass er der Mann ihrer Musiklehrerin war. Beide rieten ihr, sich fürs Abitur zu bewerben, und erklärten ihr, was zu tun war. Keiner nannte sie in Hamburg Zigeunerin, sie war höchstens eine Polin für die anderen, das war auch nicht gut, aber besser. Die deutsche Sprache hatte sie so schnell gelernt, dass man keinen Akzent mehr hörte. Auch Frana sprach so gut Deutsch, sie und der Großvater Willi waren ja aus Berlin. Dass ihre Großmutter als Wahrsagerin auf Jahrmärkten und Volksfesten arbeitete, sagte Laila keinem. Sie glaubte auch nicht, dass Frana wirklich die Zukunft voraussagen konnte. Aber sie war klug und sah den Menschen an, worauf sie hofften, wovor sie sich fürchteten und auch, wofür man sie fürchten musste. Das habe sie schon früh in all den Lagern gelernt, sagte sie, sonst hätte sie nicht überlebt.
Willi hatte sie schon im Lager Marzahn getroffen, dann wieder in Auschwitz-Birkenau, er hatte ihr von seinem Brot abgegeben, und deshalb blieb er für alle Zeiten ihr Mann, trotz allem. In Hamburg war sie zu ihm in das Hochhaus gegangen, hatte die andere Frau, eine Gadschi, aus der Wohnung vertrieben und Willi gepflegt, der zwei Jahre später am Lungenkrebs starb. Laila saß gern am Küchentisch bei Willi und Frana, die zusammen lebten, als seien sie nie getrennt gewesen. Willi schaute sie oft lange an und sagte, sie sehe aus wie seine Mutter Martha, die habe auch so grüne Augen gehabt und so schönes Haar. Nach seinem Tod begann Frana, kleine Kuchen auf Märkten zu verkaufen, bis ihre Schwiegertochter, die aus einer Schaustellerfamilie kam, ihr vorschlug, als Wahrsagerin Geld zu verdienen. Franas Söhne Moro und Joschko bauten ihr aus bunten Brettern eine transportable Bude. Die Kuchenbäckerei übernahm Flora. Flora wollte nun nicht mehr zurück nach Polen, obwohl sie doch gar nicht nach Hamburg gewollt hatte. 1989 sträubte sie sich gegen die Rückkehr. Wie Joschko es versprochen hatte, lebten sie jetzt in einer Wohnung mit Badezimmer und Fernheizung, was sollte sie in diesem Nest, so nahe bei Auschwitz? Auch Laila zog es nicht nach Chrzanów. »Aber Polen ist jetzt ein anderes Land«, sagte ihr Vater immer wieder. Eine andere Zeit habe begonnen, nicht nur für die Deutschen, die gerade die Mauer zwischen sich niederrissen, auch in Polen sei jetzt die Freiheit für alle angebrochen. »Unsere Leute können jetzt studieren«, behauptete er, als Laila vom Blauen Gymnasium sprach. Dabei waren es nur drei polnische Roma, die es auf eine Universität geschafft hatten, einer aber war aus Chrzanów. Joschko kannte ihn und wollte unbedingt in dieses andere Polen.
Vielleicht wollte er auch einfach weg aus Deutschland, wo er keine Arbeit fand, nicht mal auf dem Schrottplatz, weil er nichts mehr heben konnte und Blut spuckte. Wie sein Vater Willi, wie alle Männer aus der Kumpania, die vor dem Wielki Postoj, als sie noch herumreisen durften, Töpfe und Pfannen der Polen repariert hatten. Das hatten die Kalderaschi ihnen beigebracht, die wie die Sinti die Zigeunerlager überlebt hatten und nicht zurückkehren wollten oder konnten ins Burgenland. Die Kalderaschi hatten schon immer als Kesselflicker gearbeitet, aber früher, in der Zeit der schön geschmückten Wagen, besaßen sie besondere Werkzeuge, Geräte und Filter. Nach dem Porajmos arbeiteten sie ohne Filter vor dem Gesicht, atmeten die giftigen Dämpfe von Zink und Säure ein und wurden einer nach dem anderen krank. Joschko hatte als kleiner Junge zugesehen, wenn die Männer überm Feuer die Kessel reparierten, sie brauchten Wasser und Sand für ihre Arbeit, die trug er in Eimern herbei, doch sie riefen: »Dja tuke, dja tuke!« Geh weg, geh weg. Joschko hat das oft seiner Tochter erzählt, manchmal mit Tränen in den Augen. »Sie haben gewusst, wie gefährlich ihre Arbeit ohne die Filter ist, aber das war nun mal ihr Handwerk, sie hatten es gelernt und nichts anderes. Dja tuke, dja tuke, sie wollten mich schützen. Mein Vater Willi wollte mich schützen, und meine Onkel Sohni und Florian und Roman wollten mich schützen, dabei haben sie doch alle selbst dieses Gift eingeatmet und sind einer nach dem anderen daran gestorben, als sie schon in Deutschland und Schweden waren.« Joschko, der sich nicht an die Warnungen gehalten hatte, der zu nahe ans Feuer gegangen war, wäre wohl auch bald daran gestorben, aber er wollte nach Polen zurück, wo die Solidarność nicht mehr verboten war, und dort haben sie ihn erschlagen, einfach erschlagen im Jahr 1991. Laila war sechzehn, und wenn sie bis dahin nicht gewusst hätte, was ein Pogrom ist, nun erfuhr sie es.
Laila Fidler, die am Nauener Platz in Berlin-Wedding die U-Bahntreppe hochsteigt, eine schmale Frau von vierzig Jahren, bleibt auf dem Absatz stehen und schüttelt sich, schüttelt ihr dunkelblondes Haar, ihr ganzer Körper bebt, als müsse sie etwas von sich werfen. Sie lehnt sich an das Geländer; immer wieder geschieht es, dass diese Erinnerungen sie überschwemmen, dabei lebt sie jetzt seit vierundzwanzig Jahren in Berlin, das alles ist Vergangenheit. Aber die ist nicht vorbei, Joschko hat es gewusst.
»Ist Ihnen nicht gut? Kann ich Ihnen helfen?« Eine ältere Frau mit Kopftuch berührt sie am Arm.
Laila reißt sich aus ihren Gedanken, lächelt die Frau beruhigend an. »Danke, es geht schon.« Das hat sie hier schon oft erlebt, die Menschen achten aufeinander wie in einem Dorf.
Oben auf der Straße dreht sich die Frau noch einmal nach ihr um, winkt. Die jungen Araber, die hier immer vor dem Wettbüro standen, sind verschwunden, verticken ihre Drogen jetzt anderswo. Dafür stehen Zivilpolizisten auffällig unauffällig herum und mustern die Vorbeikommenden. Diese Polizisten, von denen einige wahrscheinlich selbst Einwandererkinder sind, nicht viel älter als die Jungen, die bis vor ein paar Wochen hier herumlungerten, tragen ebensolche Jacken und neonfarbene Turnschuhe wie die Dealer, ihre Körper sind ebenso fitnessgestählt, aber ihr Blick ist anders. Gelassen, irgendwie zufrieden mit sich. Sie haben einen Job, sie sind wichtig. Auch die jungen Drogenhändler haben aufmerksam auf die Menschen geschaut, die vom U-Bahnhof hochkamen, auch ihre Mienen schienen herausfordernd selbstbewusst, beinahe aggressiv, aber dahinter lag etwas wie Angst auf der Lauer, eine wirre Trostlosigkeit, die Laila kennt und die sie, gegen alle Vernunft, mit diesen Jungen verband.
Sie geht vorbei an dem Internetcafé an der Ecke, das kein Café ist, sondern ein nach Zigarettenrauch stinkender Raum, in dem neben Tabak und Getränken auch gebrauchte Handys ohne Papiere verkauft werden. Als Laila gerade in den Wedding gezogen war und es noch keinen Internetanschluss in ihrer Wohnung gab, kam sie trotz des abgestandenen Geruchs und der schmierigen Tastaturen täglich hierher, um Roberts Mails zu lesen. Damals hatte er die Stelle an der Universität in Montana angetreten, und sie wartete auf seine Briefe, um die Sehnsucht zu spüren, nicht seine, derer war sie sicher, sondern ihre eigene, von der sie nicht wusste, ob sie überhaupt ihm galt. Von der jungen Türkin an der Kasse, Schwester oder Freundin des Inhabers, der fast immer an einem der alten Computer selbstvergessen spielte, ließ sie sich einmal eine Rechnung für Ausdrucke geben. 14,85 € hatte sie zu bezahlen, die junge Frau schrieb die Zahlen und malte die Buchstaben, vor Anstrengung schob sich ihre Zungenspitze zwischen die Lippen. Laila las dann auf der Quittung: fürsenfumfunachsich. Scham stieg jäh in ihr hoch, und sie zerknüllte den Zettel in der Manteltasche. Im Hinausgehen begriff sie, dass der Zettel sie an ihre Mutter Flora erinnerte, die bis heute nicht richtig schreiben und lesen kann, weder Polnisch noch Deutsch, auch nicht Romanes, und dies geschickt verbirgt. Aber es war Flora immer wichtig gewesen, dass ihre Tochter lernte und studierte.
Neben dem Internetcafé gibt es ein Automatencasino, bis vor kurzem war hier ein Zeitungsladen. Laila erinnert sich gut an den alten Besitzer mit den schlauen Äuglein, der in ihren ersten Weddinger Tagen hier Zeitungen verkaufte, sie musterte und mit unverhohlener Neugier fragte: »Wo kommse denn her? Ihnen hab ick ja hier noch ja nich jesehn.«
»Ich bin gerade in die Utrechter Straße gezogen.«
»Und vorher, wo ham Se davor jewohnt?«
»In Wilmersdorf.«
»Wat denn, in Wilmersdorf?! Und da kommse zu uns inn Wedding? Wieso denn dit?«
»Es gefällt mir hier«, hatte sie geantwortet, obwohl das damals nicht stimmte.
»Na, denn ham Se aber hier noch keene Razzia erlebt.«
Und als sie schwieg, fuhr er fort: »Wissen Se überhaupt, wo Se hier jelandet sind? Im Kernjebiet vom Waffenhandel. Hier könnse allet koofen, Kalaschnikows, Handgranaten, bloß keenen Panzer.«
Ein älterer Mann mit Schnauzbart und breiten Hosenträgern über dem Bauch war eingetreten, hatte die letzten Sätze gehört und ergänzte feixend: »Panzer kann se ooch kriegen. Muss se bloß länger warten. Det andre jeht sofort, gegen cash.«
Der Verkäufer wandte sich an den Mann mit den Hosenträgern. »Ausm feinen Wilmersdorf is det Mädel inne Utrechter jekommen. Der jefällt et hier, sacht se.«
Er beugte sich über den Ladentisch, winkte sie näher an sich heran und flüsterte fast: »Ham Se doch och jelesen, det beim Bund so ville Sturmjewehre wegjekommen sind. Simsalabim, weg warn se, hier sind se wieda uffjetaucht.«




























