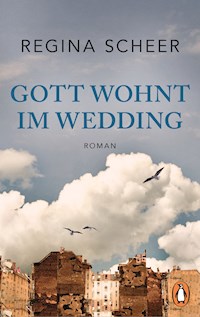12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein wunderbares Buch. Eine Historie unserer Zeit." Christoph Hein
Regina Scheer spannt in ihrem beeindruckenden Roman den Bogen von den 30er Jahren über den Zweiten Weltkrieg bis zum Fall der Mauer und in die Gegenwart. Sie erzählt von den Anfängen der DDR, als die von Faschismus und Stalinismus geschwächten linken Kräfte hier das bessere Deutschland schaffen wollten, von Erstarrung und Enttäuschung, von dem hoffnungsvollen Aufbruch Ende der 80er Jahre und von zerplatzten Lebensträumen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 741
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Regina Scheer
MACHANDEL
Roman
Alles ist wahr, aber so war es nicht. Die Orte und Geschehnisse, bis auf historisch verbürgte, sind fiktiv. Auch die Personen sind erfunden, obwohl manche reale Namen tragen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2014 beim Albrecht Knaus Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagmotive: © Getty Images / Neo Vision, amana images; PhilipYb Studio, DutchScenery /Shutterstock
Satz aus der Stempel Garamond von Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-14315-2V005
www.penguin.de
Für Roger Nastoll
(1944–1990)
Inhalt
1 CLARA – Abschied
2 NATALJA – Die Seidenbluse
3 CLARA – Das Gedächtnis der Glockenblumen
4 HANS – Todesmarsch
5 CLARA – Das Fotoalbum
6 NATALJA – Die Fremde
7 CLARA – Das Schweigen
8 HERBERT – Kadetten
9 CLARA – Tanzende Mädchen
10 NATALJA – Als käme ein schweres Gewitter
11 CLARA – Kriechwacholder
12 EMMA – Das achte Kind
13 CLARA – Auch deine Wunde, Rosa
14 HANS – Verraten
15 CLARA – Ins Exil
16 NATALJA – Budj silnoi
17 CLARA – Eiserne Ringe
18 EMMA – Trauben und Salz
19 CLARA – Mit einem Spalt darin
20 HANS – Stummsein meine Verdammnis
21 CLARA – Grigoris Rückkehr
22 HERBERT – Das Erbe
23 CLARA – Die Auferstehung der Vogelmänner
24 HERBERT – Glühendes Holz
25 CLARA – Aufbruch
Die wichtigsten Personen
Danksagung
1 CLARA Abschied
Heute Vormittag bin ich über die abgeernteten Felder zur Kirche von Klabow gelaufen, die Hotelbesitzer haben den alten Holzengel mit dem pausbäckigen Gesicht restaurieren lassen, und ich wollte ihn mir ansehen. Emma hat immer behauptet, so wie der Engel hätten ihre Kinder ausgesehen, als sie klein waren. Der abblätternde Goldanstrich ist entfernt worden, die Holzfigur hat ihre Bemalung mit Pflanzenfarben zurückbekommen. Die Wurmlöcher hat der Restaurator versiegelt, nun sieht der Engel aus, wie er vor zweihundert Jahren ausgesehen haben mag, dick und rotbäckig, vergnügt auf den ersten Blick, aber dann sieht man die aufgerissenen Augen, den wie zum Schrei geöffneten kleinen Mund und fragt sich: Was hat der Engel gesehen? Was ist ihm geschehen?
In der Kirche bin ich die Holztreppe mit dem brüchigen Geländer hochgestiegen, habe wie oft schon aus den winzigen Turmfenstern über das wellige Land geblickt. Die neuen Windräder an der Straße nach Güstrow verändern die Landschaft. Die waren noch nicht da, als wir hierherkamen, vor fünfundzwanzig Jahren.
Die Hügelgräber kann man von dort oben nicht sehen, aber auch wenn man vor ihnen steht, erkennt man sie nur, wenn man weiß, dass sie zu dieser Landschaft gehören. Sonst sieht man nur Steinhaufen. Von oben ahnt man sie unter den baumbewachsenen Inseln inmitten der Felder und Weiden, aber manchmal verdecken die Büsche und Bäume auch nur eines der Wasserlöcher, die sie hier Augen nennen. Manche der Hügelgräber liegen versteckt in den Wäldern, die es vielleicht noch nicht gab, als vor mehr als tausend Jahren in dieser Gegend die Obodriten gesiedelt haben, Slawen, die die Göttermutter Baba verehrten. Zwischen den Hügeln liegen wie von Riesen hingeworfene einzelne Steine, Findlinge, man weiß nicht, liegen sie schon seit der Eiszeit so da, sind sie Reste von Obodritengräbern oder haben die Germanen sie an ihre Plätze gerollt. Oder der Landschaftsgärtner der Gutsfamilie.
Auf dem Rückweg ins Dorf ging ich ein Stück über die Weiden, an Findlingen vorbei, die mir vertraut geworden sind wie so viele Zeichen in dieser Landschaft. Von oben sahen sie nicht besonders groß aus, aber manche sind größer als ich. Zu Hause habe ich ein Foto, da trägt Michael unsere kleine Tochter Caroline auf der Schulter, und sie berührt den glatt polierten Stein, vor dem ich jetzt stand. Die Kinder nannten ihn Alter Mann. Caroline war zwei oder drei damals, heute ist sie Mitte zwanzig, so alt, wie ich damals war. Bevor ich zur Wegscheide nach Mamerow kam, sah ich noch mehr solcher glatten Steine, auch zerklüftete und aufgesprungene, aus denen etwas wie erstarrte Lava quillt. Wenn man näher an sie herantritt, löst das Steingrau sich auf in unzählige Farbschattierungen, man erkennt bunte Einsprengsel, manche Findlinge sind wie aus bunten Streifen zusammengesetzt, die wieder grau wirken, wenn man weitergeht.
In einem Bogen lief ich über die Weiden zurück zur Kastanienallee, noch immer habe ich mich nicht daran gewöhnt, dass der alte Kirchweg nun asphaltiert ist und dass schnelle Autos mich überholen. Zum Glück haben sie den Parkplatz des Hotels außerhalb des Dorfes angelegt, gleich neben dem Golfplatz, der früher Schmökenwiese genannt wurde.
Früher. Ich bin schon wie die alten Frauen, die in dem Dorf wohnten, als wir hierherkamen; sie lebten mit Menschen, die nicht mehr da waren, das längst Vergangene gehörte zu ihrer Gegenwart. So geht es mir auch, wenn ich an meinen Katen denke, ein schönes Haus mit einem Badezimmer und großen grünen Kachelöfen, die geölten Fenster aus Lärchenholz, das Fachwerk innen und außen mit Lehm verputzt. Ich sehe noch immer das zugewachsene Haus, das mir vom ersten Moment an gefiel, in dem der Wind durch die Ritzen pfiff, dessen Fenster mit Brettern vernagelt waren. Für mich toben noch immer meine Töchter als kleine Mädchen durch den Garten, und wenn ich in der Abenddämmerung durchs Dorf gehe, sehe ich Natalja, die Russin, auf der Schlosstreppe stehen, die alte Auguste hinter den Fenstern des Inspektorhauses. Aber Auguste, außer ihrem Schwager Richard die Einzige von den Alten, die noch lebt, wohnt in Basedow in einem Pflegeheim, ich habe sie einmal besucht, aber sie erkannte mich nicht. Ihr Name ist schon auf dem Grabstein des alten Wilhelm eingraviert, nur das Sterbedatum fehlt noch.
Ich hätte statt zu den Findlingen auf den Waldfriedhof vor Klabow gehen können. Aber dort war ich oft, gleich im ersten Sommer habe ich das Grab meiner Großmutter gesucht, sie hat dort einen Stein, der war schon damals verwittert und von Efeu überwuchert. Immergrün wuchs lila blühend bis auf den Weg. Das Immergrün hatte Natalja gepflanzt, die pflegte auch die namenlosen Gräber an der Friedhofsmauer, die Russen und der erschlagene Pole sollen dort liegen. Und deutsche Flüchtlinge, die 1945 bald nach ihrer Ankunft im Schloss gestorben sind. Natalja hatte Feldsteine gesammelt und um die Gräber gelegt. Jetzt hat sie dicht daneben unter Sonnenblumen selbst ein Grab. Ihre Tochter Lena hat ihr einen schönen Granitstein setzen lassen, der seit Ewigkeiten im Düstersee im flachen Wasser lag. Natalja aus Smolensk liegt dort auf dem Waldfriedhof vor Klabow, als müsste das so sein, neben Wilhelm und Emma und all den anderen Nachbarn.
Und der alte Wilhelm liegt nur ein paar Meter entfernt von dem erschlagenen Polen, der ihn gehasst hat. Aber es gibt keinen mehr, der sich erinnern könnte, dass da ein Pole liegt und dass es der kleine Josef war. Die Namen der toten Russen kannte sowieso niemand, außer vielleicht Natalja, und das Grab wurde nicht einmal in den Friedhofsbüchern eingetragen, vor ein paar Jahren habe ich danach gesucht. Im Kirchenbuch gibt es eine Eintragung über drei unbekannte und zwei bekannte Kriegsopfer, Sowjetbürger, die im September 1949 auf den sowjetischen Ehrenfriedhof nach Lalenhagen überführt wurden. Aber der alte Pfarrer, der vor fünf Jahren zu Emmas Beerdigung aus Ratzeburg, wo er jetzt lebt, gekommen war, hatte mir beim Kaffeetrinken erzählt, er wisse, in Lalenhagen lägen nicht nur Soldaten der Roten Armee. Dort am Bahnhof wurden Deutsche begraben, Flüchtlinge, die im Barackenlager an Typhus starben, und Tote aus den überfüllten Zügen, die von Tieffliegern beschossen wurden. Auch Soldaten kamen in dieses Massengrab, russische und deutsche, man machte im Mai 1945 keinen Unterschied, es war plötzlich heiß geworden und die Toten mussten unter die Erde. Drei, vier Jahre nach Kriegsende sei dann der Befehl gekommen, die auf den Dörfern beigesetzten sowjetischen Soldaten und Ostarbeiter zu exhumieren und auf den zentralen Ehrenfriedhof nach Lalenhagen zu überführen. Man hat auch in Klabow die alten Gräber geöffnet, aber kein Friedhofsarbeiter war bereit, die Überreste anzurühren. Nur die beiden Russen, die im Mai 1945 im Buchenwald am Wieversbarg auf eine Tellermine getreten waren, hatten einen Sarg. Deren Namen kannte man noch. Der alte Pfarrer erzählte, er habe es damals auf sich genommen, für die anderen Toten mit Sand gefüllte Kisten nach Lalenhagen überführen zu lassen, wo ein Ehrenmal mit rotem Stern errichtet wurde, als lägen da nur Russen.
Sie sagen hier Russen zu allen sowjetischen Soldaten, obwohl, wie der Pfarrer sich erinnerte, bei den Einheiten, die 1945 in diese Gegend kamen, auch Georgier und Mongolen mit Schlitzaugen waren. Vielleicht waren es auch keine Mongolen, sie nennen hier alle Asiaten Mongolen. Oder Fidschis.
Es hat lange gedauert, bis ich verstand, was sich hinter der Sprache der Leute hier verbarg. Ihr Plattdeutsch konnte ich verstehen, das hatte ich im Seminar gelernt. Aber ich brauchte lange, bis ich ihr Schweigen entschlüsseln konnte. Für manches hatten sie hier keine Worte und für anderes so viele verschiedene. Sogar der Machandelstrauch, nach dem das Dorf benannt ist, hatte viele Namen. Sie nannten ihn Wacholder oder Knirkbusch, Kranewitter oder Quickholder. Auch Reckholder oder Wachandel habe ich gehört, Weckhalter oder Kronabit, der alte Pfarrer nannte ihn Jochandel. Die Flüchtlinge, die 1945 aus dem Osten ins Dorf kamen, brachten ihre eigenen Worte mit für das, was sie hier vorfanden. Die Wolhynier haben den Machandel Räucherstrauch genannt, manchmal auch Feuerbaum. Der alte Wilhelm nannte ihn Kaddig.
Die heute hier wohnen, reden anders. Die Geschäftsführer des Hotels, zu dem das Gutshaus geworden ist, sprechen bemüht Hochdeutsch, aber man hört den schwäbischen Klang sogar, wenn sie mit den Hotelgästen Englisch reden. Und die Direktrice habe ich einmal das Wort Machandel mit Betonung auf der letzten Silbe sprechen hören, als wäre es eine französische Bezeichnung: Machandelle.
Mir ging so vieles durch den Kopf, als ich heute Vormittag aus der Klabower Kirche kam. Ich weiß nicht, wie lange ich auf dem flachen Findling am Waldrand saß, dem meine Töchter den Namen Junger Mann gegeben haben, im Unterschied zum großen Alten Mann. Wenn ich da sitze, vergesse ich die Zeit und höre nur die Rufe der Vögel und den Wind, und je länger ich ihnen zuhöre, umso deutlicher werden auch die Stimmen von Menschen, die hier gelebt haben.
Seit fünfundzwanzig Jahren gehört Machandel, dieses abgelegene Dorf auf dem Malchiner Lobus der Endmoräne, zu meinem Leben. Vorher war ich nie hier gewesen. Dabei sind meine Eltern sich hier begegnet, und mein Bruder Jan, das wusste ich immer, wurde im Schloss von Machandel geboren. Aber Jan ist vierzehn Jahre älter als ich, und bei meiner Geburt im Jahr 1960 wohnte meine Familie schon lange in Berlin. Unsere Großmutter, die in Machandel geblieben war, starb kurz danach, es gab keinen Grund mehr für einen von uns, in dieses Dorf zu fahren. Dachte ich.
Wenn ich mich an meine Ankunft hier erinnere, spüre ich einen Schmerz, noch nach so vielen Jahren. Es war der letzte Ausflug mit meinem Bruder. Ich weiß noch, wie überrascht ich war, als er mir und Michael vorschlug, gemeinsam in das Dorf seiner Kindheit zu fahren, es läge nur zwei Stunden von Berlin entfernt in nördlicher Richtung.
Da hatte Jan schon all seine Bücher, die selbst gebauten Regale und sein altes Ledersofa verschenkt, seine Stereoanlage stand schon bei uns, alle seine Laufzettel waren abgestempelt. Ein paar Tage nach diesem Ausflug verließ er das Land, mit zwei Koffern und all seinen Kameras. Den Ausreiseantrag hatte er erst wenige Wochen zuvor gestellt. In diesem Sommer gingen so viele, die meisten hatten jahrelang warten müssen. Dass es bei Jan so schnell ging, lag wohl an unserem Vater. Der war zwar längst Rentner, aber immer noch Volkskammerabgeordneter und Mitglied des Antifa-Komitees, und er kannte die Telefonnummern irgendwelcher Männer, die Kurt oder Karl hießen, und manchmal sagte er ihre Decknamen aus der Illegalität, die klangen so ähnlich. Die hatten die Macht, mit ein paar Anrufen alles zu regeln. Aber ich glaube, unser Vater wusste gar nichts von Jans Ausreiseantrag und er hätte ihn auch nicht unterstützt, doch die, die darüber entschieden, wussten, wessen Sohn mein Bruder war. In seinem Beruf hatte er schon lange nicht mehr arbeiten dürfen, den Presseausweis hatten sie ihm abgenommen, seine Fotos wurden nicht mehr gedruckt, ausstellen durfte er nicht. Auch da hätte mein Vater etwas für ihn tun können, aber das wollte er nicht und Jan hätte es auch nicht gewollt.
Auf der Fahrt in das Dorf war Jan noch schweigsamer gewesen als sonst. Er saß am Steuer, obwohl sein vierzehn Jahre alter Trabant schon mir gehörte.
Wir wussten nicht genau, was er in diesem Dorf suchte, dessen Name auf all seinen Ausreisepapieren als Geburtsort stand: Machandel. Er hatte dort bei unserer Großmutter gelebt, bis er zur Schule kam. Aber die war eine Zugezogene gewesen, sie war mit unserer Mutter von weiter her gekommen, aus Ostpreußen. Umsiedler wurden sie genannt, Flüchtlinge, Heimatvertriebene; sie haben im Schloss gewohnt, es waren viele. Ich hatte mir ein Gebäude mit Zinnen und Türmchen vorgestellt, aber dann standen wir vor einem schlichten Gutshaus mit Mittelrisalit und Freitreppe, sehr schön, aber erbärmlich heruntergekommen. Wasserflecken zogen sich über die bröckelnde Fassade. Ich war begeistert von den hohen Sonnenblumen mit großen Köpfen, die überall wuchsen, um das Schloss herum und an den Gartenzäunen, alles wirkte auf mich wie in einem dieser russischen Filme, die man im Studiokino sehen konnte, Abschied von Matjora, Kalina Krasnaja. Alte Frauen mit Kopftüchern machten sich in ihren Vorgärten zu schaffen. Eine schien uns hinter ihrer Gardine zu beobachten. Jan verschwand, ohne ein Wort zu sagen, hinterm Schloss in den Weiten des Parks, Michael und ich spürten, dass er allein sein wollte, und schlenderten Hand in Hand durch das wie verwunschen daliegende Dorf. Schwalben jagten einander über den niedrigen Dächern. Ein Hahn krähte.
Emma sagte später, sie hätte mich schon an diesem ersten Tag gesehen, als wir den grünen Trabant vor dem Schloss parkten und durch das Dorf liefen. Ich trug ein langes Kleid, wie ein Nachthemd, sagte sie. Mich und meinen Mann Michael hatte sie ja noch nie gesehen, aber meinen Bruder Jan erkannte sie sofort. Der sei ja im Dorf aufgewachsen und auch später oft gekommen.
Sie hat beobachtet, wie wir vor dem Katen stehen blieben. Da hatte sie ja selbst jahrelang gelebt, bevor sie in den Neubau gezogen war, ein nüchternes, zweistöckiges Haus, das in den 50er-Jahren mitten im Schlosspark für neun Flüchtlingsfamilien errichtet worden war. Aber das erfuhren wir erst später, wir kannten Emma ja noch nicht an diesem Sommertag im Jahre 1985, und der schäbige Neubau im Park interessierte uns nicht, uns interessierte der Katen. Das Haus schien lange schon unbewohnt, die Fenster waren ohne Glas, eine Tür knarrte bei jedem Luftzug, sie war nur mit einem Draht verschlossen wie ein altes Stalltor. Zwischen den Dielen einer Stube wuchs eine kleine Birke. Wilde Rosenbüsche drängten sich an die Hauswand, später erfuhr ich, wie Emma sie nannte: Kartoffelrosen. Schwere, duftende Zweige hingen durch die Fenster ins Haus. Wir gingen durch die verlassenen Zimmer wie verzaubert, sprangen durch die Fenster in den verwilderten Garten, gingen durch die pendelnde Tür in die nächste Wohnung, drei waren es insgesamt, und schon begannen wir uns vorzustellen, dass wir die Lehmwände einreißen, die Zimmer vergrößern könnten. Wir könnten hier wohnen, in den Sommern wenigstens und an den Wochenenden, wir hatten ja nun ein Auto. Wir wollten nicht wie Jan ausreisen, wir wollten im Land bleiben, aber dieses Haus, das spürten wir, würde unser Zufluchtsort werden, hier würde es das nicht geben, was uns in Berlin oft so wütend und ratlos machte. Ich stellte mir vor, wie unsere Kinder in dem verwilderten Garten spielen würden, und schon in diesen ersten Stunden in Machandel beschlossen wir, alles zu tun, damit das halb zerfallene Haus unseres würde.
Wir gingen Jan suchen und fanden ihn auf der Schlosstreppe neben einer sonderbaren Frau. Bisher hatten wir nur alte Menschen in diesem Dorf gesehen, aber die Frau neben Jan war etwa so alt wie er, noch nicht vierzig. Sie war groß und schlank und Jan schien sie zu kennen. Sie standen beieinander, an das rostige Geländer gelehnt, um das sich wilde Wicken rankten. Jan hielt etwas in der Hand, das ihm die Frau wohl gegeben hatte. Sie schwiegen, aber mir schien eine Vertrautheit in diesem Schweigen zu liegen, die mich erstaunte. Vielleicht hatten sie vorher miteinander geredet, aber als wir kamen, sprachen sie kein Wort. Jan kam uns entgegen, ich sah, wie er das Ding in die Jackentasche steckte. Die Frau warf den Kopf in den Nacken, es war, als würde sie ihren Blick von Jan abziehen, aber sie blieb stehen, ganz ruhig. »Kennst du sie von früher?«, fragte ich meinen Bruder, und er antwortete kurz: »Ja.« Ich war gewohnt, nicht nachzufragen, wenn er in diesem Ton antwortete. Auch mein Vater gibt manchmal solche kurzen Antworten, nach denen es unmöglich ist, weiterzufragen.
Wir zeigten Jan den Katen, unser Haus nannten wir ihn schon. Er sah sich genau um, holte seine kleine Kamera aus der Tasche und fotografierte. Mit einem Griff riss er verklumpte Tapetenschichten von der Wand, kratzte an der Lehmwand darunter und zeigte uns das Stück eines freiliegenden Balkens, die Kerben und Einschnitte. Er wusste, dass der Katen vor hundertfünfzig Jahren als Schafstall gedient hatte und dass Ziegel und Holz aus einem noch älteren Haus geholt worden waren. Aber das ernüchterte uns nicht, wir fanden alles gut, wie es war, und als wir später mit Jan am Waldrand an einem Platz lagen, den er als Kind geliebt hatte, als wir im sattgrünen Gras die Wacholderbüsche, die hier hoch wie Bäume waren, gegen den Mecklenburger Himmel stehen sahen, spürten wir: Hier wollen wir sein.
Wir liefen dann noch zu einem der Seen, doch vor der Abfahrt war Jan wieder verschwunden. Michael und ich gingen ein letztes Mal durch unser Haus, da stand ein alter grauer Mann mit Gehstock im Vorraum, als hätte er uns erwartet. Wo Jan sei, fragte er und gab sich selbst die Antwort: »Bei der Stummen.« Das war Wilhelm Stüwe, ich weiß nicht, ob wir seinen Namen schon an diesem ersten Tag in Machandel erfuhren. Mir fiel der schöne elfenbeinerne Knauf seines Stockes auf. »Wollt ihr das Haus kaufen?«, fragte er und beschrieb uns, wo wir den Bürgermeister Uwe Schaumack finden würden. Das hier sei das älteste Haus des Dorfes. Es sei noch älter als das Gutshaus. Ja, es sei ein Schafstall gewesen, fiel ihm mein Mann ins Wort. Michael hatte manchmal so eine Art, sein Halbwissen auszubreiten. Der Alte betrachtete ihn, wie mir schien, mit leichter Verachtung. Dann wies er auf mein langes helles Kleid und fragte spöttisch, ob ich die Weiße Frau sei, die aus der Sage von Mamerow. Er konnte nicht wissen, dass ich mich für meine Dissertation mit niederdeutschen Sagen beschäftigte. Für mich war das damals ein Forschungsgegenstand, der gehörte in die Räume der Staatsbibliothek, ins Institut, an meinen Arbeitstisch zu Hause, nicht in dieses Dorf. Ich war verwirrt. Mein Mann fragte nach und der Alte erzählte knapp:
In Mamerow, einem der Nachbardörfer, das seinen Namen wohl noch aus der slawischen Zeit habe, spuke eine Weiße Frau auf einem Hof, sie war im Kriege erschossen worden. »In welchem?«, unterbrach mein Mann, doch der Alte lachte nur. Ihre Seele wohne nun in einem Baum, der sei eines Tages gefällt und als Bauholz in einen Schafstall gekommen. Lauernd beobachtete er die Wirkung seiner Worte. »Wurde sie Mahrte genannt?«, fragte ich, denn ich kannte solche Sagen. Der Alte spuckte ein Stück Kautabak auf den mit Moos überwachsenen Dielenboden und wandte sich grinsend zum Gehen. »Mahrte, Spukgeist, Huckup, pottegal. Ik bin keen Spökenkieker.« In der Tür stieß er mit Jan zusammen, und obwohl er kurz zuvor nach ihm gefragt hatte, ging der Alte wortlos an ihm vorbei.
Jan drängte jetzt zum Aufbruch. Unsere Hochstimmung war verflogen, etwas Unheimliches hatte der alte Nachbar in den Räumen zurückgelassen. Am Trabant stand die hochgewachsene Frau, die Stumme, wie der Alte sie genannt hatte. Aber sie sagte leise ein paar Worte zu Jan, sie umarmten sich fest und lange. Ich sah, dass mein Bruder weinte, und bemühte mich, nicht hinzuschauen.
Es war zu spät, noch den Bürgermeister aufzusuchen. Aber wir beschlossen, ihn gleich am nächsten Tag wegen des Hauskaufs anzurufen. Jan hatte im Fahren seine Jacke ausgezogen und mir auf den Schoß gelegt, etwas fiel heraus, wohl das, was die Frau ihm gegeben hatte: Auf den ersten Blick ein gewöhnlicher kleiner Feldstein, aber dann sah ich, das beinahe herzförmige Ding war zur Hälfte überzogen mit einer Kruste aus blauem Glas, die in einem gläsernen Tropfen endete, in der anderen Hälfte gab es einen Riss, aus dem etwas Schwarzes quoll. Während ich den Stein noch betrachtete, griff Jan danach und schob ihn in die Jacke zurück. Er fuhr schweigend, in Gedanken versunken wie schon bei der Hinfahrt, aber als wir uns Berlin näherten, fragte er: »Was hat denn der Alte gewollt?« Ich erzählte ihm von der Sage. Jan kannte sie. »Jeder in den Dörfern um Machandel kennt diese alten Geschichten«, sagte er. »Aber die von der Weißen Frau aus Mamerow geht noch weiter. Die hockt längst nicht mehr in dem Schafstall. Ein paar Knechte mussten sie einfangen und auf den Kirchhof von Klabow tragen. Dort ist sie nun in einem Gewölbe eingemauert. Nach einer anderen Variante sitzt sie nun in einem Machandelbaum. Den Knechten aber war jedes Wort darüber verboten.«
Ich weiß noch, dass ich lange wach lag in der Nacht nach diesem Ausflug. Ich spürte, etwas war geschehen, das unser Leben verändern würde. War es der Abschied von Jan, war es das Haus, das wir gefunden hatten wie etwas, nach dem wir uns immer gesehnt hatten, ohne es zu wissen, oder war es die Sage von der Weißen Frau, die mich bis in den Traum verfolgte? Vielleicht war es auch der Name des Dorfes: Machandel. Das Märchen vom Machandelboom hatten wir in unseren niederdeutschen Seminaren analysiert und interpretiert, niemals war mir dabei das Dorf meines Bruders und meiner unbekannten Großmutter in den Sinn gekommen.
2 NATALJA Die Seidenbluse
Nun liegt mein Grab in Mecklenburg bei den Machandelbäumen und ich bin nie wieder nach Hause gekommen. Ich habe länger in Mecklenburg gelebt als in Smolensk, aber bin doch eine Fremde geblieben unter den Deutschen. Aber ich wäre auch eine Fremde gewesen, wenn ich zurückgekehrt wäre an den Ort, an dem ich geboren bin. Smolensk war so eine schöne Stadt, wir haben Lieder über sie gesungen, sie liegt auf sieben Hügeln und an siebzehn Flüssen. Den Dnjepr hätte ich gern noch einmal gesehen. In der Gegend um Machandel gibt es keine richtigen Flüsse, die Warnow, der Peenestrom, die Nebel sind nur Rinnsale gegen den Dnjepr. Der ist so breit, fast wie ein Meer, und wenn ein Schiff vorbeifährt, schlagen die Wellen ans Ufer wie bei der Meeresbrandung. Man sieht kaum die Menschen auf der anderen Seite, nur die Hügelkette. Wenigstens ist das Land um Machandel hügelig. Manchmal, in den ersten Jahren, bin ich über die Weiden gegangen und habe mir einen Platz zwischen den Hecken gesucht, an dem mich keiner sehen konnte. Dann habe ich den Wolken nachgeschaut und geträumt, ich sei noch ein Kind, ich sei zu Hause, wir hätten einen Ausflug ins Hügelland gemacht und meine Mutter und mein Vater seien bei mir. Meine Mutter war Lehrerin, manchmal, wenn sie mit ihren Schülern einen Ausflug machte, durfte ich mitkommen, auch als ich noch ganz klein war. Einmal saßen wir alle am Rand eines Sonnenblumenfeldes, die Pflanzen waren größer als erwachsene Menschen, es war für mich wie ein Wald, ein Wald aus Sonnenblumen, in den ich hineinlaufen und mich verstecken konnte, aber ich wurde immer gefunden, und es war schön.
In Mecklenburg haben sie Die Russin gesagt, wenn sie über mich sprachen. Aber ich war keine Russin. Bevor ich geboren wurde, gehörte Smolensk eine Zeitlang zu Belarus, ich war Weißrussin wie meine Mutter. Das habe ich ihnen nie gesagt, sie hätten es nicht verstanden. Aber vielleicht irre ich mich, vielleicht war ich in meinen Papieren Russin.
1939 war ich vierzehn und mein Vater und meine Mutter wurden geholt, morgens um drei, sie seien Sowjetfeinde, hieß es. Aber ich weiß, dass sie keine Feinde waren und dass sie an den Kommunismus glaubten. Damals verschwanden viele – Lehrer, Nachbarn, der Vater meines Mitschülers Kolja. So viele Feinde konnte es gar nicht geben. Ich stand im Nachthemd auf dem Korridor, als die Männer meine Eltern wegführten. Was mein Vater gesagt hat, wie er aussah, habe ich vergessen. Ich habe es vergessen und es gibt auch keine Fotos mehr von ihm. Mama hat mich traurig angeschaut mit ihren schönen Augen, ihr Haar, das sie sonst hochgesteckt trug, hing herunter wie bei einem Mädchen. »Budj silnoi«, hat sie gesagt. Nur diese beiden Worte. Ich habe sie mir immer wieder gesagt, mein ganzes Leben lang. Wenn es schwer war, habe ich die Augen geschlossen und Mamas Gesicht gesehen: Sei stark.
Einer der Männer kam dann zurück, sie wollten die Wohnung versiegeln, ich sollte verschwinden. Nicht einmal angezogen habe ich mich, nur einen Mantel über das Nachthemd geworfen, ein paar Kleider zusammengerafft, meine Schultasche. So kam ich zu meinem Tantchen, andere Verwandte hatten wir nicht in Smolensk. Das Tantchen war alt, sie hatte nur ein ärmliches Zimmer in einer Kommunalka, aber sie besaß ein Klavier und spielte abends Stücke von Chopin, bis die Nachbarn an die Wände klopften. Sonntags lief sie in die Kirche und küsste dem Popen die Hand. Sie nahm mich mit, ich sollte beten und um Verzeihung bitten für meine Sünden und die meiner Eltern, dann kämen sie vielleicht zurück. Das Tantchen war nicht klug. Aber sie war ein guter Mensch, sie hat ihr Essen mit mir geteilt, sie hat mir aus ihren Vorhängen und alten Stoffen Kleider genäht, denn ich hatte ja nichts. Und an Feiertagen ging sie mit mir in die Mariä-Entschlafens-Kathedrale, die stand hoch über der Stadt am Steilufer des Dnjepr. Ich habe die goldenen Fresken betrachtet, die Gewölbe, den geschmückten Altar, die schönen Ikonen und gedacht: Das haben Menschen gemacht. Das alles hat sich ein Baumeister ausgedacht, und die Maurer haben die Steine herbeigeschleppt, dann haben andere auf Gerüsten gestanden und diese zarten Blütenblätter gemalt und das Gesicht der Maria, die eine junge Mutter war, die ihr Kind beschützen wollte. Das alles, habe ich gedacht, ist schon viel älter als jeder Mensch auf der Erde und wird noch sein, wenn ich nicht mehr bin.
Und jetzt bin ich tatsächlich nicht mehr und die Mariä-Entschlafens-Kathedrale gibt es wohl noch immer. Und die Sonnenblumenfelder bei Smolensk und die Hügel dort und um Machandel.
Vielleicht wird meine Tochter Lena einmal nach Smolensk fahren und in die Altstadt gehen, sie haben sie ja wieder aufgebaut. Das armselige Alltagskirchlein meiner Tante wird sie nicht mehr finden, aber die Mariä-Entschlafens-Kathedrale unserer Feiertage steht noch. Lange nach dem Krieg war die Zahnärztin aus Teterow mit einer Reisegruppe dort, sie hat mir einen Touristenprospekt mitgebracht, da habe ich die Bilder einer fremden Stadt mit fremden Menschen angeschaut, doch die Mariä-Entschlafens-Kathedrale sah aus wie in meiner Erinnerung. Wenn Lena dort sein wird, wenn sie unter dem goldenen Gewölbe steht, spürt sie vielleicht dasselbe wie ich damals, und unsere Gefühle treffen sich, denn sie haben nichts zu tun mit der Zeit; was man fühlt und denkt, ist in der Welt und vergeht nicht so schnell wie die Menschen. Ich habe auch immer meine Mutter gespürt, als sie längst nicht mehr da war.
Am Tag, als die Deutschen kamen, im Sommer 1941, war meine Abschlussfeier in der Schule. Tantchen hatte mir aus einem alten Seidenkleid eine hellblaue Bluse genäht. Am Nachmittag wollte ich mit meinen Freundinnen zum Flussufer gehen, aber am Nachmittag war schon Krieg.
Ich wollte zur Front, als Soldat oder Sanitäterin, aber ich war erst sechzehn, sie haben mich nicht genommen. Dann war die Front rings um Smolensk, sie war in den Straßen, sie war überall. Wir schliefen in fremden Kellern, in Höhlen am Flussufer. Unser Haus, unsere Straße waren zerschossen. Dann starb die Tante, eine herabstürzende Mauer hat sie erschlagen. Viele starben. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich trauern konnte. Im September feierten die Deutschen ihren Sieg in unserer Stadt, zwei Monate lang hatten die Unseren sie aufgehalten, obwohl die Deutschen dreimal so viele waren und modernere Waffen besaßen. Jetzt war der Weg nach Moskau frei.
Ich hatte die hellblaue Bluse an, als sie mich wegschleppten, es war warm, muss aber schon Anfang Oktober gewesen sein. Ich war unterwegs zum Glinka-Denkmal, zu einem Treffen mit einem Jungen, Kolja. Er war siebzehn, war in meine Schule gegangen. Er war noch kein Soldat, aber bei den Straßenschlachten hatte er gekämpft und war verwundet worden, seine Mutter hatte ihn versteckt und gesund gepflegt. Sie kannte mich, sie hat mich auf der Straße getroffen und mir gesagt, in welcher Ruine sie hausten, ich solle sie besuchen kommen. Das hatte ich ein paarmal getan, Kolja war der Einzige, mit dem ich reden konnte. Sein Vater war verhaftet worden wie meiner. Er hat es mir ganz offen erzählt, ich habe nie über meine Eltern gesprochen. Trotzdem, so bestärkten wir uns gegenseitig, war die Rote Armee unsere, die Deutschen waren unsere Feinde. Er schlug vor, wir sollten uns alleine treffen, ohne seine Mutter. Es war leichtsinnig, weil es kaum noch junge Männer in den Straßen gab. Die Deutschen nahmen sie gefangen, manche wurden gleich erschossen. Trotzdem verabredeten wir uns. Er hatte sich in mich verliebt. Ich war so allein. Ich habe Kolja nicht wiedergesehen, denn ich war es, die aufgegriffen wurde.
Für die Deutschen war ich nicht zu jung, sie haben mich eingefangen wie ein Tier und von der Straße weg in die Sammelstelle gebracht. Vielleicht haben andere sich freiwillig gemeldet, ich nicht.
Von der Sammelstelle mussten wir zum Güterbahnhof laufen, hundertfünfzig Mädchen, eine Herde Vieh mit Bewachern. Manche trugen Rucksäcke und Bündel, ich hatte nichts. Wir kamen an den zerstörten Gebäuden vorbei, am Opernhaus, am Pädagogischen Institut, es war so ein schöner, sonniger Tag im Oktober. Altweibersommer. Aber ich habe nicht aufgeblickt, ich ging neben den anderen und wäre gern unsichtbar gewesen. Meine Seidenbluse war schmutzig, in der Sammelstelle hatten wir auf dem blanken Boden gelegen und uns nicht waschen können. Ich schämte mich für mein Aussehen und hoffte, keiner würde mich sehen. Ich schämte mich auch, weil manche der Frauen neugierig auf Deutschland waren, weil sie sich freuten, im Ausland arbeiten zu können, und weil ich fürchtete, man könnte mich für eine von denen halten. Später habe ich oft an diesen letzten Gang durch Smolensk gedacht und gewünscht, ich wäre nicht so gebeugt gegangen, mit dem Blick nach unten. Ich hätte mich umsehen sollen, vielleicht hätte ich noch Bekannte gesehen, vielleicht Kolja, und oft habe ich im Halbschlaf gedacht, ich hätte den Kopf heben müssen, dann hätte ich am Straßenrand meine Mutter sehen können oder meinen Vater, die Sowjetfeinde, denn es hieß, die Gefängnisse seien geöffnet worden, als die wirklichen Feinde kamen. Aber ich wusste ja nicht einmal, wohin man sie gebracht hatte und ob sie noch lebten, und ich habe niemanden gesehen, als ich zum letzten Mal durch die Straßen meiner Kindheit lief.
Später konnte ich mich kaum an die Reise erinnern. Andere sagten mir, dass wir mit den Güterwagen bis Warschau fuhren und dort zwei Wochen in einem Lager waren. Da haben wir auch Männer gesehen, unsere Jungs, Kriegsgefangene. Sie sahen hungrig aus, verprügelt, sie wurden noch strenger bewacht als wir. Zu uns kamen dann noch Ukrainerinnen, die die Deutschen von den Feldern geholt hatten, die noch ihre Arbeitskittel und verschwitzte Kopftücher trugen. Im Lager bei Warschau konnte ich meine Bluse waschen, daran erinnere ich mich. Plötzlich war es kalt geworden. Mit den Ukrainerinnen und polnischen Frauen müssen wir dann weiter nach Berlin transportiert worden sein. Ich weiß es nicht mehr, vielleicht war ich krank. Aber ich sah später ein Bild vor mir, wie wir in Reihen frierend auf einem Berliner Bahnhof standen, russische Frauen, weißrussische, ukrainische, auch polnische, um weitertransportiert zu werden, in Viehwagen, die an einen gewöhnlichen Zug angehängt wurden. Auf diesem Bahnhof warteten deutsche Reisende auf ihre Abfahrt, Frauen, Männer, auch Kinder. Sie waren so schön, so sauber, die blonden Frauen trugen gewellte Frisuren, sie wirkten glücklich. Und ich sah, mit welchen Blicken sie uns musterten, voller Abscheu und Ekel. Eine Frau zeigte ihrer Tochter die Ukrainerinnen, mit dem Finger wies sie auf die Frauen in den geflickten Arbeitskitteln, auf die Holzschuhe. Das Schlimmste aber war, ich sah es plötzlich selbst, dass wir nicht wie Menschen blickten, sondern wie Tiere, wie gefangene Tiere voller Angst. Ich schaute an mir herunter, ich trug gute Lederschuhe, mein Rock war etwas zerrissen, aber die Bluse, meine hellblaue Bluse von der Abschlussfeier, war noch unversehrt, zwar zerknittert und angeschmutzt, aber es war eine schöne Bluse von elegantem Schnitt. Sie war nicht aus so billigem, dünnem Sommerstoff, der schnell zerreißt, sondern aus festem, gutem Seidenstoff, der Mann der Tante war Eisenbahner in Tschita gewesen und hatte solche Stoffe von der chinesischen Grenze mitgebracht.
Vielleicht war es diese Bluse, die mir das Leben rettete.
In Schwerin, wohin wir gebracht worden waren, wurden wir wieder in ein Durchgangslager getrieben, das war irgendein öffentliches Gebäude, eine Schule oder eine Kaserne mit großen Sälen. Da waren schon Russinnen, die den deutschen Aufsehern halfen. Sie sagten uns, wir sollten sehen, dass wir nicht in eine Munitionsfabrik kämen, das sei gefährlich, da würde man nicht überleben, es gäbe Explosionen und Unfälle. Ich habe mir den Namen der Stadt gemerkt, in die man sich nicht schicken lassen sollte: Torgelow. Besser sei, sagten die russischen Helferinnen, man würde in die Landwirtschaft geschickt, da hätte man genug zu essen. Und am besten sei es, wenn man eine Arbeit bei der Kirche bekäme, auf Friedhöfen.
Aber man hat uns ja nicht gefragt. Wir blieben nur wenige Tage in Schwerin, bekamen zu essen und es gab Waschräume, sogar etwas Seife. Wieder wusch ich meine Bluse und mein Haar. Die Deutschen siegten noch immer, die russischen Dolmetscherinnen erzählten es uns. Am dritten oder vierten Tag wurden wir auf einen Hof getrieben, mussten uns aufstellen wie Soldaten. Männer, manche in Uniform, schritten die Reihen ab, blieben stehen, forderten die Frauen auf, den Mund zu öffnen, ihr Gebiss zu zeigen. Wie bei Pferden, dachte ich. Das waren die Abgesandten der Munitionsfabriken und der Gutshöfe, vielleicht auch der Kirche, die sich ihre Arbeitskräfte aussuchten. Mir schauten sie nicht in den Mund, ich wurde gleich aufgefordert, einem der Männer zu folgen. Drei oder vier Mädchen und ich wurden in einen Raum geführt, in dem eine Frau wartete, eine Dame in Lederstiefeln, nicht mehr jung. Sie musterte uns, eine nach der anderen, an mir blieb ihr Blick hängen. »Das ist doch noch ein Kind«, sagte sie zu dem, der uns gebracht hatte. Sie sprach Deutsch, natürlich sprach sie Deutsch. Ich hatte Deutschunterricht in der Schule, bei uns zu Hause standen viele Bücher in deutscher Sprache, Heinrich Heines Gedicht von dem einsamen Fichtenbaum hatte mir meine Mama schon beigebracht, als ich noch in den Kindergarten ging. Er träumt von einer Palme, / die, fern im Morgenland, / einsam und schweigend trauert / auf brennender Felsenwand. In Smolensk und während der wochenlangen Fahrt in diese Stadt Schwerin hatte ich nicht gezeigt, dass ich die Deutschen verstand. Diese deutsche Sprache um mich herum klang so anders als die, die ich zu Hause gelernt hatte. Sie hatte ganz andere Worte: Todesgefahr. Lebensgefahr. Beides bedeutete dasselbe. Der Tod und das Leben sind gleich für sie, dachte ich. Mir gefiel diese Sprache nicht. Aber jetzt sagte ich wie von selbst: »Ich bin kein Kind, ich bin achtzehn Jahre alt.«
Wenn ich später an diesen Moment dachte, wusste ich nicht, warum ich gelogen hatte, vielleicht wegen der Warnungen der russischen Aufseherinnen, ich wollte versuchen, eine gute Arbeitsstelle zu bekommen. Die Frau kam bestimmt nicht von einer Munitionsfabrik voller Todesgefahr. Erstaunt fragte sie, woher ich Deutsch könne. »Aus der Schule«, antwortete ich. Plötzlich griff sie an meine Bluse, prüfte den Stoff zwischen den Fingern. »Crêpe de Chine«, sagte sie verblüfft, »woher hat die das?« Sie wandte sich an einen Mann in einer Art Jägeruniform, der Gutsverwalter, wie ich später erfuhr. »Sie wirkt sauber«, sagte sie. »Und intelligent. Versuchen wir es.« »Sie scheint nicht besonders kräftig zu sein«, wandte der Gutsverwalter ein, aber die Frau meinte, sie brauche keinen Trampel für die Feldarbeit, sondern ein Mädchen, das Gläser polieren könne und, sie wies auf meine Bluse, feine Wäsche waschen.
Die Blicke der anderen Mädchen, die einfach stehen gelassen wurden, verfolgten uns. Gepäck besaß ich ja nicht, ich wartete am Lagereingang, während die Frau und ihr Verwalter im Büro bei den Uniformierten etwas erledigten, wahrscheinlich unterschrieben sie eine Art Kaufvertrag, denn von nun an, sie haben es mir später oft gesagt, hatte ich nur zu tun, was sie mir sagten, ich sollte den Mund halten und arbeiten.
Ich hatte das schon verstanden, ich kannte ja das Wort dafür: Lebensgefahr. Eine Deutsche aus der Verwaltung des Durchgangslagers übergab mir zwei eckige Stoffstücke mit der Aufschrift OST, die musste ich in Zukunft fest an meiner Kleidung tragen. Und ein Papier auf Russisch gab sie mir, auf dem stand, was ich alles nicht durfte. Der Verwalter war in Zukunft mein Betriebsführer, dem musste ich gehorchen.
Es gab noch einen Wortwechsel meines Betriebsführers mit denen vom Durchgangslager, die wollten, dass ich im Lager bliebe und mit einem Ostarbeitertransport nachgeschickt würde, es ginge nicht, dass ich in einem Automobil mit meinen neuen Dienstherren fahren würde. Aber die Dame setzte sich durch und sie nahmen mich mit wie einen guten Einkauf.
Von den Mädchen im Lager habe ich mich nicht verabschiedet, mit keiner hatte ich mich angefreundet, die ganze Zeit über hatte ich still in der Ecke gehockt und gar nichts gefühlt. Sie zankten sich und weinten viel, manchmal sangen sie auch, dann tat mir das Herz weh. Eine war schon in Berlin verrückt geworden und wollte sich aus dem Fenster stürzen, die war so geschlagen worden, dass sie nicht mehr alleine gehen konnte. Es waren nur noch wenige Mädchen aus Smolensk dabei. Ich habe sie nicht wiedergesehen. Doch Dunja und Anna, Zwillingsschwestern aus Minsk, waren mit mir in Schwerin in dem Durchgangslager. Eine von ihnen arbeitete später in der Mühle in einem Nachbardorf, in Kuhelmies.
So kam ich nach Machandel, auf dem Rücksitz eines Automobils. Die Frau saß vorn neben dem Betriebsführer, sie drehte sich unterwegs manchmal nach mir um, sagte aber nichts. Ich war noch nicht oft mit einem Auto gefahren, schon gar nicht in so einem schönen mit roten Ledersitzen. Wir fuhren etwa zwei Stunden durch flache Landschaften, erst am Schluss wurden sie wellig wie zu Hause. Wir kamen an kleinen Seen vorbei, an weidenden Kühen und Gärten. Die Dörfer sahen so aufgeräumt und sauber aus, so friedlich. Vor Häusern aus rotem Ziegelstein waren Zierbüsche gepflanzt wie in den Parkanlagen von Smolensk. Aber einmal sah ich ein Blumenbeet, das war angelegt wie ein Hakenkreuz. Sonnenblumen sah ich nicht. Die blühen ja nur bis in den Oktober und der war vorbei.
3 CLARA Das Gedächtnis der Glockenblumen
Jan fuhr, glaube ich, über die Brücke an der Bornholmer Straße nach Westberlin. Ich war nicht dabei, habe ihn nicht bis zur Absperrung begleitet, er wollte es nicht. Als ich ein kleines Kind war, hat eine unserer Haushälterinnen ganz in der Nähe gewohnt, von ihrem Fenster in der Finnländischen Straße aus sah man auf die Grenzanlagen. Manchmal war ich in ihrer Wohnung, und von ihr hörte ich den Namen der Brücke: Böse-Brücke. Heute weiß ich, dass sie nach einem von den Nazis ermordeten Widerstandskämpfer, Wilhelm Böse, benannt war, aber damals fragte ich meine Mutter, warum denn die Brücke böse sei. Sie gab zerstreut zur Antwort, dass dahinter Westberlin läge, und mir leuchtete die Antwort ein. Nun war Jan also fort, über die böse Brücke in den anderen Teil der Stadt, den ich nie gesehen hatte, vielleicht nie sehen würde. Als ich ein Jahr alt war, wurden die Grenzschutzanlagen gebaut, so nannten meine Eltern sie. Meine ganze Kindheit lang wohnten wir in einem Haus in Pankow hinterm Bürgerpark, der an die Mauer grenzte. Vom Spielplatz aus sah man einen Wachturm. Nachts hörte man manchmal Schüsse, vielleicht waren wilde Kaninchen in die Grenzschutzanlagen geraten, vielleicht aber hatte auch jemand versucht abzuhauen. Republikflucht zu begehen, wie meine Eltern sich ausdrückten.
Jan beging nicht Republikflucht. Er reiste aus, das war ein Unterschied. Aber er war fort. Und er fehlte mir schon nach ein paar Stunden. Vielleicht hat mir mein großer Bruder immer gefehlt, er blieb irgendwie unerreichbar, auch wenn er mich in den Arm nahm. Nun würde er gar nicht mehr da sein. Nun hatte ich nur noch seine Stimme, so fremd durch das Telefon. Er sprach nicht viel, wir wussten ja, dass mitgehört wurde, aber das wussten wir schon immer und hatten uns daran gewöhnt. Er würde nicht lange in Westberlin bleiben, das hatte er uns schon vorher gesagt. Was er vorhatte, wussten wir nicht, vielleicht wusste er es damals selbst nicht. Am Abend seiner Ausreise ging ich mit Michael zu unseren Freunden. Vielleicht waren wir verabredet, ich weiß es nicht mehr. Wir trafen uns oft einfach so, man meldete sich nicht an, wenn man die anderen sehen wollte. Die Kinder nahmen wir mit, sie waren daran gewöhnt, zwischen Haufen von Mänteln und Parkas auf großen selbst gebauten Betten zu schlafen oder durch die Wohnungen zu toben, während wir redeten, redeten. In meiner Erinnerung sind diese Jahre die Jahre endloser Gespräche, die sich oft im Kreis drehten. Wir tranken billigen Rotwein, ich glaube, er hieß Rosenthaler Kadarka, aßen irgendeine Suppe, das Essen war uns damals nicht wichtig, erst Jahre später lernten wir, mit Freude zu kochen. Nur das scharfe ungarische Gulasch von Jans Freund Herbert war etwas Besonderes. Noch heute kocht er es manchmal, auch Lena mag es. Damals wohnte Herbert mit seiner Frau Maria und den beiden Kindern in der Wollankstraße, eine Zeitlang haben wir uns oft in ihrer großen Wohnung getroffen. Jan und Herbert kennen sich schon von der Kadettenanstalt in Naumburg. Aber als Jan ausreiste, war Herbert schon lange unter Dauerbewachung der Staatssicherheit. Im Halbdunkel des Treppenhauses in der Wollankstraße standen Tag und Nacht zwei oder drei Bewacher. Sie gaben sich gar keine Mühe, ungesehen zu bleiben. Wenn Herbert das Haus verließ, folgten ihm zwei. Ich wusste nicht, was die damit erreichen wollten, ob es ihnen nur um die Drohgebärde ging. Wir hatten keine Angst, wir fanden die lauernden Gestalten lächerlich. Aber heute erschrecke ich, wenn ich mich an unsere Furchtlosigkeit erinnere. Wäre es nicht natürlicher gewesen, Angst vor den Kerlen im Treppenhaus zu haben, vor der Macht, die hinter ihnen stand?
Herbert war ein leiser, zurückhaltender Mensch. Als junger Historiker an der Akademie der Wissenschaften war er der Einzige an seinem Institut gewesen, der gegen eine Parteistrafe für den Professor gestimmt hatte, den die Akademie loswerden wollte. Die Parteistrafe sollte die längst beschlossene Kündigung des Wissenschaftlers einleiten. Nachdem Herbert das einstimmige Ergebnis verdorben hatte, musste auch er gehen. Ihm wurde nicht gekündigt, er kündigte selbst, nachdem alle Entwürfe seiner B-Promotion immer wieder abgelehnt und scharf kritisiert worden waren, nachdem wegen angeblich konterrevolutionärer Denkweise ein Parteiverfahren gegen ihn eröffnet worden war und der Institutsleiter selbst ihn bat, sich und dem Institut das alles zu ersparen. Sein Geld verdiente Herbert als Hausmeister in einem kirchlichen Kinderheim. Auch seiner Frau Maria, die am Modeinstitut gearbeitet hatte, war nahegelegt worden, von selbst zu gehen, man würde ihre Entwürfe fortan kaufen. Eine Zeitlang ging das so, aber dann gestand ihre ehemalige Chefin Maria zögernd, ihr sei aufgetragen worden, die Zusammenarbeit unter einem Vorwand zu beenden.
Wir redeten uns immer ein, dieser ganze undurchsichtige und allgegenwärtige Apparat sei uns gleichgültig. Wenn in Pankow ein Staatsbesuch erwartet wurde, machten wir uns gegenseitig auf die albernen Burschen aufmerksam, die sich mit Einkaufsbeuteln aus Blümchenstoff tarnten und zu zweit durch die Straßen schlenderten. Bei öffentlichen Diskussionen nach Lesungen oder Filmvorführungen im Studiokino lachten wir schon, wenn sich diese blassen Männer mit den Namen Lutz Müller oder Dieter Krause vorstellten und dümmliche Provokationen oder eingeübte Phrasen äußerten.
Am Abend nach der Ausreise meines Bruders trafen wir uns sicher nicht in Herberts Wohnung. Aber ich weiß noch genau, dass er dabei war, als wir um den runden Tisch in einer großen Küche saßen, vielleicht war es bei der Pfarrerin oder bei jemandem aus dem Friedenskreis, vielleicht auch bei der Puppenspielerin Katja in der Florastraße, die meinen Bruder liebte und im Jahr nach ihm ausreiste, ihm nachreiste nach London und Nicaragua, ohne ihn jemals wiederzufinden. Unsere Küchen sahen einander so ähnlich. Nein, bei Katja wird es nicht gewesen sein, ihre Wohnung war klein und dunkel, die S-Bahn fuhr dicht am Fenster vorbei und es war feucht. Es wird wohl bei der rothaarigen Pfarrerin und ihrem Mann am Schlosspark gewesen sein. Ich war nicht getauft, die gesamte Familie meines Vaters war bereits aus der Kirche ausgetreten, als er noch ein Kind war, und meine Mutter hat oft wiederholt, was sie auf ihren Parteischulen gelernt hatte: »Religion ist Opium für das Volk.«
Aber ein paar Jahre zuvor hatte ich mit meinem Bruder im Pankower Gemeindehaus eine Ausstellung seiner Fotos über den Prager Frühling 1968 aufgebaut, um derentwillen er im Gefängnis gesessen hatte, seitdem ging ich oft zu den Treffen des Evangelischen Friedenskreises. Die Alte Pfarrkirche in Pankow war in Berlin bekannt für die ungewöhnlichen Gottesdienste der jungen Pfarrerin, die von ihrem Superintendenten geschützt wurde. Aber auch die Männer mit den Namen Lutz oder Dieter saßen neben uns in den Bänken und waren an ihren betont ausdruckslosen und irgendwie starren Gesichtern zu erkennen, an ihrer auffällig unauffälligen Kleidung.
Die Pfarrerin forderte in Bittgottesdiensten dazu auf, eine Kerze anzuzünden für Wehrdienstverweigerer oder für politische Gefangene, deren Namen sie nannte. Viele taten das, ohne sich um die anwesenden Spitzel zu kümmern. Am Sonntag nach Jans Ausreise ging ich zum ersten Mal nach vorn und zündete eine Kerze an für meinen Bruder. Als ich mich wieder hinsetzte, spürte ich den Blick eines dieser blassen Kerle, der mich ungeniert musterte, als wollte er sich jede Einzelheit einprägen, und mir wurde übel.
In unsere Wohnungen ließen wir diese verdrucksten Gestalten nicht, und doch ahnten wir, dass auch hier jedes Wort mitgehört oder, schlimmer noch, von irgendeinem am Tisch weitergegeben wurde. Wer dieser eine war, diese Frage beschäftigte uns oft, wir hatten mal diesen und mal jenen Verdacht, verwarfen ihn, schämten uns des Misstrauens und wurden es doch nie ganz los. Aber als sich vor ein paar Jahren nach der Öffnung der Akten herausstellte, wer die Berichte geschrieben hatte, wer aus Geltungsbedürfnis oder weil er erpresst worden war oder für einen Judaslohn als Zuträger gedient hatte, ließ mich das seltsam gleichgültig. Wir hatten es doch gewusst. Und keiner, dem ich wirklich vertraut hatte, war dabei gewesen.
Trotz der Ahnung, dass man in den Wohnungen nie ganz sicher war, waren die Treffen mit den Freunden damals das Wichtigste. Wir suchten die Nähe der anderen, erst recht, wenn wieder einer gegangen war. Vielleicht mussten wir uns in diesen Jahren so oft an den Küchentischen versammeln, weil wir uns vergewissern wollten: Wir sind nicht allein. Wir gehen nicht.
Ich verstehe es heute nicht mehr, aber an diesem Abend nach der Ausreise meines Bruders waren wir fröhlich, wir lachten viel, und ein paarmal musste ich die anderen bitten, leiser zu sein, weil Caroline nebenan schlief. Julia, die Sechsjährige, saß neben mir. Sie lachte nicht mit, sie war traurig. Natürlich waren wir auch traurig. Natürlich war der Schmerz um Jan nicht fort, wenn ich lachte. Dieser Schmerz saß mir schon seit Jahren im Hals, seitdem ich ein achtjähriges Kind war und wusste: Mein Bruder ist im Gefängnis. Ach, dieser Schmerz war da, solange ich mich erinnern kann. Schon als ich noch nicht zur Schule ging, spürte ich ihn als würgendes Mitleid mit meinem Vater. Denn auch er war ein Gefangener gewesen, viele Jahre, in einem KAZETT, lange vor meiner Geburt. Die Nazis hatten ihn eingesperrt. Jan aber haben die Freunde meines Vaters eingesperrt, seine Genossen, die mit ihm im Lager gewesen waren, die am 1. Mai auf der Tribüne saßen. Jan war nicht jahrelang Häftling gewesen wie unser Vater, er kam wieder nach ein paar Wochen oder Monaten. Niemand hat mir, der Achtjährigen, etwas erklärt. Mein Bruder wohnte dann nicht mehr bei uns. Wenn er kam, saß unsere Mutter blass im Wintergarten, wo ihre leeren Weinbrandflaschen hinter den Zimmerpalmen versteckt waren, während Jan und unser Vater sich anschrien, und ich verstand kaum, worum es ging. Oft fiel das Wort: Verrat. Ich verstand es nicht, aber in mir war damals schon das Gefühl, mein wunderbarer, starker Vater habe die falschen Freunde. Sie waren es, die Jan eingesperrt hatten, sie waren die Verräter, und wahrscheinlich wusste er es nicht einmal.
An dem Abend nach Jans Ausreise war mir seltsam leicht, vielleicht weil ich dachte, dass mein Bruder ihnen jetzt entronnen war, vielleicht weil ich mich den anderen so nahe fühlte, denen es wohl ähnlich ging. Die Pfarrerin tanzte an diesem Abend mit Michael nach russischen Zigeunerromanzen, Herbert versuchte vergeblich, mir Tangoschritte beizubringen, und irgendwann an diesem Abend erzählte ich von unserem Ausflug nach Machandel, von unserem künftigen Sommerhaus.
Schon am übernächsten Wochenende fuhren ein paar Leute aus dem Friedenskreis mit Michael zum Katen, säuberten zwei der Zimmer, und als ich in der dritten Woche nach Jans Ausreise mit den Kindern kam, waren schon Fensterscheiben eingesetzt. Der Bruder von einem aus dem Friedenskreis hatte sie aufgetrieben, er war Handwerker und half meinem Mann, das Dach zu flicken. Im Theologischen Sprachenkonvikt in der Borsigstraße wurden gerade die Haustüren ausgewechselt, wir besorgten einen Anhänger und holten uns ein paar der noch brauchbaren Türen für den Katen, der Hausmeister dort gab uns auch ein paar ausgemusterte Stühle aus der Golgathakirche mit, die wir nur neu verleimen mussten. Als Michael und ich uns vor ein paar Jahren trennten, überließ er mir alle unsere Möbel, aber diese schönen eichenen Stühle mit den geschnitzten Lehnen wollte er mitnehmen.
An dem Abend von Jans Ausreise hatten manche gesagt, wir sollten uns nicht zu früh freuen, man würde uns das Haus nicht überlassen, es gäbe neue Bestimmungen, Häuser dürfe man nur kaufen, wo man auch polizeilich gemeldet sei. Der Grund war wohl, dass es schon zu viele abseits gelegene Sommerhäuser von Berlinern ohne Telefonanschlüsse gab, was unseren Bewachern die Arbeit erschwerte.
Aber dann ging alles ganz leicht; der Bürgermeister Schaumack, ein beleibter Mann mittleren Alters, der mitten in der Erntezeit nicht viel Zeit für uns hatte, stellte uns einen Mietvertrag in Aussicht, für hundert Mark im Jahr könnten wir die Bruchbude haben. Und wenn es uns gelänge, den Katen vor dem Verfall zu bewahren, woran er allerdings bei uns Büchermenschen zweifle, dann könnten wir das Haus auch kaufen. Er fragte uns, warum wir ausgerechnet nach Machandel gekommen seien, keine Straße führe doch an diesem Nest am Rande der Mecklenburger Schweiz vorbei. Nur noch alte Leute würden da leben. Nach der Schneekatastrophe vor ein paar Jahren hatte man erwogen, alles vom Bagger zusammenschieben zu lassen, es sei zu aufwendig, wegen der paar Leute einen Winterdienst einzurichten und den Konsumbus zu schicken. Das Schloss sei ja auch nichts mehr wert und würde nur noch von zwei Frauen bewohnt, der Russin und der Stummen. Für die Gemeindeschwester und den Briefträger sei es eine Zumutung, mit dem Rad da rauszufahren, durch Wald und Sumpfgebiet. »Aber die Alten in Mecklenburg sind stur, die wollen nicht weg.« Er lachte. »Es ist eigentlich ganz gut, wenn da mal wieder was Jüngeres hinkommt.«
Ich erwähnte meine Großmutter und meine Mutter, die nach dem Krieg im Schloss gelebt hatten. Der Bürgermeister horchte auf, er kannte ihre Namen, dann sagte er etwas von einem Geigenbogenbauer, dem Lebensgefährten meiner Großmutter. Ich wusste von keinem Geigenbogenbauer. Er selbst, sagte der Bürgermeister, sei eines der vielen Flüchtlingskinder im Schloss gewesen. Durch die Bodenreform seien auch seine Eltern Neubauern geworden, sie hätten sich ein Haus in einem der Nachbardörfer gebaut, das ihm noch heute gehöre.
Anfang August zog ich mit den Kindern für einen Monat in unseren Katen. Michael musste arbeiten und kam nur an den Wochenenden. Wir hatten die Türen verschließbar gemacht, aber manchmal vergaß ich abends abzuschließen, und auch tagsüber ließen wir das Haus offen, wenn wir über die Weiden zum See gingen.
Wir schliefen auf Matratzen, nur für Caroline hatten wir am Fenster ein Kinderbettchen aufgestellt. Einmal hatte sie sich am frühen Morgen, als Julia und ich noch nicht aufstehen wollten, an den Gitterstäben hochgezogen und zeigte mit begeisterten Rufen, so laut, dass ich die Augen öffnete, auf zwei Mäuse, die durchs Zimmer rannten, ohne sich von unserer Anwesenheit stören zu lassen, die Wände hoch und runter, als spielten sie Fangen. Die Mäuse hatten den Katen jahrelang bewohnt, sie fürchteten sich nicht vor Menschen, und es dauerte lange, bis sie sich vor uns wenigstens versteckten.
Damals, während unseres ersten Sommers in Machandel, lebte noch eine Familie von Siebenschläfern unterm Dach. Wir hörten sie poltern, sahen sie aber nicht.
Über diesem ersten Sommer, an den ich oft denke, lag etwas wie ein Nebel, der die Dinge auch in der Erinnerung verschwimmen lässt. Vielleicht war es die Trauer um Jan, die über allem lag. Ja, Trauer. Wir trauerten um die Weggegangenen ähnlich wie um Gestorbene, dabei ging doch ihr Leben weiter, nur irgendwo anders in einer Welt, die wir nicht kannten. Sie verschwanden wie in diesem sagenhaften Bermudadreieck, und wenn sie doch wieder auftauchten, waren sie andere; die alte Vertrautheit hatte sich aufgelöst, es gab oft Streit, und man verstand kaum, worum es ging, und war sich fremd. Mit meinem Bruder würde es nicht so sein, da war ich mir sicher, aber würden sie Jan denn wieder einreisen lassen? Würde er kommen wollen?
Ich hatte mir nach Machandel das Material für die Dissertation mitgebracht, einen Wäschekorb voller Bücher und Exzerpte, die lagen ordentlich auf der aufgebockten Stalltür, die mein Arbeitstisch sein sollte.
Aber ich kam nicht zum Schreiben in diesem Sommer 1985. Es gab kein Wasser im Katen, und mehrmals täglich ging ich zum Verwalterhaus neben dem Gutshaus, wo mir die fast zahnlose Frau des Alten, der uns die Sage von der Weißen Frau erzählt hatte, mürrisch meinen Eimer füllte. Sie hieß Auguste Stüwe und war, wie sie mir nach und nach erzählte, hier im Dorf geboren, in unserem Katen sogar, in der linken Wohnung. Aber schon mit vierzehn hatte sie im Schloss gearbeitet, in der Küche und dann als Zimmermädchen. Das habe nicht jede gedurft, behauptete sie stolz, aber sie sei so sauber und anstellig gewesen, außerdem flink wie keine sonst. Mit siebzehn musste sie heiraten, das erste Kind war unterwegs. Ihr Mann, der damals junge Wilhelm, hatte als Melker die Wohnung überm Kuhstall. Drei Kinder wurden da oben geboren, eng war es, aber immer warm, auch im Winter. Noch als die Kinder da waren, wurde sie oft zum Putzen ins Schloss geholt, manchmal auch in die Küche. Bis dann alles zu Ende war mit der Frau Baronin und es keine Gesellschaften mehr gab im Schloss, nur allerlei Gesindel, wie Auguste sich ausdrückte. Keinen Schritt mehr habe man gehen können in Machandel, ohne auf die Hergelaufenen zu treten.
»Hergelaufene sind ja auch wir«, sagte ich. Sie winkte ab. »Wenigstens keine Russen«, hörte ich sie murmeln und irgendwas über gebildete Leute, womit sie uns meinte. Der Wasserhahn war außen an der Hauswand angebracht, ich habe das ehemalige Verwalterhaus nie betreten. Und ich habe sie auch nicht gefragt, wie sie aus der engen Melkerwohnung in dieses schöne, große Haus gekommen waren. Der Gutsverwalter, Inspektor nannten ihn die Leute, war wohl 1945 mit der Familie der Baronin geflohen, und seitdem wohnten Wilhelm und Auguste Stüwe dort.
Der alte Wilhelm kam beinahe täglich auf seinem Spaziergang zu uns hinters Haus, wo Brennnesseln und Disteln meterhoch wuchsen. Er zeigte uns die verkrauteten Reste von Gemüsebeeten, kratzte mit seinem Stock in der Erde und erklärte mir, wie ich Erdbeeren setzen solle und wo ein Bohnenbeet hingehöre. Er brachte mir Pflanzen und Samen und guckte zu, wie ich die Beete anlegte. Obwohl es mir sinnlos schien, denn ich würde ja nicht das ganze Jahr in Machandel verbringen, und obwohl ich meine Arbeit mitgebracht hatte, ließ ich mich gern darauf ein.
Manche Tage in diesem ersten Sommer habe ich brütend heiß in Erinnerung, dann war es im Lehmhaus angenehm kühl. Es gab aber auch Gewitter, nach denen es plötzlich kalt war, dann hielten die Wände die Wärme, und wir fühlten uns geborgen. Wenn die Sonne schien, krabbelte Caroline im Garten auf einer Decke herum, sie mochte das Gras nicht und schrie, wenn die Halme an ihren dicken Beinchen kitzelten.
In der Dämmerung taumelten die Fledermäuse aus dem Dach des Katens, Schatten huschten über die Wände. War es der Siebenschläfer? Ein Marder? Es duftete nach Pfefferminze, die hier überall wuchs. Die Äste eines alten Kirschbaumes waren schwer von den süßen, prallen Früchten, die unteren hingen so tief, dass Julia sie mit dem Mund pflücken konnte. »Wie im Schlaraffenland«, jubelte sie, und in diesen Momenten zerriss der Nebel und ich war einfach nur glücklich, dass wir das Haus gefunden hatten. Doch wir hatten nicht bedacht, wie mühselig es sein würde, die Kinder hier draußen zu versorgen und die Wäsche zu waschen. Die Windeln der Kleinen kochte ich auf einem kleinen Propangasherd, Papierwindeln gab es nicht immer und sie waren teuer. Doch wenn die Kinderwäsche zwischen den Apfelbäumen im Wind wehte, war ich froh, und die kleinen grünen Äpfel kündigten an: Auch im Herbst würde das hier ein Schlaraffenland sein.
In diesen Wochen schleppte ich Hunderte Eimer mit Müll und Schutt aus den anderen Zimmern des Hauses. An den Wochenenden kam Michael mit Helfern und wir stemmten Durchgänge in die Lehmwände, nahmen die Füllungen zwischen dem Fachwerk heraus und ließen nur einige der alten Holzbalken stehen. Diese Arbeit war nicht schwer, aber staubig. Abends liefen wir zu einem der Seen und wuschen den Dreck ab.
Nur die beiden Räume, in denen wir schliefen und aßen, waren bewohnbar. Das waren die Stuben, in denen die alte Emma Peters mit sieben Kindern und ihrem Mann Paul gelebt hatte, unsere Tochter Julia brachte diese Nachricht mit und zeigte mir, was sie gehört hatte: An der Außenwand stand das Bett, einen Ofen brauchte man hier nicht, der Atem der Schlafenden hielt das Zimmer warm. In der Wohnstube hatte es einen Ofen gegeben, den grünen Kachelofen, der noch immer dort stand, aber im Winter wurde der Schnee durch die Fensterritzen getrieben und lag auf den Dielen.
Julia verschwand meist gleich nach dem Frühstück. Schon an einem der ersten Tage fand ich sie im Schlosspark, wo sie mit einem der vielen Enkelkinder von Emma Peters eine Bude baute. Emma hatte von ihren sieben Kindern einundzwanzig Enkel, die alle in der Umgebung wohnten und sie abwechselnd in ihrer Neubauwohnung besuchten. Bald sah ich meine Tochter auch mittags nicht, denn was sie in Emmas Küche bekam, schmeckte ihr besser als das, was ich mühsam auf dem Campingherd kochte. Emma Peters hatte mir gleich gefallen. In ihrem schönen, alten, von Furchen durchzogenen Gesicht sah man, was sie dachte und fühlte. Sie sprach anders als die Leute hier, erst 1943 war sie als junge Frau nach Machandel gekommen, nach dem großen Bombenangriff auf Hamburg.
Manchmal verliefen wir uns in der wie verzauberten Landschaft und kehrten um, ohne den Laden im Nachbardorf erreicht zu haben. Der kürzeste Weg sollte über die Wiesen führen, an Wasseraugen vorbei, über den Schmeerbarg und den Wieversbarg.
Unterwegs, Julia an der Hand, Caroline im Tragetuch, erzählte ich Geschichten von Niklot, dem letzten Stammesfürsten der Obodriten, und seinem Sohn Pribislav, und es hätte mich nicht gewundert, wenn die Reiter plötzlich aus einer Senke aufgetaucht wären. Aber uns begegnete hier kein Mensch, nur Hasen und Rehe sprangen vor uns auf, und große Vögel kreisten über den Hügeln.
In diesem ersten Sommer in Machandel verlor ich das Gefühl für die Uhrzeit und auf unseren Streifzügen verschwammen manchmal auch die Jahrhunderte. Eichen wuchsen aus den Stümpfen noch mächtigerer Eichen. Machandelbäume standen in gerader Reihe auf Wegscheiden, die keine mehr waren. An anderen Stellen bildeten Machandelbüsche und Schlehen ein undurchdringliches Dickicht.