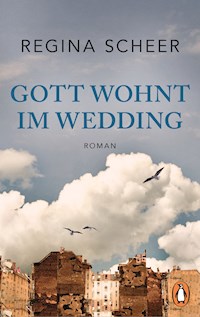12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
»Die Geschwister Scholl und ihre Gruppe an der Münchner Universität, sie hatten Geistesverwandte.«
(der freitag)
Einige von ihnen waren erst neunzehn oder zwanzig Jahre alt, als sie angesichts der Verfolgung ihrer jüdischen Familien beschlossen, Widerstand gegen die Nazipropaganda zu leisten. Nach einem Brandanschlag im Mai 1942 auf die Ausstellung »Das Sowjetparadies« im Berliner Lustgarten wurden sie gefasst und zum Tode verurteilt. Die nach ihrem Leiter Herbert Baum benannte Widerstandsgruppe ist bis heute weit weniger bekannt als die Weiße Rose; in der DDR wurde sie zwar geehrt, aber als Teil des kommunistischen Widerstands instrumentalisiert, ihre jüdische Identität oft verschwiegen oder als nebensächlich angesehen.
Wie Mosaiksteine setzt Regina Scheer Briefe, Aktennotizen und Gespräche mit Überlebenden zusammen und nähert sich auf persönliche Weise den dramatischen Geschehnissen, die bis in die Gegenwart reichen. Einfühlsam zeichnet sie die Lebensgeschichten der jungen Menschen nach, die als Verfolgte ihr eigenes Leben zusätzlich gefährdeten, um ein Zeichen zu setzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 688
Ähnliche
REGINA SCHEER, 1950 in Berlin geboren, studierte Theater- und Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität. Von 1972 bis 1976 arbeitete sie bei der Wochenzeitschrift Forum. Danach war sie freie Autorin und Mitarbeiterin der Literaturzeitschrift Temperamente. Nach 1990 wirkte sie an Ausstellungen, Filmen und Anthologien mit und veröffentlichte mehrere Bücher zur deutsch-jüdischen Geschichte, u. a. Im Schatten der Sterne (2004). Ihre ersten beiden Romane, Machandel (2014) und Gott wohnt im Wedding (2019), waren große Publikumserfolge.
Im Schatten der Sterne in der Presse:
»Eine sehr gelungene Mischung von Literatur und historischer Dokumentation.« DIE ZEIT
»Die Geschwister Scholl und ihre Gruppe an der Münchner Universität, sie hatten Geistesverwandte.« der freitag
»Ein mit viel Sensibilität und Empathie geschriebenes, fulminantes Buch, das man nicht ohne innere Erschütterung lesen kann.« damals.de
»Hella Hirsch und ihre Freunde waren für die DDR zu jüdisch, für die junge Bundesrepublik zu kommunistisch. Und heute?« taz
Außerdem von Regina Scheer lieferbar:
Bittere Brunnen. Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution
Gott wohnt im Wedding. Roman
Machandel. Roman
www.penguin-verlag.de
REGINA SCHEER
IM SCHATTEN DER STERNE
Eine jüdischeWiderstandsgruppe
Die Originalausgabe erschien 2004 im Aufbau Verlag, Berlin, mit der Unterstützung eines sechsmonatigen Stipendiums der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2023 by Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka nach einem Entwurf von Therese Schneider
Umschlagmotiv: © Archiv Michael Kreutzer (Hella Hirsch (links), Alfred Eisenstädter und Alice Hirsch (circa 1937 in Berlin)) Satz: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-27761-1V001
www.penguin-verlag.de
Familienbild
Ein Foto, vergrößert, wie aus einem Familienalbum. Es steht im Regal neben meinem Schreibtisch, schon lange. Fremde Besucher fragen: »Deine Mutter?«
Oder: »Bist du das Kind auf dem Foto?« Seltsam, niemand fragt: »Ist das dein Vater?« Der Mann auf dem Foto zieht nicht die Blicke auf sich, er ist einfach da, ganz nahe der Frau und dem Kind auf ihrem Schoß. Er ist älter als die Frau, sein Haar lichtet sich schon, er trägt einen Anzug und ein weißes Hemd mit Krawatte. Die Frau ist fast noch ein Mädchen, hübsch, strahlend, ihr welliges Haar trägt sie in der Mitte gescheitelt. Sie schaut auf, aber eben noch galt ihr Blick dem Kind. Für diesen Blick gibt es es viele ungebräuchlich gewordene Worte. Innig. Stolz. Lieblich. Sie hält das Kind mit der rechten Hand, man sieht deutlich den schmalen Ring. Der Mann, die Frau und das Kind sind im Freien fotografiert worden, vielleicht auf einer Parkbank, vielleicht auf dem Olivaer Platz im Berliner Westen. Aber die Frau trägt kein Sommerkleid, vielleicht ist es schon Herbst. Ihr Kleid ist dunkel, die Ärmel enden in Manschetten. Sind das helle Knöpfe an dem Kleid oder Flecken auf dem Foto? Es ist ein altes Foto, vielleicht aus den vierziger Jahren.
»Ich bin nicht verwandt mit dieser Familie«, sage ich den Besuchern. Ich frage sie, was sie denken, wenn sie das Foto sehen.
Der Mann sei vielleicht schon tot, vermuten die Betrachter. Die Männer seines Jahrgangs waren Soldaten. Und außerdem sterben Männer früher als Frauen. Die Frau könnte noch leben. Und das Kind, das Kind lebt gewiß noch.
Falsch. Alles an dieser Geschichte ist anders, als man denkt.
Das Kind starb zuerst. Dann die Frau. Zuletzt der Mann.
Im Juni 1941 wurde das Kind geboren. Das Foto kann nicht älter sein als vom Januar 1942. Am Ende dieses Monats war das Kind tot. Es hieß Uri.
Die Mutter war da noch nicht zwanzig Jahre alt. Noch drei Jahre hatte sie zu leben. Höchstens.
Der Mann lebte am längsten. Er starb mit einundachtzig Jahren, im Oktober 1994. Ein paar Tage zuvor hatte ich Robert Mohn noch besucht. Da konnte er nicht mehr aufstehen, das Foto, das er mir gab, nahm er aus der Nachttischschublade. Und die Kopien der Briefe, die ich ihm ein paar Jahre zuvor gebracht hatte, Ediths Briefe an ihn. Er hatte sie nur zögernd angenommen. Und nun gab er sie mir zurück, ungelesen.
Vielleicht aber ist Edith gar nicht gestorben?
Vielleicht ist sie nur nicht zurückgekommen nach Berlin, warum sollte sie auch. Robert, ihr geliebter Robby, wie sie ihn in den Briefen nannte, war mit Lida zusammen, das wußte sie. Edith hatte Robert verloren, ihr Kind war tot, die Freunde hingerichtet. Ihre Mutter ermordet. Nein, das wußte sie nicht. Das konnte sie nicht wissen. Ihre Mutter Olga Fraenkel ist erst auf Transport gegangen, als Edith schon im Untersuchungsgefängnis Charlottenburg war. Der 25. Osttransport vom 14. Dezember 1942 ging nach Riga oder nach Auschwitz. Bis heute weiß man es nicht genau. Und was dort geschah, das konnte Edith nicht wissen.
Aber sie wird es erfahren haben, als sie selbst auf einen Transport ging, nach Theresienstadt und von dort nach Auschwitz. Da wird sie begriffen haben, daß ihre Mutter Olga längst tot war. Edith hätte im Frühjahr 1945 keinen Grund gehabt, nach Berlin zurückzukommen.
Vielleicht lebt sie noch.
Vielleicht ist es wahr, was nach dem Krieg ein aus Theresienstadt zurückgekehrtes Mädchen Robert gesagt haben soll. Daß Edith sich in Theresienstadt freiwillig für den Transport gemeldet hat, weil sie mit einem Mann zusammenbleiben wollte, den sie dort kennengelernt hatte. Vielleicht hat dieser Mann überlebt. Vielleicht hat Edith überlebt. Vielleicht sind sie beide irgendwohin gegangen, und sie lebt noch irgendwo, hat Kinder, Enkel …
Das schreibe ich, und dabei rechne ich, und plötzlich wird mir klar: In wenigen Wochen ist ihr achtzigster Geburtstag. Edith wurde am 8. Februar 1922 geboren.
Roberts achtzigsten Geburtstag habe ich mitgefeiert.
Ediths achtzigsten Geburtstag wird es nicht geben. Ich weiß es. Obwohl … Hatte der Transport Er vom 16. Oktober 1944 aus Theresienstadt nach Auschwitz nicht 117 Überlebende? 1 500 Häftlinge gingen auf Transport, 117 überlebten. Erst vier Tage zuvor war ein anderer Transport aus Theresienstadt nach Auschwitz gegangen, seine Bezeichnung war Eq. 1 500 Menschen umfaßte auch er, und 78 überlebten. Am 19. Oktober, drei Tage nach Ediths Transport, kamen wieder 1 500 Menschen aus Theresienstadt in Auschwitz an, der Transport Es, von dem 53 Häftlinge überlebten. In der Statistik steht, das sind 3,53 Prozent. Wenn aus Ediths Er genanntem Transport 117 Menschen überlebten, dann sind das 7,8 Prozent. Also hatte sie eine doppelt so hohe Überlebenschance wie die aus den Transporten vor oder nach ihr.
Was schreibe ich da? Was hatte sie für eine Überlebenschance? Was soll die Statistik? Und doch, zwanghaft greife ich wieder nach den längst veröffentlichten Zahlen seriöser Wissenschaftler, als könnten sie etwas erklären oder beweisen. Nach dem Kalendarium von Auschwitz kam Ediths Transport am 18. Oktober 1944 an. Zwei Tage war er unterwegs gewesen. Im Kalendarium heißt es über den Transport Er: »Nach der Selektion werden die Jungen und Gesunden in das Durchgangslager eingewiesen, darunter 157 Frauen.«
Edith war jung, vielleicht war sie noch gesund. Vielleicht gehörte sie zu den 157 Frauen. Aber H. G. Adler, der Chronist von Theresienstadt, wußte, daß nur 110 Frauen das Durchgangslager überlebten. Warum 110, haben nicht nach der Statistik von 1995 117 aus dem Transport Er überlebt? Konnten denn sieben bereits Selektierte überlebt haben? Zahlen, Zahlen, es kommt mir obszön vor, diese Zahlen hin und her zu drehen, als hätten sie mit der Frau auf dem Foto zu tun. Aber vor mir liegt die Kopie einer Seite der Transportliste Er aus Theresienstadt, unter der Nummer 653 steht Edith Sara Fraenkel.
Im Kalendarium heißt es weiter: »Die übrigen Menschen wurden in der Gaskammer des Krematoriums III getötet.«
Sie wird ihren 80. Geburtstag in der nächsten Woche nicht feiern. Vielleicht werde ich der einzige Mensch sein, der an diesem Tag an sie denkt. Ich werde ihre Geschichte aufschreiben.
Doch, einen Menschen gibt es, der vielleicht an Edith denken wird an ihrem 80. Geburtstag. Lida. Ediths Geschichte ist nicht zu erzählen ohne Robert Mohns Geschichte, nicht ohne Lidas. Aber Lida, die ich erst in den Wochen vor Roberts Tod kennengelernt hatte, eine zarte, kleine alte Frau, die sich auf seinem Sofa im Wohnzimmer einquartiert hatte, die gekommen war, um den Sterbenden zu pflegen, Lida hat mir bald nach seiner Beisetzung gesagt: »Das alles ist jetzt abgeschlossen. Das ist eine Vergangenheit, die man nicht aufrühren soll.«
Doch Robert hatte gewollt, daß ich Ediths Geschichte erzähle. Er wußte, daß die Vergangenheit nicht abgeschlossen ist, er selbst hat schmerzhaft gespürt, wie wenig abgeschlossen das alles war.
Aber ich werde Roberts richtigen Namen hier nicht nennen und auch Lidas nicht, weil Lida es nicht will. Aber Edith Fraenkels Geschichte werde ich erzählen, so genau, wie ich es vermag. Und all die Namen ihrer Gefährten werde ich nennen, denn Ediths Geschichte ist mit ihrem Leben und ihrem Tod verknüpft. Ediths Geschichte läßt sich nicht erzählen, ohne über den Widerstandskreis um Herbert Baum zu berichten.
Namen auf dem schwarzen Stein
Die Baum-Gruppe. Diesen Begriff kenne ich seit meiner Kindheit. Da, wo ich aufwuchs, und in der Schule wurden manche Namen ganz selbstverständlich ausgesprochen: Ernst Thälmann. Käthe Niederkirchner. Saefkow-Gruppe. Irgendwie verschmolzen sie für mich mit denen der Helden aus den sowjetischen Büchern: Pawel Kortschagin, Soja Kosmodemjanskaja, Gardeschütze Matrossow. Und zu denen gehörte wohl auch der Name Herbert Baum. Ich war vielleicht zehn, als eine alte Freundin meiner Eltern, sie hieß Friedel Kantorowicz, mir ein Buch von Stephan Hermlin schenkte: »Die erste Reihe«. Ob ich das Kapitel über die Gruppe Baum gelesen hätte, fragte sie mich beim nächsten Besuch und sagte, zu meinen Eltern gewandt, ich müsse erfahren, daß es eine jüdische Widerstandsbewegung gab. Ich hatte das Kapitel über Mitglieder von Baums Gruppe gelesen und verstanden, daß sie Juden gewesen waren, die 1942, mitten im Krieg, eine Hetzausstellung gegen die Sowjetunion in Brand gesetzt hatten. In den Filmen meiner Kindheit hatten die Widerstandskämpfer klare, schöne Gesichter, sie starben unbeugsam und riefen im Angesicht des Todes Losungen: »Hoch lebe Stalin!« oder »Thälmann, Rot-Front!« oder »Ich sterbe – der Sozialismus lebt!« Über die Baum-Gruppe gab es keinen Film, aber ungefähr so stellte ich sie mir vor. In Hermlins Buch stand: »Die Namen der Mörder sind vergessen. Die ihren leben.«
Aber die Namen lebten nicht. Es blieben Namen für mich, nichts weiter. Auf einem hohen schwarzen Grabstein fand ich sie wieder, gleich hinter dem Eingang zum Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee, dem größten jüdischen Friedhof Europas. Hier war der Begräbnisplatz von Herbert Baum, die Namen seiner Freunde stehen zwar auf dem Stein, doch sie haben kein Grab, nur diesen Gedenkstein.
Diesen schwarzen Stein mit den Namen schaute ich lange an, und etwas daran berührte mich. Als ich neunzehn Jahre alt war, fiel mir auf, daß eine Alice Hirsch auch erst neunzehn gewesen war, als sie starb. Als ich das nächste Mal auf den Friedhof kam, war ich schon einundzwanzig, älter als Alice geworden ist, älter als eine Lotte Rotholz, älter als Hilde Loewy, die nur zwanzig Jahre alt wurden. Ich war so alt wie Edith Fraenkel, wie Heinz Rothholz, wie Helmut Neumann, Marianne Joachim, Heinz Joachim … Ich war schwanger, und in jähem Begreifen spürte ich einen Schmerz.
Als im Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik ein Buch erschien, das dieser Widerstandsgruppe gewidmet war, kaufte ich es. Da ging es um die illegale Unterbezirksleitung des Kommunistischen Jugendverbands, antifaschistische Volksfrontpolitik, unverbrüchliche Treue zur Partei, Betriebszellen und Kuriere, es ging um den Brandanschlag, und auch die Namen von dem schwarzen Grabstein kamen vor. Aber die Menschen blieben schemenhaft. Einige Zitate aus Briefen und Kassibern waren wie ein Spalt in einem dichten Vorhang, durch den man das Verborgene sieht, wenn man dicht genug herangeht. Ich dachte, man müßte den Vorhang von Schlagwörtern nur wegziehen und könnte die Menschen erkennen.
Herbert Baum war einmal auf einer Briefmarke zu sehen, ein winziger Kopf. Ein Freund, der seinen, wie es hieß, Ehrendienst in der Volksarmee absolvierte, schrieb mir aus der Herbert-Baum-Kaserne. An Jahrestagen des Brandanschlags gab es »eindrucksvolle Bekenntnisse zum sozialistischen Vaterland und zur deutsch-sowjetischen Freundschaft« vor der Neuen Wache Unter den Linden, über die die Zeitungen berichteten, und einmal war ich selbst dabei. Es gab Kampfappelle zur Erinnerung an »die mutige Aktion der antifaschistischen Widerstandsgruppe Herbert Baum« vor einem kleinen Denkmal im Lustgarten, das 1981 errichtet wurde. Über Marianne und Herbert Baum, die ein Ehepaar gewesen waren, erschienen seit den sechziger Jahren manchmal Zeitungsartikel, die konnte ich nicht zu Ende lesen, deren Sprache paßte nicht zu dem schwarzen Gedenkstein in Weißensee. Da stand viel über die unverbrüchliche Treue der Jungkommunisten zur Sowjetunion, über den heroischen Kampf der Partei, über sie selbst oft nicht einmal, daß sie Juden waren.
In dem Buch über die Baum-Gruppe war auch Edith Fraenkel erwähnt, es hieß, über sie wären »nur äußerst spärliche Angaben erreichbar«. Ich las jede Anmerkung und fand auch die, in der der Name des mutmaßlichen Verräters genannt war: Joachim Franke. Auch er wurde hingerichtet, sein Name steht nicht auf der Stele. Im Vorwort von 1977 wurde die Baum-Gruppe ausdrücklich als »kämpfende Gruppe unseres ruhmreichen kommunistischen Jugendverbands« bezeichnet. Man verwahrte sich gegen den Versuch, »besonders in der BRD und in Israel«, »die Legende von einer besonderen, spezifisch jüdischen Widerstandsbewegung zu verbreiten«.
Dieses Vorwort war von »Überlebenden der Widerstandsgruppe« unterschrieben. Eine von ihnen hieß Ilse Stillmann.
Die vergessene Akte
In der weißen Aktenmappe lag ein rötlicher Pappdeckel, eine Art Schnellhefter, die Personalakte der Zuchthausgefangenen Fraenkel, Edith Sara, Gefangenenbuchnummer 761/42, Frauenzuchthaus Cottbus.1
Warum ich die bestellt hatte, weiß ich nicht mehr. Es war kurz nach der Öffnung der Archive, die jahrzehntelang verschlossen gewesen waren. Mit einer Freundin bereitete ich eine Ausstellung über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg vor. Wir befragten die noch lebenden Zeugen des Widerstands, stießen auf Namen, die wir noch nie gehört hatten, auf Geschichten, die tragischer, vielschichtiger, auch verwirrender waren als die uns bekannten. Jahrzehntelanges Schweigen schien aufgehoben, aber plötzlich wollten manche Gesprächspartner sich nicht mehr erinnern, vielleicht weil sie fürchteten, das bislang Unausgesprochene sei nun, nach dem Ende der DDR, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, erst recht nicht mehr zu verstehen. Manche hielten ihr Schweigen, an dem sie doch gelitten hatten, für den letzten Beweis von Treue gegenüber einer verratenen Idee. Andere kamen von selbst zu uns, redeten, zeigten Dokumente, waren froh, endlich ihre eigene Geschichte erzählen zu können. Monatelang lasen wir in Archiven die geheimen Berichte aus dem Widerstand und spätere Darstellungen, unveröffentlichte Erinnerungen, Untersuchungsprotokolle und bruchstückhaft erhaltene Akten der Gestapo und der nationalsozialistischen Justiz. In den Zuchthausakten suchte ich wahrscheinlich die Spur einer der Frauen, über die wir unsere Ausstellung vorbereiteten.
Aber nun lag diese Akte vor mir, ich blätterte darin und sah, daß es hier um Edith Fraenkel ging, deren Namen ich von der schwarzen Stele in Weißensee kannte, um das Mädchen aus der Baum-Gruppe, zu dem »nur äußerst spärliche Angaben erreichbar« gewesen waren.
Am 8. Januar 1943 um 10. 26 Uhr wurde sie in Cottbus eingeliefert. Ihre Straftat hieß: Vorbereitung zum Hochverrat. Das Ende der Strafzeit, so stand es auf der ersten Seite der Zuchthausakte, würde am 10. 9. 1947 sein. Jemand hatte das verbessert: 9. 9. 1947, 18 Uhr.
Ihre Mutter Olga Sara war »n. O. verzogen«. Das hieß wohl: nach Osten verzogen. Der Verlobte der Eingelieferten, so stand es dort, hieß Robert Mohn, er wohnte in Berlin W 15, Lietzenburger Straße 17, bei Lau.
Eine Zuchthausangestellte mit Namen Thiede hatte am 13. Januar 1943 ein Aufnahmeprotokoll aufgenommen.
Edith Fraenkel, deren Name mir schon so lange bekannt war, ohne daß ich hinter ihm ein Gesicht finden konnte, war nicht spurlos verschwunden. Hier, in diesem Archiv, aus dieser vergilbten, verstaubten Akte kam sie mir entgegen. Gleichzeitig wußte ich, daß es eine Akte der Gestapo, der Justiz und der Zuchthauswärter war, sie spricht nicht Ediths eigene Sprache. Aber ich versuchte, mir Ediths Bild aus all diesen Vordrucken und gestempelten Formularen zusammenzusetzen. Das Einlieferungsprotokoll bestand aus mehreren Fragebögen, auf denen die gewünschten Auskünfte angekreuzt waren. Daraus ging hervor:
Die Strafgefangene Edith Fraenkel, zwanzig Jahre alt, hatte kein unversorgtes Kind.
Sie überstand bereits Masern, Röteln, Keuchhusten, Windpocken, Ziegenpeter und eine chronische Mandelentzündung.
Bei der Einlieferung litt sie an Bronchitis.
Ihr Arbeitsbuch von den Siemens-Schuckert-Werken verwies auf ihre letzte Adresse in Berlin, in der Pfalzburger Straße 86.
Sie war für Einzelhaft geeignet.
Arbeitsfähig. Sogar moorarbeitsfähig.
Sie war 1,68 m groß, von kräftiger Gestalt, hatte dunkelblondes Haar und ein ovales Gesicht. Ihre Augen waren graublau, die Augenbrauen bogenförmig. Die Nase klein, Ohren, Mund unauffällig, die Zähne vollständig. Ihr Gang war aufrecht.
Bekleidet war sie bei der Einlieferung mit einem braunen Mantel und braunen, schadhaften Strümpfen. Mit schwarzen, kaputten Schuhen.
Diese Schuhe und diese Strümpfe muß sie schon monatelang getragen haben. In der Akte stand, daß sie schon seit dem 8. Juli 1942 in Haft war, zuerst im Berliner Polizeigefängnis, dann im Gerichtsgefängnis Charlottenburg. Einige der Unterlagen von dort waren auch in Ediths Cottbuser Akte gelangt. Ich fand die Sprechzettel, die nach jedem Besuch wieder abgegeben werden mußten. Ihr Verlobter Robert Mohn und ihre Mutter Olga hatten sie im September im Gerichtsgefängnis besucht. Robert Mohn durfte sie dann noch am 19. Oktober, am 2. und am 27. November sprechen, die Mutter am 8. Oktober. Da war Olga Fraenkel also noch nicht »n. O. verzogen«.
Am 10. Dezember 1942, morgens um 9 Uhr, fand vor dem Volksgerichtshof in der Bellevuestraße 15 die Verhandlung statt, in der Edith und elf ihrer Kameraden verurteilt wurden. Es war die »Strafsache gegen den Hilfsmechaniker Heinz Israel Rothholz und andere«, verhandelt vor dem 2. Senat, der zweite von ingesamt drei Prozessen, in denen über den Anschlag auf die Ausstellung »Das Sowjetparadies« verhandelt wurde. In Ediths Akte lag eine Kopie der Urteilsverkündung. Ich las sie und stieß auf Namen, die ich auf dem schwarzen Stein gelesen hatte:
Heinz Rothholz. Heinz Birnbaum. Hella Hirsch. Hanni Meyer. Marianne Joachim. Lothar Salinger. Helmut Neumann. Hildegard Loewy. Siegbert Rotholz.
Sie waren zwischen 19 und 23 Jahren alt. Sie alle wurden zum Tode verurteilt. Nur drei der jungen Angeklagten aus diesem Prozeß erhielten Zuchthausstrafen. Edith fünf Jahre, Alice Hirsch und Lotte Rotholz, beide 19 Jahre alt, acht und drei Jahre. »Wegen Nichtanzeige eines Vorhabens des Hochverrats«, stand in der Urteilsbegründung für Edith.
Ich blätterte weiter in der Akte und fand ihren Lebenslauf, am 13. Dezember, drei Tage nach dem Prozeß, für diese Akte von ihr selbst auf ein Formular geschrieben. Es ist ein kurzer Lebenslauf, geschrieben mit Tinte in einer klaren, mädchenhaften Schrift ohne Schnörkel. Der Federhalter scheint nicht gut gewesen zu sein, es war wohl nicht ihr eigener, sondern der ihr von den Wärtern oder der Gestapo für das Beschreiben des Formulars zugewiesen. Sie mußte ihn öfter eintauchen, man sieht es an den Buchstaben.
Ich erfuhr daraus, daß sie zehn Jahre lang die private Rudolf-Steiner-Schule besucht hatte, dann in einem Geschäft für Mäntel und Kostüme gearbeitet und einen Kurs für Modezeichnen und Zuschneiden besucht hatte. Seit dem Mai 1940 hatte das Arbeitsamt sie zu der Firma Siemens & Schuckert, ElMo-Werk in Spandau, geschickt, wo sie bis zu ihrer Verhaftung arbeitete.
Dort, bei Siemens, in der sogenannten Judenabteilung 133, waren auch Herbert und Marianne Baum als Zwangsarbeiter eingesetzt, das war bekannt. Ob Edith sie dort kennengelernt hatte?
Auf Blatt 18 in Ediths Zuchthausakte stand ein Vermerk über ein »Hausstrafverfahren«. Am 16. Februar hatte sie in der Freistunde geredet. Sie gab es zu und wurde verwarnt. Hatte sie mit ihrer Mitangeklagten Lotte Rotholz gesprochen? Mit Alice Hirsch? Die waren mit ihr nach Cottbus gekommen, wahrscheinlich im selben Sammeltransport, wie aus einem Schreiben des Reichsanwalts Dr. Barnickel hervorging.
Der Charlottenburger Gefängnisarzt bescheinigte am 6. Januar 1943, die Strafgefangene Fraenkel sei frei von Hautkrankheiten und Ungeziefer, transport- und arbeitsfähig.
Da war sie längst in Cottbus, die ärztliche Bescheinigung über die Transportfähigkeit war nur eine Formsache. In Edith Fraenkels Zuchthausakte lagen Anträge des Verlobten Robert Mohn, der mehrmals versuchte, in Cottbus eine Sprecherlaubnis zu bekommen. Ein Oberwachtmeister Krause teilte ihm mit, daß das erst nach sechs Monaten möglich sei. Endlich erhielt Robert Mohn die Erlaubnis, sie am Sonntag, dem 4. Juli 1943, um 10 Uhr für eine Viertelstunde zu sprechen. »Im Sprechzimmer der Anstalt unter Aufsicht eines Beamten«. Er dürfe kein Essen mitbringen.
Er war aus Berlin nach Cottbus gekommen, er hatte sie besucht, der abgezeichnete Sprechzettel in der Akte beweist es.
Am 8. September wandte sich Ediths Verlobter an den Vorstand des Zuchthauses, weil er Ediths Unterschrift benötigte für eine Vollmacht, die ihr Abstammungsverfahren betraf.
Abstammungsverfahren?
In Ediths Lebenslauf aus der Akte las ich, sie sei die Tochter der Olga Fraenkel, geborene Marx, und des Kaufmanns Leo Fraenkel. Aber der sei nicht ihr richtiger Vater, sie habe 1940 erfahren, daß ihr Erzeuger ein »Arier namens O. Racker« gewesen sei.
Aus anderen Lebensgeschichten wußte ich, daß, nachdem die Nürnberger Gesetze galten, ungewöhnlich viele Frauen, deren Männer Juden waren, einen Ehebruch behaupteten. Zumindest für die Dauer des »Abstammungsverfahrens«, das ein »Erbbiologisches Rasseamt« nach scheinwissenschaftlichen Kriterien durchführte, galt das Kind dann nicht als »volljüdisch«.
Olga Fraenkel war selbst Jüdin, in Ediths Akte ist sie mit dem Zwangsnamen Sara angeführt. Edith aber wäre, hätte man diesen »Arier« O. Racker als ihren Vater anerkannt, nur »Mischling I. Grades« gewesen. Das hätte Hafterleichterungen bewirkt, ihr vielleicht das Leben gerettet. Es war abzusehen, daß auch die Zuchthaushäftlinge nicht verschont werden würden von den Deportationen »n. O.«. Offenbar hat Robert Mohn versucht, ein »Ehelichkeitsanfechtungsverfahren« beim Landgericht durchzusetzen, um die Bearbeitung durch dieses Rasseamt zu beschleunigen. Wahrscheinlich hatte er das schon versucht, als Edith noch in Berlin war, denn bereits am 29. Januar hatte der Oberreichsanwalt nach Cottbus geschrieben, Edith sei nicht Volljüdin, sondern Mischling I. Grades. Am 4. Februar 1943 nahm er das zurück und teilte mit diabolischer Korrektheit mit, daß die »Ermittlungen bezüglich der Feststellung, ob die Verurteilte Mischling I. Grades ist, noch nicht abgeschlossen sind«.
Robert Mohn unterschrieb seine Bittbriefe an die Zuchthausleitung mit »Heil Hitler!« Aber es nützte nichts, seit dem 1. Juli 1943 hatten Juden kein Recht mehr, die deutsche Justiz in Anspruch zu nehmen. Das »Ehelichkeitsanfechtungsverfahren« fand nicht statt, auch die Mühe, Ediths wirklichen Vater zu bestimmen, wird sich keine Behörde mehr gemacht haben. Sie galt als Jüdin, und das Frauenzuchthaus Cottbus entledigte sich ihrer wie aller jüdischen Strafgefangenen. Am 12. Oktober 1943 wurde Edith Fraenkel von der Justiz wieder der Gestapo überstellt, dem »Sammellager Bln. N 4 übergeben«, mit ihr ihre Gefährtinnen Alice Hirsch und Lotte Rotholz.
Das berüchtigte Sammellager war das ehemalige jüdische Altersheim in der Großen Hamburger Straße in Berlin-Mitte. Von dort gingen die Transporte weiter in die Vernichtungslager.
Die Notiz über Ediths »Übergabe« ist die letzte Eintragung in ihrer Zuchthausakte, die offenbar jahrzehntelang im Archiv der SED unbeachtet gelegen hatte. Einige Blätter, die zu dieser Akte gehörten, fand ich später unter anderer Signatur und dem Stempel: IfGA, Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung. Ediths Geschichte wie die der anderen aus dem Kreis um Herbert Baum galt als ein Teil der Geschichte der Arbeiterbewegung, die Deutungshoheit über diese Geschichte behielten die Parteihistoriker sich selbst vor. Erinnerungsberichte, Dokumente wie diese Akte galten als vertraulich und wurden unter Verschluß gehalten. Vielleicht wurde sie auch nur vergessen, denn auch die Autorin des einzigen Buches über die Baum-Gruppe, selbst Mitarbeiterin an diesem Institut, scheint sie nicht gekannt zu haben.
Oder paßte Edith nicht in das Bild der »klassenbewußten jungen Revolutionäre«, als die die Ermordeten aus der Baum-Gruppe angesehen wurden?
Edith durfte, nachdem sie ein halbes Jahr im Zuchthaus war, alle sechs Wochen einen Brief schreiben. Auf dem Blatt 26 in ihrer Akte wurde notiert, daß sie über dieses Recht belehrt wurde. Und dann, eine Seite später, fand ich ein Schriftstück, das wirklich von Edith kam, das nicht für diese Akte geschrieben war, sondern für einen Menschen. Das Blatt 27 in Edith Fraenkels Zuchthausakte war ein von ihr geschriebener Brief, wahrscheinlich der erste, vielleicht der einzige, den sie aus Cottbus schreiben konnte.
Er ist vom 5. September 1943 datiert und an Robert Mohn gerichtet. Natürlich wußte sie, daß fremde Augen ihn lesen würden, aber doch schrieb sie ihn an ihren Geliebten. Sie mußte ein Formblatt benutzen und im Kopf die Religion angeben. Sie schrieb: evangelisch. Auch das Sara hinter ihrem Namen ließ sie weg. Offenbar hoffte sie noch immer, als »Mischling« anerkannt zu werden.
Möglicherweise war das allein schon Grund genug, den Brief zurückzuhalten. Aber auf einer der nächsten Seiten ihrer Akte war vermerkt, daß dieser Brief wegen »unerwünschter politischer Erörterungen« nicht weitergeleitet wurde.
Da blieb er nun in der Akte, kam mit der Akte ins Parteiarchiv, lag dort Jahre, fast doppelt so viele, wie Edith Fraenkel gelebt hat. Sie schrieb:
»Mein geliebter Robby! Ja, Du hast recht, daß ich erstaunt war, Deinen letzten Brief aus Litzmannstadt zu erhalten, obwohl ich zwar gehofft und angenommen hatte, daß auch Du Berlin verläßt. Es macht mir nur etwas Sorgen, daß ich aus dem letzten Brief den Eindruck habe, daß Du Dein mir nach dem Termin gegebenes Versprechen vielleicht doch nicht gehalten hast. Du hast mir auch niemals meine Fragen daraufhin beantwortet. Bitte tue es jetzt. So, weil wir nun einmal bei den Fragen sowieso sind: Wie ist es im Generalgouvernement? Stimmung, Ernährungslage u. s. w. Robbylein erkundige Dich bitte mal, es ist jetzt ein neues Gesetz herausgekommen, daß Juden keine Termine mehr haben. Ich weiß aber nicht, ob sich das nur auf Strafverhandlungen o. auch auf Ziviltermine bezieht. Demnach würde ja mein Abstammungstermin in’s Wasser fallen. Warum triffst Du die Tante erst Ende des Jahres? Ich nahm an, daß sie schon bis Sept. o. Okt. alles erledigt hätte. Hat der arme Bruno nun endlich ausgelitten? Wenn schon keine Hoffnung mehr ist, dann soll’s dort wenigstens schnell gehen. Ist Genia bei Petra gut angekommen? Robbylein, kannst Du nicht etwas über Theresienstadt erfahren? (Verwaltungsorg. u. s. w.) Es ist mir zu schwer, daß ich nicht’s von der armen Mutti hören kann.
Bitte mein Robby, schick mir doch bitte einmal Unterzeug. Schlüpfer und vielleicht noch 1 Paar warme Strümpfe und 1 kl. Schere. Zahnpulver. Es ist ja immer möglich, daß ich hier nicht bleibe und ich habe doch hier nichts weiter als was ich auf dem Leibe hatte. So, mein Liebes, nun genug mit meinen Bitten und Fragen. Mir geht es wie immer gut gesundheitlich und wenn ich hier bleiben kann wird sich das auch nicht ändern. Meinen Mut aber, das sollst Du wissen, behalte ich, wo ich auch bin, bis zum letzten Atemzug, denn ich habe doch Dich und die arme Mutti, das ist ja schon Verpflichtung. Wer kümmert sich denn bloß um Deine Strümpfe, Wäsche u. Anzüge, Robbylein? Ach, wenn man so abends im Bett liegt, dann kommen einem alle diese Fragen u. Bilder und man möchte aufstehen und rausrennen und all das tun, was man sich ausmalt. Aber dann sagt der Verstand wieder: Nein, Du kannst ja nicht, die Türen sind zu. Und Du und die vielen andern und eigentlich alle ihr müßt weiterwarten. Robbylein, wie lange soll diese Menschheitsschande noch dauern? Es ist jetzt der Beginn des 5. Jahres daß sich die Menschheit hinschlachtet. Das Schlimmste ist, daß er einem schon fast zur Gewohnheit geworden ist, der Krieg. Wenn man sich etwas anderes vorstellt, so glaubt man eigentlich nur an eine Utopie. Aber einmal muß sich doch das Göttliche im Menschen wieder durchringen. Überall wo man hinsieht findet man doch anständige gute Menschen, also ist es doch vorhanden. Ich bitte Gott jeden Abend, daß er dem Guten in uns endlich zum Siege verhilft. – Bist Du auch gesund, mein Robbylein? Und hast Du genug zu essen? Meine Sehnsucht nach Dir ist oft unerträglich. Aber ich hoffe weiter!! Grüße bitte alle Lieben u. Alice läßt danken und grüßen und von mir viele viele 1000 Küsse Deine Edith. Haarklemmen + Nadeln habe ich bekommen.«
Lange betrachtete ich Ediths Schrift, las den Brief immer wieder. Nun endlich konnte ich mir ein Gesicht hinter dem Namen von der schwarzen Stele vorstellen, ihre Stimme.
Aber weshalb war dieser Robert in Litzmannstadt? War er dort im Ghetto? War er Jude? Seine Briefe und Anträge trugen nicht den Zusatznamen Israel. Aber durfte ein »Arier« 1943 mit einer Jüdin verlobt sein? Welches Versprechen hatte er ihr nach dem Termin gegeben? Termin nannte sie wahrscheinlich den Prozeß vor dem Volksgerichtshof, der ja öffentlich gewesen war. Vielleicht hatten sie dort noch miteinander sprechen können. Oder sie meinte seinen Besuch vom 4. Juli.
»Warum triffst Du die Tante erst Ende des Jahres?« fragte sie, nachdem sie von ihrer Sorge geschrieben hatte, der »Abstammungstermin« würde »in’s Wasser fallen«. Also hatte sie doch von der neuen Verordnung gehört, wußte, in welcher Gefahr sie als »Volljüdin« schwebte. Sie ahnte ja auch, daß sie nicht in Cottbus bleiben würde. Sie wird von den anhaltenden Deportationen gehört haben. Im Juni waren die letzten Mitarbeiter der Reichsvereinigung der Juden und der Jüdischen Gemeinde aus Berlin nach Theresienstadt deportiert worden. Die »Tante« wird der Deckname für jemand gewesen sein, von dem sie Hilfe erhoffte. Vielleicht ein Rechtsanwalt? Bruno, Petra, Genia – auch sie sind keine aus der Baum-Gruppe bekannten Namen. Vielleicht sind es Decknamen. Offenbar handelt es sich um deportierte oder emigrierte Juden. Aber 1943 konnte niemand mehr emigrieren. Ediths Gedanken über den Krieg sind wohl die »unerwünschten politischen Erörterungen«. Alice, die Robert danken läßt, wird Alice Hirsch gewesen sein, die Schwester der hingerichteten Hella Hirsch, die mit Edith Fraenkel und Lotte Rotholz zusammen in Cottbus saß. Vielleicht hatte Robert mit den »Haarklemmen und Haarnadeln« für Edith auch an sie etwas geschickt.
Aber wer war dieser Robert Mohn?
»Das Vermögen ist verwertet.«
Ich suchte im Stadtplan die Lietzenburger Straße und fuhr von Pankow nach Charlottenburg. Es war Anfang der neunziger Jahre noch nicht selbstverständlich für mich, durch diesen Teil meiner Geburtsstadt zu gehen, in dem ich mich nicht auskannte, in dem kein Haus, kein Stein für mich mit Erinnerungen verbunden war. Das Haus Nr. 17 stand da wie eine Festung, abweisend, hochmütig. Ein großbürgerliches Wohnhaus mit prächtigem Eingangsportal, etwa hundert Jahre alt. Hier also hatte er gewohnt, bei Lau. In einem alten Adreßbuch hatte ich gelesen, daß dies der Name einer Pension war. Natürlich gab es sie nicht mehr, auch keinen Robert Mohn. Schließlich waren fünfzig Jahre vergangen, seit Robert Mohn diese Adresse angegeben hatte, womöglich war er gar nicht mehr am Leben. Die Pfalzburger Straße, in der Edith Fraenkel mit ihrer Mutter gewohnt hatte, lag gleich um die Ecke. Aber die Nummern dort hatten sich seit dem Krieg verändert, ich fand das Haus nicht.
Es war ein sogenanntes Judenhaus gewesen. Das erfuhr ich bald darauf aus dem ehemaligen Archiv der Oberfinanzdirektion, in denen ich nach Edith und Olga Fraenkels »Listen« suchte. Denn jeder, der zur Deportation bestimmt war, mußte bis ins kleinste sein Vermögen angeben, das von der Oberfinanzdirektion »zugunsten des Deutschen Reichs« eingezogen wurde. Die Dokumente dieser »Verwertung« in den deutschen Archiven sind oft das einzig Sichtbare, was von einem Leben übrigblieb.
So hielt ich eines Tages die Karteikarte von Ediths Mutter, Olga Fraenkel, in der Hand. Dort stand: Olga Sara Fraenkel. Aber wie auf all diesen Karteikarten der Oberfinanzdirektion hatte nach 1945 eine deutsche Amtsperson das Sara und das Israel durchgestrichen. Als könnte dieser Bleistiftstrich ungeschehen machen, was auf der Karteikarte stand:
25. Osttransport vom 14. 12. 1942.
Olga Fraenkel, geschieden, am 1. Oktober 1888 in Mannheim als Olga Marx geboren, ist vier Tage, nachdem ihre Tochter vom Volksgerichtshof verurteilt wurde, deportiert worden. Der 25. Osttransport ging mit 811 Menschen nach Auschwitz oder Riga. Die zu dieser Karteikarte gehörende Akte war nicht auffindbar.
Ich ließ mir die Transportlisten zeigen, die im selben Archiv aufbewahrt werden; die Angaben auf der Karteikarte waren korrekt. Die Nummer 235 des 25. Osttransports hieß Olga Fraenkel, 54 Jahre alt, ohne Beruf, arbeitsfähig.
Ihre Arbeitsfähigkeit wird ihr nicht geholfen haben.
Auch auf Edith Fraenkels Karteikarte ist der Zusatzname Sara durchgestrichen. Immer wenn ich so einen Strich auf einem amtlichen Papier aus dieser Zeit sehe, stelle ich mir den Beamten – oder die Beamtin – vor, die auf Befehl der neuen Dienstherren stunden-, tage-, monatelang Striche zieht. Weg mit Israel und Sara aus den womöglich eigenhändig angelegten Akten. Gab es damals das Wort Vergangenheitsbewältigung schon? Oder wäre dieser Vorgang eher Schlußstrich zu nennen?
Als Ediths Adresse ist angegeben: Berlin W 15, Pfalzburger Straße 18, bei Arnheim. Aber in den Zuchthausakten stand die Hausnummer 86.
Auf der Karte ist das Datum von Edith Fraenkels Deportation eingetragen: Sie ging am 15. Oktober 1943 nach Theresienstadt. Also war sie nach ihrer »Übergabe« nur drei Tage in der Großen Hamburger Straße.
Unter ihrem Namen ist eine dünne Akte vorhanden. Als erstes findet sich ein »Schätzungsblatt« der Finanzbehörde, die Ediths hinterlassenes »Inventar« bewerten wollte. Den Nachlaßjägern blieb die falsche Hausnummer nicht unbemerkt. Das war am 17. März 1944, Edith war längst in Theresienstadt. »Nach polizeilicher Auskunft wohnte die Jüdin nicht Pfalzburger Str. 18, sondern Nr. 86 und ist am 15. 10. 43 nach dem Osten abgeschoben. Der Haushalt ist mit sämtl. Mobilar ausgebrannt.« Also war das »Judenhaus« bei einem der Bombenangriffe getroffen worden. Aber die Vermögensakte von Mutter und Tochter Fraenkel wird weitergeführt. Vom 15. Dezember 1944 datiert ein Schreiben der Vermögensverwertungsstelle:
»1. Das Vermögen ist verwertet.
2. Die Akten werden geschlossen.
3. Vermögens-Kontrollbogen aufstellen zur Statistik.«
Unterschrieben und gestempelt am 21. Dezember 1944. Wer Ohren hatte, konnte schon die russischen Panzer hören.
Auf der Rückseite dieses Blatts findet sich eine Aufstellung, aus der hervorgeht, daß die Einrichtung Olga Fraenkels aus dem gemieteten Zimmer in der Gemeinschaftswohnung, geschätzt am 4. November 1943, also bald nach Ediths Deportation, 320 Reichsmark wert war. Die Miete, die offenbar nach Olgas Abwanderung weitergezahlt wurde, betrug insgesamt 325 Reichsmark. Olga und Edith Fraenkel schuldeten dem Deutschen Reich nach seiner Rechnung also fünf Reichsmark.
In der Akte liegt noch ein Formblatt. Ein Obergerichtsvollzieher mit unleserlicher Unterschrift stellte Edith Fraenkel am 13. Oktober 1943, zwei Tage vor ihrer Deportation, in die Große Hamburger Straße 26, also ins Sammellager Berlin-Mitte, eine Verfügung zu, erlassen von der Gestapo Berlin, unterschrieben von einem Mann namens Dreher, daß ihr gesamtes Vermögen zugunsten des Deutschen Reichs eingezogen sei.
Nur gab es kein Vermögen. So widerwärtig diese Akten sind, sie geben Auskunft über das, was Edith Fraenkel und ihrer Mutter Olga geschah.
Ich suchte dann noch in den Deportationslisten. Die drei Mädchen der Baum-Gruppe, Alice Hirsch, Lotte Rotholz, Edith Fraenkel, waren am 12. Oktober aus Cottbus in die Große Hamburger Straße gebracht worden. Das Todesurteil, das an ihren Freunden, an Lottes Mann Siegbert, an Alices Schwester Hella, schon vollstreckt war, hatte auch sie eingeholt. Am 14. Oktober ging der 44. Osttransport mit 74 Menschen nach Auschwitz. Die Nummer 63 und 64 auf diesem Transport waren Lotte Rotholz, geborene Jastrow, zwanzig Jahre alt, Schneiderin, und Alice Hirsch, zwanzig Jahre, Putzmacherin. Alice hatte in der Linienstraße 220 gewohnt, das war ein proletarisches Mietshaus dicht am Bülowplatz, den die Nazis Horst-Wessel-Platz nannten, das Haus steht nicht mehr. Lotte wohnte in der Kreuzberger Lindenstraße 50. Das ist eine bekannte Adresse, in der Lindenstraße 48/50 gab es seit 1891 eine liberale Synagoge auf einem Hinterhof. Der Kantor und Religionslehrer wohnte im Vorderhaus, er hieß Willy Jastrow und starb 1941. Als Lotte nach Auschwitz deportiert wurde, war die Synagoge längst ein Getreidespeicher.
Edith blieb einen Tag länger im Sammellager Große Hamburger Straße, sie ging mit dem 97. Alterstransport nach Theresienstadt. Das war ein Privileg. Theresienstadt galt als Vergünstigung, auf der Wannseekonferenz war 1942 beschlossen worden, ein besonderes Lager für Alte, Prominente, Kriegsversehrte oder sogenannte Mischlinge zu schaffen.
Edith Sara Fraenkel, die Nummer 29 auf der Liste mit insgesamt 51 Namen, war als Geltungsjüdin eingetragen. So nannte man die Mischlinge, die zur jüdischen Gemeinde gehörten, die zwar nicht »volljüdisch« waren, aber doch keiner Privilegien würdig.
Jedenfalls kam sie nach Theresienstadt und nicht wie Lotte und Alice nach Auschwitz. Heute weiß man, daß die Überlebenschancen in Theresienstadt tatsächlich höher waren als in Auschwitz. 12 Prozent der Häftlinge in Theresienstadt überlebten, bei den Osttransporten war es nur ein Prozent.
Was soll das, immer wieder verliere ich mich in diesen grauenhaften Zahlen, als könnten sie das Unbegreifliche verständlicher machen.
Edith hat nicht zu den 12 Prozent gehört. Für Edith und Tausende andere war Theresienstadt ohnehin nur eine Durchgangsstation in Vernichtungslager wie Auschwitz.
Aber wie wird es Alice Hirsch und Lotte Rotholz gegangen sein, für die es diese zweifelhafte Chance Theresienstadt nicht gab, weil ihre Abstammung, wieder so ein grauenhaftes Wort, nicht in Frage stand. Wie haben sie sich von Edith verabschiedet?
Ich starre auf die Deportationslisten, als könnte ich etwas aus ihnen erfahren. Daß es sie überhaupt gibt, ist dem Ordnungssinn der Behörde der Oberfinanzdirektion zu verdanken, die von allen Deportationslisten Kopien archivierte.
Aber ich erfahre aus dieser Liste nichts. Ob Edith immer noch die kaputten Schuhe trug? Die zerrissenen Strümpfe? Wußte sie, wohin sie kommen würde? In ihrem Brief an Robert Mohn hatte sie nach Theresienstadt gefragt. Bei ihrem Namen auf der Liste steht: Kinderpflegerin. Aber in der Zwangsarbeit war sie Ankerwicklerin. Hat sie den Beruf der Kinderpflegerin angegeben, um besser überleben zu können? Vielleicht war sie gern mit Kindern zusammen. Auch zum 97. Alterstransport gehörten Kinder, das jüngste war erst drei Monate alt. Chana Elkan. Sie wurde mit ihren Eltern deportiert. Der älteste in Ediths Transport war der Schlächter Bernhard Cohn aus der Hochmeisterstraße in Prenzlauer Berg, 78 Jahre alt. Vor ihr auf der Liste stand der Bankdirektor Alex Meyer-Wachsmann, 62 Jahre alt, aus Köln-Ehrenfeld, hinter dessen Namen vermerkt ist: Krankheit. Nach ihr die achtzehnjährige Ursula Schütz aus der Bleibtreustraße 33, ebenfalls Geltungsjüdin. Ja, Theresienstadt war eine Vergünstigung.
Ilse Stillmann
Einer meiner Wohnungsnachbarn in Pankow war Konrad Weiß, ein Filmregisseur. Seine Absolventenarbeit aus den sechziger Jahren hieß »Flammen« und war dem Brandanschlag im Lustgarten durch die Baum-Gruppe gewidmet. 1967 oder 1968 hat er für diesen Film auch zwei Frauen befragt, die, so hieß es, zwar beim Anschlag nicht dabei waren, aber zur Baum-Gruppe gehörten, Ilse Stillmann und Rita Zocher. Rita Zocher, früher hieß sie Meyer, ist als einzige der Widerstandsgruppe aus Auschwitz wiedergekommen. Ilse war bis zum Kriegsende unter falschem Namen in Berlin versteckt.
Der Film zeigte nur vage, was damals geschah. Mehr wußte man eben nicht, die unmittelbar Beteiligten waren tot. Aber Konrad Weiß gab mir 1984 auch die Tonbandrollen mit den Interviews. Die konnte ich auf meinem eigenen Tonbandgerät nicht abhören, es war eine besondere Technik, die es nur im Rundfunk gab. Deshalb dauerte es noch zwei oder drei Jahre, bis ich sie hören konnte, in einem winzigen, schalldichten Abhörraum, allein mit diesen Stimmen.
Ilse Stillmann und Rita Zocher sprachen über die Baum-Gruppe. Sie erzählten, wie sie dazugekommen waren. Ilses Stimme war energisch, sie klang etwas gebieterisch, mir schien, Ilse war nicht immer einverstanden mit dem, was Rita sagte, und korrigierte sie. Im Film hatte ich gesehen, daß sie blond und schlank war, Rita eher klein, rundlich, schwarzhaarig. Beide Frauen waren zur Zeit des Interviews noch nicht alt, Mitte Fünfzig. 1942 aber gehörten sie in ihrem Kreis zu den Älteren, Rita war siebenundzwanzig, Ilse einunddreißg. Rita erzählte, daß sie Herbert Baum und Marianne schon als Elfjährige kennengelernt hatte, in der jüdischen Jugendbewegung. Später traf sie ihn oft in der Wohnung ihres späteren Schwagers Gerd Meyer, der beim Brandanschlag dabei war und hingerichtet wurde wie auch seine Frau Hanni. Sie sangen Lieder, lasen Gedichte von Rilke, hörten Schallplatten von Beethoven, Tschaikowski, lasen gemeinsam Gorkis »Mutter«, auch Engels’ »Vom Ursprung der Familie und des Privateigentums«, manche Treffen waren richtige Schulungsabende. An den Wochenenden fuhren sie mit der S-Bahn ins Grüne, oft nach Kummersdorf hinter Königs Wusterhausen. Sie schliefen dort bei einem Bauern in der Scheune.
Rita erzählte, was sie erlebt hatte. Ilse verallgemeinerte. »In der Baum-Gruppe waren ja nicht nur Juden. Die Einstellung der jungen Genossen ging weit hinaus über die Judenfrage. Es ist ein Zufall, daß wir Juden waren. Die Sowjetunion war Vorbild für uns als das einzige sozialistische Land.«
Als Rita erzählte, wie sie mit dem Stern durch die Straßen gehen mußte, bebte ihre Stimme. »Ich kann das gar nicht schildern. Ich hätte schreien können und habe vor Pein und Verlegenheit immer vor mich hin gelächelt und gedacht: Wir werden länger leben, als die Sterne sind.« Sie erzählte, wie Hitlerjungen sie anspuckten und sie, die damals schon Mutter war, das hinnehmen, sich an den Rand stellen und den Rotz abwischen mußte. Sie erzählte von ihrer kleinen Tochter, fünf Jahre alt, von ihrer Angst um dieses Kind, das keine Milch, kein Gemüse bekommen sollte. Sie erzählte nicht, was mit diesem Kind geschehen ist, aber ihre Stimme ließ es ahnen.
Ilse nahm ihr das Wort ab und sprach von Solidarität. Sie berichtete über die Zwangsarbeit, über die Judenabteilung 133 im ElMo-Werk, in der Herbert Baum als Einrichter arbeitete. Er habe eine Anfrage ans Ernährungsamt gerichtet, weshalb den Juden, die 72 Stunden in der Woche arbeiten mußten, die Schwerarbeiterzulage gestrichen wurde. Da hätten sie eine Zeitlang wieder die Zusatzkarten für Schwerarbeiter bekommen. »Wir wollten den jüdischen Kollegen ein Beispiel geben.«
So klang auch ihre Stimme, fest, entschlossen. Rita dagegen begann zu weinen, als sie von der Kochstube in einem Judenhaus erzählte, in der sie damals mit Mann und Kind wohnte. Sie hat nach dem Brandanschlag geflohene Mitglieder der Gruppe in ihrer Kochstube aufgenommen. Am 7. Oktober 1942 wurde sie verhaftet. Im Frauenzuchthaus Cottbus war sie mit drei Mädchen aus der Gruppe zusammen, später wurde sie nach Auschwitz-Birkenau deportiert, zum Schluß noch nach Ravensbrück.
Edith Fraenkels Namen fiel in den Interviews nicht. Erst viel später erfuhr ich aus Ritas Lebensbericht, den mir ihr nach dem Krieg geborener Sohn gab, daß während Ritas Zeit im Zuchthaus Cottbus auch Edith Fraenkel in dieser Judenzelle dort lebte, die eigentlich eine Einzelzelle war. Eine der vier, manchmal fünf Frauen mußte immer auf dem Betonboden schlafen.
Als ich die Tonbänder abhörte, wußte ich noch nichts von Ritas Sohn, damals fragte ich mich nur nach dem kleinen Mädchen, ihrer Tochter. Rita war im August 1982 gestorben, sie konnte ich nichts mehr fragen.
Ilse Stillmann lebte.
Ich kannte Ilses Schwester Edith, die 1932 mit ihrem Mann Nathan Steinberger in die Sowjetunion gegangen war, wo er am Internationalen Agrarinstitut 1935 promovierte. 1937 wurden sie verhaftet, von ihrer zweijährigen Tochter getrennt, unter aberwitzigen Anschuldigungen in Gefängnisse gebracht, ins Lager Kolyma und nach Karaganda verschleppt, dann »auf ewig« nach Magadan verbannt und erst zwei Jahre nach Stalins Tod »rehabilitiert«. 1955 kehrte diese Familie nach Berlin zurück und wohnte zunächst monatelang bei Ilse Stillmann und ihrem Mann in deren Haus. Nie, nicht ein einziges Mal, habe Ilse sie nach ihren Erlebnissen in der Sowjetunion gefragt, wußte ich von Ilses Schwester. Ilse wollte die Gründe für Ediths und Nathans späte Heimkehr nicht wissen. Natürlich wußte sie, was geschehen war. Aber das alles war für Ilse abgetan, und um es zu benennen, genügte ihr ein einziges Wort: Personenkult. Mehr Worte darüber ließ sie nicht zu. Ilses Schwester erzählte mir das nicht erbittert, sondern traurig und verständnislos. Sie und ihr Mann, der in der DDR Hochschulprofessor war, wurden wieder Mitglieder der Jüdischen Gemeinde, sie hatten sich von ihren kommunistischen Überzeugungen nicht getrennt, waren aber zurückgekehrt zu ihren Wurzeln und verschwiegen nicht, was ihnen im Namen der Partei angetan wurde. Ilse blieb Parteikommunistin, ihre jüdische Herkunft empfand sie als unwichtig, die interessierte sie nicht besonders, seit sie mit fünfzehn Jahren aus der Gemeinde ausgetreten war.
Das erzählte sie mir im Januar 1987. Ihr Mann Günter Stillmann war ein Jahr zuvor gestorben, und sie war aus dem Haus in eine kleinere Wohnung umgezogen. Ich hatte ihr geschrieben, sie hatte mich angerufen und gesagt, sie sei bereit, mir etwas über die Baum-Gruppe zu erzählen.
Die Frau, die mir öffnete, hielt eine Zigarette in der Hand. Über der braunen Hose und dem grauen Pullover trug sie einen offenen Dederonkittel, bunt geblümt hing er um ihren schmalen Körper.
Ich wußte, daß sie in der Jablonskistraße im Prenzlauer Berg aufgewachsen war. Als der Erste Weltkrieg zu Ende war, starb Ilses Vater, und die Mutter mit den vier Kindern geriet aus den immer schon bescheidenen Verhältnissen in große Armut. Ilse, damals Ilse Lewin, war ein rebellisches Mädchen, schon als Vierzehnjährige schloß sie sich dem »Schwarzen Haufen« an, einer Absplitterung des Deutsch-Jüdischen Wanderbunds »Kameraden«. Von dort zum Kommunistischen Jugendverband war es nur ein Schritt, den sie mit anderen Freunden 1927 ging, da war sie sechzehn. Sie trat in den Arbeiterschützenverein ein und erwarb, worauf sie lebenslang stolz war, das Woroschilow-Schützenabzeichen.
Wir saßen in ihrem nach dem Umzug noch etwas kahl wirkenden Wohnzimmer an einem Tisch, auf dem sie eine Zeitung mit ausgefülltem Kreuzworträtsel, Bücherstapel und den Aschenbecher beiseite schob, um Platz für die Teetassen zu schaffen. In den Büchern lagen Zettel mit Anmerkungen, einige waren zur Schonung in Zeitungspapier eingeschlagen, andere in grüne Plastehüllen, wie sie Kinder für Schulbücher verwenden. Obenauf lagen Stücke von Bertolt Brecht und ein eben erschienenes Buch von Ilja Ehrenburg. Ilse kannte Artikel von mir aus der »Weltbühne«, deshalb war sie auch sofort zu einem Treffen bereit gewesen, sie duzte mich gleich und begann bereitwillig und ohne meine Fragen abzuwarten zu erzählen. Der Tee in ihrer Tasse wurde kalt, weil sie sich von ihrer eigenen Begeisterung hinreißen ließ, als sie von den Wanderungen und Diskussionen beim »Schwarzen Haufen« sprach, von ihren Freunden Siegbert Kahn und Rudi Arndt, die Ilse für den Kommunistischen Jugendverband »gekeilt« hatten.
Rudi kannte Ilse schon seit der Schulzeit. Er war nur zwei Jahre älter als sie und der Sohn ihres verhaßten Physiklehrers Isidor Arndt an der Jüdischen Schule in der Kaiserstraße, aber Rudi war zum Kummer dieses Vaters von ganz anderer Art als der konservative Schulmeister. Die Arndts wohnten damals in der Gubitzstraße in Prenzlauer Berg, nicht weit von Lewins. Der alte Arndt sorgte dafür, daß Ilse wegen »revolutionärer Umtriebe« vorzeitig aus der Schule flog. Daß sein Sohn Mitglied der Bezirksleitung des Kommunistischen Jugendverbands wurde, konnte er nicht verhindern. Schon Ostern 1931 wurde Rudi Arndt zu Festungshaft verurteilt. Im Juni 1933 wurde er Mitglied des Zentralkomitees des schon illegalen Jugendverbands und kam im Oktober erneut in Haft.
Ilse nannte seinen Namen in unserem Gespräch immer wieder, aber auch die anderer Genossen, die ihr lebenslange Gefährten wurden: Sieke Kahn und seine Frau Rosa, ihr späterer Mann Günter Stillmann, Trulla Wiehr, Lothar Cohn, der ein Bruder von Marianne Baum war.
Ich fragte nach Herbert und Marianne. Zu meiner Überraschung erklärte Ilse kurz, gar kein Mitglied der Baum-Gruppe gewesen zu sein. Sie kannte Herbert und Marianne, schon durch Lothar Cohn. Bei Siemens sei sie dann wieder mit ihnen zusammengekommen. Das sei alles.
Ich muß sehr verständnislos geguckt haben, denn sie erzählte von selbst weiter. Damals hieß sie Ilse Haak, weil sie 1933 eine kurze Scheinehe eingegangen war, um ihren Namen Lewin loszuwerden. Das habe ihr natürlich nichts genützt, sie mußte wie alle Juden den Stern tragen und sich zur Zwangsarbeit vermitteln lassen. Sie hatte vorher in verschiedenen Büros gearbeitet, diese Stellen dann als Jüdin verloren und war schließlich zum Palästinaamt gegangen, zur Jüdischen Jugendhilfe, wo sie Vorbereitungslager für Palästina organisierte. Im September 1940 wurde auch sie zur Zwangsarbeit eingeteilt. Sie wollte zu Siemens ins ElMo-Werk, in diese Judenabteilung 133, weil sie wußte, da sind die Baums, das sind Genossen. Sie ahnte, daß hinter Herbert und Marianne ein ganzer Kreis von jungen Leuten stand. In der Judenabteilung bei Siemens waren noch Heinz Rothholz, Gerd Meyer und Edith Fraenkel, die zu Baum gehörten. In einer anderen Abteilung, das erfuhr Ilse aber erst später, auch Heinz Joachim. Einmal war sie in Baums Wohnung, ein einziges Mal, danach hielt sie sich fern. Sie hatte ihre eigenen Genossen, die waren ziemlich besorgt wegen Baums Leichtsinn, sogar Lothar Cohn, den sie LoCo nannten, stand dem Widerstandskreis seines Schwagers ablehnend gegenüber. Sie könne mir deshalb auch gar nichts Genaues über die Baum-Gruppe erzählen, schon gar nicht über den Brandanschlag, der ja eine große Dummheit gewesen sei.
Warum sie denn aber als Überlebende der Widerstandsgruppe auftrete, sogar dieses Vorwort unterschrieben habe, fragte ich erstaunt. Sie winkte ab. Das hätten die Genossen so festgelegt. Und das sei doch auch richtig, man müsse den Auffassungen aus dem Westen entgegentreten, durch die die Baum-Gruppe ganz falsch eingeordnet würde, womöglich noch von Israel vereinnahmt werden könne. Schließlich waren Baum und Marianne im Kommunistischen Jugendverband, von den anderen wisse sie das nicht, die anderen kannte sie nicht. Nur den Birnbaum, genannt Buber, und seine Freundin Irene Walther habe sie in den dreißiger Jahren schon mal am Ihlandsee in Strausberg gesehen, wo sich Berliner Jungkommunisten trafen. Die beiden waren auch Baum-Leute, das wußte sie aber damals nicht, das erfuhr sie erst, weil ihre Namen unter denen der Hingerichteten waren. Und Richard Holzer, ein Überlebender der Baum-Gruppe, sei ihr schon um 1937 als Kommunist bekannt gewesen. Die anderen Überlebenden der Baum-Gruppe habe sie erst viel später kennengelernt, in der Arbeitsgruppe Herbert Baum beim Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer.
Sie selbst sei Angehörige einer anderen illegalen Gruppe gewesen, mit Siegbert und Rosa Kahn, mit ihrem späteren Mann Günter Stillmann, und als die dann emigrieren mußten, hatte sie Kontakt zu der kommunistischen Gruppe um Hans Fruck und LoCo, in der auch ihre Freundin Trulla war. Aber sie hielten sich im Gegensatz zu Baum an die Regeln der konspirativen Arbeit.
Ich fragte sie nach ihrer ersten Begegnung mit Herbert Baum. Das muß um 1931 gewesen sein. Er war, sagte sie, unter den Jungkommunisten in Berlin ziemlich bekannt. Ein bißchen war er wie Rudi Arndt. Herbert war etwas jünger als Rudi, 1931 noch keine zwanzig Jahre alt, sie beide standen dort, wo sie auftauchten, ganz natürlich im Mittelpunkt. Ilse suchte nach einem Foto von Rudi, auf dem er in kurzen Hosen, selbstbewußt, die Hände in die Hüften gestemmt, im Freien stand. Tatsächlich hatten sein schmales Gesicht, das dunkle Haar, die mandelförmigen Augen Ähnlichkeit mit den wenigen Fotos von Herbert Baum, die ich kannte.
Ich fragte nach Martin und Sala Kochmann. Nein, die habe sie nie gesehen. Auch Rita Zocher, die frühere Rita Meyer, und Charlotte Holzer, die frühere Lotte Paech, kenne sie nur aus der DDR.
Ich war verblüfft. Aber sie schien ihre Rolle als Überlebende einer Widerstandsgruppe, von der sie sich doch ferngehalten hatte, ganz in Ordnung zu finden. Einen Moment lang wußte ich nicht, was ich sie noch fragen sollte. In meiner Verwirrung machte ich mir Notizen, schrieb wörtlich auf, was sie gerade sagte: »Illegal leben und politisch arbeiten, schön und gut. Aber dann noch in der Wohnung illegal Lebensmittel schieben und Schwarzmarktgeschäfte. Ich habe auf solche Hilfe verzichtet, fand das nicht richtig. Herbert hat mir auch mal Ausweise von französischen Fremdarbeitern angeboten, das habe ich aus Vorsicht abgelehnt. Als Baums Leute aus der Halle geholt wurden, hat der Gerd Meyer sich noch so zu mir umgedreht, als ob er was sagen wollte. Ich habe zu seiner Frau Hanni Meyer gesagt, sie dürfe zu keinem Kontakt aufnehmen. Die wird sich nicht dran gehalten haben. Sie waren unvorsichtig.«
Während ich diesen Notizzettel betrachte, fünfzehn Jahre nach meinem Besuch bei Ilse Stillmann, dreizehn Jahre nach ihrem Tod, würde ich sie noch so vieles fragen wollen. Damals konnte ich nichts fragen, weil ich nichts wußte. Ich wußte nichts über Hanni Meyer, geborene Lindenberger, erst später erfuhr ich, daß sie im Januar 1942, kurz vor ihrem 21. Geburtstag, den zwei Jahre älteren Gerd Meyer geheiratet hatte, den Bruder von Rita Zochers Mann Herbert. Gerd Meyer war als Werkzeugmacher bei Siemens in derselben Abteilung 133 wie die Baums, wie Ilse, wie Heinz Rothholz. Und Edith Fraenkel. Wie hat Ilse Gerds Frau nach der Verhaftung in der Judenabteilung warnen können? Wo sind sie sich begegnet, wenn Ilse doch gar keinen Kontakt zu Baums Leuten hielt? Ist sie zu ihr nach Hause gegangen? Ist Hanni zu Siemens gekommen, ihren Mann zu suchen? Damals fielen mir diese Fragen nicht ein, heute kann sie mir keiner mehr beantworten.
Edith Fraenkel war ihr in Erinnerung als ein sehr junges, stilles Mädchen, das irgendwie zu Baums Leuten gehörte. Die kleine Fraenkel nannte Ilse sie. Sie sprach während der Arbeit und in den Pausen oft mit Marianne Baum, auf eine vertraute Art, die Ilse mißfiel. Edith war eine der Ankerwicklerinnen, wie Ilse selbst. Am Schluß kam sie wohl in eine andere Abteilung. Ilse schilderte mir stolz die schwierige Arbeit einer Ankerwicklerin, für die man Geschicklichkeit und technisches Verständnis brauchte. Nach einer Vorlage mußte man Versuchsanker für U-Boote schalten, die waren mit neu entwickelten Werkstoffen isoliert. In der Halle arbeiteten 500 Menschen, es herrschte ohrenbetäubender Lärm von den Maschinen. Morgens mußte man in Gruppen auf dem Hof antreten und bei Wind und Wetter warten, bis die Vorarbeiterinnen, ihre war ein HJ-Mädchen, sie in Gruppen heraufholten. Damals gab es oft nächtliche Bombenangriffe, die jüdischen Zwangsarbeiter waren müde, schlecht ernährt, froren. Oft mußten sie zur Arbeit laufen, weil die S-Bahn stehenblieb, später durften Juden gar keine Verkehrsmittel mehr benutzen. Aber sie durften auch nicht zu spät kommen, weil die Auslieferung zur Deportation drohte. Von den Launen der Vorarbeiter waren die jüdischen Zwangsarbeiter abhängig, die den Stern auch am Arbeitskittel tragen mußten und sich nicht von ihrem Arbeitsplatz rühren sollten. Herbert war Einrichter, der konnte herumgehen. Marianne arbeitete im Nebensaal, sie war da die Leiterin und konnte sich auch bewegen, mit den Frauen sprechen. Ilse sah und hörte manchmal, wie Marianne junge Arbeiterinnen zu irgendwelchen Sachen einlud, Vorträge, Ausflüge, als das schon verboten war, wie sie immer wieder das Gespräch auf politische Zusammenhänge brachte. Und das waren doch keine Genossen, die meisten in der Judenabteilung waren völlig unpolitisch, allenfalls in den jüdischen Jugendbünden gewesen.
Ilse hatte deshalb mehrmals Streit mit den Baums.
Die alte Frau in der bunten Schürze hatte sich so in ihre Erinnerungen vertieft, daß sie mich kaum noch wahrzunehmen schien. Ich war es nicht, der sie das alles erzählte, ich war austauschbar, irgendeine jüngere Genossin. Ilse war jetzt in der Vergangenheit, und für ein paar Stunden war ihr die Abteilung 133 gegenwärtiger als diese ihr ohnehin noch fremde Wohnung im Berlin des Jahres 1987. In ihrem Gesicht spiegelte sich der Ärger über Marianne Baums Unvorsichtigkeit, als sei die nicht schon seit fünfundvierzig Jahren tot.
Ich bat sie, mir von ihrem einzigen Besuch in Baums Wohnung zu erzählen, und sie sagte schnell, das sei nur wegen Rudi Arndt gewesen. Um 1935 saß Rudi im Zuchthaus Brandenburg, gleichzeitig mit Siegbert Kahn. Rosa, Siekes Frau, besuchte ihren Mann viermal im Jahr, wie es erlaubt war, aber die Liebste von Rudi, die rothaarige Trulla, war keine Jüdin und durfte ihn nach den Nürnberger Gesetzen nicht mehr besuchen. Da sprang Ilse ein und gab sich an Trullas Stelle als Verlobte aus. Mehrmals besuchte sie Rudi im Zuchthaus, Trullas Briefe schrieb sie in ihrer eigenen Schrift ab und schickte sie ihm. Rudis Briefe brachte sie Trulla. Ende 1936 hätte Rudi entlassen werden müssen, die Freunde hatten schon eine Schiffskarte für ihn besorgt. Rudi war zu bekannt, er hätte in Deutschland nicht mehr politisch arbeiten können. Nur wurde er nicht entlassen, er kam in Schutzhaft nach Sachsenhausen und Dachau, später nach Buchenwald. Besuche waren nicht mehr möglich, nur selten noch konnte er eine Nachricht an Ilse schicken, die sie weitergab an Trulla. Der Kontakt brach ab.
Bis eines Tages, im Sommer 1940, ein Genosse aus Wien im Palästinaamt erschien, Willi Ernst, der gerade aus Buchenwald entlassen worden war und schon die Papiere für seine Ausreise nach Amerika hatte. Der fragte nach Frau Haak, wie Ilse damals hieß. Aber sie arbeitete nicht mehr dort, sondern war gerade zu Siemens gekommen. Ilse wohnte damals mit ihrer alten Mutter in der Lietzenburger Straße 43 zur Untermiete bei einer jüdischen Familie Freundlich. Zu dieser Wohnung schickten die Kollegen vom Palästinaamt den Willi Ernst, und dort wartete er auf Ilse. Er brachte Nachricht von Rudi Arndt, der in Buchenwald Blockältester einer jüdischen Baracke gewesen war. Lange erzählte der Besucher von Rudi, den er verehrt hatte, der in Buchenwald die Achtung und das Vertrauen so vieler Kameraden besessen hatte, den sogar die SS respektieren mußte, weil er es schaffte, in der Lagerhölle so etwas wie Menschenwürde am Leben zu erhalten. Rudi habe regelrechte marxistische Kurse abgehalten, erzählte der Wiener. Die SS haßte ihn, weil sie ihm nichts nachweisen konnte. Im Mai 1940 ließen sie ihn in die Postenkette laufen. Selbstmord hieß die offizielle Version.
Trulla war damals nicht in Berlin. Ilse wollte, daß die Freunde vom illegal arbeitenden Kommunistischen Jugendverband, die sie irgendwo hinter Herbert Baum vermutete, die Wahrheit über Rudi Arndts Tod erführen. Sie sprach mit Baum, damals war sie erst ganz kurz in der Abteilung. Herbert sagte, Ilse solle an einem der nächsten Abende in seine Wohnung kommen, sie würde dort ein paar Genossen treffen.
Ilse fuhr am angegebenen Abend in die Stralauer Straße zu Baums. Damals verhielt man sich schon konspirativ, achtete darauf, ob man verfolgt würde, war vorsichtig. Sie rechnete mit fünf oder sechs Leuten, die sie bei Baums treffen würde, ausgewählten Genossen. Zu ihrem Entsetzen war die kleine Wohnung bis auf den letzten Platz mit ihr unbekannten Menschen vollgestopft, die ihr erwartungsvoll entgegenblickten, manche Gesichter kamen ihr bekannt vor. Ilse war zu Tode erschrocken, dann wütend. Sie gab nur sehr allgemeine Auskünfte über Rudi und sah zu, daß sie bald von dort wegkam. Bei diesem Besuch sah sie auch Lebensmittel in der Wohnung, die für Juden längst nicht mehr zu kaufen waren. Baum muß Schwarzmarktgeschäfte gemacht haben. Bei Siemens sah sie ihn manchmal mit französischen und belgischen Zwangsarbeitern zusammen, was auch verboten war. Danach hatte sie ihren ersten Streit mit Herbert und Marianne, der aber zu nichts führte. Herbert ließ sich von ihr nichts sagen. Und er hatte gar keine Kontakte mehr zu übergeordneten Leitungen, er selbst war die Leitung. Ilse sprach mit LoCo darüber, auch mit Hans Fruck. Hinter denen, das ahnte sie, stand Walter Husemann, der so etwas wie die illegale Parteiführung verkörperte. Nach dem Krieg erfuhr sie, daß tatsächlich Kontakte von Fruck zu Walter Husemann, Wilhelm Guddorf, John Sieg bestanden, die im Herbst 1942 im Zusammenhang mit der Schulze-Boysen-Gruppe verhaftet wurden. Sieg brachte sich Ende 1942 in der Gestapo-Haft um, Guddorf und Husemann wurden im März 1943 hingerichtet. Für Ilse Stillmann war Hans Fruck die Partei. Der und LoCo hatten ihr zur Zurückhaltung gegenüber Baums Gruppe geraten, sie solle streng im Rahmen der Legalität bleiben.
Und doch kam es noch einmal zu einer Gemeinsamkeit, auch wegen Rudi. Der alte Arndt hatte zunächst auf eine Herausgabe der Urne seines Sohnes verzichtet. Aber Ilse ging als Verlobte zur Jüdischen Gemeinde und forderte nachdrücklich die Urne aus Buchenwald an. Im Oktober kam sie. Isidor Arndt und seine Frau, Rudis Stiefmutter, waren sehr ängstlich, aber nun wollten sie eine ordentliche Beerdigung in Weißensee. Im kleinen Kreis, mit Rabbiner. Ilse aber, trotz aller Vorsicht, benachrichtigte alle noch erreichbaren Genossen, die Rudi gekannt hatten. Lothar Cohn war zu dieser Zeit nicht da, aber seine Eltern kamen und sein Bruder, seine Schwester Marianne, auch Herbert Baum und Baums Jungen aus der Abteilung 133, Richard Holzer und Lotte Paech aus Baums Gruppe. Ilse hatte sich für die Beisetzung ihres Verlobten bei Siemens freigenommen; wie die anderen ihr Fernbleiben von der Schicht begründeten, wußte sie nicht. In Veröffentlichungen hatte ich über diese »machtvolle antifaschistische Kundgebung« gelesen, an der vierzig bis siebzig Leute teilgenommen haben sollen. Ilse sagte mir, sie waren etwa zwanzig Leute auf dem Friedhof, die Hälfte waren Genossen. Der alte Arndt war fassungslos und verschreckt angesichts dieser vielen Leute. Wenigstens in die Erde hatte er seinen verlorenen Sohn in aller Stille bringen wollen. Aber das ließ Ilse nicht zu. Als der Rabbiner seinen »Quatsch«, wie sie fand, absolviert hatte, hielt sie selbst spontan eine kleine Rede. Sie sagte, wer Rudi gewesen sei und daß er ihr und so vielen ein Vorbild bleiben würde.
Trulla konnte erst später benachrichtigt werden.
Ilses Augen leuchteten, als sie über Rudi Arndts Beerdigung sprach und über die gelungene politische Aktion, die, so fand sie, ganz in Rudis Sinn gewesen wäre.
Ich weiß heute, Trulla empfand das anders.