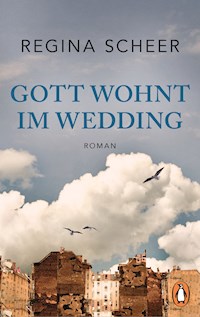11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ein Haus und seine Menschen. AHAWAH heißt Liebe. AHAWAH stand bis in die dreißiger Jahre über der Tür eines Hauses in der Berliner Auguststraße. Damals war es ein jüdisches Kinderheim mit außergewöhnlichem sozialem und pädagogischem Anliegen. Dann wurde es Sammelstelle für den Abtransport jüdischer Menschen in die Konzentrationslager. Später schien es keine Vergangenheit mehr zu haben. Regina Scheer rekonstruiert die bewegende Biographie des Hauses, das für jüdische Kultur und jüdische Schicksale steht und für Berliner Leben im 20. Jahrhundert. Von der Autorin der Bestseller „Machandel“ und „Gott wohnt im Wedding“. "Regina Scheer fand viele Lebensläufe und teilte sie mit. Sie schrieb ein Buch zur Geschichte und gleichzeitig ein Buch über Regina Scheer." Vera Friedländer, Die Weltbühne. Erweiterte Neuausgabe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Ähnliche
Über Regina Scheer
Regina Scheer, geboren 1950 in Berlin, 1968 bis 1973 Studium der Theater- und Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 1972 bis 1976 war sie Redakteurin der Studentenzeitung »Forum«, von 1980 bis 1990 Redakteurin der Literaturzeitschrift »Temperamente«. Sie arbeitet freiberuflich als Publizistin, Historikerin und Herausgeberin. Regina Scheer lebt in Berlin.
Regina Scheer veröffentlichte mehrere Bücher zur deutsch-jüdischen Geschichte und hat 2014 ihren ersten Roman »Machandel« vorgelegt, für den sie den Mara-Cassens-Preis sowie den Ver.di-Literaturpreis Berlin Brandenburg 2017 erhielt. Zuletzt erschien »Gott wohnt im Wedding«.
Im Aufbau Taschenbuch ist von ihr lieferbar: »AHAWAH. Das vergessene Haus. Spurensuche in der Berliner Auguststraße«.
Informationen zum Buch
Ein Haus und seine Menschen.
AHAWAH heißt Liebe.
AHAWAH stand bis in die dreißiger Jahre über der Tür eines Hauses in der Berliner Auguststraße. Damals war es ein jüdisches Kinderheim mit außergewöhnlichem sozialem und pädagogischem Anliegen. Dann wurde es Sammelstelle für den Abtransport jüdischer Menschen in die Konzentrationslager. Später schien es keine Vergangenheit mehr zu haben. Regina Scheer rekonstruiert die bewegende Biographie des Hauses, das für jüdische Kultur und jüdische Schicksale steht und für Berliner Leben im 20. Jahrhundert.
Von der Autorin der Bestseller »Machandel« und »Gott wohnt im Wedding«.
»Regina Scheer fand viele Lebensläufe und teilte sie mit. Sie schrieb ein Buch zur Geschichte und gleichzeitig ein Buch über Regina Scheer.« Vera Friedländer, Die Weltbühne.
Erweiterte Neuausgabe
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Regina Scheer
AHAWAH Das vergessene Haus
Spurensuche im jüdischen Berlin
Inhaltsübersicht
Über Regina Scheer
Informationen zum Buch
Newsletter
Das sprechende Haus
Vom Hekdesch zum Krankenhaus
Ein Haus für »Armut, Körperschmerz und Judentum«
Besuch im Vaterland
Das Haus Nummer 17
Die griechische Insel
Vom Volksheim zur AHAWAH
Das Meißener Weinlaubservice
Die Barmherzigen Schwestern
Das unreine Kind
Im Archiv des Oberfinanzpräsidenten
»… sterben an eurer Vergeßlichkeit«
Ediths Geschichte
Das Heim am Rande der Wüste
AHAWAH-Lebensfäden
Bildteil
Nachwort zur Neuauflage 1997
Nachwort 2019
Personenregister
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Impressum
Die Namen der Personen und Orte sind weitgehend authentisch. In einigen Fällen wurden sie aus Gründen des Personenschutzes verändert.
Allen Menschen, die mir mit Hinweisen, mit ihrem Vertrauen und mit ihrer Geduld geholfen haben, möchte ich danken.
Herzlicher Dank gilt auch Frau Dr. Ruth Gross, die mir Fotografien ihres Vaters Abraham Pisarek zur Verfügung stellte.
R.S.
Das sprechende Haus
Ich will über ein Haus schreiben, über Menschen, die dort hineingingen, hineingetragen, hineingetrieben wurden, über Menschen, die in dem Haus lebten, gesund wurden, hofften, haßten, starben, Menschen, die in ihm lernten, lehrten, die es verließen, verlassen mußten, hinausgetrieben, hinausgetragen wurden, die hinausrannten, aus dem Fenster sprangen, die das Haus nicht vergessen haben, die es mit sich nahmen bis an den Rand der Wüste.
Ich war vierzehn Jahre alt und kam in das Haus, weil es damals die Erweiterte Oberschule »Max Planck« war. Vier Jahre lang fuhr ich an jedem Schultag mit der Straßenbahn von Niederschönhausen nach Berlin-Mitte.
Nie zuvor hatte ich eine solche Straße gesehen.
Sie schien mir schmal, dunkel; die Fassaden der Häuser blätterten ab, wie entzündete Wunden kroch die Fäulnis über das Mauerwerk, gab Reste von Anstrichen und Inschriften preis. Hinter den Fassaden ahnte ich Leben.
Auf dem kurzen Stück der Auguststraße zwischen der Tucholskystraße und der Großen Hamburger gab es drei Schulen – oder waren es sogar vier. Aber die eigentlichen Bewohner der Auguststraße waren alte Frauen, die aus den Fenstern guckten, die mit geblümten Beuteln und Kunstledertaschen unterwegs waren oder zu zweit vor den Häusern standen, vor den zugemauerten Eingängen längst verschlossener Läden. Männer schienen zu diesen Frauen nicht zu gehören.
Meine Schule war ganz anders als die fünf Berliner Schulen, die ich bis dahin kennengelernt hatte. Sie sah anders aus, sie roch anders.
Von der Auguststraße kam man durch die Toreinfahrt des Vorderhauses, in dem eine Hilfsschule untergebracht war, auf den ersten Hof, in dessen Mitte eine Fahnenstange hochragte. Später, viel später sah ich auf alten Fotos, daß hier ein Blumenrondell gewesen war, und ich traf Menschen, die sich an die üppig blühende Pracht erinnerten.
Ein Vierteljahrhundert nach meiner ersten Begegnung mit dem Haus liegen neue Fotografien des Hauses und seiner Höfe vor mir. Da gibt es wieder ein Rondell, auf dem sich ein kümmerlicher Strauch zu leben abmüht. Die Fahnenstange hat sich verdoppelt, rechts und links des spärlichen Rondells harren sie weißgestrichen und leer der zukünftigen Fahnen, weil die alten im Moment, da ich dies schreibe, nichts mehr gelten.
Die Eingangstür auf den neuen Fotos ist dieselbe wie in meiner Schulzeit, es ist die dunkelgestrichene, mit Kreisen und Mäandern verzierte eichene Kassettentür wie auf den Fotos von Abraham Pisarek, es ist die Tür von 1861.
Fotos dieser Tür habe ich Menschen gezeigt, die bei ihrem Anblick in Tränen ausbrachen. Vier Jahre lang ging ich tausende Male durch diese Tür. Ich stieg die Treppe hoch, ging nach rechts ein Stück des langen Korridors entlang, wieder eine Treppe hoch, ganz oben rechts befand sich mein Klassenraum. Der war nicht wie gewöhnliche Klassenzimmer geschnitten, es gab in diesem Haus kaum Zimmer von normaler Größe. Die meisten Räume waren Säle, manche hatten seitliche Guckfenster, hinter denen schmale Kammern lagen. Alle Räume waren hell, hatten große Fenster zum ersten Hof oder wie unser Klassenzimmer zum Garten hinter dem Haus. Ich weiß nicht, warum ich ihn in Gedanken von Anfang an Garten nannte, denn außer wenigen alten Bäumen erinnerte nichts an einen Garten. Es war ein ummauerter Schulhof, auf seinem rötlichen Belag wuchs nichts. Aber von oben aus dem Fenster sah man hinter der Mauer so etwas wie einen verwilderten Park, in den Baracken hineingestellt waren, und dahinter die Rückfront der Ruine, die einmal die Synagoge in der Oranienburger Straße gewesen war. Die alten Bäume zwischen dieser Synagoge und meinem Schulhaus standen im Winter knorrig und schön wie von Caspar David Friedrich gemalt, im Sommer verdeckte ihr Grün die Synagoge. Von oben aber wirkte die Mauer nicht trennend, von hier sah alles aus, als gehörte es zusammen. Links hinter der Mauer war ein anderer Garten, der des katholischen Sankt-Hedwig-Hospitals in der Großen Hamburger Straße. Die drei Grundstücke der Synagoge, des katholischen Hospitals und meines Schulhauses stießen hier zusammen.
Ich kam gern früh, lange vor den Lehrern und den anderen Schülern, in das Haus. Dann waren die Straßenbahnen noch nicht so voll, und vor allem war das Schulhaus leer. Ich konnte an meinem Platz sitzen und schreiben oder lesen. Da, wo ich herkam, fand ich diese Stille nicht. Ich schrieb kleine Bücher voll, meine Tagebücher, und hörte, wie sich das Haus langsam mit Geräuschen füllte, wenn die anderen kamen. Dann verstummte das Haus. Vorher hatte es geächzt und gesummt und geatmet. In den frühen Morgenstunden, wenn die Stimmen seiner Bewohner noch schweigen und keine Türen klappen, kann man die Sprache eines Hauses verstehen.
Manchmal, wenn ich morgens kam, traf ich die Reinigungsfrau, die in meinem Klassenzimmer noch bei der Arbeit war. Die Frau, denke ich heute, wird dreißig gewesen sein, mir kam sie alt und müde vor. Bevor sie ging, setzte sie sich manchmal an den Lehrertisch, rauchte eine Zigarette und sprach mit mir. Sie störte mich nicht, ihre Stimme war nicht laut, nur monoton. Sie sprach, ohne eine Antwort zu erwarten, von ihren Kindern, denen sie, bevor sie im Morgengrauen zur Arbeit gegangen war, das Frühstück hingestellt hatte, von ihrem Mann, der ausgezogen war, aber sie und die Kinder nicht in Ruhe ließ, von ihrer Wohnung in der Ackerstraße, nicht weit von hier, gleich hinterm Koppenplatz.
Die Frau war in dieser Gegend geboren.
Oft erzählte sie von dem Bonzenbunker am Koppenplatz, der nach dem Krieg gesprengt worden sei. Wenn sie vom Einkaufen kommt, sagte sie, setzt sie sich manchmal da auf die Bank und denkt daran, wie sie als Zehnjährige mit ihrer Mutter und den Geschwistern bei angekündigtem Bombenalarm zu dem Bunker gerannt war, wo meistens schon Hunderte warteten. Aber erst zum Schluß, als die Bonzen schon abgehauen waren, hätten sie und ihre Geschwister einen Platz im Bunker bekommen. Vier Wochen lang saßen sie dann da unten, vier Wochen bis zum 2. Mai, bis die Russen kamen.
Einmal fragte ich die Reinigungsfrau, was meine Schule für ein Haus gewesen sei. »Ein Judenhaus«, sagte sie, und ihr Gesicht verschloß sich. Was das sei, ein Judenhaus, wollte ich wissen. Die leise, monotone Stimme antwortete nicht mehr.
Wie oft habe ich später bei Frauen in der Auguststraße diesen Moment erlebt, wo ein offenes Gesicht sich verschließt, wo keine Antwort mehr kommt, wo jede Frage abprallt an glatter Freundlichkeit und der Behauptung, nichts zu wissen, nichts gesehen zu haben.
Aber das war viel später, in den siebziger und achtziger Jahren. Nein, in den achtziger Jahren antworteten dieselben Frauen mir schon wieder, da waren sie wirklich alt und freuten sich, daß eine kam und etwas von ihnen wissen wollte, da kramten sie in ihren Familienfotos, baten mich wiederzukommen und erinnerten sich an alles.
Damals, in den sechziger Jahren, fragte ich meine Lehrer, und die wußten nur, daß das Haus ein Altersheim gewesen sei. Ein jüdisches Altersheim, sagten manche. Aber niemanden interessierte das, keiner wollte es genauer wissen, schien mir.
Freilich, jedes Jahr an einem bestimmten Tag fand ein Appell zum Gedenken an die Opfer des Faschismus statt, dicht am Jüdischen Friedhof in der Großen Hamburger Straße, den das Stadtgartenamt damals noch nicht eingeebnet hatte.
Hier hatte nun wirklich ein jüdisches Altersheim gestanden, davon war die Rede, der wir, auf dem Bürgersteig stehend, zuhörten und von der ich sonst nichts, gar nichts behalten habe. Ein Kranz wurde an der Stelle niedergelegt, wo das Altersheim gewesen war, das von der Gestapo 1941 als ein Sammellager für Berliner Juden eingerichtet wurde, die hier auf den Abtransport in die Gaskammern warten mußten. Als ich in der elften Klasse, also siebzehn Jahre alt war, bin ich ausgesucht worden, diesen Kranz niederzulegen. Ich weiß noch, das Grün war aus echten Nadelzweigen, die piekten, aber die roten und gelben Blüten waren kalte Plaste. Blumen waren damals schwer zu bekommen.
Ich haßte diesen Kranz, und der Auftrag war mir unangenehm. Ich weiß nicht, wieso ich ihn nicht einfach abgelehnt hatte. Vielleicht, weil es mir gar nicht in den Sinn kam, einen Auftrag der Lehrer abzulehnen, oder weil ich es trotz allem als Auszeichnung empfand oder weil ich unklar fühlte, daß diese Zeremonie einen Sinn hatte, der tiefer lag, als diese Ansammlung gelangweilter Schüler dann vermuten ließ, die sich freuten, einer Stunde Unterricht entronnen zu sein, einen Sinn, der weiter reichte als diese Rede, der niemand zuhörte, der solche Reden kannte – und das war wohl jeder von uns.
Schon auf dem Rückweg zu unserem fünf Minuten entfernten Schulhaus waren der Appell und was damit zusammenhing kein Thema mehr.
Jahre später, als ich schon nach Spuren der Menschen aus dem Haus in der Auguststraße suchte, als ich mir von Überlebenden berichten ließ und Protokolle in Archiven las, fand ich einen Bericht, der mich an die unglückseligen Appelle meiner Schulzeit in der Großen Hamburger Straße erinnerte.
Anneliese Borinski, ein junges Mädchen, das Auschwitz überlebt hatte, schrieb im Herbst 1945 über einen anderen Appell in der Großen Hamburger Straße. Anneliese, die ihren deutschen Namen ablegte und sich später Ora nannte, war bis zum Frühjahr 1943 im Landwerk Neuendorf bei Fürstenwalde gewesen. Dieses Gut, zu dem 1500 Morgen Land gehörten, war 1932 von der Jüdischen Fürsorge eröffnet worden, um junge Arbeitslose zu Landwirten und Gärtnern auszubilden – Berufe, die in Palästina gebraucht würden. Seit 1941 war Neuendorf ein Zwangsarbeiterlager, und die meisten der jungen Leute, von denen viele aus den inzwischen geschlossenen Hachscharahlagern Ahrensdorf und Schniebinchen gekommen waren, wo sie sich auf das Gelobte Land vorbereiten wollten, mußten unter Naziaufsicht in Fürstenwalder Fabriken arbeiten. Im März 1942 begannen die Deportationen aus Neuendorf. Und im April 1943 wurde die letzte Gruppe auf den Weg nach Auschwitz geschickt. Dabei war Anneliese Borinski.
Ihre Gruppe kam am 19. April in der Großen Hamburger Straße an. »Die Berliner scheinen an Bilder dieser Art gewöhnt«, schreibt sie und schildert den bewachten Marsch durch die Straßen. »Wir sind am Freitag Nachmittag angekommen, am Abend singen wir in allen Räumen: Schir Hammaloth [Psalm zum Sabbat – R. S.]. Seltsame Atmosphäre, die in diesen Räumen herrscht. Mischung von hoffnungsloser Verzweiflung und ein wenig Sarkasmus, ein letztes Auflodern des Lebenswillens, und eine Begierde, noch einmal alles auszukosten, was dieses Leben bieten konnte. Eine Art ›Zauberberg‹ … Am Morgen machen wir unseren Appell auf dem Flur, die Kommandos schallen durchs Haus. Wir machen Frühsport, nachdem wir die Erlaubnis dazu von dem für uns verantwortlichen SS-Chef bekommen haben, in dem kleinen Garten, der zum Haus gehört, – und in dem wir außerdem jeden Tag eine halbe Stunde zwei und zwei hintereinander spazieren gehen dürfen – und an den angrenzend der kleine alte Friedhof liegt, in dem sich das Grab Moses Mendelssohns befindet. – Es mutet einen an wie eine Art tragischer Ironie. Einmal machen wir dort unten einen ganz offiziellen Sing-Kreis, wir singen unsere Lieder, und die Gestapo hört zu, und wenn sie es verstehen, dann lächeln sie vielleicht über diese Toren, die in dieser Situation singen: ›Wir formen ein neues, ein starkes Geschlecht. Wir fordern die jüdische Ehre! Wir kämpfen für Freiheit, für Gleichheit und Recht!‹
Am Montag ganz früh noch einen letzten Mifkad [Appell – R. S.]. Letzte Worte des Glaubens an ein gutes Geschick, des Vertrauens zueinander, des – hoffentlich nicht endgültigen – Abschieds. Ein Händedruck im Kreis – dann geht alles sehr schnell.«
Mit Lastwagen fuhren sie zum Güterbahnhof, von dort in geschlossenen Viehwaggons nach Auschwitz.
Wie anders hätte unser eigener Appell sein können, wenn man über Menschen gesprochen hätte, über Menschen wie Anneliese Borinski, deren Gesichter und Namen hinter der erstarrten Formel von den Opfern des Faschismus nicht mehr aufleuchteten. Unsere Lehrer selbst werden nichts von ihr gewußt haben.
Daß ich den Appell nicht ganz vergessen habe, liegt vielleicht an der Reinigungsfrau aus der Ackerstraße, die an diesem Tag oder an einem der nächsten spöttisch zu mir sagte: »Du hättest den Kranz auch vor die Tür unseres eigenen Hauses legen können. Hier war auch ein Sammellager.«
In den Monaten vor dem Abitur war ich auf der Suche nach einer eigenen Wohnung oder einem Untermieterzimmer oder wenigstens nach einer Bodenkammer. Ich bin in alle Häuser der Auguststraße gegangen, durch die fremden, nach Katzen und Kohl riechenden Treppenhäuser gestiegen, besichtigte die staubigen Böden, die nicht abgeschlossen waren, und schaute mir die Höfe an, auf denen kleine Werkstätten Lärm verbreiteten, die manchmal als Ersatz für einen Schrebergarten dienten, wo kümmerliche Pflanzen neben einem alten Küchentisch sorgsam begossen wurden. Damals sprach ich zum erstenmal mit den alten Frauen der Auguststraße, in einem seltsam flirrenden, funkelnden Licht, das in den Treppenhäusern die Schatten zerteilte. Die Sonnenstrahlen fielen durch die Reste bunter Scheiben oder durch leere Rahmen, denen die Scheiben längst fehlten. In manchen Häusern roch es nach kaputten Toiletten, in einem kamen die Frauen mit Eimern zu dem einzigen eisernen Ausguß auf einem Podest. Andere Häuser aber bewahrten ihre einstige Vornehmheit, mit Bohnerwachs kämpften die Frauen gegen die Gerüche des Zerfalls. Eine Wohnung fand ich in der Auguststraße nicht, aber ich fragte nach meinem Schulhaus und sah, wie die Gesichter sich verschlossen.
So lange wohne man nun doch nicht hier, und außerdem gingen die Fenster nach hinten raus, und man hätte immer zu tun gehabt, das Haus sei eine Schule, das stünde doch dran, mehr könne man nicht sagen.
Im Herbst nach dem Abitur fing ich an der Humboldt-Universität zu studieren an und begann ein anderes Leben, das mich für lange Zeit nicht in die Auguststraße führte.
Der Gedanke an das Haus aber verließ mich nie ganz. Manchmal lieh ich mir Bücher aus der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde, die war in der Oranienburger Straße 28, nur ein paar Minuten von meinem alten Schulhaus entfernt. Dieses graue, verfallene Bürgerhaus war etwa so alt wie das Haus in der Auguststraße und hatte wohl schon immer der Jüdischen Gemeinde gehört. Früher war es verbunden mit dem Haus Nr. 29, das im Krieg abgebrannt ist. Die umfangreiche Bibliothek der Gemeinde und die Lesesäle waren, das hatte ich gelesen, früher in den oberen Etagen beider Häuser untergebracht. Als ich die Bibliothek kennenlernte, in den siebziger Jahren, gab es nur ein paar Regale in einem kleinen Zimmer, das einmal in der Woche geöffnet war. Die Bücher, die man hier ausleihen konnte, handelten von jüdischem Leben, oder sie waren von jüdischen Autoren geschrieben, nicht alle waren im Osten Deutschlands gedruckt. Nirgends sonst konnte man so einfach »Westbücher« ausleihen wie in der Oranienburger Straße 28. Es gab keine entwürdigenden Erlaubnisscheine, keine Sondergenehmigungen wurden verlangt, keine Stempel. Aber nur wenige wußten damals davon. Viele Leser gehörten der Gemeinde an, andere waren, wie ich, Studenten oder Journalisten, die nach spezieller Literatur suchten. Wenn ich dort am Tisch saß und in Neuerscheinungen blätterte, hörte ich, wie die Besucher sich leise unterhielten, etwa über eine Gemeindeveranstaltung, den Sederabend oder den Chanukkaball, wie sie einander berichteten, wer krank geworden oder gestorben sei, und ich hörte, wie sie mit der hübschen, dunkelhaarigen Bibliothekarin, der Frau des Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, besprachen, daß es diesem oder jener gelungen sei, einen Paß für eine Amerika- oder England-Reise zu erhalten, um Verwandte zu besuchen. Die Bibliothekarin trug einen silbernen Schmuck mit einem jüdischen Symbol, ich glaube, es war die Menorah, der siebenarmige Leuchter.
Menorah ist auch das Wort für Licht, und irgendwie schien mir dieses Symbol in dem düsteren Haus Oranienburger Straße 28 am richtigen Platz. Auch meine Freundin Jalda, ein Jahr jünger als ich, mit der ich während der Schulzeit in einem Singeklub war, trug so ein silbernes Kettchen um den Hals. An ihrem hing der Mogen David, der Davidstern, ein Geschenk ihrer Mutter, die Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt hatte.
Ich war dabei, als ein Kulturfunktionär der Berliner Leitung der Freien Deutschen Jugend sie ärgerlich wegen des Kettchens ansprach. Sie solle es ablegen, oder ob sie mit dem Symbol eines imperialistischen Staates, eines Aggressors, herumlaufen wolle.
Jalda sagte ruhig, für sie sei dies das Symbol des Volkes ihrer Mutter. Sie trage den Davidstern zum Gedenken an die vielen Gefährtinnen ihrer Mutter, unter denen auch das Mädchen Anne Frank war, das ihre Mutter in Bergen-Belsen zur Totengrube tragen mußte.
Der Funktionär schwieg unzufrieden. Natürlich war er dafür, die Opfer des Faschismus zu ehren. Er war selbst erst Mitte zwanzig, was wußte er über den Davidstern. Er fragte nicht, er spürte wohl, daß es Fragen gab, die in Bereiche führten, in die er nicht eindringen wollte. Das spürten wohl auch die beiden Volkspolizisten, die damals, war es in diesem oder einem der nächsten Jahre, am 9. November die beiden Jungen und das Mädchen mit aufs Revier nahmen, weil sie Kerzen vor der Synagogenruine in der Oranienburger Straße 30 angezündet hatten.
Die Sechzehnjährigen standen noch einige Minuten vor der Synagoge, blickten auf die winzigen Lichter und wollten schon wieder gehen, als die Volkspolizisten, die sich auf dem Streifengang befanden, ihre Ausweise sehen wollten. Wer hatte den Jugendlichen die Genehmigung gegeben, hier so ein öffentliches Aufsehen zu erregen? Niemand. Aber die jungen Leute wußten von der sogenannten Kristallnacht, und die Kerzen sollten erinnern. Die Polizisten erinnerten sich an ganz andere Aktionen, wenn sie brennende Kerzen sahen, was ging sie die Kristallnacht an, die DDR als antifaschistischer Staat gehörte zu den Siegern der Geschichte, in der Zeitung hatte auch nichts von einer Kristallnacht gestanden, und eine Gedenkveranstaltung, bitteschön, mit Kerzen, an einer öffentlichen Straße, dürfe nicht ohne staatliche Genehmigung erfolgen. Deshalb und weil das Mädchen keinen Ausweis bei sich trug, wurden die Jugendlichen mitgenommen aufs Revier, wo man sie ein paar Stunden lang festhielt, bis man einigermaßen überzeugt war, daß sie aus politischer Naivität und in keiner feindlichen Macht Auftrag gehandelt hatten, als sie die Kerzen anzündeten.
Einer von ihnen war Valentin, der Sohn einer Bekannten, der später eine grüne Punkfrisur trug und noch oft seine Nächte auf Polizeirevieren verbrachte. Als er vierundzwanzig war und trotz seines guten Abiturs immer wieder zum Studium abgelehnt wurde, stellte er einen Ausreiseantrag. Diesmal wurde er wirklich eingesperrt. Unter dem Vorwand der staatsfeindlichen Hetze saß er zehn Monate lang im Gefängnis und wurde dann verkauft.
Ich habe später oft an die Kerzen vor der Synagogenruine gedacht, die man nur so kurze Zeit brennen ließ.
1988 wurde der 50. Jahrestag des Novemberpogroms mit offiziellen Feierstunden begangen, laut und für die Medien inszeniert. Am 7. oder 8. November ging ich spätabends durch die Oranienburger Straße. Da waren Scheinwerfer aufgestellt, Gerüste verdeckten die schadhaften Fassaden der Häuser, an der Ruine wurde fieberhaft gearbeitet, mir schien, man pflasterte sogar das Straßenstück vor der Nummer 30 neu. Ich hatte gelesen, das Staatsoberhaupt würde am 9. November mit Repräsentanten des öffentlichen Lebens, mit Vertretern der Jüdischen Gemeinde, mit internationalen Gästen und Journalisten dort erscheinen. Als ich näher treten und mir die nächtlichen Bauarbeiten anschauen wollte, forderten mich zwei Polizisten auf, weiterzugehen. Hier gebe es nichts zu sehen, mein Verhalten sei eine Ordnungswidrigkeit. Ich sah in die ausdruckslosen Gesichter der Uniformierten und begriff, daß es keinen Sinn hatte, mit ihnen zu streiten. Vielleicht waren sie vom selben Revier wie die, die mehr als ein Jahrzehnt vorher an ebendieser Stelle die Kerzen ausgetreten hatten.
In der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde gab es einige alte Adreßbücher. Ich suchte nach der Auguststraße 14/16, dem Judenhaus, und fand, daß die Grundstücke 13 bis 17 tatsächlich der Jüdischen Gemeinde gehörten – oder gehört hatten. Die Nummer 13, der rote Backsteinbau neben meiner Schule, vom Baustil unverkennbar jünger als das Haus 14/16, war 1928 als Mädchenschule der Jüdischen Gemeinde gebaut worden. Vorher stand in den Adreßbüchern: Kohlenplatz. Der Kohlenplatz ist erst nach 1917 eingetragen, vor 1917 hieß es: Baracken des Jüdischen Krankenhauses.
Welchen Krankenhauses?
Für mein Schulhaus war im Adreßbuch von 1917 kein Krankenhaus angegeben, da stand: Jüdische Kindervolksküche. Und: Kleiderkammer der Kriegshilfskommission der Jüdischen Gemeinde. Und: Kriegskindergarten. Und: Näh-, Lehr- und Stillstube der Jüdischen Gemeinde.
Ich ging in die Ratsbibliothek im alten Marstallgebäude und fragte dort nach Adreßbüchern. Man wollte mir nicht alle die wertvollen, schadhaften Wälzer zeigen. Ich sollte mich für ein Jahr entscheiden. Ich wählte 1925.
Da stand für die Auguststraße 14/16:
AHAWAH– Jüdisches Kinder- und Jugendheim.
AHAWAH ist ein hebräisches Wort, es heißt Liebe.
Wenn man sich die Lage der Grundstücke auf einer Karte ansieht, erkennt man, daß es ein großes, zusammenhängendes Areal war, zu dem nicht nur die Häuser Auguststraße 13 bis 17 gehörten, sondern auch die südlich angrenzenden Grundstücke der Oranienburger Straße 28 bis 31, darunter das Synagogengrundstück – mitsamt ihren Gärten und Höfen Eigentum der Jüdischen Gemeinde.
Die Nummer 17 ist das Wohnhaus links neben meinem Schulhaus, scheinbar ein gewöhnliches Mietshaus, etwas besser erhalten als die umliegenden, nach dem Krieg wurde es verputzt. Auch dieses Haus hatte also der Jüdischen Gemeinde gehört.
Im Adreßbuch von 1917 ist ein Jüdischer Volksverein im Haus Nummer 17 eingetragen. In dem von 1925 steht auch: Zimmer 21, Verband der Ostjuden. Und eine Haushaltsschule gab es 1925. Sie ist bis zum Ende der dreißiger Jahre angegeben.
Außerdem steht da im Adreßbuch von 1925: Büro der Poale Zion.
Poale Zion?
Das heißt Arbeiter Zions, und so nennt sich die Jüdische Sozialdemokratische Arbeiterorganisation, deren Ziel von Anfang an eine Synthese zwischen Sozialismus und Zionismus war und die, so hatte ich in der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde gelesen, »die territoriale Lösung der Judenfrage und die Schaffung eines sozialistischen Gemeinwesens in Palästina« anstrebte.
In der Nummer 17 war also unter anderem ein Büro dieser Poale Zion, die die Gründung von landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaften, der Kibbuzim, im Gelobten Land als Beitrag zur Lösung der Judenfrage ansah. Davon hatte ich gehört, denn ich kannte schon als Kind Menschen, die in Palästina gelebt hatten und später in ihr Geburtsland Deutschland zurückkehrten, um hier den Sozialismus aufzubauen. Manchmal sprachen sie von diesem Sozialismus wie von einem Traum. Wenn ich sie dann fragte, ob das, was wir hier hätten, denn kein Sozialismus sei, schwiegen sie, als läge ein Tabu über diesem Wort. Ein Tabu wie über dem Wort Zionismus. Wenn man danach fragte, war es, als ob man die Nachbarinnen in der Auguststraße nach dem alten Schulhaus fragte: Die Gesichter verschlossen sich.
Was in den Häusern 17 und 13 und was in der Oranienburger Straße gewesen war, schien mir zwar interessant, aber ich suchte nach meinem Haus.
Wie sehr diese Häuser und was in ihnen geschah miteinander verbunden waren, begriff ich erst viel später, als ich mehr wußte.
Damals also kannte ich nur den Namen des Kinderheims: AHAWAH.
Wo kamen die Kinder her?
Wo waren sie geblieben?
Erst seit 1920 taucht die AHAWAH in den Büchern auf. Was war vorher in dem Haus? Wieso standen nebenan Baracken des Jüdischen Krankenhauses?
Wo war dieses Jüdische Krankenhaus? Ich suchte in den Katalogen der Ratsbibliothek und fand ein Buch »Das Neue Krankenhaus der Jüdischen Gemeinde zu Berlin«. Erschienen ist es 1861 im Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin, gedruckt von Gustav Schade in der Marienstraße 10. Verfasser ist Dr. Ch. Esse, ein »Königlich-Geheimer Regierungsrath, Verwaltungsdirektor des Charité-Krankenhauses, der Chirurgischen Universitätsklinik und der Thierarzneischule zu Berlin«. Ich blätterte in dem schmalen, hochformatigen Band, der eine vor allem technische Beschreibung des Krankenhauses zu sein schien. Funktionszeichnungen von Wasserleitungen, Klosetts, Pumpen und anderen technischen Details.
Und da sah ich das Haus.
Die Lithographie war wie eine Architekturzeichnung, genau, aber ohne Leben, und doch erkannte ich sofort das Haus, in dem ich vier Jahre lang zur Schule gegangen war, die mir vertraute Tür, die beiden seitlichen Eingänge, die immer verschlossen waren.
Ich vertiefte mich in Esses Beschreibung des Hauses und fand wieder, was ich kannte, so als ob man das Jugendbild eines vertrauten Menschen anschaut, dem man erst im Alter begegnete. Man erkennt die wesentlichen Züge und entdeckt sie eigentlich erst jetzt, wo das Alter sie verändert hat.
Plötzlich wurde mir der Sinn der seitlichen Guckfenster klar, hinter denen der Raum so schmal gebaut war. Das waren die Wärterinnenzimmer neben den großen Krankensälen. Der Königliche Geheimrat Esse war der Berater und Gutachter des Krankenhauses gewesen, er lobte das funktionstüchtige, schön und modern ausgestattete Gebäude, nur die schwer zu öffnenden Fenster im Obergeschoß (ich erinnerte mich gut an sie!) fanden sein Mißfallen, er vergaß aber nicht zu bemerken, daß in gerade dieser Angelegenheit sein Rat in den Wind geschlagen worden war. Aus Esses Schrift erfuhr ich auch, wann und wie es zum Bau des Krankenhauses gekommen war.
Das Haus hatte nun einen Beginn. Ich hielt einen Faden in der Hand, an dem ich mich bewegen konnte auf der Suche nach der Geschichte des Schulhauses, das ein Judenhaus gewesen war, ein Krankenhaus, bevor es zum Kinderheim AHAWAH wurde und schließlich zum Sammellager.
Nach vier Jahren Studium begann ich bei einer Zeitung zu arbeiten, und mein Leben wurde wie bei fast allen Frauen des Landes ähnlich dem Kampf mit dem vielköpfigen Drachen im Märchen, der unbesiegbar bleibt, weil ihm immer ein neuer Kopf nachwächst. Nur fehlte der tröstliche Schluß aller Märchen, dies war kein Märchen, sondern mein Alltag zwischen Kinderkrippe und Arbeitsplatz und Kaufhalle und Wohnungsamt … Manchmal stahl ich mir ein paar Stunden und fuhr in die Auguststraße. Hier veränderte ich meinen Schritt. Ich rannte nicht wie sonst, sondern ging, vorbei an den sprechenden Fassaden der Häuser. Manchmal blieb ich stehen und hörte zu. Vielleicht gehen andere so in den Wald, wie ich in die Auguststraße ging. Alles veränderte sich dort ständig, und doch blieb etwas unberührt, unverändert, wie erstarrt für eine lange Zeit, die noch nicht abgelaufen war.
Es war wie in der Schulzeit, wenn morgens das ächzende Haus zu mir gesprochen hatte, und ich ahnte, daß in den Mauern Geheimnisse liegen, die sich offenbaren, wenn man, wie im Märchen, die wahre Gestalt der Dinge hinter den durch Alter und bösen Zauber verunstalteten äußeren Formen erkennt.
Ich begann, diese Auguststraße zu lieben, besonders das Stück zwischen der Großen Hamburger Straße und der Tucholskystraße, die früher Artilleriestraße hieß.
An der Nummer 69, gegenüber dem Schulhaus, rostet ein Schild vor sich hin: Margarinefabrik. Eine Margarinefabrik habe ich dort nie gesehen, aber das Schild gab es schon, als ich zur Schule ging, und es hängt heute, ein Vierteljahrhundert später, noch immer an dieser Stelle. An ebendieser Stelle, das hatte ich in alten Chroniken gelesen, befand sich auf einem Erdhügel von 1701 bis 1719 das Hochgericht. Die armen Löffeldiebe, Kindesmörderinnen und sonstigen Untertanen, die an dem Galgen ihr Leben lassen mußten, gaben der Gasse ihren ersten Namen: Armesündergasse. Schon vor 1723 aber nannte man sie nur noch Armengasse, nach Armenhaus und Armenfriedhof, die der Stadthauptmann Christian Koppe auf dem heutigen Koppenplatz, an dem die Große Hamburger Straße endet, hatte einrichten lassen. Auch Koppe selbst wurde 1721 dort beigesetzt. 1839 wurde der Friedhof eingeebnet, auf dem die Allerärmsten und Selbstmörder ihr Grab gefunden hatten. Gleich hinter dem Armenfriedhof war die Stadt zu Ende, die Linienstraße hieß früher Hinter der Linie. Sie war, wie der Friedhof, 1705 angelegt worden und bezeichnete den Weg entlang der Stadtgrenze. Parallel dazu verlief die spätere Auguststraße, die aber seit 1739 erst einmal Hospital-Straße hieß, benannt nach dem Koppeschen Armenhause. Fast hundert Jahre lang hieß sie so. Erst 1833 war sie nach Prinz August von Preußen, dem Generalinspektor und Chef der Artillerie, benannt worden. Die Artilleriekasernen waren nicht weit von der neu ernannten Auguststraße, eine lag am Oranienburger Tor, die anderen befanden sich am Kupfergraben, hinter der Ebertbrücke, auf die die Artilleriestraße zuführte, deren Namen man nach 1945 in Tucholskystraße umwandelte, weil Artillerie wohl zu militärisch klang. Aus demselben Grunde nannte man im Scheunenviertel eilig die Dragonerstraße und die Grenadierstraße nach antifaschistischen Widerstandskämpfern um, die in dieser Gegend nie gelebt hatten.
Die Straßennamen zu tilgen hieß, auch die Spuren so vieler Juden auszulöschen, die nichts hinterließen als ihre Adressen in den Deportationslisten der Gestapo. Niemandem scheint nach 1945 klar gewesen zu sein, daß man mit dem Auslöschen der Namen Dragoner- und Grenadierstraße den Ort namenlos machte, an dem die Erinnerung so vieler von dort Geflohener sich festhielt. Und wenn man diese Straßen schon unbedingt neu benennen wollte, warum dann nicht nach jüdischen Widerstandskämpfern, die hier gelebt haben? Sonja Spitz. Oder Ruben Rosenfeld.
Sonja Spitz wurde schon früh von den Nazis zusammengeschlagen und weggebracht, keiner weiß, wo sie umkam.* Von ihr hat mir ein alter Mann erzählt, der im Scheunenviertel gewohnt hatte. Gustav Buttgereit, Kommunist und jahrelang Häftling in Sachsenhausen, leitete bis zu seiner Verhaftung 1936 eine Widerstandsgruppe, die Losungen an die Wände schrieb und die illegale Zeitung »Rund um den Ochsenkopf« druckte. Manchmal trafen sie sich in einer Kellerwohnung der Auguststraße. Sonst hatte er an die Auguststraße keine besonderen Erinnerungen. Aber seine Gruppe gab sich den Namen SONJA SPITZ, weil sie die fröhliche Sonja nicht vergessen konnten.
Und Ruben Rosenfeld, der »stille, bescheidene Junge aus dem Berliner Getto«, wie Mischket Liebermann, auch eine aus der Grenadierstraße, ihn in ihren Erinnerungen beschreibt, der seit 1933 illegal gearbeitet hatte, der verhaftet wurde und sich unter ein Auto warf, um niemanden zu verraten. Ruben Rosenfeld wurde gerettet, weiter gefoltert und schließlich, weil er aus einer ostjüdischen Einwandererfamilie kam, nach Polen ausgewiesen. Später entkam er in die Sowjetunion. Dieser Ruben Rosenfeld, von dem alle, die ihn kannten, mit Verehrung sprechen, saß noch irgendwo in einem sowjetischen Lager, als seine Genossen die Straße, in der er gelebt hatte, umbenannten. Erst 1956 kam er wieder, als Krüppel. Nach ihm ist nichts benannt. Von ihm haben mir alte Menschen erzählt, seine Genossen. Mit leiser Stimme. Wenn ich das Tonbandgerät vorher abschaltete.
Aber das war in späteren Jahren, als ich schon begriffen hatte, daß ich, um zu erfahren, was in der Auguststraße geschehen ist, auch nach anderen Straßen fragen mußte.
Die Auguststraße war der antimilitaristisch gemeinten Umbenennung entgangen, vielleicht, weil August so ein unverfänglicher, heiter anmutender deutscher Name ist.
August hieß auch der längst verstorbene Mann von Frau O., einer Greisin mit wirrem weißem Haar, die ich schon oft beobachtet hatte, wie sie mit zwei schweren Taschen durch die Straßen schlurfte. Sie ist mir in der Erinnerung geblieben, weil sie die erste der alten Frauen war, der ich in ihre Wohnung folgen durfte, und weil mir diese Wohnung noch heute wie ein surrealistisches Bild vor Augen steht.
Ich weiß nicht mehr, ob ich Frau O. ansprach oder sie mich, jedenfalls durfte ich eine ihrer Taschen tragen und sie begleiten. Sie wohnte auf der der Schule gegenüberliegenden Seite der Auguststraße, ihre Wohnung erreichte man vom Hof über eine kleine Treppe. War es überhaupt eine Wohnung? Es war ein Loch, feucht und muffig, vollgerümpelt mit allen möglichen unbrauchbaren Dingen. Frau O. machte sich vor meinen Augen daran, den Inhalt ihrer Taschen auf dem Fußboden auszubreiten und zu sortieren, es waren Lumpen und Flaschen, die sie aus den Mülltonnen der Umgebung zusammengeklaubt hatte. Vom Verkauf dieses Abfalls lebte sie, erzählte sie mir, denn die Rente sei zu gering, und August, ihr verstorbener Mann, hätte alles Ersparte versoffen. Und die Kinder, von denen wolle sie gar nicht erst reden. Dabei wären sie einmal wohlhabend gewesen, August hätte einen Fischstand in der Markthalle besessen. Und vor dem Krieg hätten sie in der Nummer 66 gewohnt, im Vorderhaus, wo die Konditorei Wachsmuth war. Aber das Haus sei abgebrannt, und da hätten sie diese Bude hier zum Übergang bekommen, die Übergangszeit dauere jetzt schon über dreißig Jahre. Man müsse sich eben selber helfen. Und sie sei zufrieden, da draußen vor dem Fenster könne sie Tomaten züchten, und an Sommerabenden könne man auf der Treppe zum Hof gemütlich sitzen, man müsse sich eben einrichten. Sie zum Beispiel brauche fast gar nichts außer Essen zu kaufen, sie brauche bloß aufzuheben, was andere wegschmissen.
Jede Fläche in der Wohnküche, der linoleumbezogene Küchenschrank, der Tisch mit der abgewetzten Wachstuchdecke, die Stühle und Hocker, alles war vollgestellt mit Tassen ohne Henkel, mit angeschlagenen Blumenvasen, Porzellanfiguren, denen die Nase oder ein Arm fehlten, und anderem Zeug. Vor allem aber irritierte mich ein kleiner Plastekosmonaut, der in verschiedenen Farben überall auftauchte. Er hing an der Lampe, und ein Dutzend von seiner Art stand aneinandergereiht auf dem Küchenschrank, das Bord über dem Waschbecken war mit blauen und rosa Plastekosmonauten belegt, und am Fenster hing eine ganze Traube Plastekosmonauten in Gelb, Grün, Rosa, Blau und Orange.
Frau O. bemerkte meinen Blick und erzählte mir stolz, sie habe in der Linienstraße am Studentenklub einen ganzen Karton solcher Kosmonauten gefunden, da sei ein Büro von der FDJ gewesen, die hätten solche Kosmonauten für das Jugendfestival verkauft, das sei nun vorbei, und die Kosmonauten wären ihre. Ob sie mir einen schenken solle. Ich habe tatsächlich so einen himmelblauen Plastekosmonaut von Frau O. aus der Auguststraße mitgenommen, und noch lange lag der in der Spielzeugkiste meiner kleinen Tochter und erinnerte mich an Frau O., die ich aber auch sonst nicht vergessen hätte. Sie war die erste gewesen, die mir von den Kindern im Haus Nr. 14/16 erzählte. Sie hatte sie gesehen. Natürlich hatte sie die Kinder gesehen, erzählte sie arglos. Schließlich war sie schon im Jahre 1929 in die Auguststraße gekommen, weil sie August O., diesen Suffkopp, heiraten mußte. Wäre sie doch in Birkenwerder geblieben, wo sie hingehörte.
Aber die jüdischen Kinder konnte jeder sehen, die waren ja nicht unsichtbar. Die sind ganz normal zur Schule gegangen und haben Lärm auf der Straße gemacht wie alle Kinder. Zuerst jedenfalls. Als dann das mit Hitler und den Juden immer schlimmer wurde, sind auch die Kinder irgendwie stiller geworden. Die kamen kaum noch raus aus ihrem Haus. Da waren dann auch noch ganz kleine, die noch nicht laufen konnten. Mittags wurden sie auf dem Balkon des roten Schulhauses, der Nummer 13, ins Freie gelegt. Dann waren die Kinder weg.
»Wann?« fragte ich. Und: »Wo waren die Kinder dann?«
Frau O. warf mir einen merkwürdigen Blick zu und schwieg. »War das Haus dann leer?« fragte ich.
Leer war es nicht, erfuhr ich. Dann kamen alte, ganz hinfällige Greise. Manche mußten hineingetragen werden. Immer neue kamen. Fast jeden Tag. Und andere wurden abgeholt. Zum Schluß wurden sie alle abgeholt.
»Wohin?« Wieder dieser merkwürdige Blick.
»War das Haus dann leer?« Ich bohrte weiter.
Frau O. erinnerte sich, daß das Haus nie ganz leer war. Juden waren in den letzten beiden Kriegsjahren nicht mehr dort gewesen. Die waren alle verschwunden. Auch die jüdischen Nachbarn aus den anderen Häusern der Auguststraße. Hier haben ja in jedem Haus Juden gewohnt. Wer sagt, er erinnere sich nicht, lügt. In der Nummer 17 war die Frau Link so eine Art Hausmeisterin. Ihr Mann hat auch dort gearbeitet. Die Nummer 17 war ja so ein Bürohaus von den Juden. Die Links sind erst sehr spät weggekommen. Frau Link hatte eine Schwester, auch eine Jüdin natürlich, die hieß Frau Ruben und war Hausmeisterin in der roten Schule, der Nummer 13. Das war eine jüdische Mädchenschule. Aber die war schon vor dem Rußlandfeldzug geschlossen, die wurde Lazarett, und die Nonnen aus der Großen Hamburger Straße haben das Lazarett betreut. Frau Ruben, die Hausmeisterin, war da schon lange weg. Die und Frau Link hatten aber noch eine dritte Schwester, die mit einem Nazi verheiratet war. Die wohnten in der ersten Etage der Nummer 69, da, wo Margarinefabrik dransteht. Die hießen Goldmann. Goldmann klingt jüdisch, aber der Mann war in der SA, und die Frau tat dann so, als ob sie mit dem Jüdischen gar nichts zu tun hatte. Die hat ihre Schwestern nicht mal mehr gegrüßt. Sie hat überlebt. Jeder in der Auguststraße kannte die drei Schwestern Link, Goldmann und Ruben.
Ich solle doch mal die Else Wierschke fragen, die wohne in der Nummer 17. Damals hätte ihr der Lebensmittelladen in der 18 gehört, den gebe es nicht mehr, aber Else Wierschke wüßte Bescheid. Die würde alle kennen, die hier mal gewohnt haben.
»War denn das Haus nun leer«, fragte ich wieder.
Leer sei es nicht gewesen, die Hitlerjugend hätte noch darin gehaust. Und der Lehmann, der alte Nazi, das einarmige Scheusal, hätte die Jungens getriezt. Wie klein der gewesen sei, als die Russen kamen. Wie die meisten Nazis hier in der Auguststraße. An der Ecke zur Kleinen Auguststraße hatten die Rosenbergs gewohnt, auch keine Juden, ganz und gar nicht. Der sei dicker Nazi gewesen, und die Frau Köchin bei Hitlers Leibstandarte. Als dann alles vorbei war, hätten die sich an die Russen gehalten und wollten wieder bestimmen, wo es langgeht. Der Rosenberg hätte die Frauen zusammentreiben wollen, damit sie den Koppenplatz enttrümmern, den Bunker wegräumen. Aber der hätte sich nur einmal getraut, den Mund aufzumachen. Frau O. freute sich bei der Erinnerung, wie die Frauen es dem gegeben haben. Man wußte ja, wer Nazi war. Waren ja nicht so viele. Der Lehmann, sagte sie, sei erst zwei Jahre nach dem Krieg abgehauen.
»Also saß im Haus Auguststraße 14/16 zum Schluß die Hitlerjugend?« fragte ich.
Aber die gesprächige Frau O. fand, sie hätte nun genug erzählt, und außerdem argwöhnte sie inzwischen, ich wolle sie ausfragen.
Ich habe sie noch öfter besucht, und jedesmal freute sie sich, aber über die Juden in ihrer Straße zu sprechen, hatte sie keine Lust mehr. Drei oder vier Jahre nach unserer ersten Begegnung fand ich ihre Wohnungstür aufgebrochen und angelehnt. Ich ging hinein, da waren noch ihre Möbel, ihre Lumpen und sogar ihre Plastekosmonauten und die bunten Postkarten auf den Konsolen, von denen aber, wie ich sah, keine an sie geschrieben worden war. Die Küche und der dahinter liegende Schlafraum waren noch unordentlicher als sonst, als hätte sie jemand durchsucht, aber nichts gefunden, was des Mitnehmens wert gewesen wäre. Auf dem Herd schimmelten noch Speisereste, aber ich begriff, daß Frau O. nicht wiederkommen würde.
Ich war ihr dankbar, denn sie war die erste, die zu mir von den Kindern gesprochen hatte. Ihre Erinnerung war neben den Eintragungen in den Adreßbüchern für lange Zeit das einzige Zeichen, daß es das Kinderheim AHAWAH wirklich gegeben hatte. Denn andere Nachbarn, die ich auf der Straße ansprach, bei denen ich klingelte, wußten nichts davon.
Sie erzählten mir, was für Läden es in der Auguststraße gegeben hat, sie wußten genau die Fassaden der Häuser zu beschreiben, die es nicht mehr gab, sie zeigten mir Fotos ihrer im Krieg gefallenen Söhne und Männer, sie erinnerten sich sehr gut an bestimmte Tage, zum Beispiel an den 22. April 1945, als mindestens drei Keller in der Straße verschüttet wurden und ein batteriegetriebenes Postauto, ein sogenannter Suppentriesel, mit der Schnauze nach unten auf der Kreuzung Auguststraße/Artilleriestraße in einen Bombentrichter fiel und merkwürdigerweise wochenlang dort liegenblieb. Und an den zweiten Mai erinnerten sie sich, als die Russen kamen. Eine Frau, die bei Kriegsende neun Jahre alt war, damals wohnte sie in der Kleinen Auguststraße, erzählte mir, ihre Mutter hätte sie immer gewarnt vor den Russen, die würden kleine Kinder mit der Zunge an den Tisch nageln. Als die fremden Soldaten dann am 2. Mai an der Kellertreppe standen und sie hochkommen mußten, verging das Mädchen fast vor Angst. Und dann war es wie in den späteren Lesebuchgeschichten: Der Russe ließ sein Gewehr sinken, als er das blondzöpfige Mädchen sah, streichelte mit seiner rauhen Hand dessen Gesicht und schenkte ihm eine Büchse Ölsardinen. Nein, hier in der Auguststraße taten die Russen keinem etwas. Damals jedenfalls nicht. Und mitten auf der Straße lag ein totes Pferd, da schnitten die Frauen sich mit Küchenmessern Scheiben ab. Aber auch diese Frau konnte sich nicht an das Kinderheim AHAWAH erinnern.
Auch das Ehepaar Stange nicht, das direkt dem Eingang zum Haus 14/16 gegenüber wohnte. Seit 1931. Zuerst wollten sie gar nicht mit mir sprechen, sie wüßten auch nichts, weil sie nie Zeit hatten, auf die Nachbarn zu achten. Aber ich sprach Frau Stange, die oft am Fenster ihrer Parterrewohnung saß, immer wieder an, denn andere Nachbarn, auch Frau O., hatten mir gesagt, wie lange das Ehepaar schon in dieser Wohnung lebte. Eines Tages grüßte ich Frau Stange von Frau Zimmer, einer in dieser Gegend sehr geachteten Persönlichkeit aus der Sophien-Gemeinde, und sie lud mich doch in ihre Wohnung ein. Ihr Mann, der einen Schlips trug und sein dünnes Haar streng gescheitelt hatte, blieb distanziert. Etwas schien ihm an meinem Vorhaben nicht geheuer. Reserviert hörte er zu, wie seine Frau plauderte, die im Grunde froh war, eine Abwechslung zu haben. Ja, an die Links erinnere sie sich. Nette Leute. Und an die Loszynskis oder Loschinskis, die hätten auch in der Nummer 17 gewohnt. Der Herr Loszynski oder Loschinski war beim Katasteramt der Jüdischen Gemeinde. Von denen hätten sie das Klavier. Und den Blick des Mannes bemerkend, fügte sie hastig hinzu: teuer gekauft. Eines Morgens waren bei Loszynskis die Jalousien runter. Weg, die ganze Familie.
Und die alten Leutchen im Altersheim in der Großen Hamburger Straße. Die guckten immer aus dem Fenster, wie das bei alten Menschen eben so ist. Sie selbst sitze ja auch gern mal und gucke. Aber eines Tages waren da keine Köpfe mehr hinter den Scheiben. Man mußte doch dort vorbei, wenn man zur S-Bahn ging. Wann das gewesen sei, daran erinnere sie sich nicht. Für Zahlen habe sie kein Gedächtnis. Ja, auch an die Goldmann-Familie erinnere sie sich genau. Der Mann war bei der SA. Die hatten drei Kinder. Der Große war sogar Soldat. Das Mädel war so ’ne Dünne, der sah man das Jüdische von der Mutter her an. Wie die das gedreht haben, daß die Frau Goldmann unbehelligt blieb und keinen Stern tragen mußte wie ihre Schwestern und daß der Goldmann sogar Uniform trug … Das war doch nicht rechtens. Aber niemand hat es gemeldet. Das nicht. In der Auguststraße hat keiner den anderen angezeigt. Vorher nicht und nachher nicht. Da sind manche in die Partei gegangen, die waren vorher in der anderen.
Der Mann räusperte sich. Frau Stange schwieg erschrocken.
Ich wollte, daß sie weiterredete, und fragte, was mir einfiel: nach dem Rabbinerseminar von Adass Jisroel in der Artilleriestraße.
Doch, sie hätten gewußt, daß da Juden waren. Man sah es ja an den Bärten. Von der Kristallnacht hätten sie nichts mitgekriegt, nein. In der Auguststraße war da nichts los. Nur ihr Günther, der Kleine, der 34 geboren wurde, der ist am nächsten oder übernächsten Tag mit dem Dieter aus dem Nachbarhaus losgezogen, und eine wütende Frau brachte die Kinder am Schlawittchen zurück. Da hatten der Bengel und sein Freund in der Artilleriestraße von den Fensterbrettern der Kellerwohnungen die Blumentöpfe auf die Straße geschmissen, und mit ihren kleinen Füßen hatten sie gegen die Türen getreten. »Die dachten wohl, da wohnen Juden«, erzählte Frau Stange lachend. »Der muß was mitgekriegt haben von der Kristallnacht, Kinder haben doch ihre Augen überall.«
Sie selbst konnte ihre Augen nicht überall haben, von dem Kinderheim wüßte sie nichts, versicherte sie immer wieder.
Ich sah, daß dem Mann das Gespräch immer weniger behagte. Von einem solchen Heim hätten sie niemals etwas gehört, bestätigte er. Und ob da drüben in dem Haus nun Kinder oder alte Menschen gewohnt hätten, darum hätten sie sich einfach nicht gekümmert, das sei doch auch nicht ihre Angelegenheit gewesen.
Ich blickte aus Stanges Wohnzimmerfenster. Man sieht von dieser Stelle durch den Torweg auf mein altes Schulhaus. Aber beide versicherten, nie bemerkt zu haben, was da vor sich ging. Und der Mann war Soldat gewesen. Als einer der ersten aus der Auguststraße wurde er eingezogen. Ich fragte ihn nach seinen Kriegserlebnissen. Zu meiner Überraschung, ich hatte keine Antwort erwartet, wurde er lebhaft.
Jawohl, er sei Soldat gewesen und könne beurteilen, was an dem dran sei, was man heute der Wehrmacht und überhaupt den Deutschen vorwirft. Vielleicht seien Unkorrektheiten vorgekommen, aber das hätte ja gar keiner gewußt. Er zum Beispiel war lange Zeit in Warschau im Lazarett. Da ist er auch mal an dem Ghetto vorbeigegangen, aber was da hinter den Mauern losgewesen sei, hätte man nicht erfahren. Wozu also diese Vorwürfe. Er könne sich schon denken, was meine Fragerei bezwecken solle. Er habe aber ein reines Gewissen und seine Frau auch. Er habe den ganzen Rußlandfeldzug mitgemacht. Bis nach Welikije Luki sei er gekommen. Immer korrekt, immer anständig. Weder er noch seine Kameraden müßten sich irgendwelche Greueltaten vorwerfen. Alles Propaganda. Aber die Russen!
Herr Stange stand auf und winkte mich ins Nebenzimmer, wo er mir einen dunkelbraunen Schreibtisch mit Löwenfüßen zeigte. Plötzlich erregt und bitter, wies er auf sorgfältig ausgebesserte Furnierschäden an der Seite. »Wissen Sie, wer das war? Die Russen. Wissen Sie, was die gemacht haben? Die sind im Mai 1945 in unsere Wohnung gedrungen, meine Frau war mit den Kindern im Harz bei ihrer Mutter, ich stand noch im Felde. Da haben die eine Kommandantura aus unserer Wohnung gemacht. Unser Schlafzimmer haben sie einfach auf den Hof gestellt. Kirschbaum, poliert, ein Schlafzimmer. Auf den Hof. Dem Regen ausgesetzt. Und hier, in den Schreibtisch haben sie Nägel reingeschlagen, hier an der Seite, für die Kalaschnikow, einfach so. Was müssen das für Menschen sein, die so etwas fertigbringen. Nein, korrekt waren die Russen nicht zu uns Deutschen.«
Meinen Notizen nach fand dieser Besuch bei dem Ehepaar Stange im Mai 1977 statt. Dreihundertvierundachtzig Monate nach Kriegsende schmerzte das Loch im Furnier seines Herrenschreibtisches den Herrn Stange aus der Auguststraße mehr als alles andere, was ihm im Leben widerfahren war, mehr als die Löcher in seinem Gedächtnis.
Ich verabschiedete mich, aber es war nicht mein letzter Besuch bei den Stanges, deren Fenster heute, während ich das schreibe, mit Brettern vernagelt sind, weil in der Auguststraße 70 niemand mehr wohnt.
Ich begann, mir nach meinen Besuchen in der Auguststraße Notizen zu machen, ich hielt die Gespräche mit den Nachbarn fest und die Veränderungen in der Straße. Allmählich traten unter dem schlechten Putz und der Tünche der Nachkriegsjahre alte Inschriften wieder hervor:
Leitern – eigene Herstellung
Tapetenhaus – Gebrüder Untermann
Die feuchten Mauern gaben ihre Geheimnisse preis, und ich wußte, daß ich wiederkommen würde in die Auguststraße, fragen und zuhören, bis das Schweigen, das über dem Haus lag, aufgehoben sein würde.
Manchmal kam ich monatelang nicht in die Auguststraße, dann aber war ich wieder ganze Tage dort, und manche Nachbarn kannten mich schon, manche tranken Kaffee mit mir, zeigten mir die Briefe ihrer Kinder und wollten wissen, was mir ihre Nachbarn erzählt hätten. Über das Haus erfuhr ich lange Zeit nichts Neues. Aber meine Notizbücher und Mappen füllten sich. Mir blieben die Archive und Bibliotheken, mir blieb ein Stapel alter Gemeindeblätter, die die Bibliothekarin der Jüdischen Gemeinde mir auslieh, und mir blieb eine Broschüre, die ihr Mann von einem Symposium über Jüdische Krankenhäuser mitbrachte. Ich versuchte zu verstehen, was die Vorgeschichte des Hauses Auguststraße 14/16 gewesen war.
Vom Hekdesch zum Krankenhaus
Jüdische Gemeinden, die sich durch die Jahrhunderte immer wieder Verfolgung, Beschimpfung, Demütigung ausgesetzt fanden, konnten nur bestehen, indem sie sich als soziale Gemeinschaften verstanden, nicht nur durch den Glauben vereint, sondern auch durch die Verantwortung füreinander.
Zedakah ist ein hebräisches Wort und heißt Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in einem. Zedakah ist eine Gerechtigkeit, die natürliches und soziales Unrecht ausgleicht. Wer im Sinne der Zedakah handelt, ist ein Zadik, ein Gerechter.
Ein jüdisches Krankenhaus gab es in Deutschland schon um 1210 bei Regensburg. Seit dem 15. Jahrhundert entstanden dann viele solcher Häuser, nicht nur in größeren Städten. Oft waren sie nur eine Art Quarantänestation für Aussätzige, ähnlich den Pesthäusern des Mittelalters.
Die jüdische Ethik, der Gedanke der Zedakah, gebot, die Kranken zu besuchen, sie zu pflegen. Neben diesen Hospitälern gab es auch immer bescheidene Häuser, manchmal nur Stuben, die fremden Glaubensgenossen, und nicht nur solchen, Herberge boten. Auch arme Gemeindemitglieder konnten hier, an diesem Hekdesch genannten Ort, Obdach und Pflege finden.
Die sich für das Hekdesch, aber auch für andere Kranke verantwortlich fühlenden Gemeindemitglieder bildeten die Gesellschaft der Krankenbesucher, die Chewra Bikur Cholim.
Ein Grundgedanke jüdischer Krankenpflege ist die Zuwendung. Im Talmud heißt es:
»Du mußt den Kranken notfalls hundertmal am Tag besuchen, und allein das Interesse, das man ihm entgegenbringt, kann ihm Gutes tun.«
Die Krankenbesuchsgesellschaft gab es in Berlin schon im Mittelalter. Das erste Hekdesch war um die Mitte des 16. Jahrhunderts westlich des heutigen Alexanderplatzes zu finden, zwischen der ehemaligen Gollnow- und der Landwehrstraße. Aber jüdische Geschichte ist eine Geschichte von Verfolgung und Vertreibung. Hundert Jahre lang gab es keine Juden in der Mark Brandenburg, keine Hekdesch, keine Chewra Bikur Cholim …
1671 begann die neuere Geschichte der Jüdischen Gemeinde Berlins, nachdem Friedrich Wilhelm von Brandenburg, genannt der Große Kurfürst, das »Edikt wegen 50 aufgenommener Schutzjuden, jedoch, daß sie keine Synagoge halten«, erließ. Als ein Jahr später seine Landsleute gegen die Ansiedlung der reichen, aus Wien vertriebenen Familien protestierten, meinte der Große Kurfürst, die Juden seien »uns und dem Lande nicht schädlich, sondern vielmehr nutzbar«.
Also durften sie bleiben, ihre Rechte wurden je nach der politischen Lage und der Laune des jeweiligen Herrschers in den folgenden Jahrhunderten eingeschränkt oder erweitert, aber in Berlin konnte die Jüdische Gemeinde sich etwa ab 1700 niederlassen. Auch das Recht, eine Synagoge zu errichten, hatte die Gemeinde schließlich für 3000 Taler vom König gekauft, und seit 1714 gab es sie in der Heidereuthergasse. Die Synagoge wurde im zweiten Weltkrieg zerstört, aber sie stand noch, erst nach dem Krieg wurde sie abgerissen. Heute liegt ein Parkplatz ungefähr dort, wo die Heidereuthergasse die Rosenstraße und die Spandauer Straße miteinander verband.
Um 1703 wurde wieder ein Hekdesch errichtet. Das stand in einer schmalen Gasse zwischen der Kloster- und der Rosenstraße. Im Statut dieses Hekdesch von 1744 heißt es, wenn, »was Gott verhüten möge, ein Fremder kommt« oder auch ein Bedürftiger aus der eigenen Gemeinde, »der wert darin gebracht«. Er muß »sein gut Bett weiß überzogen« vorfinden. Am Bett soll ein Schlafrock hängen. Ihm steht Essen zu, die Hilfe eines von der Gemeinde beauftragten Arztes und Medizin, die ein Bote aus der Apotheke holen soll. »Und wenn der Vorsteher befindet, daß der Kranke eine gefährliche Wunde oder Krankheit hot, so ret der Arzt selber, man soll noch mehr Aerzte nehmen. Mit einem Wort an kein geld wird nischt gespahrt.«
Zedakah ist eine Gerechtigkeit, die natürliches und soziales Unrecht ausgleicht.