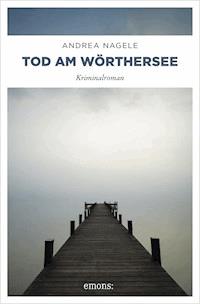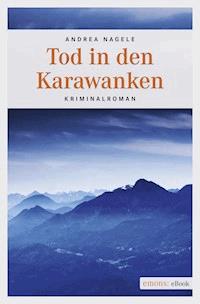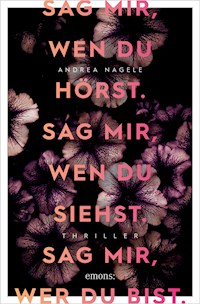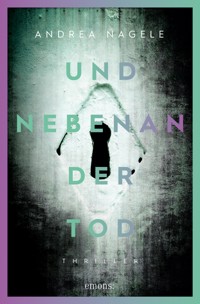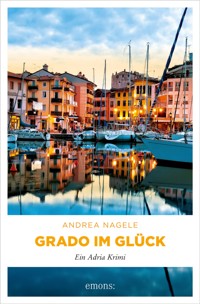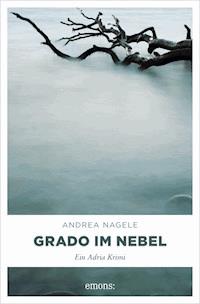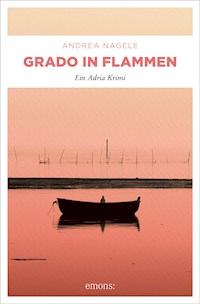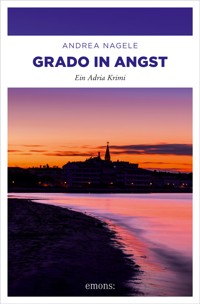Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Auge des Sturms Ein Junge wird Zeuge eines Mordkomplotts. Am nächsten Tag ist er spurlos verschwunden. Während die Polizei um Maddalena Degrassi fieberhaft nach ihm sucht, bricht ein verheerender Wirbelsturm über die Lagunenstadt herein und stürzt den idyllischen Adria-Ort ins Chaos. Eine Leiche und mysteriöse Knochenfunde geben Rätsel auf – und der Angst sind keine Grenzen gesetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Andrea Nagele, die mit Krimi-Literatur aufgewachsen ist, leitete über ein Jahrzehnt ein psychotherapeutisches Ambulatorium und betreibt heute eine psychotherapeutische Praxis in Klagenfurt. Mit ihrem Mann lebt sie in Klagenfurt am Wörthersee und in Grado.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
©2019 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: mauritius images/Etabeta/Alamy Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-487-2 Ein Adria Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Für Tobi, neben dem sich jeder Sturm wie ein Lüftchen anfühlte (1989
Tag 1
1
Der Himmel über Grado trug ein so tiefes Grau, dass er dunkel wirkte, dabei hatte der Abend noch gar nicht begonnen.
Emmanuele konnte sich Zeit lassen, der Supermarkt hatte noch eine Weile geöffnet.
Mit überkreuzten Beinen saß er auf einem abgebrochenen Stück Mauer und atmete den Geruch von Katzenpisse und scharf riechendem Unkraut ein. Nonna Marbella hätte den Namen sicher gekannt und aus Blüten, Blättern und Wurzeln vielleicht einen Tee gebraut. »Jeder Teil einer Pflanze birgt sein eigenes Geheimnis«, sagte sie immer. Meistens aber schmeckten diese Aufgüsse giftig, und schon beim Gedanken daran ekelte sich Emmanuele.
So wenig er Nonnas angeblich heilende Tees mochte, so sehr sehnte er sich danach, sie wieder im Wohnwagen vor der Kochplatte stehen zu sehen, sie in einer Sprache Lieder singen zu hören, die er nicht verstand.
Ihr wäre es auch gelungen, in seinem Streit mit den anderen Jungs aus der Wohnwagensiedlung zu schlichten, und mit großer Wahrscheinlichkeit hätte sie ihm geraten, die Finger von Susanna zu lassen.
Ob er allerdings diesen Rat beherzigt hätte? Emmanuele war sich da nicht so sicher. Nicht umsonst erzählte man sich, dass er ein sturer Kerl sei.
Unglücklich kramte er die Zigarettenschachtel aus der Tasche seiner Jeans und zog die letzte Kippe heraus. Mit plötzlichem Zorn zerdrückte er das leere Päckchen in seiner Hand und schleuderte es in den Rinnstein. Dabei fiel ihm auf, dass der Asphalt Risse hatte, so trocken war es in den letzten Wochen gewesen.
Der Schein der Feuerzeugflamme erhellte kurz sein scharfkantiges Gesicht.
Flammen. Sie hatten Nonna Marbella verbrannt, jetzt wartete ihre Asche in einer Urne auf der Anrichte seines ältesten Bruders auf die Ewigkeit. Er bezweifelte, dass das Wissen darum seiner Oma zu Lebzeiten behagt hätte.
Er blickte aufs Meer. Die schweren Wolken schienen sich noch weiter gesenkt zu haben. Durch die Äste der Pinien schimmerte das Wasser, es wirkte nahezu schwarz und dehnte sich bis zum Horizont. Auf den Wellen wirbelte schmutziger Schaum. Die Vögel in den Baumkronen machten Radau, und das Keppeln der Möwen am Strand tönte lauter als sonst.
Tiere spürten als Erste ein aufziehendes Unwetter, das wusste er von Nonna Marbella. Auch Schlimmeres erahnten sie, lange bevor die Menschen es bemerkten.
Wie viele andere, so war auch seine Familie nach dem großen Erdbeben in Umbrien nach Norden, in sicherere Zonen, geflüchtet. Mit neuen Erdstößen rechnete Emmanuele aber nicht, auch wenn die Vögel sich merkwürdig verhielten. Schon eher mit einem heftigen Regen, der nun jederzeit über Grado hereinbrechen konnte. Vielleicht sollte er einen Zahn zulegen, um trocken in den Supermarkt zu gelangen.
Es war unglaublich schwül. Das T-Shirt klebte Emmanuele am Rücken und an der Brust, das Hoodie hatte er sich um die Hüfte gebunden. Schweiß perlte auf seiner Stirn.
Die Spitze der Marlboro glühte hellrot auf. Emmanuele zog noch ein letztes Mal daran, dann zertrat er den Stummel mit dem Absatz seines schäbigen Schuhs.
Schon lange wünschte er sich weiße Chucks, aber nein, er musste ja die Schuhe seiner großen Brüder auftragen. Langweilige braune Treter.
Der Wind hatte zugenommen. Er rauschte laut in den Pinien. Emmanuele blickte zum Himmel empor und sah Wolken über das Firmament rasen. Es kam ihm so vor, als jagten sie einander in wilder Hatz. Die Spannung, die in der Luft lag, stand kurz vor der Entladung.
Endlich. Ein Tropfen auf seinem Gesicht.
Einen Augenblick lang ersehnte er nichts mehr als einen erfrischenden Regenguss, dann besann er sich seines Auftrags und sprang los.
Er hetzte den staubigen Weg zwischen den Sträuchern entlang und bog auf die breitere Straße ein.
In diesem Moment barsten über ihm die Wolken. Der Regen, beleuchtet von den Scheinwerfern vorbeifahrender Autos, fiel zu Boden wie silberne Schnüre. Emmanuele genoss das herrliche Gefühl. Innerhalb weniger Minuten war er klatschnass.
Die Sohlen seiner abgetretenen Lederschuhe quietschten bei jedem Schritt auf dem nassen Asphalt.
Eine Zeit lang lief er parallel zu den Fahrzeugen, erst als eine ferne Ampel auf Rot schaltete und der Verkehr kurz ins Stocken geriet, drängte er sich zwischen den Autos hindurch auf die gegenüberliegende Seite der Straße.
Der Wind hatte noch weiter zugenommen und blies ihm den Regen ins Gesicht. Emmanuele schlüpfte in sein Hoodie, zog die Kapuze über sein Haar und lief weiter. Nur wenige Menschen hasteten an ihm vorbei, die gebückten Körper und Köpfe unter aufgespannten Schirmen. Von ihm nahm niemand Notiz. Es kam ihm vor, als löste er sich im Wind auf.
Immer stärker wurde der Regen, und Emmanuele versuchte, den Wasserfontänen auszuweichen, die von den Reifen der Autos auf den Gehweg geschleudert wurden. Längst schon fand er es gar nicht mehr lustig, nass durch die Gegend zu laufen.
Einmal rempelte er hart gegen den Rücken eines Mannes, der fluchend die Hand hob.
Ich bin also doch nicht unsichtbar, dachte er und sprang über die nächste Pfütze.
Endlich erreichte er den Eingang des Supermarktes, stieg die wenigen Stufen hinauf und verschwand im Inneren. Wohltuende Kühle empfing ihn. Es verschlug ihm einen Moment lang den Atem, der Supermarkt war gesteckt voll.
Emmanuele klappte sein Handy auf und scrollte zur Liste der Einkäufe.
Wofür seine Mutter das alles brauchte?
Mit dem Geld für die Lebensmittel hätte er Besseres angestellt. Aber seine Mama meinte, für die gesamte Familie zu kochen hieße, sie damit zusammenzuhalten. Dabei nutzten die anderen sie bloß aus.
Nicht nur seine beiden Brüder und deren faule Freundinnen, nein, auch viele Bewohner der angrenzenden Wohnwagen. Mama tat so, als wären Nonna Marbellas selbstlose Aufgaben ansatzlos auf sie übergegangen. Dabei kochte sie gar nicht gut. Zu wenig Salz, zu wenig Zucker und alles schmeckte gleich. Ein langweiliger Einheitsbrei. Emmanuele biss sich auf die Unterlippe, er fand es ziemlich gemein, so über seine Mutter zu denken, selbst wenn es die Wahrheit war. Er wusste, dass sie es nie wirklich leicht gehabt hatte. Vielleicht sollte er ihr einen der Rosensträuße mitbringen, die vorn an den Kassen auf Kunden warteten. Sie würde mit ihm schimpfen, aber er wusste ja, dass ihr Gemaule nur ihre Freude überdecken sollte.
Rasch lud er Salatgurken, Kohlkopf, Zucchini, Tomaten, Auberginen und einen Zwei-Kilo-Sack Kartoffeln in seinen Einkaufswagen. Mit einem Mal begann die Neonbeleuchtung zu flackern, und ein Krachen ließ den Raum vibrieren. Erschrocken sah Emmanuele nach oben.
Sosehr er den Regen vorhin herbeigewünscht hatte, Gewitter waren ihm schon als kleines Kind verhasst gewesen. Die Angst vor Kugelblitzen, die durch geschlossene Räume rollten und alles darin in Brand steckten, hatte ihn früher oft genug in das Bett seiner Eltern getrieben.
Aber nicht nur er, auch andere Kunden wirkten verunsichert. Ein Blick durch die Fensterfront nach draußen ließ erkennen, dass der Regen in wilden Kaskaden vom Himmel fiel und grelle Blitze in rasender Folge das tiefschwarze Firmament zerrissen.
Das Trommeln der Tropfen auf dem flachen Supermarktdach erinnerte Emmanuele an Hagelschauer, und beim Gedanken an den Heimweg zog er fröstelnd seine Schultern unter dem nassen T-Shirt-Stoff nach oben.
Hastig raffte er die restlichen Artikel zusammen, eine Tüte Bohnen, die verlangte Melone, Thunfischdosen und Nudeln. Jetzt noch schnell zu den Putzmitteln im hinteren Bereich und dann nichts wie nach Hause.
Nach der Packung Scheuermittel im untersten Regal des leeren Ganges musste er sich tief bücken, und in genau dieser Position überraschte ihn ein weiterer Knall, lauter noch als der erste. Wieder begann die Beleuchtung zu flackern, diesmal aber breitete sich gleich darauf Dunkelheit aus. Von irgendwoher kam ein Pfeifen, als würde ein riesiges Tier den Atem ausstoßen. Dann verstummten für einen Augenblick alle Geräusche.
Emmanuele sah sich orientierungslos um. Er konnte kaum die eigene Hand vor Augen erkennen.
Also stehen bleiben und abwarten.
Nach ein, zwei Minuten, die ihm viel länger erschienen, hörte er die schrille Stimme einer Verkäuferin, die etwas von einem Blitzschlag schrie, der den Strom lahmgelegt habe. Da sich die automatischen Türen eine Zeit lang nicht würden öffnen lassen, wurden die Kunden gebeten, sich ruhig zu verhalten. Geduld, verlangte die Stimme, Geduld und Ruhe!
Und damit, fast schlagartig, setzte Unruhe ein.
Kleinkinder plärrten, Frauen und Männer redeten durcheinander, riefen über die Reihen hinweg und versuchten, sich gegenseitig in der Lautstärke zu überbieten.
Und draußen tobte der Sturm.
Hunderterlei ging Emmanuele durch den Kopf. Konnte er die Situation ausnutzen? Einer seiner Brüder hatte wegen Diebstahls vor Gericht gestanden, eigentlich geriet die gesamte Sippe immer mal wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Nur er hatte sich bisher nichts zuschulden kommen lassen. Aber das lag eher an mangelnden Gelegenheiten als am nicht vorhandenen Willen.
Doch was gab es hier schon groß zu holen außer Kisten voll mit Bananen, Tiefkühlpizza, Erdbeereis und ätzend riechendem Putzzeug.
Nun, Schuhpaste brauchte er keine, aber vielleicht hatten sie Schuhe? Gegen coole Sneakers hätte er nichts einzuwenden. Er kramte nach seinem Feuerzeug und versuchte, sich im zuckenden Schein der Flamme einen Überblick zu verschaffen.
Nichts zu machen, es war alles zu unübersichtlich.
Erst durch die endlich wieder funktionierende Notbeleuchtung gelang es Emmanuele, sich langsam voranzutasten, aber immer noch gab es Stellen, die in völlige Dunkelheit gehüllt waren. Nicht nur einmal stieß er bei seiner Odyssee gegen sperrige Einkaufswagen.
Dank einer Folge von silbernen Blitzen, die durch die Frontscheiben den Supermarkt erhellten, gelangte Emmanuele schließlich ans Ziel seiner Wünsche. Fast meinte er zu träumen, aber was er sah, war real. Vor ihm stapelten sich, als würden sie nur auf ihn warten, die heiß ersehnten Sportschuhe in verschiedenen Größen.
Emmanuele blickte sich um. Soweit er sehen konnte, war niemand außer ihm in dem schmalen Gang. Mit Hilfe des Feuerzeugs betrachtete er die unterschiedlichen Sneakers. Oh ja, er wollte eine bestimmte Marke, und als er sie fand, pfiff er durch die Zähne. Die hier waren goldrichtig.
Entschlossen bückte er sich und streifte die alten Halbschuhe von den Füßen. Glücklich strich er über den glatten Stoff der weißen Sportschuhe, dann hielt er inne. Leise Stimmen drangen an sein Ohr. Ertappt sah er sich um, doch da war niemand.
Nur eine Stimme, gedämpft durch alle möglichen Kartons, die ihren Ursprung in einer der parallel verlaufenden Reihen haben musste.
Hastig schlüpfte Emmanuele in die Sneakers und band sie zu.
Es mussten zwei sein, dort gegenüber, aber die beiden würden ihm diese Gelegenheit nicht verderben. Allerdings sollte er sich beeilen und, bevor das Licht wieder funktionierte, rasch seinen Standort wechseln.
Leise. Er spitzte die Ohren, wie immer, wenn er versuchte, jedes Geräusch zu vermeiden. Dabei war das Letzte, was er vernehmen wollte, das leise Gespräch im anderen Gang, und doch kam er nicht umhin zuzuhören.
»Wenn du die Angelegenheit nicht geregelt bekommst, geht es dir an den Kragen. Glaube mir, ich meine es ernst.«
War das ein Mann?
»Du willst mir drohen? Ausgerechnet du?«
Und das eine Frau?
»Nein, ich mache dich nur auf die Konsequenzen aufmerksam.«
Die zweite Person antwortete etwas, das Emmanuele nicht verstand. Gleich darauf vernahm er wieder die Stimme der ersten.
»Entweder vernichtest du das Papier und verzichtest, oder ich bringe dich um. Deine Entscheidung.«
Emmanueles Hirn brauchte ein paar Sekunden, bis es verarbeitet hatte, was er da hörte.
War das eine Erpressung? Oder hatte er sich getäuscht, womöglich verhört?
Kündigte da einer kaltblütig einen Mord an?
Was sollte er tun? Er erschrak bis in die Knochen, und sein Herz klopfte wild. Es war, als würde ein Gummiring seinen Kehlkopf umschließen, sich immer fester zusammenziehen und eine Saugglocke ihm den Sauerstoff aus den Lungen pumpen. Krampfhaft nach Luft schnappend, versuchte er durchzuatmen. Ihm war schwindlig vor Angst. Kleine silberne Sterne tanzten vor seinen Augen, Schweiß stand auf seiner Stirn, lief unter dem T-Shirt seine Brust entlang, sammelte sich in seiner Nackenfalte, den Kniekehlen, sogar an den Rändern der neuen Sneakers.
Die Stimmen auf der anderen Seite waren verstummt. Die beiden hatten ihn schnaufen gehört!
Himmel. So etwas passiert nicht real, nur im Fernsehen, versuchte er sich zu beruhigen.
Langsam, mit zunehmender Fassung, wurden seine Gedanken klarer. Er musste hier so schnell wie möglich raus.
Mit angehaltenem Atem schob er die alten Schuhe tief in ein Regal, streifte dabei mit seinem Ellbogen eine Schachtel und hörte ein ohrenbetäubendes Klirren. Irgendwas war heruntergestürzt.
Innerlich verfluchte Emmanuele seine Tollpatschigkeit. Er schlich vorsichtig den Gang entlang und sah ängstlich nach rechts und links.
Niemand zu sehen. Erleichtert atmete er aus.
Aber dann hörte er Schritte. Schuhe mit klackernden Absätzen näherten sich, kamen direkt auf ihn zu.
Emmanuele begann zu laufen. Er sprang um eine Ecke und hetzte in den offenen Bereich des Marktes. Dort war es heller. Fast sofort sah er einen der Jungs aus der Wohnwagensiedlung, aber der war ihm keine Hilfe, mit dem war er bis auf den Tod zerstritten.
Wegen Susanna.
Und jetzt wurde es auch noch hell um ihn. Neongelbes Licht flammte auf. Alles erstrahlte. Giftgrüne Avocados, tiefblaue Pflaumen, knallrote Äpfel und pinke Pfirsiche stachen ihm ins Auge. Geblendet von dem unerwarteten Farbenrausch in der Obst-und-Gemüse-Abteilung, kniff er die Lider zusammen, um sie gleich darauf wieder aufzureißen.
Kunden schoben ihre Einkaufswagen an ihm vorbei.
Wo waren die beiden von vorhin? Hatten sie sich unter die Leute gemischt?
Die kalte Angst, die ihn gepackt hatte, ließ ihn nicht los.
»Sie haben die Kassen geöffnet, die Scanner funktionieren wieder«, hörte er jemanden neben sich sagen.
Ein Hauch von Normalität.
Emmanuele begann sich rücksichtslos seinen Weg zu bahnen, rempelte ungeniert nach allen Seiten.
Endlich war er im Kassenbereich angelangt. Die Angestellten, mit einer raschen Überprüfung des Kassenstandes beschäftigt, ignorierten ihn vollständig. Das Klimpern der Münzen hallte überlaut in seinen Ohren, immer noch nahm er seine Umgebung viel zu intensiv wahr.
Schockreaktion, davon hatte er schon gehört.
Endlich gelangte er durch die wieder funktionierende Schiebetür nach draußen.
Die Intensität des Regens hatte etwas nachgelassen, aber der warme Wind von vorhin blies unvermindert heftig. Nach wie vor zuckten Blitze, nur das Grollen des Donners war schwächer geworden. Stellenweise stand das Wasser zentimeterhoch, und Emmanuele hoffte, dass seine Sneakers nicht zu Schaden kamen.
Verdammt, der vollgepackte Einkaufswagen stand ja immer noch vor der Regalreihe mit den Sportschuhen. Mit dem Diebesgut an seinen Füßen konnte er ihn schlecht holen. Und überhaupt, keine zehn Pferde brachten ihn mehr zurück in das Geschäft, in dem er dieses Gespräch belauscht hatte.
Ob seine Mutter ihm diese Geschichte wohl abnahm?
Nie und nimmer. Wenn er ihr erzählte, was er vorhin gehört hatte, wäre sie nur überzeugt, einen kleinen Spinner mehr in die Welt gesetzt zu haben.
»Bursche, warte!«
Die Stimme, die hinter ihm ertönte, hatte er erst vor Minuten gehört.
Emmanuele begann zu laufen. Er rannte schneller, als er es jemals für möglich gehalten hätte, übersprang die tiefen Pfützen, so gut es ging, und preschte weiter.
Nur weg von hier.
Der Wind kam von vorn, riss ihm die Kapuze vom Kopf, auch der Atem wurde ihm knapp. Dabei musste er höllisch aufpassen, denn der Boden war mit Piniennadeln, Blättern und abgebrochenen Ästen übersät und rutschig wie eine Eisfläche.
Klatschende Schritte hinter ihm.
Wurden sie lauter, kamen sie näher?
Verbissen sah er geradeaus, wagte nicht, einen Blick über die Schulter zu werfen.
Emmanuele sprang auf die Straße. Bremsen quietschten, Wasser spritzte. Die Fahrer veranstalteten ein Hupkonzert. Jemand fluchte.
Geduckt hastete er an ruckartig haltenden Autos vorbei, erreichte die andere Straßenseite und rannte weiter in Richtung Meer.
Mit einem Satz nahm er die niedrige Steinmauer, die den Strand von der Straße trennte, und lief durch den tiefen Sand zu den Badehäusern.
Erst als er unter dem schützenden Vordach einer der ältesten Hütten angelangt war, blieb er stehen.
Seine Brust bebte vom Trommelwirbel, den sein Herz veranstaltete, und sein Atem rasselte wie der eines Asthmatikers. Aber hinter ihm war es ruhig. Keine Stimmen mehr, keine Schritte.
Vorsichtig drückte Emmanuele die Klinke der Badehaustür nach unten– und hatte Glück.
Im Inneren roch es muffig, aber das machte nichts. Schnell legte er den Riegel vor und sank auf die schmierige Holzbank. Erst jetzt, mit dem Gefühl, die Welt draußen weggesperrt zu haben, ließ der Schwindel in seinem Kopf allmählich nach, und sein Herzschlag beruhigte sich.
Hier fühlte er sich vorerst sicher, den Verfolger hatte er anscheinend abgeschüttelt. Kurz sehnte er sich die ereignislose Langeweile der letzten Wochen herbei und den ihm nun harmlos erscheinenden Zoff mit den Jungs um Susanna, aber dann zwang er sich zur Konzentration.
Was wäre geschehen, wenn sein Verfolger ihn geschnappt hätte? War ihm wirklich ein potenzieller Mörder auf den Fersen gewesen, oder spielte ihm seine überreizte Phantasie einen Streich?
Nein. Das Gespräch war real gewesen und die ihn verfolgenden Schritte auch.
Vorsichtig linste Emmanuele durch die notdürftig verschalten Planken. Draußen schien alles ruhig zu sein, aber zur Sicherheit blieb er noch eine Weile sitzen.
Eines war ihm klar: Er brauchte Hilfe. Irgendjemandem musste er sich anvertrauen.
Je länger er über die Szene im Supermarkt nachdachte, desto klarer wurde ihm, dass es sich dabei um keines der Abenteuerspiele mit anderen Jungs aus dem Trailerpark handelte.
Aber hatte er den Mut, zur Polizei zu gehen? Bullen standen dort, wo er herkam, per Definition auf der anderen Seite, sie waren Feinde. Aber hier ging es vielleicht um Mord, und schlimmer noch, er war möglicherweise selbst in Gefahr.
Immer noch unsicher öffnete er schließlich die Tür und schlüpfte ins Freie. Vorsichtig sah er sich nach allen Seiten um, vergewisserte sich, allein zu sein.
Immerhin, es hatte zu regnen aufgehört. Himmel, Meer und Sand waren zu einer teigigen bleichen Masse zusammengeflossen, und die Möwen kreischten, als hätten sie Angst, darin zu verschwinden.
Jetzt, da Gewitter und Regen weitergezogen waren, konnte man erkennen, dass der Abend eben erst begonnen hatte.
Das Unwetter hatte viel zu kurz die erhoffte Abkühlung gebracht. Es war wieder heiß, und Emmanuele konnte spüren, wie die Kleidung auf seiner Haut trocknete.
Unschlüssig stapfte er in Richtung der Polizeistation.
Insgeheim beneidete er die Leute, die in dieser Burg arbeiteten. Sie hatten Fenster zum Meer und fuhren Motorräder und schnittige Wagen.
Als er auf den Eingang zuschritt, musste er grinsen. Von wegen schnittig. Ein alter, abgetakelter2CV stand ziemlich allein auf dem Parkplatz.
Er klingelte an der Sicherheitstür und wartete. Das Tor, an dem er halb lehnte, öffnete sich so unerwartet, dass Emmanuele stolperte.
»Nicht so stürmisch.« Ein weißblonder Mann in modisch aussehender Kleidung empfing ihn grinsend.
»Ich möchte eine Aussage machen, ich habe etwas gehört«, sagte Emmanuele und kam sich neben dem eleganten Blonden klein und schäbig vor.
»Komm mit, die Nachtschicht hat gerade begonnen, ich bringe dich zu meinem Kollegen.«
Als sie ein Büro betraten, sah er zuerst nur einen dicken Bauch, auf dem ein kahler Kopf saß.
»Lippi, Besuch.« Der Blonde klatschte in die Hände, sodass der andere Polizist erschrak.
»Ja bitte?«, sagte er, aber es klang wie: »Hinaus!«
»Der Junge hier möchte etwas melden. Und jetzt entschuldigt mich bitte.« Der Blonde verließ das Büro wieder.
Nun waren der Dicke und Emmanuele allein.
»Worum geht es?« Der verschlafene Ausdruck war aus dem Gesicht des Polizisten gewichen, er sah Emmanuele unfreundlich an.
»Im Supermarkt an der Hauptstraße gab es einen Stromausfall. Keine Kasse ging mehr, und es war dunkel.«
»Und weiter?« Der Dicke rieb sich gelangweilt das Kinn.
Emmanuele kam sich blöd vor, er begann zu stottern: »Da… da war einer, der hat zu einer anderen Person… also, er hat gesagt, er würde sie umbringen.« Er holte tief Luft und spürte Röte in seine Wangen steigen. Das war ihm das letzte Mal in der Volksschule passiert.
Der Dicke lachte. »Und das ist alles?«
Das kam davon, wenn man seiner Bürgerpflicht nachging und die Feinde aufsuchte. Es würde ihm eine Lehre sein.
»Ich habe übrigens auch etwas gehört«, fuhr der Dicke genüsslich fort, nachdem er Emmanuele gründlich gemustert hatte. »Und zwar, dass es während des Stromausfalls zu einigen Diebstählen kam. Kannst du mir darüber auch etwas sagen?«
Emmanuele fühlte sich zunehmend unbehaglich. Ohne es verhindern zu können, sah er auf seine Sneakers.
Der Dicke folgte seinem Blick, schaute ihm danach streng in die Augen und knurrte: »Verschwinde.«
Emmanuele sprang auf. Er war froh, das stickige Büro verlassen zu können. So ein Idiot.
Aufgewühlt machte er sich auf den Weg zu den Wohnwagen.
Vielleicht konnte Diego ihm helfen? Zu dem Alten, der aus Südamerika stammte, hatte er halbwegs Vertrauen.
Früher hatte Diego ihm und den anderen Kindern Geschichten vorgelesen, und immer hatte er ihre Fragen ernst genommen und ihnen aufmerksam zugehört, wenn sie selbst zu erzählen begannen. Inzwischen war er sehr alt und auf einem Auge blind. Das Lesen fiel ihm zunehmend schwer, aber die Kinder mochten ihn immer noch, weil er sie nie wie ein lästiges Übel behandelte.
An den Sommervormittagen, wenn es noch etwas kühler war, lief der Alte oft mit einem Lederbeutel über der Schulter durch Grado und bat Touristen und Einheimische, ihm alles Mögliche abzukaufen, und an den Nachmittagen, nach einer ausgiebigen Siesta, bemalte er Blechgeschirr und Kochlöffel aus Holz mit bunten Mustern.
Als Emmanuele, der kurz zuvor einen entsprechenden Zeitungsartikel gelesen hatte, ihn einmal fragte, ob die Farben denn nicht gesundheitsschädlich wären, immerhin würde von diesen Tellern gegessen und aus den Tassen getrunken, hatte Diego geantwortet: »In unserer Welt passiert so viel Schlimmes, da macht ein wenig Grün, Blau oder Rot im Magen nichts aus.«
Kurz bevor er den Trailerpark erreicht hatte, spürte er, dass er beobachtet wurde.
»So warte doch!«, hörte er jemanden rufen.
Aber Emmanuele wartete nicht.
Wie von Furien gehetzt, überquerte er den nahen Parkplatz und rannte auf das große Feld zu, auf dem sich die Wohnwagensiedlung befand.
So schreckliche Angst hatte er nie zuvor in seinem Leben verspürt.
Während er lief, hörte Emmanuele die Schritte des Verfolgers leiser werden. Die Erleichterung überfiel ihn so heftig, dass er in Tränen ausbrach. Er versteckte sich schniefend hinter einem der großen Lkws.
Ein schöner Feigling war er. Zornig wischte er die Nässe aus seinem Gesicht und blickte sich vorsichtig um.
Wie es schien, war er wieder allein.
Wie hatte der Fremde aus dem Supermarkt ihn wiedergefunden? Wusste er, wo er wohnte?
Erst nach geraumer Zeit entschloss er sich, aus der Deckung zu treten und die kurze Strecke zu Diegos Wohnwagen in Angriff zu nehmen. Immer wieder sah er sich um, konnte aber keine Menschenseele entdecken.
Im Inneren des Wohnwagens war es unordentlich. Überall stand mit Farbe angekleistertes Blechgeschirr, und in einem Topf auf der Herdplatte köchelte Essen. Es roch nach gebratenen Zwiebeln und Fisch und ein bisschen nach altem Mann. Emmanuele schüttelte sich.
»Was verziehst du das Gesicht? Fisch reinigt den Magen. Du isst doch mit mir?« Diego, der von draußen hereinkam, warf ihm einen aufmunternden Blick zu. »Gleich gibt es Suppe.«
»Danke«, murmelte Emmanuele und merkte erst jetzt, wie hungrig er war. Ohne sich noch länger zurückhalten zu können, legte er los. »Ich brauche deine Hilfe. Da war ein Mann im Supermarkt, der von Mord gesprochen hat. Er drohte, jemanden umzubringen, wenn der nicht tut, was er will. Ein Brief kam auch vor. Der meinte es ernst.«
»Ach was.« Der Alte winkte ab, er schien nicht beeindruckt. »Es wird viel Unsinn gesprochen, kümmere dich nicht um den Kram anderer Leute.«
»Aber ich habe Angst. Er hat mich gesehen, und er hat mich verfolgt. Zwei Mal, das letzte Mal fast bis hierher. Versteh doch, er weiß, wie ich aussehe. Diego, ich war sogar bei der Polizei, aber die glaubt mir auch nicht.« Wieder musste Emmanuele gegen aufsteigende Tränen ankämpfen.
Diego hatte kurz aufgeschaut. »Du sagst, er hat dich verfolgt? Und du bist sicher, dass das nicht irgendwelche Spaziergänger gewesen sind?«
Emmanueles Augen brannten, seine Glieder fühlten sich vor Erschöpfung schwer an. Immerhin, der Alte schien ihn nicht auslachen zu wollen, und doch blieb ihm jetzt selbst die Antwort im Hals stecken. Was hätte er auch noch tun können, als immerzu zu beteuern, dass er sich nicht irrte?
Resigniert legte er sein Gesicht in die Handflächen.
Als er schließlich den Kopf hob, reichte Diego ihm einen Becher mit Tee und schob auffordernd die Zuckerdose über den Tisch. Sein Gesicht mit den vielen Runzeln und Falten hatte einen ernsten Ausdruck angenommen, und das gesunde Auge blickte ihn forschend an.
»Trink und dann sag mir, wie ich dir helfen kann.«
Als er keine Antwort bekam, fuhr Diego fort: »Nehmen wir mal an, alles ist so, wie du es geschildert hast. Wenn da einer dicht hinter dir her war, dann weiß er jetzt ziemlich genau, wo du wohnst.« Er kratzte nachdenklich sein stoppeliges Kinn. »Vielleicht solltest du heute nicht zu Hause schlafen. Für eine Nacht könntest du bei mir unterkommen. Wenn es tatsächlich einer auf dich abgesehen hat, bist du allerdings auch bei mir nicht sicher. Und durch den Streit mit den anderen Jungs wegen dem Mädchen hast du hier auch keine anderweitige Unterstützung.«
Endlich fühlte Emmanuele sich verstanden.
»Meine Brüder kommen erst in ein paar Tagen von der Baustelle zurück«, sagte er leise, »bis dahin muss ich mich verstecken.«
»Ja. Mein Angebot steht.«
»Danke. Aber hier findet er mich. Einen Ort gäbe es schon, wo ich hinkönnte. Begleitest du mich zu den alten Badehäusern? Dort ist es sicher. Und bitte sag Mama, dass ich heute bei dir übernachte.«
Diego nickte. »Mit deiner Mutter werde ich reden, aber es gibt auch ein Morgen, Junge. Wie geht es weiter?«
Emmanuele zögerte nicht, darüber hatte er bereits nachgedacht. »Gleich morgen früh gehe ich noch mal zur Polizei. Und diesmal lasse ich mich nicht abwimmeln.«
Jetzt schüttelte der Alte den Kopf. »Ich weiß was Besseres.«
Er kramte in einer Tischlade und reichte Emmanuele fünfzehn Euro in drei zerknitterten Scheinen. »Gleich nach dem Aufstehen, am besten noch bevor die Sonne aufgeht, nimmst du den ersten Bus hinauf in den Karst. In Prosecco steigst du aus. Und nicht vorher oder danach.«
Emmanuele sah ihn an, unfähig, etwas zu sagen.
»Eine alte Bekannte von mir, Pulcinella, hat da oben ein Haus. Bleib eine weitere Nacht bei ihr. Dann sehen wir weiter.«
»Aber wenn inzwischen etwas Schlimmes passiert? Ein Mord?«
»Zuerst bringen wir dich aus der Schusslinie. Wenn der Kerl meint, es gäbe einen Zeugen, wird er seinen Plan nicht gleich in die Tat umsetzen. Er wird dich suchen, aber nicht finden. Und damit hoffentlich das Interesse verlieren.«
Diego kritzelte etwas auf einen Zettel und reichte Emmanuele das zusammengefaltete Blatt. »Sag Pulcinella, Diego schickt dich. Übermorgen nimmst du bei Tagesanbruch den Bus zurück. Wie gesagt, ich spreche mit deiner Mutter.«
»Danke«, murmelte Emmanuele. »Und wenn ich zurück bin, gehe ich zur Polizei.«
Nachdem sie ihre Suppe gelöffelt hatten, traten sie vor den Wohnwagen. Die Schwüle war beinahe nicht zu ertragen und die Nacht viel zu dunkel. Nebeneinander stapften sie in Richtung Strand. Der Pfad wurde schmaler, schlängelte sich durch sich bewegendes Gestrüpp, der Wind trug den Geruch des Meeres herüber, das, vom Unwetter aufgewühlt, gegen den Strand donnerte.
Wie gern würde Emmanuele jetzt in seinem eigenen Bett liegen und seinen Kopf, in dem die Gedanken wild kreisten, in den weichen Kissen verbergen. Das aber durfte er nicht.
Dankbar umschloss seine Hand das Geld des Alten. Und den Schein für den Einkauf hatte er auch noch.
»Diego«, begann er, doch seine Stimme klang zittrig, deshalb behielt er für sich, was er sagen wollte.
Aber der Alte verstand ihn auch so. »Emmanuele, es kommt schon alles wieder in Ordnung.«
Vor der Hütte umarmten sie sich. Ein wenig verlegen strich Diego ihm über das Haar, drehte sich abrupt um und stapfte zurück. Einige Zeit noch schimmerte sein abgetragenes Hemd hell zwischen den Hütten, dann war Emmanuele allein.
Seltsam einsam fühlte er sich jetzt, wie von der ganzen Welt verlassen. Die Nacht schien noch dunkler geworden zu sein, der Mond hatte sich hinter dicken Wolkenbänken versteckt. Und das Tosen des Meeres hatte etwas Bedrohliches.
Nein, hier war er sicher.
Entschlossen drückte er die Klinke der Tür nach unten.
Als Emmanuele das Geräusch hörte, war es zu spät.
Zu spät, um sich zu ducken, zu spät, um zu schreien.
Etwas Hartes prallte auf seinen Kopf, aber den Schmerz spürte er glücklicherweise nicht mehr.
2
Nach den starken Regenfällen und Gewittern der letzten Tage sorgt ein Tiefdruckgebiet aus Westeuropa in vielen Gegenden Norditaliens weiterhin für Unwetter. Vor Starkregen, heftigen Windböen und Hagelstürmen wird gewarnt. Abkühlung ist nur kurzfristig zu erwarten, Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit halten an.
Zufrieden las er, was er soeben durch den Äther geschickt hatte. Sollten die Burschen nur wieder die Stirn runzeln und hinter seinem Rücken die Augen verdrehen. Er jedenfalls nahm seine Aufgabe ernst.
Giuseppe, von jedermann Pepi genannt, fühlte sich zu Höherem berufen, und so nahm er in Kauf, dass seine Kollegen ihn ob dieses Anspruchs häufig belächelten. Früher, kurz nachdem er nach einem einjährigen Aufenthalt in Amerika zurück nach Grado, in seine Heimatstadt, gekommen war, hatte ihn ihr mitleidiges Getue gestört, aber inzwischen wusste er es weitgehend zu ignorieren.
Bis heute schwärmte er von der Arbeit beim Wetterdienst an der Ostküste der Vereinigten Staaten, am liebsten wäre er dortgeblieben, doch seine Tätigkeit war nun mal auf das eine Jahr beschränkt gewesen. Eines aber hatte er aus Übersee mitgenommen: sein spezielles Wissen über die Beschaffenheit und Unterschiedlichkeit des Windes in all seinen Erscheinungsformen.
Und hier, im Land der Bora, war er damit am richtigen Platz.
Die meteorologische Station in Palmanova, in der er seit seiner Rückkehr arbeitete, beschäftigte sich naturgemäß mit vielem mehr als nur mit dem Wind. Jede Wetterformation wurde genau berechnet, analysiert und ihre mögliche Auswirkung in passenden Verklausulierungen der Bevölkerung mitgeteilt.
Er aber hatte sich spezialisiert.
»Pepi, der Wind-Fan«, so nannten sie ihn, wenn sie annahmen, dass er sie nicht hören konnte, und grinsten dabei.
Nun, bis auf das Grinsen, das abschätzig war, hatte er nichts dagegen. Er war tatsächlich ein Wind-Fan.
Stürme faszinierten ihn.
In Amerika gab es viele Experten, was Wetterphänomene betraf, auch unter seinen Kollegen. Dort war das selbstverständlich. Hier aber wurde blöd gekichert, wenn er sein ganz spezielles Wissen zum Besten gab.
Nur Isabella war anfangs anders gewesen. Als er begonnen hatte, sich mit ihr zu treffen, zeigte sie sich ganz begeistert von seinen Ausführungen. Sie hatte ihm stundenlang zugehört. Inzwischen aber bat sie ihn immer häufiger, das Thema zu wechseln, wenn er Gefahr lief, sich in seinen Ausführungen zu verlieren. Selbstverständlich kam Giuseppe ihrem Wunsch dann sofort nach, doch insgeheim kränkte es ihn.
Die Einladung zu einem Vortrag in die Gradeser Bibliothek im vergangenen Sommer hatte ihn stolz gemacht, doch der Zeitpunkt war schlecht gewählt. Ausgerechnet das Wetter hatte nicht mitgespielt. Die Sonne brannte gnadenlos vom wolkenlosen Himmel, es war Ferragosto, und niemand interessierte sich für Stürme.
Die Ränge waren erschreckend verwaist geblieben. Bis auf die übliche Handvoll gelangweilter Pensionisten, einen Franziskanermönch, der extra von der Isola Barbana gekommen war, den rührigen Besitzer des kleinen Baumarktes auf der Colmata und Isabella, die aus Loyalität gekommen war, sprach er vor leerem Haus. Der Vortrag war nicht wiederholt worden.
Dabei hatte er viel zu erzählen. Was kaum jemand wusste: Giuseppe war aktives Mitglied des European Storm Forecast Experiment, des Europäischen Unwetter-Vorhersage-Experiments namens »Esotex«. Als einer der verantwortlichen Meteorologen dieser Gruppe übermittelte er für seine Region Daten, die darüber Auskunft gaben, welche Unwetter zu erwarten waren. Ihm, der ungern etwas dem Zufall überließ, war es eine verbindliche Pflicht, die europäische Wetterkarte im Blick zu behalten.
Wie immer, so freute Giuseppe sich auch heute auf das Treffen mit Isabella, er fuhr schneller als sonst.
Der Lufterfrischer in Form eines Apfels spendete süßsauren Duft, sie mochte diesen Geruch, der ihrem Parfum ähnelte.
Was aber war gar so dringend?
So vehement bestand sie sonst selten auf einem Treffen mit ihm. Irgendetwas hatte sie auf dem Herzen, etwas, worüber sie unbedingt mit ihm sprechen wollte.
Vielleicht war sie schwanger? Giuseppe konnte dieser Vorstellung einiges abgewinnen.
Sie hatten vereinbart, sich gleich nach Dienstschluss in der »Casa Bianca« an der Autobahnabfahrt von Palmanova auf ein Feierabendgläschen zu treffen. Er hatte diesen Ort vorgeschlagen, weil er auf dem Rückweg nach Grado lag und sie in der rustikalen Trattoria sonntags manchmal zu Mittag aßen. Das Lokal war sozusagen vertrautes Terrain.
Er bog den Rückspiegel zu sich und kontrollierte kurz, was ihm entgegenblickte. Seine braunen Augen waren leicht mandelförmig, die Nase hatte genau die richtige Länge, und an seiner ovalen Gesichtsform gab es nichts auszusetzen. Einzig seine Lippen könnten etwas voller sein. Automatisch presste er sie zusammen, so lange, bis alle Farbe entwichen war, um den Mund dann zu öffnen. Nun waren die beiden dünnen Striche, die einmal jemand Ist-Zeichen genannt hatte, gut durchblutet und rot.
Zum Glück kann mich hier niemand sehen, dachte er und warf einen übermütigen Kussmund in die Luft. Schon spürte er Isabellas weiche Lippen auf seinen und wie ihr seidiges Haar seine Haut kitzelte. Ein Baby müsste die perfekte Mischung ihrer beider Gene sein. Ein Kind von Giuseppe und Isabella wäre sicher ein Volltreffer.
Fröhlich bog er auf den geräumigen Parkplatz und stellte seinen Fiat parallel zum Weingarten ab. Da er Isabellas kleinen Lancia nirgendwo entdecken konnte, blieb er sitzen. Die schwüle Hitze war auch abends noch unerträglich und nur mit Klimaanlage auszuhalten.
Längst schon war Giuseppe klar, dass die außergewöhnlich hohen Temperaturen der letzten Wochen, verbunden mit der extrem hohen Luftfeuchtigkeit, eindeutige Boten eines herannahenden Unwetters waren. Wann es allerdings Grado und Umgebung erreichen und wie stark es sich entladen würde, war schwer zu berechnen.
Giuseppe aber traute sich durchaus zu, exaktere Aussagen zu machen.
»Bitte«, hörte er in Gedanken den Chef der Meteorologischen Anstalt sagen, »kümmere dich darum, die Daten ordnungsgemäß an den Zivilschutz weiterzugeben. Alles andere ist Hokuspokus.« Nun, klar war jedenfalls, und dazu brauchte er nicht auf seine Erfahrungen aus Amerika zurückzugreifen, dass ein gewaltiger Sturm auf sie zukam.
»Pepi, träumst du wieder von Unwettern?«
Isabellas melodische Stimme riss ihn ins Hier und Jetzt zurück. Sie hatte an die Scheibe geklopft und starrte ihn nun vorwurfsvoll an.
»Aber nein«, er öffnete die Tür und stieg aus, »ich bin nur einige Zahlen der vertikalen Windscherung von heute Nachmittag in Relation zur Temperaturenverteilung durchgegangen, aber das hat mit Unwettern nur indirekt zu tun.«
Ihre Mundwinkel zuckten. Sie trat einen Schritt vom Auto weg und wandte sich ab. Lachte sie etwa?
Seine gute Laune war mit einem Schlag verflogen.
Gemeinsam gingen sie über den Parkplatz und setzten sich vor dem Eingang der Trattoria an einen der Holztische. Isabella kramte in ihrer Tasche.
»Du wirst doch nicht rauchen?«
Sie sah ihn verständnislos an. »Im Freien ist es erlaubt. Hol du uns schon mal ein Glas Malvasia.«
Giuseppe zuckte mit den Schultern. Er ekelte sich vor dem Zigarettengeschmack in Isabellas Mund. Sie wusste es und rauchte trotzdem.
Als er mit dem Weißwein zurückkam, klopfte sie auf die Bank neben sich.
»Pepi, ich halte die Hitze nicht länger aus, sie macht mich krank und hässlich.« Sie tupfte mit einer Serviette über ihre Stirn und nahm einen Schluck Wein.
Das Gegenteil war der Fall. Giuseppe fand, dass sie nicht krank, sondern ausgesprochen gut aussah, das Sommerkleid betonte zusätzlich ihre schlanke Figur.
»Du bist unglaublich attraktiv«, sagte er eifrig. »Warst du beim Friseur?«
»Was soll ich dort bitte schön?« Sie verstrubbelte ihr kurz geschnittenes schwarzes Haar und blitzte ihn zornig an. »Immer redest du irgendetwas daher, du nimmst mich gar nicht mehr wahr. In deinem Kopf schwirren nur Zahlen und Messdaten herum, da ist für nichts anderes Platz. Genau das ist der Grund, weshalb wir miteinander reden müssen, Pepi.«
Giuseppe wusste nicht, was sie meinte. Sie gefiel ihm doch, und er hatte es ihr eben gesagt.
Seine Mutter kam ihm in den Sinn, und ihm fiel ein, dass sie ihn vor ihr gewarnt hatte. »Eine verwöhnte Göre ist das«, hatte sie gesagt. »Überlege dir gut, ob du dich mit ihr einlässt. Das ist eine, die dir auf dem Kopf herumtanzt. Du bleibst in so einer Beziehung immer der Zweite.«
Giuseppe hatte damals gelacht. Die beiden Frauen hatten sich zuvor nicht länger als vier Minuten gesehen. Jetzt zog sich sein Magen schmerzhaft zusammen.
»Was willst du mir sagen?« Seine Stimme klang verzagt, denn langsam begriff er.
»Pepi. Ich mag dich sehr.« Sie nahm seine Hand und drückte sie leicht. »Und eine ganze Weile habe ich mir vorstellen können, dass wir zusammenbleiben. Aber«, ihre dunklen Augen sahen ihn traurig an, »dir muss doch auch klar sein, dass wir zunehmend verschiedene Sprachen sprechen, unterschiedliche Werte und Ziele verfolgen.« Sie verstummte, leerte ihr Glas und sah betreten zu Boden.
Giuseppe registrierte die feuchten Flecken, die sich unter Isabellas Achseln auf dem Sommerkleid ausgebreitet hatten. Diese fürchterliche Hitze.
»Isabella«, sagte er liebevoll, um sie zu besänftigen, »ich bin nun mal ein Mann der Zahlen, so wie du eine Frau der Blumen und Pflanzen bist, aber das heißt doch noch lange nicht, dass es zwischen uns nicht funktionieren kann.«
Isabella arbeitete als Floristin in Grado, und er war stolz darauf, seine Gefühle so gut formuliert zu haben. Bittend sah er sie an.
Sie aber wandte sich ab. Stand auf und nahm ihre Tasche. »Pepi, ich brauche Abstand. Wir werden uns in nächster Zeit nicht sehen, lass mir ein wenig Raum.«
Bevor Giuseppe etwas erwidern konnte, war sie schon auf dem Weg durch den Innenhof hin zum Parkplatz. Zurück blieb ein Hauch ihres Apfelparfums– und ein verzweifelter Giuseppe.
3
Christopher Schumann war bester Laune.
Wieder einmal war es ihm gelungen, jemandem einen Gefallen zu erweisen. Noch dazu war dieser Jemand sein alter Schulfreund Johannes Schröder. Das stimmte ihn besonders fröhlich.
Vor zwei Jahren hatten die beiden sich bei einer Feier zum zwanzigjährigen Jubiläum ihres Abiturjahrgangs wiedergetroffen. Zuvor waren ihre Wege auseinandergedriftet und der Kontakt der einst besten Freunde allmählich eingeschlafen. Hin und wieder hatten sie sich noch eine Weihnachtskarte geschrieben, später sporadisch eine SMS zum Geburtstag. Bis sich auch das erübrigt hatte.
Christopher fand das schade. Ihm waren Freundschaften mit den Klassenkameraden immer wichtig gewesen. Auch nach der Beendigung der gemeinsamen Schulzeit versuchte er, Kontakte nicht abreißen zu lassen, und in den meisten Fällen war ihm das auch gelungen.
Gab es mal was zum Feiern, lud man sich gegenseitig ein. Aber erst seine Anwesenheit machte diese Feste zu etwas Besonderem. Sein mitgebrachtes Bier, seine Weine waren stets von ausgesuchter Qualität, und die von ihm georderten Blumensträuße waren prächtiger als alle anderen.
Christopher wusste, wie man Menschen zufriedenstellte.
Seine Frau Annemarie, mit der er seit der Abschlussklasse zusammen war, konnte das nur bestätigen.
Einen Wermutstropfen gab es jedoch in dieser harmonischen Beziehung. Sie bekamen keine Kinder, sosehr sie sich auch darum bemühten.
Dieses Glück blieb ihnen versagt.
Unzählige Ärzte hatten sie mit dem immer gleichen Ergebnis konsultiert. Christophers Spermien waren aktiv und schwirrten wie kleine lebhafte Würmchen im Pool herum, während Annemaries Uterus und Eileiter geradezu geschaffen zu sein schienen für die Produktion des ersehnten Nachwuchses. Trotzdem wurde sie auf normalem Wege einfach nicht schwanger.
Immer wieder sprachen sie über eine künstliche Befruchtung, auch über eine Adoption, aber immer wieder nahmen sie davon Abstand. Sie waren gesund, es konnte ja jederzeit klappen. Später wäre für diesen Schritt immer noch Zeit. Wie in den meisten Dingen ihres gemeinsamen Lebens waren sie sich auch hierbei einig.
Ja, Christopher und Annemarie waren ein glückliches Paar.
Während Annemarie sich nun mit ihrer Schwester in einer Therme eine Auszeit von ihrem Job als Apothekerin gönnte, verbrachte Christopher, der sich als Jurist in einer großen Kanzlei mit Wirtschaftsfragen beschäftigte, in Grado ein paar Tage mit seinem alten Schulfreund Johannes. Um die bewährte Freundschaft wieder so richtig aufleben zu lassen.