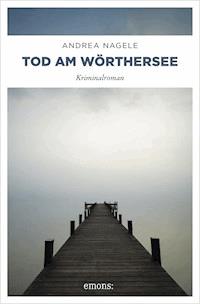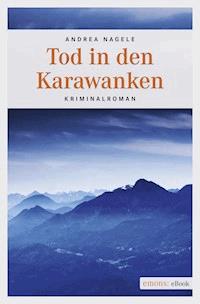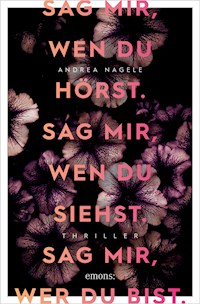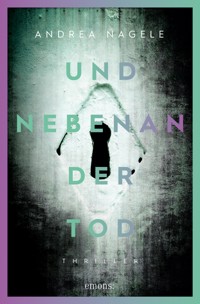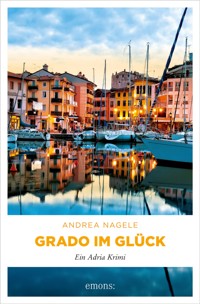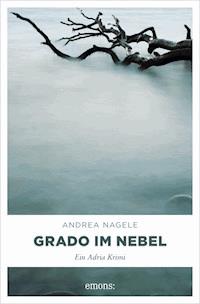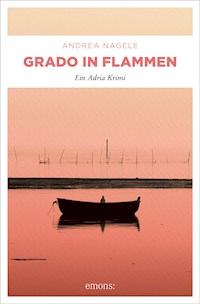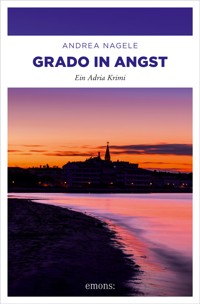Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kommissar Rosner
- Sprache: Deutsch
Zwischen Wahnsinn und bitterer Realität – ein packender Psychokrimi, der Hochspannung garantiert. Helene traut ihren Augen nicht: In der Wiege ihres Sohnes auf der Säuglingsstation eines Klagenfurter Krankenhauses liegt ein fremdes Kind. Doch niemand glaubt der jungen Mutter. Kommissar Rosners Freundin Alice liegt einige Zimmer weiter und gerät immer tiefer in den Sog der Ereignisse. Als sich Helene schließlich zu einer Verzweiflungstat hinreißen lässt, schreitet Rosner ein . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Nagele ist mit Krimi-Literatur aufgewachsen. Sie leitete über ein Jahrzehnt ein psychotherapeutisches Ambulatorium. Neben dem Schreiben betreibt sie eine psychotherapeutische Praxis. Sie lebt mit ihrer Familie in Klagenfurt am Wörthersee und in Grado in Italien. »Kärntner Wiegenlied« ist ihr sechster Krimi.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2017 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: joto/photocase.de
Umschlaggestaltung: Franziska Emons/Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-284-7
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Maxi
Erster Teil
1
Rosner flucht.
Er tut es leise, kaut an seinen Unflätigkeiten und frisst sie in sich hinein. Dabei signalisiert der Schmerz in seinem Magen schon seit Stunden ein »Unverdaulich«.
Das ist dieser Kreislauf, der bald zu Geschwüren führt, denkt er, aber wenn ich nicht fluche, dann platze ich auf der Stelle.
Er versucht sich wieder auf die Akte, die vor ihm liegt, zu konzentrieren, aber schon nach der Lektüre weniger Seiten beginnen die Zeilen vor seinen Augen zu verschwimmen.
Seit Wochen plagt er sich nun mit dieser Sache herum, kommt keinen Schritt weiter.
Der »fröhliche Weinberg«, so hat Rosner, in Anlehnung an ein Lustspiel von Zuckmayer, den Verbrecher zynisch genannt, der seit Längerem Klagenfurt unsicher macht. In mehreren Fällen ist der Maskierte nach Mitternacht in Wohnungen eingebrochen und hat, bei Konfrontation mit den Mietern, auch vor Gewalt nicht zurückgeschreckt. Überhaupt scheint es ihn nicht zu stören, bei seinen Raubzügen beobachtet zu werden. Überaus kräftig, schlägt er auf seine Opfer ein, fesselt sie mit Paketklebeband an Stühle und sucht unverfroren nach Wertgegenständen. Dabei bedient er sich, falls vorhanden, an den Weinvorräten der Wohnungsinhaber, um manchmal den Tatort erst nach Stunden wieder zu verlassen. Mit einem fröhlichen »Habe die Ehre, pfiat Gott« soll sich der Verrückte unter der Sturmmaske jedes Mal verabschiedet haben.
»Jetzt müssen wir uns schon mit auf Umgangsformen Wert legenden Säufern herumschlagen«, knurrt Rosner in Richtung Admira Spahic, die es sich wieder einmal nicht nehmen lässt, unangemeldet die spärlichen Pflanzen, die das Fensterbrett in Rosners Büro verschönen, zu gießen.
Seit dem großen Grillfest duzen sie sich, aber Rosner findet, wohl seiner momentanen Stimmung geschuldet, dass sich der Abstand zwischen ihnen dadurch eher vergrößert hat.
Ein Grillfest im Wintergarten, und das im Dezember.
Es war Alices Idee gewesen.
Zuvor aber hatte Rosner gelitten.
Alice, seine Alice, hatte sich zu einem zänkischen Weib gewandelt.
Eine Nervenschwäche, hatte Rosner, der sich selbst hin und wieder als ausgeglichenen Mann von Welt sieht, vermutet, denn Alice schien nervös, ja geradezu fahrig zu sein. Und fiel nur ein einziges falsches Wort – immer, so lautete der Vorwurf, kam es von ihm –, dann konnte sie aus der Haut fahren, konnte zischen und fluchen.
Und einmal, als er auf seinem Standpunkt beharrte, na gut, er hatte zu laut und vielleicht auch ein bisschen zu nachdrücklich darauf bestanden, war sogar ein Teller geflogen.
Dabei schien ihr körperlich nichts zu fehlen. Die magere Alice mit den spitzen Knochen hatte sogar zugelegt, ein wenig runder war sie geworden, und Rosner gefiel das gut, aber dafür brach sie öfters in Tränen aus, und wenn er sie trösten wollte, wegen was auch immer, verließ sie nicht selten den Raum und ließ die Tür hinter sich ins Schloss krachen.
Nein, so wäre das nicht weitergegangen. Das wollte er nicht. Er, der die Dinge gern an sich herankommen lässt, denn viel erledigt sich dadurch von selbst, hatte beschlossen, die Initiative zu ergreifen.
Schritt für Schritt wollte er vorgehen, und zwar sofort.
Er hatte an dem Tag seine Arbeit Arbeit sein lassen und war zu Alice gefahren.
Kein schlechter Anfang, und auch der frühe Abgang aus dem Büro fühlte sich gut an. Kurz fragte er sich, ob er Blumen besorgen sollte, aber nein, ihm war nicht nach Schenken, ihm war nach Reden zumute.
Dennoch umarmte er Alice, als sie in der Tür stand. Er konnte nicht anders, und nein, er wollte sich auch nicht wehren gegen ihre Schönheit, die ihm entgegenschlug wie eine Welle, die den Herzschlag beschleunigte. Ein wenig erstaunt war sie, weil er ungewohnt früh dran war, aber ihre grünen Augen strahlten trotzdem.
Vielleicht deshalb hatte er sie sanft gefragt, was denn los sei, und sie dabei festgehalten. Er sagte, dass er wüsste, dass es die Nerven wären, und dass es dagegen sicher ein Mittel gebe oder eine Therapie, und sie müsse sich keine Sorgen machen. Und wenn es was anderes wäre, ergänzte er schnell, auch dagegen gäbe es sicher Hilfe.
Lange sah sie ihn an.
Dann lächelte sie.
»Ja, Rosner, mein Liebster, mein Alles, es ist etwas anderes. Du Idiot, ich bin schwanger.«
So war die Idee zum Grillfest entstanden.
Er hatte dann, aus einer Laune heraus, im großen Schmuckgeschäft in der Bahnhofstraße einen Ring erstanden, einen schmalen aus Weißgold mit einem winzigen Brillanten, und die Verkäuferin hatte, um die Passform zu prüfen, hilfreich den entsprechenden Finger zur Verfügung gestellt. Die Größe wäre jederzeit zu ändern, glaubte sie betonen zu müssen, und lächelte, als wäre sie es, die demnächst von Rosner zum Standesamt geführt werden würde.
Mit der Schmuckschachtel in der Innentasche seines grauen Sakkos und einem Strauß weißer Tulpen in der Hand hatte Rosner sich schließlich Alice genähert und dabei festgestellt, dass sein Herz heftig klopfte.
Rosen, er hätte doch Rosen nehmen sollen. Ein wenig linkisch hatte er versucht, ohne die Blumen dabei zu erdrücken, seine Liebste zu umarmen. Alice hatte gelächelt, gelächelt in ihrer unnachahmlichen Art, und ihre kühlen Finger hatten kurz seine Wangen berührt. Dann war sie zurückgetreten, um ihn zu mustern.
»Was ist los, Rosner?«
Das große Glücksgefühl, das ihn überschwemmte, als er die geliebte Stimme hörte, hatte ihn stocken lassen.
»Ich … ich möchte mich verloben«, hatte er schließlich gestottert und war sich wie ein pubertierender Narr vorgekommen.
Als Alice daraufhin gesagt hatte, dass sie sich freue, und wissen wollte, ob sie die Glückliche kenne und ob sie derjenigen mit Rat und Tat zur Seite stehen könne, da sie ja einiges wisse über einen bestimmten nicht leicht zu behandelnden Kriminalisten, war er fuchsteufelswild geworden.
Dann hatte er jedoch einen verdächtigen Schimmer in ihren Augen bemerkt, in diesen strahlend grünen Augen, in denen er sich verlieren konnte, und dadurch wieder Boden unter den Füßen gewonnen. Stumm reichte er ihr die kleine Schatulle und beobachtete, noch immer um Gelassenheit ringend, ihre Reaktion.
»Rosner, du bist ein Spießer und ein unverbesserlicher Romantiker dazu.«
Er hatte ein ganz leichtes Zittern in ihrer Stimme hören können, und als Rosner genau hinsah, fand er, dass auch der Schimmer in ihren Augen nicht kleiner geworden war. Wollte sich da gar eine Träne bilden?
Mehr aber hatte er beim besten Willen nicht erkennen können, denn Alice warf sich ihm in die Arme. Beide taumelten ein paar Schritte nach hinten, und wie es der Zufall wollte, stand dort das Sofa. Danach hatte es einige Zeit gedauert, bis sie wieder Worte fanden, die nicht nur geflüstert waren und die einen Sinn ergaben.
»Nein, Rosner, verloben will ich mich nicht. Wozu soll das gut sein?«, hatte Alice schließlich erklärt. »Wir sind verliebt. Wir sind glücklich. Und wir bekommen ein Baby. Wir müssen nichts ändern, weil es nichts zu ändern gibt. Perfekt ist perfekt.«
Rosner hatte ihre Fingerspitzen geküsst, ihr vorsichtig den Ring übergestreift und genickt. »Aber feiern will ich«, hatte er ein wenig störrisch gemurmelt.
Daher das Grillfest, auch wenn es Winter war. Als sie überlegt hatten, wen sie einladen wollten, kam ihnen die Erkenntnis, dass sie gar nicht so viele Leute kannten. Rosner wollte von seinen Kollegen nur Admira Spahic und Luigi Olivotto dabeihaben, beim dicken Brunner, dem Chef, sträubte er sich, und Alice bestand darauf, die Eltern von Ännchen einzuladen. Des Weiteren sagten auch einige Nachbarn, die mit dem Hintergedanken, so einer Lärmbelästigungsklage aus dem Wege zu gehen, kontaktiert wurden, ihr Kommen zu.
»Nur deine Rosine will ich nicht sehen«, hatte Alice gefaucht.
Woraufhin Rosner, der seine Ausbildung zum Kriminalisten in diesem Moment nicht brauchte, um zu wissen, dass nur bedingungslose Zustimmung einen sinnlosen Konflikt verhindern konnte, heftig nickend »Sie heißt Simone. Und es gibt keinen Grund, sie einzuladen« gemurmelt hatte.
Er hatte sich um die Getränke gekümmert, Bier, Glühwein, Mineralwasser und Saft, Alice besorgte Koteletts, Steaks, Pute und Fisch. Frau Greiner, eine ihrer dicken Nachbarinnen, schleppte Schüsseln mit Kartoffel-, Bohnen- und Gurkensalat herbei, als ginge es darum, eine Kompanie hungriger Pfadfinder zu verköstigen. Die Spahic schenkte ihnen ein Bild, eine Landschaft, selbst mit bunten Farben gemalt und so scheußlich wie nichtssagend. Rosner sollte das Aquarell später im kleinen Kellerabteil an die Wand nageln und auf Alices Rückfrage betonen, dem Raum so einen weiteren Hauch von Elend verleihen zu können.
Olivotto überreichte eine Flasche Wein und stotterte, dass die für die Dame des Hauses und keineswegs als Versuchung für den Hausherrn gedacht sei. Beide hatten sie lachen müssen, Rosner, weil es ihm nichts ausmachte, auf seine zurückliegenden Alkoholprobleme angesprochen zu werden, und Alice, weil für sie Alkohol in der Schwangerschaft ebenfalls tabu war. Olivotto hatte sie verständnislos angeschaut, dann aber mitgelacht.
Die Tränen aber waren Alice erst in die Augen gestiegen, als sie das Gastgeschenk des spät kommenden älteren Ehepaares auspackte, bei dem sie ihre Jugendjahre verbracht hatte. Ännchen, kunstvoll gerahmt, lachte ihr auf Hochglanz entgegen. Alice hatte das Foto an ihre Brust gedrückt, dann umarmte sie Vater und Mutter ihrer verstorbenen Freundin.
Es waren die letzten Tränen gewesen bei diesem Fest.
Rosner, der über keinerlei Erfahrung in der Kunst des Grillens verfügte, stellte bald eine natürliche Begabung dafür bei sich fest, die ihm von seinen Gästen und von Alice bereitwillig bestätigt wurde. Sogar die verkohltesten Fleischstücke fanden, abgemildert durch saftigen Salat und hinuntergespült mit Bier und Wasser, den Weg in die hungrigen Mägen. Admira Spahic hielt eine Rede im Tonfall des dicken Brunner, in der sie die Nachlässigkeit und den Schlendrian des gesamten Polizeiapparats und im Speziellen jenen der Gruppe Rosner scharf kritisierte. Rosner hielt sich vor Lachen den Bauch, und Olivotto, befeuert von mehreren Flaschen Bier, gab mit der beachtlichen Stimme eines Hobby-Tenors je eine Arie von Verdi und von Puccini zum Besten. Als er, bestärkt durch das Schweigen der Zuhörer, zu Tannhäuser übergehen wollte, wurde es ihm verboten.
Besonders gut unterhielt sich Rosner mit dem ihm bis dato unbekannten Anatoli, einem Gast, der auf der Liste von Alice gestanden haben musste, denn zu den Nachbarn gehörte er nicht. Sie verstanden sich blendend, und Rosner staunte nicht nur über die originelle Sicht auf die Welt, die jener Anatoli vertrat, sondern auch über die beachtlichen Mengen an Nahrung und Flüssigkeit, die dieser hagere Mann in kürzester Zeit zu sich nehmen konnte. Auch Alice plauderte angeregt mit dem charmanten Gesprächspartner, war aber, wie sich herausstellte, der Meinung, er wäre von Rosner geladen worden. Als sie darüber sprachen, stellten sie lachend fest, offensichtlich einen Wildfremden verköstigt zu haben.
Spät in jener Nacht, als die letzten Gäste gegangen und sie endlich wieder allein waren, begannen Alice und Rosner zu tanzen. Kerzen tauchten den Wintergarten in ein warmes Licht, das flackernd Verheißung versprach, und Rosner wusste, dass er noch nie so glücklich gewesen war.
2
Helene betritt das matt erleuchtete Säuglingszimmer.
»Eins, zwei, drei«, zählt sie und starrt gebannt auf die Reihen kleiner Plexiglasbetten.
Aber was, wenn sie es nicht erkennt? Wenn sie vergessen hat, wie es aussieht?
Eins, zwei, drei. Das Dritte von links.
Schon im Kreißsaal, schon in den Sekunden seiner Geburt, hatte sie diese Angst, ihr eigenes Kind nicht wiederzuerkennen.
Was halfen da das Lächeln der Ärzte, die beschwichtigenden Worte der Hebamme? Nichts, gar nichts.
»Eins, zwei, drei. Das Dritte von links.«
Habe ich laut gezählt?, fragt sie sich. Egal. Da ist er. Er liegt, wo er liegen soll.
Erleichtert beugt sie sich über das Bettchen.
Ihr süßes Baby, ihr kleiner Max.
Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass alle Babys Glatzen haben und aussehen wie fette, zufriedene Buddhas. Ihres hat kurzes, sehr festes Haar. Mit diesem gelben Stoppelfeld auf dem Köpfchen sieht es aus wie ein amerikanischer Soldat. Wie ein GI. Die kennt sie aus den Filmen, die Sven, der Vater des Kleinen, sich kiloweise reinzieht.
Die kornblumenblauen Augen hat Max eindeutig von Sven.
Auch wenn die Hebamme ihr umständlich erklärt hat, da bei der Geburt das Auge noch nicht vollständig entwickelt und der Farbstoff der Iris zum Sehen nicht notwendig sei, wären alle weißen Säuglinge blauäugig und die meisten schwarzen braunäugig, glaubt Helene nicht daran.
»Wie ist das dann bei Erwachsenen mit blauen Augen? Denen ist die Geburtsfarbe ja wohl erhalten geblieben«, hatte sie dem unbeirrt entgegengesetzt und ein Kopfschütteln als Antwort erhalten.
Das Baby schläft mit halb geöffnetem Mund und gibt leise gurgelnde Laute von sich. Die Augäpfel zucken unruhig hinter den geschlossenen Lidern. Träumt es? Können Babys schon träumen? Sie weiß so vieles nicht.
Sein Kopf ist rund, die Gesichtshaut durchscheinend hell, wie bei einer sehr fein gearbeiteten Porzellanfigur.
Oh ja. Ihr Baby ist perfekt.
Sie versteht nicht, warum, aber sie weiß, dass sie diesen kleinen Mann in dem hässlichen Plexiglasbett abgöttisch liebt.
Helene fasst mit einer ungeduldigen Handbewegung ihre langen braunen Haare zusammen und verknotet sie am Hinterkopf. Dann beugt sie sich vor, um den Duft einzufangen, diesen ganz besonderen Duft ihres Babys. Karamellisierte Äpfel mit einem Schuss Maggi? Sie lächelt. Jedenfalls einzigartig. So wie die unverkennbare Zartheit und Temperatur seiner Haut. Wie hatte sie jemals daran zweifeln können, ihren Max unter Tausenden Babys nicht wiederzuerkennen?
Dennoch ist ihr klar, dass sie bei ihrem nächsten Besuch im Kinderzimmer wieder in diesen Ängsten gefangen sein wird.
Sie wirft einen prüfenden Blick auf die Babys, die neben Max liegen. Ein blasses Neugeborenes mit bläulichen Schatten unter den Augen liegt links von ihrem Sohn. Auch ein Junge. Er sieht verletzlich aus. Die Kleine rechts neben Max hat rosa Wangen und schnaubt durch die Nase. Das pausbäckige Mädchen mit dunklem Schopf schläft unruhig, ihr kleiner Mund macht Saugbewegungen. Auch in den anderen Reihen ist keines der Babys wach.
Alle haben sie nach der Geburt Püppchen aus Stoff von der Krankenhausverwaltung geschenkt bekommen. Rosafarbene für die Mädchen, hellblaue für die Jungen. Damit die Kleinen beim Schlafen nicht gestört werden, baumeln diese Beschützer am Fußende der Bettchen. Helene streicht gedankenverloren über Max’ Puppe. Auch sie hat ihrem Kind einen Talisman geschenkt. Ein hellbraunes Bambi mit weißen Flecken und weichen Ohren. Es gehörte einmal ihrem Bruder Tim und später dann ihr. Eine der Schwestern bat sie, es auch noch nach der Geburt in ihrem Zimmer aufzubewahren, das Säuglingszimmer solle nach Möglichkeit einheitlich aussehen. Helene stimmte bereitwillig zu, sie hätte sich nur schweren Herzens von ihrem Glücksbringer getrennt. So gehört das Bambi noch einige Zeit ihnen beiden. Zufrieden lächelt sie in sich hinein.
Max. Obwohl er so zart ist, wirkt ihr kleiner Liebling am kräftigsten. Vorsichtig streicht Helene mit der Kuppe ihres Zeigefingers über seine gerunzelte Stirn.
»Lassen Sie den Kleinen doch schlafen.«
Die Kinderschwester, eine dunkelhäutige Tamilin, deren Alter von Helene auf Anfang bis Mitte dreißig geschätzt wird, wacht über die kleine Brut wie eine Gefängnisaufseherin. Sie ist eindeutig aufseiten der Kinder, den Müttern gilt selten ihr Mitgefühl.
Sie kann mich nicht leiden, denkt Helene und drückt jetzt erst recht einen Kuss auf Max’ Stoppelhaar. Trotzig dreht sie sich um.
»Ich wollte sichergehen, dass ihm nichts fehlt.« Sie sagt es sanft, fast entschuldigend, und wundert sich.
Wo ist die kratzbürstige Helene geblieben? Sind es meine Hormone, die verhindern, dass ich selbstgerechten Kinderschwestern den Marsch blase und mit meinem Jähzorn schlafende Babys aus ihren Träumen reiße? Werde ich gar erwachsen? Ist es ein Mutterinstinkt?
Mutterinstinkt.
Wie oft haben Sven und sie sich über dieses alberne Wort lustig gemacht.
»Klingt faschistoid«, hört sie ihn sagen und sieht ihn an einem seiner unzähligen Piercings drehen.
Inzwischen ist sie sich nicht mehr so sicher.
Hätte sie nur eine kleine Portion mehr von diesem sagenumwobenen Instinkt, wäre die Panik, ihr Baby nicht wiederzuerkennen, sicher nur eine harmlose Seifenblase, die, kaum verspürt, schon wieder zerplatzt.
Leise summend geht sie zurück. Ihre Haare haben sich wieder gelöst und hängen um ihr Gesicht. Die Stoffschuhe an ihren Füßen schlurfen über den Plastikboden.
Eigentlich ist sie in einem Zimmer der Kategorie »Rooming-in«. Normalerweise bedeutet das, sein Baby die meiste Zeit über bei sich haben zu dürfen. Da jedoch die Werte seines Apgar-Tests ungünstig waren, muss Max im Kinderzimmer bleiben. Unter Aufsicht der Wärterin.
Apgar.
Wieder so ein dämliches Wort, mit dem sie sich neuerdings herumschlagen muss. Weil sie sich in der Schwangerschaft nicht mit Babykram beschäftigen wollte, hatte es hier ein Arzt übernommen, ihr das Punkteschema, mit dem sich der Zustand von Neugeborenen beurteilen lässt, zu erklären.
»Anlass zur Sorge besteht keiner. Herzfrequenz und Atmung lassen allerdings noch etwas zu wünschen übrig. Wir übergeben Ihren Sohn daher zur Sicherheit der Aufsicht erfahrener Säuglingsschwestern. Und auch Ihnen kann ein bisschen Ruhe nicht schaden.«
Damit spielte er allem Anschein nach auf ihr unbeständiges Leben an. Oder auf das von Sven, dem Musiker.
Egal. Jetzt hat sie anderes im Kopf, als über die Vorurteile des Arztes zu grübeln. Max füllt ihre Gedanken vollkommen aus. Vom Aufwachen bis zum Einschlafen, von oben nach unten, von links nach rechts.
Helene setzt sich auf das Bett und knetet ihre Brüste. Niemand hat sie vor diesen Schmerzen gewarnt. Zuerst die anstrengende Geburt, die sich über Stunden hinzog, jetzt die Milch, die wie Nadelstiche ihre Haut durchbohrt, aber nicht einschießen will.
Dabei möchte sie ihr Baby doch selbst ernähren, mit sättigender Muttermilch. Sie will es richtig machen, wenigstens dieses eine Mal.
Wenn sie nur nicht so müde wäre.
Träge öffnet sie die Nachttischlade und zieht das Bambi heraus. Es ist so vertraut. Am Hals ist das flauschige Material ganz glatt. Tims Finger haben es dort beim Einschlafen gedrückt. Ohne sein Kuscheltier war ihr kleiner Bruder nie zu Bett gegangen.
Helene atmet stoßartig aus. Sie schließt die Augen.
Eine schwarz gefleckte Kuh geistert durch den Raum. Der Linoleumboden verwandelt sich in eine sattgrüne Weide, die Zimmerdecke macht einem sommerblauen Himmel Platz. Bienen summen durch die Luft. Eine setzt sich auf den Ausschnitt ihres Nachthemds und sticht.
Helene schreckt aus ihrem Dämmerschlaf auf.
Ihre Brüste fühlen sich an wie kleine Ballons kurz vor dem Bersten. Sie öffnet ihr Nachthemd und betrachtet sie prüfend. Helle Haut zieht sich über blau hervortretende Adern. Einen Bienenstich sieht sie nicht. Sie muss geträumt haben. Wenn die Milch nicht bald zu fließen beginnt, wird sie nach heißen Kompressen verlangen. Oder nach homöopathischen Medikamenten.
Wieder schließt sie die Augen.
Eins, zwei, drei. Das Dritte von links.
Helene beugt sich über das Babybett und fährt erschrocken zurück. Dieses kleine schrumpelige Ding mit dem roten Gesicht ist nicht ihr Max. Das kann nicht sein. Angst drückt ihren Körper zusammen, lässt sie klein werden und schwach. Fieberhaft sucht sie in den anderen Betten nach ihrem Kind. Sie kann Max nicht finden. Er ist nicht da.
Das Dritte von links.
Ihre Finger nesteln nach dem weißen Band, das man dem Kind wie allen Säuglingen hier um das Handgelenk gebunden hat. Darauf stehen Name, Tag und Stunde ihrer Geburt.
Ruth. Ein Mädchen. Weiter liest sie nicht.
Entsetzt presst sie die Fäuste auf ihren Mund. Sie beißt auf ihre Fingerknöchel, dann beginnt sie zu schreien. Vor dem Kinderbett lässt sie sich fallen und brüllt, was das Zeug hält.
»Max! Ich kann mein Baby nicht finden! Im dritten Bett von links liegt ein fremdes Kind!«
Ihre Schreie hallen von den Wänden des Kinderzimmers wider und vermischen sich mit dem Weinen der erwachenden Säuglinge.
Eine Gestalt beugt sich über sie. Rüttelt an ihren Armen, drückt ihr ein feuchtes Tuch auf die Stirn. Helene schlägt um sich und wird gehalten.
»Ruhig«, befiehlt eine Männerstimme, »beruhigen Sie sich.«
Jemand hält ihre Hand. Helene öffnet die Augen. An der Wange spürt sie den weichen Stoff des Bambis. Sie starrt auf die inzwischen vertraute weiß gesprenkelte Zimmerdecke des Krankenzimmers. Also liegt sie in ihrem Spitalbett und nicht auf dem Boden des Säuglingszimmers. Sie ist müde, fühlt sich benommen, geistert irgendwo neben sich durch die Gänge der Säuglingsstation.
»Sie haben geträumt. Hier.« Janisha Narayan, die dunkelhäutige Kinderschwester, hält ihr den schlafenden Max entgegen. Der Pfleger, der Helene festgehalten hat, lächelt freundlich und tritt einen Schritt zurück.
Helene bedankt sich laut weinend und presst ihr Gesicht in die frische Baumwolle, die ihr Baby umhüllt.
»Ich hole ihn in einer halben Stunde ab«, murmelt die Schwester.
Kurz muss Helene an das Märchen von Rumpelstilzchen denken. Dann ist sie allein mit dem Kind.
Versonnen betrachtet sie Max. Sie kann sich nicht sattsehen an seinem rosa Mund. Verzückt bewegt sie jeden seiner winzigen Finger. Die Nägel schimmern wie frisch poliert.
Warum nur fürchtet sie sich so, warum quälen sie diese Alpträume? Warum ausgerechnet jetzt?
»Wir beide schaffen das schon«, flüstert sie.
Das Baby öffnet seine blauen Augen und sieht sie an.
Ungeschickt fummelt Helene an den Knöpfen ihres Nachthemds, und Max beginnt zu quäken. Er ist hungrig. Sie hat keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Niemand hilft ihr, erklärt ihr, was sie zu tun hat. Alle gehen davon aus, dass die Natur ihre Lehrerin ist. Schweiß steht auf ihrer Oberlippe. Mit der Zungenspitze leckt sie das Salz weg. Wenn sie bloß ihre Mutter fragen könnte.
»Mama«, flüstert sie und schüttelt dabei verneinend den Kopf.
Feuchte, verschwitzte Strähnen kitzeln ihre Wangen. Unwillig streift Helene sie hinter die Ohren.
Dann zieht sie ihr Nachthemd in die Höhe und legt sich Max kurz entschlossen an die Brust. Zumindest er weiß, was zu tun ist. Zielsicher findet sein Mund den Weg zu ihrer Brustwarze. Er saugt sich fest, und Helene bekommt Angst. Vorsichtig schiebt sie ihren kleinen Finger zwischen Max’ Lippen und ihre Brust. Plopp, sein Mund löst sich. Unzufrieden, ohne getrunken zu haben, verzieht er sein runzeliges Gesicht.
Helene hat die Kinderschwester nicht kommen gehört. Lächelnd nimmt die Tamilin ihr das Stoffbündel ab und legt es an ihre weiß gestärkte Schulter. Sacht klopft sie auf den Rücken des Säuglings.
Ist es ihr gleichgültig, ob das Baby ausreichend Nahrung bekommen hat?
Als hätte die Kinderschwester sie gehört, sagt sie leise: »Keine Bange, er bekommt schon genug, darauf passen wir auf.« Mit der rechten Hand zeigt sie auf ein Glas mit trüber Flüssigkeit. »Trinken Sie das, es ist ein Kräutertee, der die Milchbildung anregt.«
Wer hat das auf mein Nachtkästchen gestellt und wann?, fragt sich Helene.
»Schlafen Sie jetzt.« Die Tamilin hebt streng ihre Augenbrauen und deutet auf das Licht.
Sofort knipst Helene es aus.
Als die Dunkelheit sie umfängt, fühlt sie sich einsam. Sehnsucht macht ihr Herz schwer. Ihre Finger umfassen den glatten Hals des Bambis. Diese Berührung hat etwas Tröstendes. Lange kann sie nicht einschlafen, und als es ihr doch gelingt, geistern ihre aufgewühlten Gedanken durch eine düstere Traumwelt.
»Frau Kasper.«
Die Stimme durchdringt ihren Halbschlaf. Traumverloren schlägt Helene die Augen auf. Zuerst erkennt sie nichts. Verlegen blinzelt sie die Benommenheit weg und sieht dunkel gelockte Haare sich über einem kantigen Männergesicht auftürmen. Eine lange Nase nähert sich ihr.
»Frau Kasper? Verstehen Sie, was ich sage?«
Erschrocken fährt Helene hoch. Jetzt ist sie endgültig wach.
»Wer sind Sie, was wollen Sie von mir?«
In dem Moment, als sie die Frage stellt, bemerkt sie den weißen Arztkittel. Rechts oben, über einer Tasche, in der ein Kugelschreiber steckt, ist ein Name eingestickt: »Dr. Emanuel Friede«.
Vielleicht ist das ein weiterer Alptraum? Hastig nimmt sie einen Schluck aus dem Glas auf dem Nachttisch. Die Flüssigkeit schmeckt bitter.
»Darf ich mich Ihnen vorstellen, Frau Kasper? Mein Name ist Friede, ich bin Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und arbeite in dieser Klinik als Konsiliararzt. Das heißt«, fügt er hinzu, als sie ihn verständnislos anschaut, »ich werde geholt, wenn etwas nicht ganz im Lot zu sein scheint.«
»Wieso? Hier gibt es dafür keinen Grund. Ich brauche keinen wie Sie!« Ihre Kratzbürstigkeit ist zurückgekehrt. »Lassen Sie mich in Frieden.«
»Frieden?« Buschige Augenbrauen ziehen sich über grauen Augen in die Höhe. »Und schon haben wir einen kleinen gemeinsamen Nenner.«
Die Locken bewegen sich rhythmisch, als der Psychiater seine Stirn in Falten legt und auf den eingestickten Schriftzug an seinem Kittel deutet. Dann verzieht er sein Gesicht zu einem schiefen Grinsen. »›Friede, Freude, Eierkuchen.‹ Damit haben meine Mitschüler und Lehrer mich schon in der Volksschule schikaniert.«
Ohne es zu wollen, setzt Helene nach: »›Kaspar, Melchior und Balthasar‹, die Heiligen Drei Könige. Ich war auch nicht besser dran als Sie.«
Der Doktor schnappt wie ein Hund nach dem Wurstzipfel: »Gut. Offensichtlich teilen wir ein gemeinsames Schicksal.«
Helene spürt Groll in sich hochsteigen. »Na und? Sagen Sie mir endlich, was Sie wollen.«
Sie schüttelt ihr Kissen auf, lehnt es an die Eisenverstrebungen hinter sich und drückt den Rücken dagegen. Aufrecht und steif sitzt sie da und beobachtet den Arzt, der den Besucherstuhl eine Spur zu nahe an ihr Bett rückt.
»Sie werden von Alpträumen geplagt, wirken auf das Personal manchmal desorientiert. Ein klein wenig fahrig und unsicher. Sie sprechen davon, dass Sie Ihr Kind nicht wiedererkennen könnten. Befürchten, dass es plötzlich im falschen Bett liegen oder verschwunden sein könnte. Frau Narayan, unsere Stationsschwester, macht sich Sorgen um Sie.«
Sofort sieht Helene Rumpelstilzchen vor sich.
»Ich weiß Ihre Fürsorge zu schätzen, aber ich brauche sie nicht. Wir kommen allein zurecht, Max und ich.«
»Trotzdem möchte ich Ihnen gern ein Medikament geben«, er zögert, »gegen Ihre Nervosität. Sie müssen sich nicht unnötig quälen. Das schadet Ihnen und auch Ihrem Kind.«
Ich werde ganz sicher nichts einnehmen, denkt Helene zornig. Dass die Inhaltsstoffe meinem Baby durch die Muttermilch schaden, weiß sogar ich.
»Lassen Sie mir das Zeug da. Wie viele soll ich schlucken?«
Dr. Friede sieht sie einen Augenblick nachdenklich an, dann nickt er. »Braves Mädchen«, sagt er und zieht eine schmale Schachtel aus der Seitentasche seines Kittels. »Sie nehmen jeden Morgen eine Pille. Nach kurzer Zeit schon werden Sie sich bedeutend wohler fühlen.«
Jetzt ist Helene verunsichert. Vielleicht hilft das Gift ja tatsächlich gegen ihre Benommenheit. »Danke«, murmelt sie und fasst kurz Vertrauen.
Doch sofort verspielt Friede seinen Vorschuss.
»Hören Sie in letzter Zeit Stimmen, die zu Ihnen sprechen, auch wenn niemand sonst im Raum ist? Oder sehen Sie Gestalten, die keiner außer Ihnen wahrnimmt?«
»Ja glauben Sie denn, ich bin durchgeknallt? Irre? Ein Psycho? So viele sinnlose Fragen, nur weil ich unschöne Träume hatte?«, faucht sie ihn an.
Dr. Friede steht auf. »Es geht nicht um Alpträume, die haben wir mitunter alle«, sagt er sanft. »Manchmal gaukelt das Hirn uns etwas vor, das in der Realität nicht existiert. Nach einem Schock oder einem Unfall kann das vorkommen, und hin und wieder auch nach einer Geburt.«
Die Bettdecke hat Helene wie einen Schutzpanzer bis zum Hals gezogen. Hilfe, denkt sie und krümmt die Zehen nach unten, bis es wehtut. Was bildet der Affe sich ein? Und die Tabletten hatte er auch schon dabei, ohne mich zuvor gesehen oder gesprochen zu haben.
»Vielleicht haben Sie ja recht«, sagt sie und steigert sich dabei in sinnlose Wut. »Jetzt sehe ich zum Beispiel Sie vor mir sitzen. Und da niemand sonst im Zimmer ist, der mir bestätigen kann, dass Sie wirklich hier sind, könnte es sich um eine Illusion handeln. Ganz echt wirken Sie nämlich nicht in Ihrer Arroganz.«
Friede tätschelt beruhigend die Bettdecke da, wo er Helenes Schulter vermutet. »Nicht Illusionen, sondern optische und akustische Halluzinationen nennen wir das. Aber ich muss Ihnen dennoch zu Ihrem Scharfsinn gratulieren. Patienten, die mitdenken, fällt der Weg zur Genesung um vieles leichter.«
»Bitte gehen Sie jetzt.« Helene wird es zu viel. »Ich möchte mich ausruhen, um für mein Kind da zu sein.«
Sie ist so müde. Nur noch verschwommen sieht sie, wie Dr. Friedes Fingerspitzen sich von der Bettdecke entfernen.
Sie denkt an Spinnenfäden.
3
Emanuel Friede schaut durch die Milchglasscheibe des Säuglingszimmers. Undeutlich erkennt er zwei Schwestern, die sich an den kleinen Betten zu schaffen machen. Eine schemenhafte Gestalt steht vor dem Brutkasten. Kurz überlegt er einzutreten, beschließt dann aber, zuerst die Gesprächsprotokolle der Krankenbesuche auf Band zu diktieren.
Stirnrunzelnd steht er kurz darauf in der Dienstkanzel. Die diensthabende Schwester hat sich in den dahinterliegenden Tablettenraum verzogen. Auch wenn er lieber allein seine Gespräche dokumentiert, stört ihn ihr unterwürfiges Verhalten. Nicht alle hier sind so, die meisten begegnen ihm auf Augenhöhe. Das ist ihm entschieden lieber.
Überhaupt, Augenhöhe. Gern würde er seinen Patienten in normaler Kleidung, ohne den weißen Kittel, gegenübersitzen, aber so sind hier nun einmal die Vorschriften. Ein wenig antiquiert. Darin haben sie sich dem verstaubten Klinikdirektor angepasst.
In seiner Privatpraxis fühlt sich Friede entschieden wohler. Bunte Farben dominieren dort den Raum, und unzählige Bücher in hohen Regalen vermitteln eine warme, gemütliche Atmosphäre. Den bequemen weinroten Lehnsessel hat ihm sein Großvater vererbt, der die Ordination vor ihm führte.
In den Sprechstunden sitzt Friede dort in Jeans und T-Shirt und versucht so, den Patienten, die ohnehin mit einem mulmigen Gefühl zu ihm kommen, so viel Normalität wie möglich zu vermitteln.
Wer geht schon gern zum Seelenklempner? Wer gesteht es sich ein, nicht richtig zu ticken?
Der erste Schritt, das ist Dr. Friede klar, ist der schwerste.
Nicht unzufrieden mit sich und seinen Erkenntnissen fährt er sich mit einer Hand durch die dichten Locken.
Dann verhärten sich seine Gesichtszüge.
In letzter Zeit läuft seine Privatpraxis alles andere als gut. Finanzielle Sorgen belasten ihn. Ja, er befürchtet sogar, die Ordination in der teuren Innenstadt nicht mehr lange erhalten zu können.
Mühsam zwingt er sich dazu, sich wieder auf die Arbeit im Sanatorium zu konzentrieren.
Zu drei jungen Frauen auf der Geburtenstation wurde er heute gerufen: einer Mutter, die eine Totgeburt zu verkraften hat, einem Mädchen, selbst erst siebzehn Jahre alt, das nervös auf ihr erstes Kind wartet, und zu Frau Kasper in Zimmer sieben.
Von den dreien bereitet ihm diese Patientin am meisten Kopfzerbrechen. Er denkt an ihren unsicheren, hilfesuchenden Blick. Das strähnige braune Haar war ihr immer wieder ins Gesicht gefallen, und – Himmel, ja – sie machte auf ihn den Eindruck, als hätte sie das letzte Mal vor der Geburt geduscht. Zudem war ihr Nachthemd fleckig und am Ausschnitt eingerissen. Schlau ist er aus ihr nicht geworden. Einerseits wirkte sie ängstlich, verwirrt, neben sich stehend, andererseits wiederum klar, durchaus intelligent und aufbrausend.
Das Gespräch war eindeutig nicht gut verlaufen. Gleich am Anfang muss er sie verärgert haben. Aber schlagfertig ist sie, das muss er ihr lassen. Während der Unterhaltung hatte ihre Stimmung einige Male umgeschlagen. Nicht untypisch für den Babyblues. Wenn die Stimmungsschwankungen allerdings länger als ein paar Tage anhielten, konnten sie erste Hinweise auf eine postnatale Depression sein, vielleicht sogar auf die gefürchtete Kindbettpsychose.
Friede macht sich eine Notiz.
Er geht kritisch mit seinen Diagnosen um. Dem generalisierten Abrechnungskodex mit den Krankenkassen hat er noch nie viel abgewinnen können.
Nachdenklich streicht er sich über das Kinn. Etwas eigenartig sind diese Ängste schon. Jede Mutter hat bisher ihr Kind wiedererkannt, und die Befürchtung, ein Neugeborenes könnte einfach verschwinden, ist absurd. Ihm ist nicht bekannt, dass es hier in diesem Krankenhaus jemals so einen Fall gegeben hätte.
Möglicherweise leidet die Patientin unabhängig vom Babyblues an einer Zwangsstörung. Das Abzählen der Kinderbetten in den Reihen könnte darauf hinweisen.
Unschlüssig steht er auf und geht über den Gang. Vielleicht sollte er noch einmal nach ihr schauen, genauer nachfragen?
Er erinnert sich an ihr blasses, abweisendes Gesicht und entscheidet sich dagegen.
In Gedanken versunken kehrt er zum Säuglingszimmer zurück. Eben will er an die Milchglasscheibe klopfen, da wird die Tür von innen geöffnet.
»Hallo, Herr Doktor«, begrüßt ihn Schwester Janisha. »Was führt Sie zu uns?«
»Ich habe mit der Patientin aus Zimmer sieben gesprochen und wollte mir diesen Wunderknaben, das Baby, das so viele Ängste auslöst, mal ansehen.«
Emanuel Friede beugt sich über das Bettchen mit der Plexiglasumrandung und betrachtet den schlafenden Säugling. Ein wenig blass sieht der kleine Max aus. »Ist mit ihm alles in Ordnung?«
»Es geht ihm gut, aber er hatte eine schwere Geburt und muss sich erholen.« Schwester Janisha lächelt und zieht ihn am Stoff seines Arztkittels vom Bett weg. »Wenn Sie schon mal den Weg hierher gefunden haben, möchte ich Ihnen die neugeborenen Zwillinge zeigen. Zwei putzige Mädchen, die wirklich komplett gleich aussehen. Wir sind ganz vernarrt in die beiden.«
Friede wirft noch einen letzten Blick auf den schlafenden Max und wendet sich dann den beiden Zwillingsmädchen im Brutkasten zu. »Die sind wirklich niedlich«, lügt er ungeniert. Babys und Kleinkinder interessieren ihn nur in beruflicher Hinsicht.
Aus einem der Betten ertönt ein Krähen.
»Die Arbeit ruft«, sagt die Säuglingsschwester mit einem Schmunzeln, das ihr Gesicht weich macht.
Emanuel Friede gesteht sich eine gewisse Schwäche ein für die Schwester in der strengen Tracht mit den funkelnden Augen und dem blauschwarzen Haar, das sie in einem straffen Knoten am Hinterkopf trägt. Wie sie wohl ohne ihre Arbeitskluft aussieht?, fragt er sich nicht zum ersten Mal.
Er beschließt, sich nach ihrem Dienstplan zu erkundigen und öfter mal im Säuglingszimmer vorbeizuschauen.
Trotz der Babys.
4
Melitta klappt ihr Notebook zu. Durch das halb geöffnete Fenster des Seminarraumes weht Fliederduft. Der Stuhl scharrt über den Boden, als sie aufsteht und das Fenster mit einer heftigen Bewegung schließt.
Sie mochte den Mai mit seiner ahnungsvollen Verheißung noch nie. Alles blüht und sprießt und ist dennoch durch gravierende Wetterumschwünge, durch Kälteeinbrüche oder unerwartete Hagelschauer vom jähen Tod bedroht. Speziell hier in der Grafschaft Devon kann dieser Wechsel von einem Moment auf den anderen geschehen. Eben noch als lila-pink-rote Farbexplosion auf den Sträuchern, schwimmen Azaleen- und Rhododendronblüten oft schon Minuten später nach heftigen Regengüssen die Rinnsale entlang.
Melitta spürt die vertraute Melancholie, die sich nie weit von ihr entfernt, in sich aufsteigen. Um sich abzulenken, rezitiert sie lautlos die ersten Zeilen aus John Keats’ Gedicht »Die letzten Blätter, die an Büschen hängen«. Sie lächelt in sich hinein.
Aufmerksam lässt sie ihren Blick über die gebeugten Köpfe ihrer Studenten gleiten. Sie nimmt nicht an, dass jemand schummelt, aber Kontrolle ist besser als Naivität.
In diesem Semester läuft alles wie geschmiert, und das liegt daran, dass sie sich als Gastdozentin an der Universität von Exeter befindet und sich ausschließlich mit ihrer Lieblingsschriftstellerin Daphne du Maurier beschäftigen darf. Zufrieden lehnt sie sich zurück und massiert ihre Nackenmuskulatur.
An ihrer Heimatuniversität in Klagenfurt, wo sie am Institut für Anglistik und Amerikanistik lehrt, hatte sie letztes Jahr ein Seminar von einem erkrankten Kollegen über Christopher Marlowe, einen Dichter des 16. Jahrhunderts, übernehmen müssen. Beileibe nicht ihr Spezialgebiet. Und durchaus nicht nebenbei, sondern eher als kurzfristige Hauptbeschäftigung war sie gleichzeitig in den anstrengenden Machtkampf um die Position des Dekans involviert gewesen. Ironie am Rande, denn sie hatte längst keinen Ehrgeiz mehr, Institutsvorstand zu werden. Früher, ja früher hätte sie diese Rolle gereizt, mit Freude wäre sie Teilnehmerin des Wettkampfs gewesen. Aber das liegt lange zurück. Als die Anfrage aus Exeter sie erreichte, war sie regelrecht froh gewesen, nach England flüchten zu können.
Trotz der neuen herausfordernden und spannenden Aufgabe ist sie in letzter Zeit jedoch erschöpft, schläft miserabel und wacht viel zu früh auf. Die Arbeit, die sie sonst mühelos von ihren Gedanken ablenken konnte, strengt sie an. Es fällt ihr zunehmend schwer, sich zu konzentrieren.
Ein Klopfen reißt sie aus ihren Gedanken. Die Tür öffnet sich einen Spalt, und Professor Ashton zwängt sich in den Raum.
Glücklich über die Unterbrechung stecken die Studenten die Köpfe zusammen und beginnen zu tuscheln.
Ärger steigt in Melitta hoch. »Ruhe«, knurrt sie und macht eine unmissverständliche Geste.
Die Haarschöpfe ihrer Studenten senken sich wieder über die Prüfungsbögen. Es ist, als gäbe es ein kollektives enttäuschtes Ausatmen.
»William«, flüstert sie in Richtung des grauhaarigen Mannes, der an sie herangetreten ist. »Kann das, was immer es ist, nicht bis später warten? Du platzt mitten in eine schriftliche Prüfung.«
»Mel«, entgegnet er ungerührt, »ist es dafür nicht noch ein bisschen früh im Semester?«
Sie bemerkt, dass einige Köpfe wieder in die Höhe schießen, und sieht in grinsende Gesichter.
»Gut gemacht, William«, zischt sie und drängt ihren ungebetenen Gast entschlossen zur Tür.
»Mel, somit erspare ich mir jetzt die Frage, ob du mich heute Abend zum Essen begleitest. Wir sprechen uns später.«
Hinter sich hört Melitta unterdrücktes Kichern.
Den Nachmittag verbringt sie zu Hause. Nur kurz wollte sie sich aufs Sofa setzen und für einen Augenblick die Augen schließen. Erschrocken fährt sie aus einem verstörenden Traum hoch. Wieder ging es um ihre beiden Kinder, wieder hatte sie versucht, den Lauf der Ereignisse zu verändern. Und wieder war sie kläglich gescheitert.
Sie muss einige Zeit geschlafen haben, denn es ist inzwischen Abend geworden. Benommen steigt sie in ihre albernen Holzpantoffeln, die sie von der letzten Anglistik-Tagung aus Amsterdam mitgebracht hat.
Ein träges Licht liegt über dem Feld vor ihrem Fenster. Die Sonne ist fast hinter dem Hügel verschwunden.
Nach einem Blick auf die blinkende Uhr im Anzeigefeld ihres DVD-Players atmet sie auf. Es bleibt noch etwas Zeit, sich frisch zu machen.
Energisch öffnet sie das Fenster, so als wolle sie sich selbst überzeugen, munter und voller Kraft zu sein. In Wirklichkeit fühlt sie sich erschöpft, und ihre Lust auf den Abend mit William, der bei ihrem Gespräch im Anschluss an das Seminar beharrlich durchgesetzt hatte, sie heute zum Essen auszuführen, hält sich in engen Grenzen. Ein wenig farblos ist ihr Engländer schon.
Die Abendluft strömt kühl in den Raum und bringt den würzigen Duft des nahen Waldes mit sich. In Exeter können sich Maitage anfühlen, als wäre der Winter nahe.
Sie lächelt.
Ein tiefroter Strahl der untergehenden Sonne lässt sie an ein Gedicht denken, das sie vor Jahren im Tagebuch ihrer damals halbwüchsigen Tochter gefunden hatte.
Melitta schaudert. Es war so viel passiert, dass sie sich sogar über das eigentlich selbstverständliche Verbot, in den geheimen Aufzeichnungen anderer zu stöbern, besonders wenn es die eigenen Kinder waren, hatte hinwegsetzen müssen. Freilich, geändert hatte, was sie dort fand, nichts an dem, was geschehen war und noch passieren sollte.
Nichts davon war je zu verhindern gewesen.
Stumm rezitiert sie die Strophe.
Untergehende Sonne,
einmal noch leuchtet sie auf.
Ein Strahl, ein letzter,
wird verdrängt
durch dunkle Wolken der Nacht.
Die aufsteigenden Tränen unterdrückend, geht Melitta ins Badezimmer. Wie klug und empfindsam ihre Tochter in Worte gefasst hat, was sich damals anbahnte.
Sie stellt sich auf die Zehenspitzen und schaut aus dem schmalen Fenster über der Dusche. Wenn sie sich streckt, kann sie zwei Spitzen des viereckigen Turmes der St.-Peter-Kathedrale sehen. Ohne dem Glauben an Gott viel abgewinnen zu können, überrascht es Melitta jedes Mal aufs Neue, welch beruhigende Wirkung die mächtige gotische Kirche auf sie ausübt. Oft besucht sie den Innenraum und bestaunt die astronomische Uhr aus dem 15. Jahrhundert, deren Ziffernblatt mit den hübschen Fleur-de-Lys bemalt ist.
Ihr kastanienbraunes Haar, das an den Ansätzen grau zu werden beginnt, bindet sie so fest zurück, dass ihre Kopfhaut spannt. Die Backenknochen zeichnen sich spitz in ihrem Gesicht ab. Früher hat man ihre leicht aufgeworfene Nase liebevoll als Stupsnäschen bezeichnet, jetzt erinnert sie Melitta an eine zerquetschte Tomate. Verwundert darüber, wie blau ihre Augen nach all dem Kummer immer noch strahlen, tuscht sie behutsam ihre Wimpern, legt ein leichtes Make-up auf und pinselt beigefarbenes Gloss auf ihre Lippen.
Ihren Mund betrachtend, denkt sie vage an äußerliche Gemeinsamkeiten. Beide, sie und ihre Tochter, sind mit vollen, gewölbten Lippen gesegnet, im Unterschied zu ihrem Sohn, dessen Mund an einen Bindestrich zwischen Abertausenden Sommersprossen erinnerte.
Melitta reibt kräftig die Haut über ihren Backenknochen, um ein wenig Farbe in ihr fahles Gesicht zu bringen. Für ihre achtundvierzig Jahre sieht sie nicht schlecht aus. Die Figur ist durchtrainiert und ihre Haut fast faltenfrei, da sie sich nie übermäßig der Sonne ausgesetzt hat. Früher galt sie als schön.
Gemächlich schlendert sie aus der Wohnung.
Der rostige Rasenmäher an der Mauer, die rote Plastikschaufel am Wegrand, unter der Wäscheleine die leuchtend gelben Kluppen, als wären sie Sommerblumen, und das verbeulte blaue Kinderdreirad, das wohl schon seit Jahren auf seinen Besitzer wartet, sie alle sind vertraute, gern gesehene Gegenstände, die ihr hin und wieder eine ganz eigene Art von Zufriedenheit schenken können. Und da ist auch das erwartete Knarren, als sie die Gartentür öffnet. Wie wenig Zeit es doch braucht, bis sie sich in einer neuen, unbekannten Umgebung heimisch fühlt.
Sie hat keine Eile, William zu treffen. Von ihrer Wohnung braucht sie zu Fuß kaum zehn Minuten in die Innenstadt von Exeter. Der direkte Weg führt an einem idyllischen Teich vorbei, der fast gänzlich von Trauerweiden verdeckt wird, sie aber wählt heute den längeren, über den Hügel.
Exeter hat ihr Herz im Sturm erobert, anders als William Ashton, der, seit er sie im Sommer des Vorjahres zum ersten Mal sah, um ihre Gunst buhlt.
Eigentlich sollte sie nur ein Semester bleiben, doch dann wurden daraus zwei. Ein schwedischer Kollege, der sie hier ablösen sollte, sprang kurz vor Sommersemesterbeginn aufgrund eines Todesfalls in der Familie ab. Melitta hatte da bereits schweren Herzens ihre Koffer für den Rückflug nach Klagenfurt gepackt und konnte ihr Glück, das auf dem Unglück eines anderen beruhte, kaum fassen.
Der Weg über den Hügel ist steil und erfordert einiges an Geschicklichkeit. Das ist einer der Gründe, warum sie diesen Pfad vorzieht. Sie braucht die Anstrengung, die Herausforderung, das Kräftemessen mit der Natur nach langen Tagen des Sitzens vor den Studenten.
Sie schreitet schnell aus und ist froh, keinem Menschen zu begegnen. Es riecht nach den Kräutern, die hier wuchern. Manchmal nimmt sie sich ein wenig wilden Anis oder die weniger wilde Kamille, um sich daheim einen Tee zu brauen.
Die kleine Stadt empfängt sie mit einem Lied. Eine johlende Schülergruppe strömt aus dem College. Unwillkürlich lächelt Melitta.
Scheinwerfer bestrahlen die Kathedrale; es ist ein malerischer, ein beeindruckender Anblick. Zumindest so lange, bis sie William unter einer der Laternen ungeduldig auf und ab gehen sieht. Als er sie bemerkt, winkt er begeistert und eilt auf sie zu.
Melitta übersieht seine weit geöffneten Arme, macht lächelnd einen Schlenker um ihn herum und zeigt auf die Kirche.
»Ist schon abgesperrt?«
»Ja, gerade eben. Ich durfte noch kurz hinein. Aber ich konnte einen Tisch für uns bei Michael Caines reservieren. Zufrieden?«
Sie nickt. »Und ob.«
Auch wenn sie nicht viel zu sich nimmt, bei köstlichem Essen kann Melitta nicht Nein sagen. Als sie den Namen in Verbindung mit dem Restaurant »Lympstone Manor« zum ersten Mal hörte, dachte sie ein wenig naiv, der britische Schauspieler würde dort kochen. Doch auch wenn es nur sein Namensvetter war, Melitta kann nicht genug bekommen von dessen herrlichen Speisen.
Die Holztische mit dem weißen Gedeck und den grauen Stühlen vermitteln eine elegante, jedoch nicht allzu förmliche Atmosphäre. Das Licht ist gedämpft, der Schein der Kerzen auf den Tischen spiegelt sich in den Kristallgläsern.
Alles wäre schöner und besser, wenn Bernhard neben ihr säße. Aber der ist nicht da und wird es nie wieder sein.
Nie wieder.
Melittas Magen zieht sich schmerzhaft zusammen. Sie beißt so fest auf ihre Unterlippe, dass sie den metallischen Geschmack von Blut wahrnimmt. Vergeblich versucht sie, die quälende Erinnerung an ihren jung verstorbenen Ehemann und den damit verbundenen körperlichen Schmerz zu verdrängen. Williams besorgte Stimme holt sie in die Gegenwart zurück.
»Setz dich doch, gefällt dir unser Tisch?« Er sieht sie um Zustimmung heischend an.
»Entschuldige bitte. Er ist perfekt. Ich war für einen Moment in Gedanken«, sagt sie leichthin und nimmt Platz.
Williams braune Augen funkeln erwartungsvoll. Aber was auch immer er sich erhofft, sie wird ihn ein weiteres Mal enttäuschen.