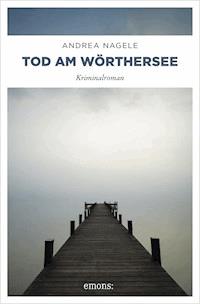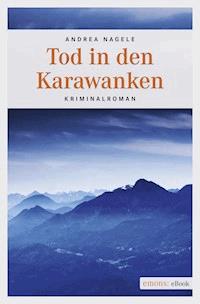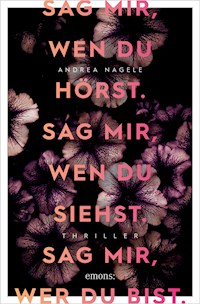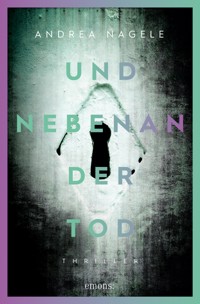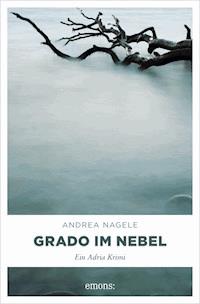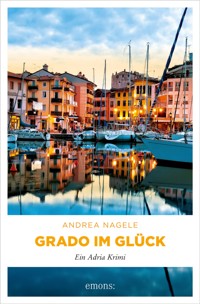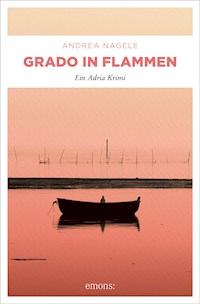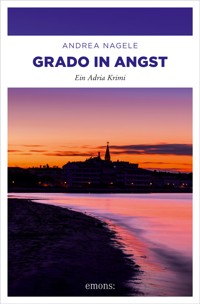Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In Klagenfurt verschwindet ein junges Mädchen spurlos, nur wenige Stunden nachdem ein wegen Kindsmordes verurteilter Mann aus der Haft entlassen wurde. Ein weiteres Kind wird vermisst, und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Die zwölfjährige Kathi kennt beide Mädchen - ist sie das nächste Opfer?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Nagele arbeitet als Psychotherapeutin und lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Klagenfurt am Wörthersee.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: ©mauritius images/imageBROKER/Bernard Jaubert Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-764-2 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Karo,
ohne die diese Geschichte nicht entstanden wäre
Prolog
Ljubica steht an der Haltestelle und ärgert sich. »Mist, jetzt ist der blöde Bus weg.« Sie sieht die roten Schlusslichter im Morgennebel verschwinden.
Es beginnt zu nieseln. Aus ihren blonden Locken dreht sie einen Zopf und zieht die Kapuze des hellblauen Pullovers darüber. Sie hat weder Regenjacke noch Schirm dabei. Ungeduldig starrt sie die St.Ruprechter Straße hinunter. Die Autos fahren wegen des Regens langsam an ihr vorbei.
Sie ist die Einzige an der Haltestelle. Der Schulrucksack hängt schwer auf ihrem Rücken. Um die schmerzenden Stellen zu entlasten, zieht sie die Schultern hoch. Dann hält sie erschrocken die Luft an. Hektisch durchkramt sie die Taschen ihrer Bluejeans. Hoffentlich hat sie ihr Asthmaspray nicht zu Hause vergessen! Doch, da ist es. Beruhigt atmet sie aus.
Die Anfälle häufen sich in letzter Zeit. Wenn sie im Unterricht zu röcheln beginnt und die anderen Kinder sie anstarren, ist ihr die Krankheit peinlich.
Ihre Eltern haben sich vor ein paar Monaten scheiden lassen. Obwohl sie seit der Trennung nur einige Häuserblöcke voneinander entfernt leben, sieht Ljubica ihren Vater kaum noch. Meli, ihre beste Freundin, redet nicht mehr mit ihr. Heute, in der letzten Stunde, wird Meli der Klassenlehrerin sagen, dass sie nicht mehr weiter neben ihr sitzen will. Das hat Ljubica von Sarah erfahren.
»Meli ist eine blöde Kuh!«, hatte sie zu Sarah gesagt. Dabei findet sie das gar nicht. Enttäuscht und traurig ist sie. Seit der ersten Klasse teilt sie mit Meli die Bank.
Wo bleibt der nächste Bus? Ungeduldig wirft sie einen Blick auf ihre rosa Armbanduhr. Jetzt wird sie viel zu spät zum Unterricht kommen. Ob sie laufen soll? Aber es ist weit bis zur Schule, und der Regen ist stärker geworden.
Die Wolken hängen schwer über den Dächern der Häuser. Sie glänzen schwarz vor Feuchtigkeit. Der Morgennebel hat sich verzogen. Ljubica friert unter dem Pullover. Regennass klebt er an ihr. Bald beginnen die Ferien, dann fährt sie mit ihrem Vater in Urlaub. Das hat er zumindest versprochen.
»Hast du den Bus verpasst? Komm, ich bringe dich zur Schule!«, hört sie jemanden aus einem Auto gegenüber der Haltestelle rufen.
Der Mann kommt ihr bekannt vor. Zu Unbekannten darf sie nicht ins Auto steigen. Doch wenn er aus der Nachbarschaft kommt, ist er kein Fremder, spukt es Ljubica durch den Kopf.
Mit einem Mal fühlt sie sich erleichtert. Jetzt kann sie sich doch noch unbemerkt in den Turnsaal schleichen. Nach kurzem Zögern überquert sie die Straße. Die Wagentür öffnet sich auf der Beifahrerseite, sie schlüpft ins Innere und lässt sich auf den Ledersitz fallen. »Danke.« Schüchtern dreht sie den Kopf zum Fahrer.
»Das mach ich gern. So ganz allein an der Bushaltestelle könnte dir alles Mögliche geschehen«, sagt der Mann und lächelt freundlich.
Das Brummen des Motors und das Prasseln der Tropfen gegen die Scheibe üben eine beruhigende Wirkung auf Ljubica aus. Rund um sie verschwimmt die Welt im Regen. Ihr fällt ein, woher sie den Mann kennt. Er ist ihr einige Male auf dem Spielplatz begegnet.
»Meine Eltern haben mir verboten, mit Fremden zu reden. Doch ich weiß, wer du bist. Sie werden schon nichts dagegen haben, wenn ich mitfahre«, sagt Ljubica stolz. Vertrauensvoll tippt sie ihm auf die Schulter.
Der Mann zuckt zusammen. Er stößt ihre Hand weg und bremst scharf ab. Ruckartig bleibt das Auto stehen.
Er dreht sich zu ihr und umklammert ihre Oberarme mit seinen großen Händen. »Ich mache nichts falsch.«
»Au!«, schreit Ljubica auf und will sich losreißen.
Aber er hält sie zu fest und lächelt überhaupt nicht mehr.
Da spürt sie das beunruhigend vertraute Kribbeln in ihrer Kehle. Verzweifelt versucht sie, sich aus der Umklammerung zu befreien. Sie muss sofort an ihr Spray gelangen. Schreien geht nicht, denn der Mann hält ihr jetzt auch noch den Mund zu. Das Kitzeln in ihrem Hals wird immer unerträglicher. Es fühlt sich an, als hätte sie ein Hasenfell verschluckt. Obwohl ihre Nase frei ist, bekommt sie kaum noch Luft.
Ljubica spürt einen heftigen Druck in ihrer Brust. Ein greller Blitz zuckt vor ihren weit aufgerissenen Augen. Danach ist da nur noch tintenschwarze Dunkelheit. Unbeholfen wehrt sie sich gegen den zähen Strudel, der sie immer tiefer und tiefer mit sich hinunterzieht und ihr die letzte Luft nimmt. Nach einer Weile gibt sie ermattet auf und überlässt sich dem Sog ins Niemandsland.
Ljubica läuft über eine bunte Sommerwiese.
Zitronengelbe Schmetterlinge torkeln in der Mittagssonne durch die Luft. Der Himmel ist blau und spannt sich wolkenlos über die Landschaft. Es duftet nach Honig und Rosen. Plötzlich schiebt sich eine schwarze Wolke vor die Sonne, der Tag wird zur Nacht. Und kalt ist es auf einmal, bitterkalt.
Mit einem Schrei auf den Lippen schreckt Ljubica hoch. Aber sie kann ihren Mund nicht öffnen. Die große Hand ist immer noch da. So fährt der Schrei zurück in ihren Hals und droht, sie zu ersticken.
Sie hat keine Ahnung, wo sie sich befindet. Es fällt ihr schwer zu denken. Unheimlich ist es hier und dunkel. Ljubica will nach Hause. Aber da sind diese stahlharten Arme, die sie fest umschlungen halten und jede Bewegung verhindern.
Ein scharfer Schweißgeruch umgibt sie.
Ihr Spray!
Immer hektischer wird ihr Kampf gegen die Umklammerung. Eiskalter Schweiß perlt auf ihrer Stirn.
Sie braucht ihr Spray!
Angst schießt durch ihren Körper. Unkontrolliert beginnt sie zu zappeln. Dann bleibt ihr die Luft abermals weg. Das fellige Ding in ihrem Mund bringt sie wieder und wieder zum Würgen. Magensäure kommt hoch, durchdringt das Hasenfell und breitet sich ätzend in ihrer Mundhöhle aus.
Sie will sich wehren und kann nicht. Die Arme sind wie Stahlklammern.
Ljubica spürt die Gefahr.
Das Grauen überwältigt sie und reißt sie in einen tiefen Abgrund. Alles dreht sich. Sie wirbelt tiefer und tiefer.
Papa, Mama und Meli tanzen über die Wiese. Aber es ist jetzt dunkel dort.
Sie beginnt zu weinen. Die Tränen fließen und vermengen sich mit dem letzten Hauch Luft.
Dann ist da nur noch samtige Schwärze, durch die ein glänzender Nachtfalter taumelt.
***
»Wuff!«, bellt Ariel und zerrt sein Herrchen ungestüm mit sich.
Rupert Pinter beschleunigt seinen Schritt und hält dann abrupt inne.
Das wird ja immer schöner!
Der freche Dackel übernimmt die Führung, anstatt sich dem Willen seines Herrchens zu fügen. Wer ist denn hier nun der Boss?
Rupert zieht an der Leine, und Ariel rennt würgend gegen das Halsband an. Irritiert hebt er den Kopf und schaut mit angelegten Ohren anklagend zu seinem Herrchen hoch. Rupert muss schmunzeln.
»Dann mach ich dich eben los.« Brummend öffnet er den Verschluss des roten Lederhalsbandes. Sofort schießt Ariel kläffend in das lichte Grün des Mischwaldes hinein.
Es ist ein lauer Abend Anfang Mai. Es riecht nach feuchter Erde und zarten Frühlingsblumen. Tief atmet Rupert die frische Luft ein und spaziert gemächlich den von Tannennadeln und Blättern übersäten Forstweg auf dem Kreuzbergl entlang. Sein Hausarzt hatte ihm geraten kürzerzutreten. Doch es war Rupert schwergefallen, diese Empfehlung umzusetzen. Er hatte die Geschwindigkeit seines hektischen Arbeitslebens im Ruhestand einfach beibehalten. Seine Frau und sein Sohn nahmen, im Unterschied zu ihm, den ärztlichen Rat sehr ernst. Zu Weihnachten haben sie Rupert deshalb einen Dackel geschenkt.
»Ariel, bei Fuß! Komm sofort hierher!«, ruft er gereizt in den Wald hinein. Längst möchte er den Heimweg antreten, doch von seinem Hund ist nichts zu sehen. Zu Hause erwarten ihn ein zarter Braten und ein guter Schluck Rotwein. Mit raschen Schritten marschiert er den Weg entlang. Tagsüber wimmelt es hier von Spaziergängern und Joggern, jetzt scheint außer ihm kein Mensch mehr unterwegs zu sein.
Wo bleibt dieser eigensinnige Dackel bloß?
Die Farbe der Bäume ist in diesem Teil des Waldes um einiges dunkler. Es riecht jetzt nach Pilzen und ein wenig modrig.
»Ariel!«, ruft er abermals, diesmal eine Spur zornig.
Aus der Ferne vernimmt er ein Jaulen. Es verstummt so abrupt, wie es begonnen hat.
»Du blöder Hund wirst doch nicht in eine Falle gelaufen sein?« Er lauscht in den Wald hinein.
Die Stille verunsichert ihn. Rupert legt an Tempo zu. Abseits des Weges umfängt ihn die Feuchtigkeit wie ein dünner Regenmantel, und der Moschusgeruch wird stärker. Die Bäume scheinen enger aneinanderzurücken und bilden mit den Sträuchern und Büschen eine undurchdringbare Wand.
»Nervensäge, das hat man nun davon«, schimpft er verhalten. »Ich geb dich ins Tierheim, wenn du nicht sofort kommst. Bei Fuß, aber dalli!« Die Rufe verhallen ohne Reaktion.
Das hat ihm gerade noch gefehlt. Er soll sich doch nicht aufregen! Genau davor hat sein Arzt ihn gewarnt.
Unwillig schiebt er das Gestrüpp beiseite. Das tiefe Grün wird heller. Er gelangt an eine kleine Lichtung. Einige schräge Sonnenstrahlen malen dicke Streifen auf das kurze grüne Gras.
Da ist sein Dackel! Mitten auf der Lichtung läuft er auf und ab.
»Ariel!«
Doch der Hund macht keine Anstalten, sich ihm zu nähern. Aufgeregt umkreist er etwas. Als er ihn bemerkt und schrill zu kläffen beginnt, macht Rupert Pinter einen zornigen Schritt nach vorn.
Was treibt das Tier da?
Ariel zerrt an vertrockneten Zweigen, die auf dem Boden liegen. Als Rupert näher kommt, erkennt er, dass sich unter dem Geäst eine Falle verbirgt. Sicher ist die Grube von Jägern ausgehoben worden. Das Tier hat die Witterung der Beute aufgenommen.
»Braver Hund.« Rupert ist besänftigt. Dackel sind Jagdhunde, das liegt in ihrer Natur. »Marsch jetzt, los! Wir gehen nach Hause, genug der Abenteuer für heute.«
Der Dackel beachtet ihn nicht. Unermüdlich gräbt er, zieht und zerrt an den Ästen.
Der unangenehme Moschusgeruch ist nun stärker geworden.
Rupert versucht, den Hund am Halsband wegzuziehen, doch er rutscht auf dem feuchten Boden neben der Grube immer wieder weg. Ariel schnüffelt und jault, ist jetzt ganz nahe bei seinem Herrchen. Das tarnende Gestrüpp ist durch die hartnäckige Arbeit des Hundes lichter geworden, und so fällt Ruperts Blick unweigerlich in die Tiefe.
Er kneift die Augen zusammen. Da unten ist kein Tier gefangen. Auf dem Boden der Grube liegt eine Puppe im weißen Kleid, mit zerbrochenen Gliedern, ausgebreitet auf einem hell schimmernden Tuch.
Nein, halt.
Rupert wird klar, was er sieht. Entsetzt zieht er die Luft durch seine Nase ein.
Ein kleines, hell gelocktes Mädchen liegt dort unten, keine Puppe. Sie ist auf ein Leintuch gebettet, umgeben von verwelkten roten Rosen. Mit einem Kranz aus Margeriten im Haar. Der Anblick ist rührend und schrecklich zugleich.
Rupert Pinter spürt, wie sein Herz schmerzhaft zu rasen beginnt. Eine lähmende Übelkeit überfällt ihn.
Er macht einen Schritt zurück und schnappt nach Luft. Mit bebenden Fingern greift er nach dem Handy. Sein Atem geht stoßweise und vermischt sich mit dem Hecheln des Hundes, als er die Nummer des Notrufes wählt.
»Helfen… Sie mir… bitte. Ich… mein Name ist… Rupert Pinter. Ich stehe… mitten… im Kreuzberglwald und habe gerade eine Kinderleiche… gefunden.« Rupert Pinters Atem rasselt.
»Moment«, hört er eine weibliche Stimme. »Wir schicken sofort einen Wagen. Bleiben Sie in der Nähe und warten Sie bitte. Wo genau befinden Sie sich?«
»Ein wenig abseits, ich…«, er blickt sich suchend um, »unter der Schießstätte. Da ist ein kleines Wiesenstück zwischen den Tannenbäumen.«
Er hört undeutliches Gemurmel, so als würde die Polizistin mit jemandem im Hintergrund sprechen.
Rupert will nichts wie weg. Er bückt sich zu Ariel, der jetzt still zu seinen Füßen kauert. »Wo sind wir da nur hineingeraten?«, murmelt er und krault den Hund schwer atmend hinter dem Ohr.
»Sind Sie noch dran?«, fragt die Polizistin.
»Ja, ja. Natürlich… Mein Dackel ist bei mir. Er hat… das kleine Mädchen… gefunden.«
»Chefinspektor van Hals ermittelt in der Angelegenheit eines verschwundenen Kindes. Ich werde ihn informieren. Eine Streife ist schon auf dem Weg zu Ihnen. Wenn die Kollegen das Fahrzeug unter dem Schweizerhaus parken, sind sie spätestens in zwanzig Minuten da. Schaffen Sie das so lange?«
Rupert nickt mit einem gequälten Ausdruck im Gesicht und sagt schnell: »Sie sollen sich bitte… beeilen. Die Aufregung… Ich bin nicht mehr der Jüngste…«
Eins
1
»Komm her, mein Schatz.«
Gerald baut sich vor ihr auf. Der samtige Ton seiner Stimme täuscht Waltraud nicht. Dennoch stellt sie sich vor, wie er ihr zärtlich übers Haar streicht und sie sanft an sich zieht. Umschlossen von seinen Armen will sie das Schreckliche vergessen. Seine Fingerkuppen sollen über ihre Rückenwirbel wandern und erst bei der kleinen Falte knapp über ihrem Slip haltmachen. »Mhmm«, schnurrt sie erwartungsvoll und gibt sich einen Moment der Sehnsucht hin, bevor Gerald sie in die Wirklichkeit zurückholt.
Seine Hände sind auf ihr, reißen, zerren an ihrem Shirt. Sein Bieratem durchdringt ihre Abwehr, knallt in ihre rosa Welt. »Stell dich nicht so an!« Seine Zähne krallen sich in ihre Lippen.
Waltraud weiß, dass sie jetzt höllisch aufpassen muss und keinen Fehler machen darf. »Tscheri«, flüstert sie an seinem Hals vorbei.
Ihre Hände wandern seinen Körper entlang. So kann sie das Zittern ihrer Finger unterdrücken. Bewegung. Sie presst ihn an sich, ihre Hand gleitet unter sein Hemd, ihre Finger spreizen sich über seinem Nabel.
Brutal stößt er sie von sich.
Waltraud taumelt gegen einen Stuhl. Fängt sich, will ausweichen, aber Gerald ist schon über ihr. Er reißt sie an sich und windet ihre Haare um seine linke Hand, ballt sie zur Faust. Grob zerrt er ihren Kopf nach unten, nestelt an den Knöpfen seiner Jeans.
Sie darf sich den Schmerz nicht anmerken lassen. Es würde ihn nur noch weiter aufstacheln. Hoffentlich skalpiert er mich nicht, denkt sie. Ein Indianer reitet mit grimmigem Gesicht an ihr vorbei und schwenkt einen blonden Zopf durch die Nacht, während ihre Lippen gegen die Metallknöpfe knallen. Sie ist die Squaw.
Unvermittelt reißt Gerald sie hoch, ihr Haar immer noch um seine Faust gewunden, und bläst ihr ins Gesicht. Sie fühlt sich wie eine Marionette, die vor ihm baumelt. Berühren ihre Füße noch den Boden? Ihr wird schwindlig, das Herz rast, als wolle es dem Körper entfliehen und davonlaufen. Hinein in die Nacht. Mit der Rechten stößt er sie von sich weg. Die Haare hat er losgelassen, sie spürt ein scharfes Brennen auf der Kopfhaut. Die Stehlampe schwingt auf sie zu, und krachend geht Waltraud zu Boden.
Gerald ist jetzt über ihr und drückt ihren Kopf zur Seite. Sie schließt die Augen. Palmen, Kirchen, schneebedeckte Felder, Kathi als Baby. Ungeordnet rasen die Schnappschüsse ihres Lebens an ihr vorbei. Gerald stößt sein Knie in ihren Bauch und legt seine Hand um ihren Hals. Bitte bring mich nicht um, fleht sie stumm und erstarrt.
Sie spürt den Schmerz, bevor sie das Klatschen hört. Rechts, links hämmern seine Handflächen auf ihre Wangen. Zum Glück kriegt sie wieder Luft. Sie schmeckt Blut in ihrem Mund. Wahrscheinlich ist ihre Oberlippe aufgeplatzt. Während Gerald ihren Kopf gegen die Holzdielen knallt, kriecht Waltraud aus ihrem Körper. Vorsichtig, sodass er es nicht merkt, schleicht sie sich davon.
Zusammengekauert hockt sie in einer Ecke des Schlafzimmers und verfolgt das Geschehen. Zum Glück ist das hier nicht das richtige Leben. Die arme Frau dort auf dem Boden röchelt, also ist sie noch nicht tot. Der Mann hat sie umgedreht und fährt mit einer leeren Bierflasche über ihren nackten Rücken und setzt zu einem Stoß an. Sie ist selbst schuld, dass ihr das passiert. Hätte sie sich doch getrennt von dem Schwein, als er sie das erste Mal so hernahm. Die Frau tut Waltraud nicht leid.
Im Moment spürt Waltraud nur ihren knurrenden Magen. Sie beschließt, sich ein Spiegelei mit knusprigem Schinken zu braten.
Waltraud weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Sie setzt sich auf und beugt sich über Gerald.
Wie unruhig er selbst im Schlaf noch ist. Unregelmäßig hebt und senkt sich seine behaarte Brust. Sein Atem pfeift durch die halb geöffneten Lippen. Sie riecht den Alkoholdunst, der über ihm hängt, und noch etwas anderes, Dunkleres. Blut. Ihr Blut.
Wie lange hat sie auf diesen Moment gewartet, wie sorgsam alles geplant! Eine ganze Packung Schlaftabletten, zu einem feinen Pulver zerstoßen, gewissenhaft im letzten bitteren Bier aufgelöst. Doch nicht einmal die Medikamente vermögen ihm einen entspannten Schlaf zu bescheren. Unerwartet schlägt er seine Augen auf. Schon reißt er sie wieder an den Haaren zu sich. Sie weiß, was jetzt kommt. Doch anders als sonst sind seine Bewegungen träge. Die Mittel zeigen Wirkung. Als er sich auf sie werfen will, gelingt es ihr, die hinter ihrem Rücken verborgene rechte Hand abwehrend vor ihre Brust zu halten. Gerald stürzt direkt hinein ins lange, silbern glänzende Messer.
Er schreit auf, bäumt sich, will sie fassen.
Waltraud fühlt eine ungeahnte Kraft in sich, drängt ihn weg und stößt zu, wieder und wieder, bis sie erschöpft über ihm zusammenbricht. Irgendwann rollt sie sich zur Seite und liegt nun mit offenen Augen seltsam besänftigt da. Ihr Nachthemd ist nass. Nass von Blut. Geralds Blut. Alles Grauen hat nun ein Ende.
Schweißgebadet schreckt Waltraud hoch.
Wo ist das Messer?
Bebend vor Angst knipst sie das Nachttischlicht an. Da ist kein Messer. Und auch keine Blutlache. Nichts außer ihren eigenen roten Spuren auf dem Leintuch. Gerald schläft neben ihr. Grunzende Laute blähen seine Nasenflügel auf. Er lebt.
Als ihr Atem ruhiger wird, legt sie sich zurück auf das durchschwitzte Kissen. Bekümmert streicht sie über ihre Augen, wischt die Tränen an den Gesichtsrand.
Mord.
Wäre es denn überhaupt Mord, wenn sie Gerald im Kampf um ihr eigenes Leben erstäche? Oder wäre es Notwehr? Um den Vorsatz geht es, fällt ihr ein, und um den Affekt.
Neben ihr schnarcht Gerald laut und gurgelnd.
2
Erster Tag
Michael massiert mit sanftem Druck seinen Nacken. Seit dem Aufstehen plagen ihn Rückenschmerzen. Er muss falsch gelegen haben.
Mit Schmerzen verbindet er immer noch seine Frau Elisabeth. Sie war lange Zeit krank. Als sie vor zwei Jahren starb, glaubte er, keine einzige Minute ohne sie weiterleben zu können. Der Zorn, von seiner Frau allein zurückgelassen worden zu sein, hatte ihn dann aber am Leben gehalten. Und Maisy. Früher hatte er wenig Zeit mit seiner Enkeltochter verbracht. Kleine Kinder und Tiere sind ihm unheimlich. Erst seit Elisabeths Tod beschäftigt er sich regelmäßig mit der Kleinen und passt auf sie auf. Er genießt diese Herausforderung, die seinem Leben wieder einen Sinn gibt.
Als Vertreter für Landmaschinen war er in den Jahren seiner Berufstätigkeit unter der Woche nur selten zu Hause. Noch dazu bereitete es ihm damals einen nicht unbeträchtlichen Spaß, mit den Bauern abends in den Gasthäusern bei einem guten Schluck Karten zu spielen. Vielleicht war seine ständige Abwesenheit ja verantwortlich für den heute schwierigen Charakter seines Sohnes Thomas.
Zerstreut räumt er die Reste des schnellen Frühstücks weg. Er bückt sich, um den Abfalleimer unter dem Abwaschbecken hervorzuziehen. Ihm ist, als lege sich dabei eine Eisenklammer um seinen Rücken. Er trocknet seine Finger am Geschirrtuch und angelt nach der Tageszeitung. Während er die Schlagzeilen überfliegt, eilen seine Gedanken weiter.
Schon unzählige Male hatte er seiner Schwiegertochter geraten, Thomas zu den Kongressen zu begleiten. Es ist seit langer Zeit das erste Mal, dass sie wieder mitfährt. In seinen Augen übertreibt es Marisa mit ihrer Fürsorge gegenüber Maisy. Sie sollte sich mehr um ihren Mann kümmern.
Behutsam legt Michael ein frisches Set auf den Tisch und bereitet Maisys Frühstück zu. Er ist inzwischen so häufig im Haus seines Sohnes, dass er sich hier mühelos zurechtfindet.
»Ich bin von allein aufgewacht.« Seine Enkelin springt die Stufen herunter und stürmt in die Küche.
»Trifft sich gut, mein Schatz«, antwortet Michael zufrieden, hebt sie hoch und schwenkt sie durch die Luft. »So. Und jetzt gibt’s Frühstück.«
Am frühen Nachmittag muss die Kleine zum Zahnarzt, danach wird er mit ihr am Lendkanal entlang zum Reptilienzoo spazieren. Kinder und Tiere, denkt er und lächelt.
Früher hätte ihn da niemand hinbekommen. Inzwischen ist er bereit, kleine Zugeständnisse zu machen. Morgen, gleich nach dem Ballettunterricht, wollen sie zum mittleren Kreuzberglteich und Boote aus Baumrinde ins Wasser zwischen die Seerosen setzen.
Während Maisy ihren Kakao schlürft, betrachtet Michael sie nachdenklich. Mit ihren dunklen Locken, den meerblauen Augen und ihrer fröhlichen Unbeschwertheit hat sie erheblich mehr Ähnlichkeit mit ihrer Mutter als mit ihrem Vater.
»Die Sommersprossen auf deiner Nase hast du jedenfalls von mir«, sagt er laut.
»Danke.« Sie lacht.
»So und jetzt beeil dich, wir marschieren los und besorgen uns im Supermarkt etwas Gutes für später zum Mittagessen.«
»Pizza!«, ruft sie strahlend.
Michael sieht seine Enkelin forschend an und überlegt kurz. »Ich habe an etwas Gesünderes gedacht. Aber wenn du dir das so wünschst, gibt es heute eben Pizza.«
Er freut sich auf die gemeinsame Zeit mit Maisy und darauf, dass er endlich dazu kommen wird, die unerledigten Handwerksarbeiten im Haus seines Sohnes zu erledigen.
»Nein!«, ruft er aus, als er bemerkt, dass seine Enkeltochter träumerisch Honig auf dem Teller zu verteilen beginnt und die Finger hineintunkt.
Maisy sieht ihn schelmisch an und steckt den Zeigefinger in ihren Mund. Ein großer Klecks landet dabei auf ihrem T-Shirt. »Das schmeckt, Opa!« Begeistert schleckt sie ihre Finger der Reihe nach ab.
»Mit Wasser allein wird das nicht sauber. Zieh dich schnell um, und dann geht’s los.«
Maisy schlingt die Ärmchen um seinen Hals und flüstert ihm ins Ohr: »Ich hab dich lieb. Schaust du dir mit mir heute Abend ›Alice im Wunderland‹ an?«
Seine Rührung verbergend holt Michael ihre Jacken. »Nun, ›Aladin und die Wunderlampe‹ wäre mir entschieden lieber.«
3
Marisa wischt mit einer unauffälligen Handbewegung die Schweißtröpfchen von ihrer Stirn.
Sie wirft Thomas einen Blick zu. Mit einer Hand hält er lässig das Lenkrad, die andere liegt entspannt auf der Gangschaltung. Das Surren der Klimaanlage übertönt die Radiomusik.
»Soll ich aufCD umschalten?«, fragt sie nervös und beginnt, die Plastikhüllen zu durchstöbern.
»Du machst doch sowieso, was du willst. Also frag mich nicht.« Er klingt verärgert.
Marisa schluckt den aufsteigenden Groll hinunter. Sie atmet tief durch und nimmt eineCD aus der Ablage. »Nick Caves ›Love Songs‹?« Stirnrunzelnd bläst sie sich eine dunkle Haarsträhne aus dem Gesicht und dreht dieCD in ihren Händen. Ihre Augenbrauen fahren fragend in die Höhe. »Seit wann haben wir die denn?«
Thomas antwortet nicht sofort. Er macht eine kaum merkliche Bewegung und räuspert sich. »Sie war als Geschenk für dich gedacht. Aber vor deiner Neugier ist leider nichts sicher«, sagt er gereizt.
Er umklammert das Lenkrad jetzt fest. Dass er so türkisfarben schimmernde Adern an den Händen hat, ist ihr vorher noch nie aufgefallen. Sie schickt ihm einen zärtlichen Blick. »Danke«, sagt sie besänftigend. »Ich wollte dir die Überraschung nicht verderben. Lass sie uns bitte anhören.«
»Darauf habe ich jetzt keine Lust mehr. Die ist mir gründlich vergangen«, erwidert er leise und nimmt ihr dieCD aus der Hand.
Marisa spürt einen feinen Stich und schluckt. »Meinst du, dass dein Vater mit Maisy zurechtkommt? Er wirkt zerstreut in letzter Zeit. Und Maisy ist so lebhaft. Vielleicht hätte ich doch zu Hause bleiben sollen«, flüstert sie.
»Ich habe dich nicht gedrängt, mich zu begleiten. Du wolltest unbedingt mit.«
»Ja, und das will ich immer noch.«
»Dann hör endlich auf zu nörgeln und trau meinem Vater zu, dass er ebenso gut wie du auf Maisy aufpassen kann. Immerhin hat er auch mich großgezogen.«
Marisa schließt die Augen und lehnt sich zurück. Als Thomas ihr von der Einladung nach Grado erzählt hatte, war sie sehnsüchtig und schwärmerisch geworden. Schöne Erinnerungen an die Zeit vor ihrer Heirat hatten sie überrollt. Damals war ihr Leben noch unbeschwert gewesen. Nicht so wie jetzt, wo sie den Tag mit Maisy verbringt und ungeduldig darauf wartet, dass ihr Mann von der Klinik nach Hause kommt. Sie vermisst den fröhlichen Medizinstudenten, der ihr Herz erobert hatte. Irgendwann im Laufe ihrer Ehe war ihnen die Leichtigkeit abhandengekommen.
Im letzten Jahr war Thomas einige Male allein zu Fortbildungen oder Kongressen gefahren. Sicher lag das auch an ihr. Es widerstrebt ihr, Abend für Abend im Kreis seiner Kollegen nach den richtigen Worten zu suchen. Aber damit ist jetzt Schluss. Heute würde sie sich nicht wie eine graue Maus fühlen.
Kurz blitzt der Gedanke auf, es könnte Thomas vielleicht ganz gelegen kommen, dass sie so oft daheim bei Maisy bleibt.
Sie räkelt sich in ihrem Sitz und murmelt schläfrig: »Dauert es noch lange?«
»Ich habe dir gesagt, wir sind nicht vor elf in Grado.« Er wirft ihr einen undefinierbaren Blick zu, und Marisa ist sofort hellwach. Wieder einmal kann sie seine Stimmung nicht deuten. Es macht sie traurig.
4
Waltraud schmiert Camouflage-Cover-Make-up auf ihr Gesicht. Sie erschrickt vor der starren Maske, die ihr im Badezimmerspiegel entgegensieht.
So alt sieht sie aus! Dabei ist sie erst siebenunddreißig.
Mit einem angefeuchteten Wattepad reibt sie über die Augenbrauen und wischt vorsichtig über den Mund.
»Au, shit, tut das weh.« Ihre Lippen brennen, und sie meint, Blut zu schmecken.
Wieder sieht sie diese Frau auf dem Boden ihres Schlafzimmers liegen und dreht sich schnell weg. Jetzt ist keine Zeit für solchen Unsinn. Sie muss zur Arbeit. Heute ist sie wieder mal spät dran. Wenigstens kann sie den Einkauf nach Dienstschluss direkt vor Ort im Supermarkt erledigen. Gerald und Kathi haben sich Paprikahühnchen mit Rosmarinkartoffeln gewünscht. Um halb zwölf muss sie wieder zu Hause sein, damit alles rechtzeitig fertig wird. Immer diese Hetze, dieser Stress.
Heute vertritt sie Hildegard für drei Stunden an der Kasse. Sie konnte ihr diesen Wunsch nicht abschlagen, obwohl sie den Kopf voll mit anderem hat. Und kaum noch Energie. Ihre junge Kollegin wird im Sommer heiraten.
»Du hast ja schon Erfahrung mit dem Heiraten«, hört sie Hildegard wieder scherzen.
Ja, das stimmt.
Zwei Mal hat sie in ihrem Leben vor dem Traualtar gestanden. Beim ersten Mal war sie so jung wie Hildegard. Aus dieser Ehe stammt ihre Tochter. Waltraud wischt mit einem Wattestäbchen über die Haut unter ihren Augen. Ihre Tränen sollen die Wimperntusche nicht verschmieren. Das fehlte noch, denkt sie und drängt Kathis Vater Kurt aus ihren Gedanken.
»Wie lang brauchst du noch? Wir wollen auch mal ins Bad.«
Waltraud erschrickt vor Geralds Stimme. Instinktiv macht sie einen Schritt vor. Sie spürt den harten Rand des Waschbeckens in ihrem Unterbauch.
Im nächsten Moment steht Gerald hinter ihr, drückt sich an sie. »Oh, du hast dich verletzt.« Herausfordernd berühren seine Finger ihren Hals und heben ihr Haar. »Soll ich dir eine Salbe bringen?«
Nur das nicht. Waltraud sieht sich mit fettigen Strähnen an der Kasse des Supermarktes sitzen.
»Geht schon, danke«, murmelt sie und wundert sich, wie brüchig ihre Stimme klingt.
»Und was ist das da, du Tollpatsch?«, rügt Gerald und dreht sie zu sich. Mit dem Daumen wischt er das Make-up über ihrer Wange weg. Entzündet rot leuchtet die Schramme auf ihrer blassen Haut.
»Nichts, lass nur. Ich war ungeschickt«, besänftigt sie ihn und zeigt auf ihre langen Nägel.
»So mag ich mein Mädchen.« Zufrieden tätschelt er ihre Wangen. »Mach was drüber, sonst glaubt dein Chef noch, ich verprügle dich.«
Waltraud sieht ihn im silbergrauen Hochzeitsanzug neben sich in der Kirche stehen. Die Erinnerung pocht hartnäckig in ihrem Kopf, doch sie ist nicht willkommen. Schnell tuscht sie ihre Wimpern ein zweites Mal, lässt die Schramme wieder unter Make-up verschwinden und kneift ihre Lippen über dem nach Erdbeeren schmeckenden Gloss zusammen.
»Ich muss los, zu Mittag gibt’s Hendl.« Sie drängt sich an Gerald vorbei aus dem Bad.
Ihr Rücken schmerzt, und die Beine drohen unter ihr nachzugeben, als sie die Treppe hinunterläuft. Vor der Tür des Hauses atmet sie tief durch. Schwül ist es heute.
Viel zu heiß für diese Jahreszeit.
Waltraud hetzt durch den Morgen. Ihr rasendes Herz gibt das Tempo vor. Die Geschwindigkeit ist ihre Freundin. Sie verhindert hartnäckiges Grübeln und sorgt dafür, dass nur noch das Atmen zählt.
Verstohlen zwängt sich die Sonne durch die Wolkendecke.
In ihrer Angst vor Gerald hat sie begonnen, ihre Welt nach Fluchtpunkten einzuteilen. Von der Wohnanlage weiter zum Südring, vorbei an den Industriegebäuden, hin zur Innenstadt.
Noch fünfzig Meter, und sie ist in Sicherheit.
Ihre Wegstrecke prüft sie genau, hütet sich aber, den Blicken der entgegenkommenden Menschen zu begegnen. Mit gesenktem Kopf läuft sie die Straße entlang. Strähne um Strähne klatscht das Haar gegen ihre Wangen. Nie wird sie es abschneiden, denn es verhüllt ihr Gesicht wie ein seidiger Schleier.
Die Müllabfuhr ist heute spät dran, der Abfall quillt aus den Tonnen. Sie wendet sich ab, damit der Gestank nicht in ihr Innerstes gelangt. Dort ist ohnehin schon zu viel Mist.
Ihre Brust brennt, das Herz flattert gegen die Rippen. Waltraud bleibt stehen und lehnt sich atemlos an eine Hausmauer. Mit dem Rücken reibt sie über den rauen Verputz, die Nägel in die Handflächen gekrallt. Fest, fester. Erst wenn sie den Schmerz spürt, verschwinden die peinigenden Gedanken.
5
Der Bus Nummer61, der vom Heiligengeistplatz zum Baumbachplatz fährt, ist wie immer um diese Zeit überfüllt.
Peter Grohar lässt seine Hände zu Fäusten geballt in die Taschen seiner Cordhose gleiten. Dreimal atmet er durch, darauf bedacht, die Luft langsam und bewusst durch die Nase ausströmen zu lassen. Innerhalb von Sekunden spürt er kalten Schweiß auf seiner Stirn. Jeder unkontrollierte Körperkontakt ist ihm zuwider. Automatisch rückt er von seiner Sitznachbarin ab.
Schüler drängen sich im Gang zwischen den Sitzreihen.
Hinter sich vernimmt er ein Kichern. In seinem Rücken spürt er neugierige Blicke. Er macht eine rasche Handbewegung, als wolle er eine lästige Fliege verscheuchen. Die Frau neben ihm murmelt etwas Unverständliches und rückt nun ihrerseits einige Zentimeter von ihm weg. Das Gackern hinter ihm wird lauter. Er beschwört sich, es zu missachten, und muss sich dennoch umdrehen.
In Bruchteil einer Sekunde erfasst er die Situation. Zwei Teenager lehnen mit roten Gesichtern aneinander und flüstern sich gegenseitig kleine Geheimnisse ins Ohr. Das Mädchen am Fenster trägt ein viel zu weit ausgeschnittenes Oberteil zu hautengen Jeans. Als die beiden seine Blicke bemerken, schlagen sie verschämt die Augen nieder. Tut bloß nicht so unschuldig, denkt Peter und dreht sich rasch um.
Eine dunkelblaue Luftmatratze taucht vor seinem inneren Auge auf. Mit den Zähnen zieht er am orangefarbenen Stöpsel, schmeckt bitteres Gummi und hört beglückt zu, wie die Luft zischend entweicht. Es ist Sommer, seine Welt ist in Ordnung, und er freut sich auf die Butterbrote mit Schnittlauch, die zu Hause auf ihn warten. Dann spürt er auf einmal die Hand seiner Stiefschwester Rosl auf seiner Schulter und zuckt erschrocken zusammen.
Die Frau neben ihm räuspert sich und steht umständlich auf. Sie wirft ihm einen missbilligenden Blick zu und drückt sich an den Schülern vorbei zum Ausgang.
Der Bus bleibt ruckartig stehen. Ein Raunen geht durch die Menge. Ein wenig muss er noch durchhalten, erst die nächste Station ist sein Ziel. Viktor Arnold, sein Bewährungshelfer, hat ihm ein Kaffeehaus am Rande von Klagenfurt als Treffpunkt vorgeschlagen. Ob er wohl weiß, wie viele Schülerinnen jetzt im Bus sind? Will er testen, wie gut Peter sich im Griff hat?
Die langen Jahre im Gefängnis haben Peter Grohar gelehrt, niemandem zu trauen. Sozialarbeiter, Betreuer, Therapeuten, Bewährungshelfer und wie sie sonst noch heißen, sie alle sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ihnen geht es nur darum, ihn zu kontrollieren.
6
»Jetzt geht er«, zischt Julia Kathi ins Ohr.
Sofort beginnen die beiden wieder zu kichern.
»Hab ich dir doch gesagt, der tickt nicht richtig«, bringt Kathi unter Gelächter hervor, »musst dir doch bloß seine Kappe ansehen!«
»Wie der uns vorhin angeglotzt hat. Richtig krank war das. Mir ist Gänsehaut über die Arme gelaufen.« Julia schüttelt sich und wirft ihre blonden Haare in hohem Bogen nach hinten über die Schultern. Dann legt sie die Hände um ihren schlanken Hals, drückt zu und verdreht ihre braunen Augen. »Vielleicht wollte er uns abmurksen? Wie Freddy Krueger?«, sagt sie mit gekünstelt schauriger Stimme.
»Das wohl nicht«, sagt Kathi und kichert, »ich glaube eher, dass er gemerkt hat, wie wir über ihn getuschelt und ihn angestarrt haben.«
»Na, jetzt ist er jedenfalls weg.« Julia hat noch immer diese hohle Stimme: »Und mit ihm das Grauen.«
In der diesjährigen Schulaufführung darf Julia die Rolle der Ophelia in Shakespeares Hamlet übernehmen. Es ist zwar eine Nebenfigur, die noch dazu bald ertrinkt. Doch Kathi weiß, dass Julia sich wie eine Schneekönigin gefreut hat, als der Lehrer sie dafür auswählte.
»Dafür sitzen jetzt Willi und Robby hinter uns.« Kathi muss verhindern, dass Julia sich umdreht. Daher legt sie ihren Arm fest um ihre Schulter. »Schau unter keinen Umständen zurück.«
Aber Julia windet sich aus der Umklammerung und wirft den beiden einen kecken Blick zu. »Hi, boys!«
»Psst.« Kathi ist die Situation unangenehm.
»Sei nicht so uncool.« Julia mustert Kathi von oben bis unten. »Was hast du heute überhaupt an?«
Julia gilt unter den Schülern als Modeexpertin. Immer hat sie die neuesten Markenartikel.
»Hallo, Erde an Kathi! Wo lebst du denn? Hinter dem Mond?«
Kathi spürt, wie ihr das Blut ins Gesicht schießt. Mit diesen kirschroten Wangen möchte sie nicht gesehen werden. Schon gar nicht von Robby.
»Mist«, brummt Kathi und bohrt ihren Schuh ärgerlich in den Fußboden unter dem Sitz. Ihr ist eingefallen, dass sie ihre Mathematikhausaufgabe daheim vergessen hat.
»Was gibt’s?« Julia wirft ihr einen gelangweilten Blick zu.
»Ich habe Mathe vergessen.«
»Macht doch nichts. Ruf deine Mama an, sie soll dir das Heft in der Pause nach der zweiten Stunde bringen.«
»Keine gute Idee«, murmelt Kathi, »Mama ist im Supermarkt.« Nervös kratzt sie mit dem Zeigefinger über ihren Handrücken. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Wenn sie ohne die Hausaufgabe auftaucht, geht es ihr an den Kragen.
Vielleicht sollte sie doch daheim anrufen?
Möglicherweise hebt Gerald ab. Sie hat etwas gut bei ihm. In letzter Zeit musste sie zweimal bei seiner Arbeitsstelle anrufen, um ihn zu entschuldigen.
Mama, ihre arme Mama.
Kathi will jetzt nicht an die vergangene Nacht denken. Sie putzt sich geräuschvoll die Nase, um auf andere Gedanken zu kommen.
Seit dem schrecklichen Unfall ihres Vaters ist nichts mehr so wie früher. Nach seinem Tod hatte Mama zwei Jobs annehmen müssen, um die Rechnungen bezahlen zu können. Als dann Gerald aufgetaucht war, hatte Kathi gehofft, dass sich alles zum Besseren wenden würde. Er war so fröhlich, und Mama konnte sich wieder freuen.
Doch Gerald ist Alkoholiker. Zuerst war es ihnen nicht aufgefallen. Mit der Zeit kam er dann aber immer später nach Hause und brüllte bei der geringsten Kleinigkeit los. Da waren Mama und er schon verheiratet. Zweimal hat sie ihn hinausgeworfen, aber wenig später stand er wieder vor der Tür und wollte alles anders machen. Kathi ist froh, dass Gerald sie nicht adoptieren wollte und sie weiter den Nachnamen ihres Vaters tragen darf.
Gedankenverloren starrt sie auf die roten Abdrücke, die ihre Nägel im Handrücken hinterlassen haben.
Im Zeichenunterricht beschließt Kathi, hinauszugehen, um anzurufen. Mit ihrem Bild ist sie schon fertig. Sie greift in die Taschen ihrer Jeans, sucht nach dem Handy. Als sie es nicht findet, holt sie ihren Schulrucksack unter dem Pult hervor und durchforstet das Innere. Nirgends verbirgt sich das Telefon, es ist auch nicht zwischen die Seiten ihrer Bücher oder Hefte gerutscht.
So ein Mist, denkt sie wütend.
»Julia«, sie stupst ihre Freundin an und flüstert ihr zu: »Ich glaube, ich habe mein Handy verloren.«
»Hmm«, brummt Julia unbeeindruckt und pinselt weiter an ihrer Blume.
Sie sollen eine Sommerwiese malen. Julia macht es wieder einmal anders als die anderen, denn ihre Blumen sind schwarz, der Himmel rot und die Gräser weiß.
»Was sagst du dazu?« Sie steckt den Pinsel ins Wasserglas und schaut Kathi auffordernd an.
Kathi ist wegen des verlorenen Handys nicht in der Stimmung, die Malkunst ihrer Freundin zu bewundern. »Was soll ich denn jetzt machen? Das verdammte Handy ist fort. Ich muss es im Bus verloren haben.« Sie zieht an ihrem T-Shirt, bis es über ihre Hüftknochen reicht.
»Jetzt wein doch nicht gleich. Wir suchen nach der Schule den Weg ab, vielleicht finden wir das dumme Ding ja«, tröstet Julia sie.
In diesem Moment läutet es zur Pause.
Kathi packt hastig ihre Malsachen weg, als Julia aufspringt. »Kate, ich habe die Idee! Wäre sie nicht von mir, müsste sie glatt von mir stammen, so gut ist sie!«, lobt sie sich so überschwänglich, dass Kathi zu lachen beginnt.
»Ja?«, bringt sie hervor, als Julias Worte wie ein Wasserfall auf sie herniederprasseln.
»Wir rufen jetzt dein Handy mit meinem an. Vielleicht geht ja jemand ran und bringt es uns. Falls du es verloren hast, könnte es jemand gefunden haben.«
»Du bist ein echtes Genie.« Erleichtert umarmt Kathi ihre Freundin. »Meine Lebensretterin.«
Geschmeichelt holt Julia ihr rosa Telefon aus der Hosentasche und schwenkt es vor Kathis Gesicht herum. »Los, komm auf den Gang. Wir erledigen das jetzt sofort. Und dann rufst du deine Mutter an, damit sie die Hausübung bringt.«
»Ich hab dir doch gesagt, sie sitzt im Supermarkt an der Kasse. Aber vielleicht erreiche ich Gerald.«