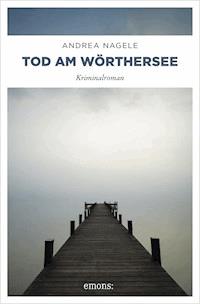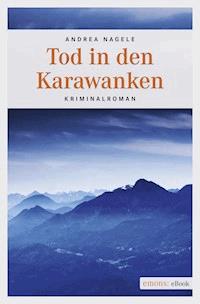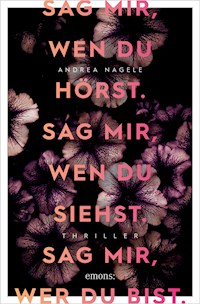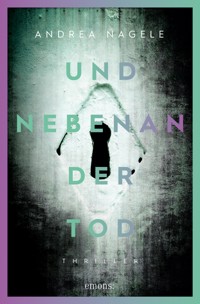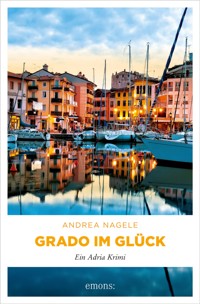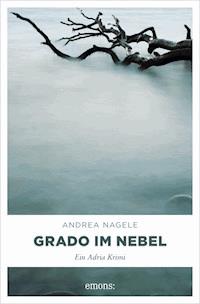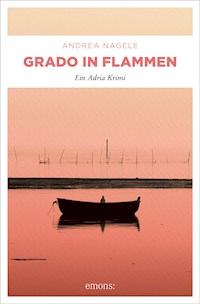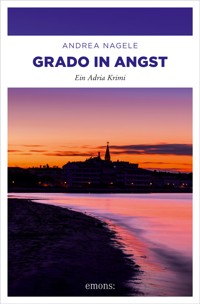Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissaria Degresse
- Sprache: Deutsch
Grado erlebt seine dunkelste Stunde – ein Thriller mit Tiefgang vor traumhafter Kulisse. Auf der Hochzeit ihres ungeliebten Vorgesetzten Comandante Scaramuzza und ihrer Mutter im malerischen Wasserschloss von Strassoldo wird Commissaria Degrassi Zeugin eines Mordanschlags und einer Entführung. In den engen Gassen Trapanis beginnt eine Verfolgungsjagd – die in der Lagune von Grado ein grausames Ende findet. Wer übersteht die "Bluthochzeit"?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Andrea Nagele, die mit Krimi-Literatur aufgewachsen ist, leitete über ein Jahrzehnt ein psychotherapeutisches Ambulatorium. Heute arbeitet sie als Autorin und betreibt in Klagenfurt eine psychotherapeutische Praxis. Mit ihrem Mann lebt sie in Klagenfurt am Wörthersee und in Grado.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
©2020 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Montage aus iStockphoto.com/Alfaproxima, iStockphoto.com/AM-C Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-635-7 Ein Adria Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unterwww.emons-verlag.de
Für meinen Vater.
Prolog
Sie prüfte die Temperatur des Wassers.
Warm.
So warm wie das Meer in jenem Sommer.
Als kleines Mädchen war sie mit ihren Eltern nach Cefalù ans Meer gefahren. Am liebsten hatte Giulietta nahe am Wasser gelegen, ihr langes Haar zu beiden Seiten des Kopfes ausgebreitet wie einen Vorhang und ihren Körper sanft vom Tyrrhenischen Meer umspülen lassen. Die Wellen schmiegten sich dann behutsam an ihre Haut und hüllten sie in eine Wärme, die sie zuvor nicht gekannt hatte. Der gelbe Sand hatte den Weg in jede Beuge, jede Falte ihres Körpers gefunden, das Kitzeln der feinen Körnchen war kaum zu ertragen gewesen und doch so angenehm. Und obwohl das Salz nach dem Schwimmen auf ihren Lippen gebrannt hatte, schmeckte es ebenso intensiv und köstlich nach Sommer.
Giulietta war damals fünf Jahre alt gewesen. Intuitiv aber hatte sie bereits gewusst, dass dieser Urlaub ein besonderer war, einer, an den sie sich ihr Leben lang erinnern würde. Alles hatte gestimmt. Sie fühlte sich aufgefangen und beschützt durch die Wärme des Wassers, glücklich und frei.
Frei.
Vielleicht hatte sie sich deshalb das Bad eingelassen und die Kerzen auf dem Rand der emaillierten Wanne drapiert. Das Aromaöl verströmte einen Duft, der sie an Cefalù erinnerte. Es roch nach Blau, nach Grün und nach Salz, und das Wasser lockte.
Vom Dunst war der Spiegel über dem Waschbecken beschlagen, und Giulietta wischte eine Stelle blank, um ihr Gesicht anzusehen. Es lächelte ihr zu. Es leuchtete, es strahlte. Und sie lächelte zurück.
Vorhin hatte sie sich verbraucht gefühlt, älter, als sie tatsächlich war. Aber jetzt ging es ihr gut.
Ihr helles Haar fiel lang über ihre Schultern, es reichte bis zu ihrer Brust. Mit einem geübten Griff drehte sie die Strähnen umeinander und klammerte sie lose am Hinterkopf fest. Dann stieg sie aus Shirt, Jeans und Unterwäsche und ließ die Kleidung achtlos zu Boden fallen.
Keiner durfte ihr mehr Vorschriften machen, niemandem würde sie mehr Rechenschaft für ihr Tun ablegen.
Es war richtig gewesen. Richtig und notwendig, den entscheidenden Schritt zu setzen. Es gab kein Zurück.
Sie musste frei sein. Und bleiben.
Kurz verließ sie das Bad, um eine Zeitschrift zu holen. Da begegnete ihr sein Blick.
Erschrocken hielt sie inne und spürte, wie ihr Mund trocken wurde. Schnell griff sie nach dem goldenen Herz auf der Kommode, das ihre beiden lächelnden Gesichter umrahmte, und schleuderte es gegen die Wand. Zufrieden sah sie das Sonnenlicht in den Glasscherben auf dem Fußboden funkeln.
Eine Flasche Rotwein stand auf dem Tisch. Es war noch früh am Nachmittag, aber heute spielte das keine Rolle.
Heute war ein besonderer Tag. Endlich war sie erwachsen.
Ihr Blick streifte die Tabletten in den Blistern. Die brauchte sie nun nicht mehr. Ihre Entscheidung gegen ihn und für sich selbst hatte den verrutschten Botenstoffen in ihrem Hirn den notwendigen Stoß versetzt, damit sie sich wieder richtig zusammenfügten. Angst und Depressionen waren wie verflogen.
Als es klopfte, schlüpfte sie widerwillig in ihren Morgenmantel und lugte misstrauisch durch den Spion. Niemand zu sehen. Erleichtert atmete sie aus. Sicher hatte der Postbote das erwartete Päckchen auf der Fußmatte abgelegt.
Sie öffnete die Tür nur einen Spalt, trotzdem war er breit genug, dass er seinen Fuß hineinzwängen konnte.
»Nein«, wehrte sie sich, doch da hatte er die Tür schon gegen sie gedrückt.
Sie stolperte rückwärts, und er war im Raum.
»Bitte«, sagte er sanft, und nicht zum ersten Mal stand seine Stimme im Kontrast zu der Gewalt, die er gegen sie eingesetzt hatte. »Giulietta, bitte lass uns kurz reden.« Sein Blick glitt an ihr vorbei, blieb an den Scherben hängen.
»Es gibt nichts mehr zu sagen. Es ist vorbei.« Stolz schwang in ihrer Stimme, doch ihr Herz stolperte bei den Worten. Immer noch konnte sie die Anziehungskraft spüren, die von ihm ausging und die sie über so viele Monate an ihn gefesselt hatte.
»Ich akzeptiere kein Nein.«
»Du musst.«
»Ist es unwiderruflich? Habe ich keine Chance?«
Wieder machte ihr Herz einen Sprung, denn verdammt noch mal, ein Teil von ihr strebte ihm entgegen. Unwiderstehlich. Ja, so konnte er sein. Aber es gab auch die andere Seite, die düstere.
»Wir haben es mehrmals versucht, doch immer endete es gleich. Du willst mich besitzen. Ich aber gehöre niemandem außer mir selbst.«
»Giulietta«, er verlegte sich aufs Bitten, »verlass mich nicht.«
»Stopp«, unterbrach sie ihn harsch und wunderte sich, wie ihre Stimme das heftige Pochen ihres Herzens und ihren Zweifel übertönen konnte. Wie gern würde sie sich jetzt an ihn schmiegen, sich ihm überlassen und seine Liebe spüren.
Es könnte gut gehen. Ein, zwei Wochen. Doch danach wäre es nur noch schlimmer. Schlimmer als die anderen Male, schlimmer als jemals zuvor.
Ihr Nein stand fest.
»Dann lass uns in Frieden auseinandergehen.« Er sah sie ernst an. »Ich liebe dich und werde dich immer lieben. Du bist mein Ein und Alles.«
Giulietta zögerte. Einen Augenblick zu lang.
Schon hatte er Gläser aus der Vitrine geholt, zur Flasche gegriffen und eingeschenkt.
»Schönes Purpur.« Er lächelte.
»Der Wein ist aus dem Keller meines Vaters.«
Entgegen allen Vorbehalten konnte sie ihm nicht böse sein, dazu hatte sie ihn zu sehr geliebt.
Schweigend tranken sie.
Als sie die Flasche geleert hatten, öffnete er eine zweite. Was soll’s?, dachte sie. Seine Gesichtszüge waren weicher geworden, hatten das Drängende verloren.
»Wir bleiben Freunde?«, versicherte sie sich.
Seine dunkelbraunen Augen wurden noch eine Spur dunkler. »Natürlich bleiben wir Freunde.«
Sein Tonfall hatte sich verändert. Jetzt lag darin eine Schärfe, die vorhin nicht da gewesen war, die Giulietta aber allzu gut kannte. Sie schaute ihn an, überlegte, was sie sagen sollte, doch er kam ihr zuvor.
»Diesmal nehme ich meine Tasche mit den restlichen Kleidungsstücken mit.« Er sagte es mit einem Lächeln, doch seine Oberlippe zuckte dabei.
»Ich bringe sie dir.« Giulietta stand unsicher auf. Der Pinot Nero war stark, und sie fühlte sich benebelt.
Rasch warf sie sein Buch vom Nachtkästchen auf den Stoß Kleidung in der Reisetasche, die sie bereits gepackt hatte, und holte Rasierzeug, Kamm und Aftershave aus dem Badezimmer.
Das Wasser in der Wanne war inzwischen kalt. Sie ließ es ablaufen. Dann drehte sie den Hahn weit auf und füllte heißes Wasser und Duftöl nach. Zufrieden strich sie mit der Hand durch den sich bildenden Schaum.
»Giulietta?« Er stand in der Tür und sah sie an. »Dir ist nach einem Bad?«
Sie lachte verlegen. »Später.«
»Wenn ich fort bin?«
Sie nickte und ignorierte den klagenden Unterton.
»Lass uns zuerst noch unsere Gläser austrinken, einen letzten Schluck auf die alten Zeiten.«
Dagegen sprach nichts.
Der Wein schmeckte seidig. Er hatte die Gabe, alles in Aquarellfarben zu tauchen. Und nach dem Entspannungsbad hatte sie ohnehin nichts anderes vor, als es sich vor dem Fernsehapparat gemütlich zu machen.
Erneut schenkte er nach, und mit einem Mal verschwamm sein Gesicht. Sie hob ihre Hand, aber ihre Finger gehorchten nicht.
»Giulietta.« Seine Stimme war mehr Feststellung denn Frage, sie kam von weit her.
Sie dachte an den Mann mit der schwarzen Maske. Der sie angegriffen und ihr eine Reihe fürchterlicher Drohungen ins Ohr geflüstert hatte. Den er ihr geschickt hatte, um sie gefügig zu machen.
Sie dachte, wie dumm sie war. Wie vertrauensvoll, wie arglos. Doch ehe sich die Worte zu einem klaren Gedanken zusammenfügten, drifteten sie bereits wieder davon. Sie versuchte, etwas zu sagen, und verschluckte sich an ihrer Stimme.
Sein Gesicht näherte sich ihrem. Wie bei einem Vexierbild schien sein Mund zu lächeln, um gleich darauf in Wut zu erstarren. Es war bezaubernd und erschreckend zugleich.
Stand er auf?
Kam er auf sie zu?
Schimmerten Tränen in seinen Augen?
Sie versuchte, ihm auszuweichen. Ihr Rücken presste sich gegen die Lehne.
Er beugte sich über sie, mehr Schatten als Kontur. Eine Geisterhand zwängte ihre Lippen auseinander, ließ Wein in sie hineinfließen. Sie würgte, spuckte, verkrampfte sich. Rinnsale flossen über ihr Kinn, in ihr Dekolleté. Wieder zwang er den Rand des Glases an ihren Mund.
Seine Fingerspitzen strichen über ihre Haut.
Der Hauch seines Atems streifte ihr Ohr.
Wann hatte er ihr den Bademantel ausgezogen?
Wann sie vom Stuhl gehoben?
Trug er sie auf seinen Armen?
Sie schwebte durch den Raum und sank herab in das warme Wasser des Tyrrhenischen Meeres.
Es roch nach Blau, nach Grün und nach Salz.
Die Klinge schnitt eine Linie in ihren Unterarm. Es fühlte sich an wie das Kitzeln einer Feder.
Ehe Giulietta das Bewusstsein verlor, bündelte sie ein letztes Mal ihre Kraft.
Sie hob ihm ihr Gesicht entgegen.
Erster Teil
1
»Degrassi!«
Maddalena sah irritiert von ihrem Notebook hoch. Unverkennbar Scaramuzzas Stimme. Der Comandante stand in der offenen Tür und blickte sie auffordernd an.
»Ja?« Sie konnte nur vermuten, worum es ging. »Wir graben uns immer noch durch Unmengen an Aufzeichnungen aus der vordigitalen Zeit. Man kann sich nicht vorstellen…«
»Es geht nicht um die Vermisstenfälle. Jetzt nicht«, unterbrach er sie brüsk.
Neugierig stand sie auf und ging um ihren Schreibtisch herum auf ihn zu. Während der letzten Wochen hatte ihr Chef einigen Druck gemacht. Er wollte endlich Resultate sehen. Die Geschichte um die Knochenfunde im Garten der Villa Esperanza, in der von der ehemaligen Besitzerin über viele Jahre hinweg illegale Abtreibungen vorgenommen worden waren, hatte ihm ordentlich zugesetzt. Zwar waren die strafrechtlichen Zusammenhänge schon vor Monaten ermittelt worden, die Identifizierung der Frauen, die damals die Hilfe der Engelmacherin in Anspruch genommen hatten, erwies sich jedoch eher als Marathon denn als Sprint. Was die Überreste der ungeborenen Kinder betraf, so war von Anfang an klar gewesen, dass man nur wenige der gefundenen Knochen würde zuordnen können. Ohne die freiwillige Mithilfe der Frauen, die diese Kinder nicht gewollt hatten, würden die meisten von ihnen für immer namenlos bleiben. Es hatten sich in dem Massengrab allerdings auch die Knochen von zwei erwachsenen Frauen befunden, die mutmaßlich bei den Eingriffen verblutet waren und von irgendjemandem vermisst gemeldet worden sein mussten. Weshalb sie nun in jeder verfügbaren Minute, die sie nicht mit anderen Angelegenheiten beschäftigt waren, Datenbanken und alte Akten nach ihnen durchforsteten.
»Kommen Sie.« Er zeigte auf den kleinen Tisch, an dem sie manchmal mit Besuchern oder einem aus ihrem Team etwas besprach. »Setzen wir uns.«
Maddalena nahm Platz, und er entschied sich für den Stuhl an der direkt daran angrenzenden Tischseite statt ihr gegenüber.
»Also«, fing er an und machte eine Pause. Das war eines seiner üblichen Machtspielchen. Leute hinhalten. Maddalena versuchte, sich ihre Ungeduld nicht anmerken zu lassen. »Da ich in absehbarer Zeit Ihr Stiefvater werde, müssen wir uns überlegen, wie wir einander zukünftig ansprechen.«
Nun war es also so weit, dies war der Moment, den sie seit Langem hatte kommen sehen. Sie wollte ihm sagen, dass sie ihn als Chef nicht leiden konnte und schon gar nicht als Mann ihrer Mutter. Sie wollte ihm sagen, dass er verschwinden sollte, irgendwohin möglichst weit weg von hier, in eine andere Stadt, in der er fremde Menschen schikanieren konnte.
Sie sagte nichts dergleichen.
»Ich fände es am besten, wenn wir bei der offiziellen Anrede blieben«, entgegnete sie ruhig. »Sie sind mein Vorgesetzter, und das ändert sich durch die Heirat nicht.«
»Das ist doch nicht Ihr Ernst?« Der Comandante beugte sich vor, und ein Schwall seines aufdringlichen Aftershaves wehte ihr entgegen.
Mama, was findest du bloß an ihm?, fragte sie stumm.
»Sie selbst, Commissaria, haben dieses Thema angesprochen, an jenem Abend vor dem Tornado, als wir uns auf der Dachterrasse des ›Astoria‹ trafen. Sie erinnern sich?«
Das tat sie. Und auch daran, dass er sie damals »Kindchen« genannt hatte.
»Ich wollte von Ihnen wissen, ob ich mich versetzen lassen soll.«
»Was ich völlig unangebracht fand, obgleich der Vorschlag mich nicht überrascht hat, denn Sie sind ja als Hitzkopf bekannt.«
Maddalena unterdrückte eine scharfe Bemerkung, doch Scaramuzza gab ihr ohnehin keine Gelegenheit zu antworten.
»Ich habe keine Probleme mit Mitarbeitern, die aus meinem persönlichen Umfeld kommen. Den talentierten Arturo Fanetti muss ich diesbezüglich wohl nicht extra erwähnen. Niemand nimmt Anstoß daran, dass der Sohn meines ältesten Freundes mich Onkel Muzzi nennt. Sie müssen ja nicht Vater zu mir sagen, Achille genügt.«
Maddalena drehte sich der Magen. Jetzt die richtige Antwort, betete sie.
Sie zwang ein Lächeln auf ihr Gesicht. »Gegenseitiger Respekt ist die Grundvoraussetzung für eine wertschätzende Zusammenarbeit. Vorerst schlage ich daher vor, beim Sie zu bleiben, jedenfalls auf der Polizeidienststelle und bei öffentlichen Auftritten. Im Privaten…« Sie zögerte und suchte nach Worten.
Scaramuzza lächelte breit. »Ja, so machen wir es. Alles andere wird sich ergeben. Ich werde Ihnen in den nächsten Wochen zwischendurch immer mal wieder etwas Freiraum verschaffen, damit Sie meine Sibilla bei den Hochzeitsvorbereitungen unterstützen können. Der Termin ist nicht mehr allzu weit entfernt. Und ihr jungen Leute wisst noch nicht, wie schnell die Zeit verfliegt.«
Maddalena konnte ob dieser Ansprache erst mal nichts erwidern. Ihre Mutter war gut imstande, mit ihren Freundinnen und Verwandten alles für die Hochzeit Erforderliche auch ohne ihr Mitwirken zu arrangieren. Vermutlich wäre sie dabei sowieso nur ein Störfaktor.
»Sibilla möchte ihren Brautjungfernabend unbedingt im ›Delfino Blu‹ feiern, während ich zeitgleich ein anderes Lokal für meinen Junggesellenabschied gewählt habe«, sagte Scaramuzza, der, obgleich sie das Wesentliche geklärt hatten, keine Anstalten machte, ihr Büro wieder zu verlassen.
»Das Restaurant ist doch sehr nett, manchmal gehe ich mit den Kollegen am Ende des Tages auf eine Pizza dorthin.«
»Das haben Sie im Führungskräfteseminar gelernt, auf das ich Sie geschickt habe, nicht? So ein gemeinsames Essen fördert den Teamgeist.« Wieder lächelte er breit, und Maddalena kam nicht umhin, fasziniert auf sein Raubtiergebiss zu starren. »Ich wollte meiner zukünftigen Gattin allerdings eine der Dachterrassen der Stadt vorschlagen.«
»Schöne Idee, aber die Besitzerin vom ›Delfino Blu‹ war mit meiner Mutter zusammen auf Kur, daher kennen sich die beiden. Und das ist auch der Grund, warum Mama dorthin will. Die Hochzeit selbst ist ja in Strassoldo geplant?«, setzte sie nach und kannte seine Antwort bereits.
»Das Beste ist gerade gut genug für meine schönste aller Frauen.«
Maddalena wand sich innerlich, musste ihm aber recht geben. Er hatte sehr gut gewählt. Der von einer romantischen Landschaft umgebene mittelalterliche Ort mit seinen beiden Schlössern und der Kirche schien wie aus der Zeit gefallen.
»Toll«, pflichtete sie ihm bei.
»Degrassi«, er lehnte sich zurück und streckte seine langen Beine aus, »wo wir schon mal beisammensitzen, was machen Ihre Ermittlungen für Fortschritte? Ich hoffe, der Aufruf in den Medien bezüglich der Knochenaffäre zahlt sich endlich aus.«
So war es immer. Kaum entspannte sie sich in seiner Gegenwart, begann er wieder, Druck auszuüben.
»Es sieht ganz so aus. Seit wir mit der Suche nach Zeugen an die Öffentlichkeit getreten sind, haben sich drei Frauen gemeldet, die sich in den siebziger Jahren von Dolores Moretti helfen ließen. Alle drei ließen Proben für einen DNA-Abgleich mit den gefundenen Überresten hier, und ihre Aussagen bestätigen das, was uns die Nichte der Engelmacherin erzählt hat.«
»Gut.« Scaramuzza nickte. »Haben Sie schon alle Vermisstenfälle durchsehen können? Unser Rechtsmediziner, übrigens ein guter Bekannter von mir, lässt ausrichten, dass ihm die Überreste der beiden Frauen in den letzten Monaten ans Herz gewachsen seien, er sie aber dennoch gern an die Angehörigen übergeben würde, die zu ermitteln Sie offenbar nicht in der Lage sind. Es wäre mir lieb, wenn Sie diese Unterstellung, die auch auf mich zurückfällt, bald widerlegen könnten.«
Maddalena stöhnte innerlich. Der Forensiker war als frauendiskriminierender Macho bekannt und ihr durch seinen herablassenden Umgangston ihr gegenüber verhasst. »Wie gesagt, wir sind dran. Das Verfahren gegen die Besitzer der Villa wegen Mitwisserschaft und Widerstand gegen die Staatsgewalt läuft.«
»Nun«, der Comandante stand auf, »dann werde ich Sie jetzt weiterarbeiten lassen und meine Sibilla zum Mittagessen ausführen. Ach«, er drehte sich noch einmal zu ihr um und sah sie direkt an, »wegen des Hauses in Santa Croce sollten wir uns bei Gelegenheit noch mal zusammensetzen. Sibilla wird ja zu mir ziehen, und Sie haben die kleine Villa am Meer. Wir müssen überlegen, ob wir das Haus verkaufen.«
Was erdreistete sich der Kerl? Maddalena biss die Zähne zusammen. Sie würde mit ihrer Mutter ein ernstes Wörtchen reden müssen. Wenn irgendwer darüber zu entscheiden hatte, waren es Mama und sie.
Unempfindlich für die Stimmungen seiner Gesprächspartner, grüßte der Comandante kurz und verließ ihr Büro. Kaum war er fort, stand Zoli in der Tür, die ihre beiden Büros verband.
»Der Chef war hier?«, fragte er misstrauisch, als er Maddalenas rote Wangen bemerkte. »Um was ging es?«
»Um das Übliche. Setzen Sie sich, Zoli, ich wollte ohnehin mit Ihnen sprechen. Es gibt da einen alten Vermisstenfall aus der Schweiz, der könnte was für uns sein. Zeitlich würde es hinkommen. Und das junge Mädchen wollte in den Süden.«
Durch das geöffnete Fenster drang Meerluft herein. Das Rauschen der Wellen war heute nur ein mildes Plätschern, allein die Möwen schrien laut wie immer.
Während sie den Fall besprachen, fielen Maddalena wieder die Worte des Comandante über ihr Elternhaus in Santa Croce ein. Sie ärgerte sich über ihre Mutter, die sie bei so vielem im Unklaren ließ. Und sie dachte an Franjo. Schon im kommenden Herbst würde er ein Restaurant hier in Grado übernehmen, eines, das an jener wunderbaren Stelle lag, wo Meer und Lagune sich trafen. Darüber, wie er sich alles genau vorstellte, hatten sie bisher nur oberflächlich gesprochen. Fest stand einzig, er würde zu ihr ziehen. Nach anfänglichem Unbehagen freute sie sich auf das Zusammenwohnen mit ihm. Ausschlaggebend war der verheerende Sturm im August gewesen, der Menschen getötet und vieles zerstört hatte. Auch der Kontakt zu Franjo war über Stunden abgerissen. Als er wieder vor ihr gestanden und sie mit seinen dunklen Augen angesehen hatte, wusste sie, dass sich ein Leben mit ihm an ihrer Seite richtig anfühlte. Was er allerdings mit seinem Gasthaus im Karst vorhatte und ob Mateja, seine Mutter, dort oben allein bleiben würde, waren Themen, die sie seither großzügig aussparten, bargen sie doch einiges an Sprengstoff für ihre Beziehung, die immer wieder von Krisen geschüttelt wurde.
»Chefin«, Zoli klopfte mit seinem Kugelschreiber auf den Tisch, »gestern war ein Mann hier, der eine Aussage machen wollte.«
»Ja, und worum ging es dabei?«
»Ich dachte, Sie sollten es sich selbst anhören. Er müsste jeden Moment da sein.«
»Warum so geheimnisvoll? Sie scheinen ja bereits zu wissen, was er loswerden wollte.« Zolis Verzögerungstaktik war für Maddalena zwar nicht neu, aber darum nicht weniger enervierend.
Er deutete auf sein Heft, in das er ständig schrieb, und hielt es ihr hin, doch Maddalena schob seine Hand weg. Er sollte selbst berichten.
»Der Mann behauptet, vor fünfzig Jahren ein seltsames Erlebnis gehabt zu haben, das ihm erst wieder ins Bewusstsein kam, als er hörte, dass wir nach betroffenen Frauen und Zeugen hinsichtlich der Vorgänge in der Villa Esperanza suchen.«
Sofort stand Maddalena das Bild des verwahrlosten Dschungels vor Augen, der das heruntergekommene Haus umschloss. Sie dachte an die Gräber der Katzen und an das, was der verheerende Sturm, der allein hier in Grado in knapp fünfzehn Minuten über fünfhundert Bäume entwurzelte, anstelle von Tierleichnamen unter den Palmen mit den falschen Datteln zutage gefördert hatte. Sie konnte nicht verhindern, dass sie sich schütteln musste.
Bevor sie genauer nachfragen konnte, klopfte es, und Fanetti betrat, gefolgt von einem etwa Siebzigjährigen, den Raum.
»Commissaria, dies ist Conte Breciani, er hat um zwölf Uhr einen Termin bei Ihnen.« Fanetti lächelte und sah den Mann bewundernd an.
Maddalena warf Zoli einen gereizten Blick zu. Verstand er noch immer nicht, dass sie es hasste, wenn andere ihren Kalender ohne vorhergehende Absprache mit ihr bestückten und sie dann nicht rechtzeitig informierten?
»Sorry«, murmelte Zoli geknickt.
»Fanetti, Sie bleiben hier und schreiben das Protokoll. Nehmen Sie dafür mein Notebook.« Sie wies auf einen freien Platz. »Conte Breciani, bitte setzen Sie sich zu uns.«
Arturo Fanetti nickte erfreut. Blaublütige hatten es ihm offensichtlich angetan.
»Zoli, Sie telefonieren inzwischen mit der Schweizer Kollegin, von der wir die Information aus der Datenbank vermisster Personen haben.« Sie stand auf, um ihm den Zettel mit der Nummer zu geben, und begleitete ihren Mitarbeiter in den angrenzenden Raum. »Lassen Sie sich alles geben, was man über das Mädchen weiß.«
Zoli zog sein typisches Raubvogelgesicht und wies mit einem entschuldigenden Lächeln auf seine Thermoskanne. »Ein kleiner Tropfen zur Stärkung?«
»Da kann ich nicht widerstehen.« Maddalena nickte versöhnlich und nahm den Becher. Zolis Mutter war in der Dienststelle bekannt für ihren vortrefflichen Mokka. Sogar Fanetti, der aus einer berühmten Kaffeedynastie stammte, musste ihre Brühkünste anerkennen.
»Commissaria, ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Es ist etwas Persönliches, und es ist wichtig.« Zoli zog die Oberlippe zwischen seine Zähne, wodurch seine Adlernase noch länger wurde. »Meine Maddalena kommt bald nach Grado. Sie wird bei uns wohnen, also… bei meiner Mutter und mir. Ich glaube, diesmal ist es für immer.«
Maddalena sah ihn überrascht an. Über die angebliche Verlobte Zolis kursierten die albernsten Gerüchte. Tatsache war, niemand glaubte so recht an ihre Existenz. Die meisten, dazu gehörte auch sie selbst, vermuteten, dass es sich dabei um weiter nichts als eine Schwärmerei für seine Chefin handelte.
»Das ist doch großartig«, sagte Maddalena sanft und dachte: Der Arme, womit wird er diesmal das Nichterscheinen seiner Liebsten rechtfertigen?
»Nein, sie kommt wirklich.« Er wedelte mit einem Computerausdruck vor ihrer Nase. »Das Flugticket.«
Seine Antennen, was ihre Überlegungen betraf, waren scharf gestellt. Doch seine angebliche Verlobte sollte auch schon mal im Zug gesessen haben, ohne dass sie je an ihrem Bestimmungsort angekommen war. Wegen des Sturmes habe sie kurzfristig umkehren müssen. Das gab Anlass für so manches Gelächter hinter vorgehaltener Hand.
»Daher, Commissaria, wollte ich Sie etwas fragen. Comandante Scaramuzza hat ja das gesamte Team zur Hochzeit eingeladen. Bisher hatte ich keine Begleitung angegeben. Darf ich meine Verlobte trotzdem mitbringen? Was meinen Sie?«
»Natürlich, Zoli, warum nicht?«, erweiterte Maddalena großzügig die Einladungsliste ihres zukünftigen Stiefvaters. Was machte schon ein Gast mehr oder weniger? Diese Hochzeit lag ihr schwer im Magen. Mit der Idee, halb Grado zu den Zeugen seiner Eheschließung zu machen, hatte das ohnehin schon großspurige Verhalten ihres Chefs noch zusätzlich Fahrt aufgenommen.
In ihrem Büro fand sie den Conte und Arturo Fanetti in ein angeregtes Gespräch vertieft. Maddalena musterte den Adeligen. Er sah aus wie einer der Weinbauern, die sie durch Franjo kannte. Rotgesichtig, korpulent und leger gekleidet. Ein silberner Haarkranz begrenzte seine spiegelblanke Glatze. Seine Augen blickten freundlich, wenn auch ein wenig Angst darin zu liegen schien. Und er verströmte einen leichten Alkoholgeruch, der Maddalena an fruchtige Weißweine denken ließ.
»Stellen Sie sich vor, Commissaria, ich kenne den Vater Ihres Kollegen vom Golfen, wir habe gerade darüber gesprochen«, hob er nervös an, doch Maddalena stoppte ihn mit einer Geste am Weiterreden.
Fanetti sah mit leicht abschätzig gekräuselten Lippen vom Notebook hoch.
Nachdem der alte Mann die erforderlichen Angaben zu seiner Person gemacht hatte, erkundigte sich Maddalena nach dem Grund für seinen Besuch.
»Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, aber mein schlechtes Gewissen lässt mir keine Ruhe, seit mir die möglichen Zusammenhänge klar geworden sind. Was der Sturm im Garten der Villa Esperanza zum Vorschein brachte…«
Wenn das so zäh weiterging, konnte sie sich das Mittagessen mit ihrer Freundin Bibiana abschminken.
»Nun?« Sie sah ihn aufmunternd an. »Conte Breciani, was ist es denn, was Sie an den Knochenfunden so irritiert hat?«
»Nein, bitte nennen Sie mich nicht Conte, Signor Breciani reicht.« Er sah sie verlegen an. »Wissen Sie, es ist so: Wir wohnen auf einem Landgut in der Umgebung von Fiumicello und bauen Wein an.«
Maddalena grinste innerlich, ein Bild des Schriftzugs auf den Flaschenetiketten vor Augen: »ConteBR«.
»Früher hatten wir viele Angestellte, heutzutage ist es eher ein Familienbetrieb. Damals, und ich rede jetzt von einem Tag vor rund fünfzig Jahren, war ich ein Junge, und es war Sommer.«
»Wann genau?«
»Ich war dreizehn, als es geschah.«
Maddalena rechnete rasch nach und stellte fest, dass sie sich verschätzt hatte, der Graf konnte erst Anfang sechzig sein.
»Ich will nicht sagen, dass ich mich langweilte, mein Vater war streng und wusste uns zu beschäftigen. Freizeit blieb kaum. Wir Kinder wurden durchgehend mit allerlei Aufgaben betraut und mussten unterschiedliche Sportarten betreiben. Ich hatte einen wunderschönen Papagei, einen Beo, dem ich mit großem Ehrgeiz das Sprechen beibrachte. Manchmal half ich dem Gärtner in unserer Parkanlage, ich hatte ein Faible für Blumen, eigentlich für alles Schöne. Und es traf mich wie ein Blitz, als ich sie das erste Mal sah. Sie, das war eine Küchenhilfe, ein Mädchen aus Schweden. Der Korb auf ihrer Schulter quoll über von Gemüse und Kräutern. Bis heute verbinde ich diesen Geruch mit ihr.«
Einen Moment lang war Maddalena abwesend. Sie verband Franjo mit diesem Geruch und wurde von Sehnsucht nach ihm erfasst.
»Sie schaute mich an, und ich war von der ersten Sekunde an unsterblich in sie verliebt. Nie zuvor und nie wieder danach sah ich so meerblaue Augen. Sie trug ihr glattes blondes Haar in der Mitte gescheitelt und zu einem Zopf gebunden. ›Kommst du aus einem Märchen?‹, fragte ich sie, und sie antwortete in einem so schlechten Italienisch, dass ich sie kaum verstand: ›Ich bin Frau Holles Pechmarie.‹ Aber egal was sie sagte, ob an diesem Tag oder in den darauffolgenden Wochen, ich hing an ihren Lippen. Sie hieß Lykke und war schon achtzehn. Sie war von Schweden nach Italien gereist, weil sie den Süden kennenlernen wollte. Bei uns auf dem Landgut konnte sie kostenlos wohnen und als Küchenhilfe etwas Geld verdienen. Ich glaube, sie sah kaum mehr als ein kleines Hündchen in mir, das ihr überallhin folgte.«
»Einen Moment bitte. Ich komme gleich zurück«, warf Maddalena ein, nahm ihr Handy und ging in Zolis Büro. Dort atmete sie tief durch. »Der Conte holt ziemlich weit aus, das kann eine Weile dauern. Sagen Sie bitte mein Mittagessen mit Bibiana ab.«
Zoli nickte und öffnete die Visitenkarte, die sie ihm via WhatsApp schickte. »Wird erledigt. Soll ich Ihnen ein paar Tramezzini mit Thunfisch und Ei besorgen?«
»Das wäre nett.«
Zoli sorgte gern für ihr Wohlbefinden, und sie war nicht wirklich erstaunt, dass er ihren Geschmack kannte.
Zurück in ihrem Büro, setzte der Conte seine Ausführungen anstandslos fort, so als hätte sie den Raum gar nicht verlassen. Maddalena war inzwischen gebannt von seiner Geschichte und unterbrach ihn kein einziges Mal.
»Ich konnte nicht aufhören, sie anzustarren, und lauerte ihr überall auf. Meinem Papagei brachte ich ihren Namen bei. Lykke fand mich niedlich, oft strich sie über mein damals noch volles schwarzes Haar und sagte: ›Kleiner Conte, wenn du bloß ein paar Jährchen älter wärst.‹ Ich bedauerte das, denn im Unterschied zu ihr sah ich darin kein Problem. Meine großen Schwestern zogen mich auf und ließen an Lykke kein gutes Haar. ›Eine Herumstreunerin ist sie, die wird dir noch ordentlichen Kummer bereiten. Halt dich von der besser fern.‹ Natürlich hörte ich nicht auf sie, auch wenn sie schließlich recht behalten sollten. Einer unserer Stallburschen hatte mir im Vorjahr das Mopedfahren beigebracht, und so borgte ich mir einmal heimlich sein altes Vehikel aus und fuhr mit Lykke nach Grado an den Strand. Es war spätnachts, und die meisten Leute schliefen schon. Der Sand war noch warm vom heißen Tag. Über uns hing eine schmale Mondsichel, die kaum Licht spendete. Sterne waren in jener Nacht keine zu sehen. Das Meer hatte sich zurückgezogen, und sogar die Möwen schliefen. Wir saßen eine Weile so nebeneinander, bis Lykke meine Hand nahm und leise fragte: ›Hast du schon mal geküsst, kleiner Conte?‹ Ich weiß noch, wie mir die Hitze ins Gesicht stieg. Mutig drehte ich mich zu ihr und dachte, jetzt oder nie. Ihre Haut fühlte sich samtig an, als ich ihr Gesicht berührte. Ihre Lippen waren voll, und sie schmeckte nach Gemüse und Kräutern. Es war mein erster Kuss, und ihr langes offenes Haar kitzelte meine Wangen. ›Genug‹, sagte sie und machte sich los. ›Ja, ich habe schon geküsst‹, sagte ich und grinste. Ich war selig vor Glück.«
Maddalena hörte Fanetti leise seufzen. Dachte er an seine eigene romantische Liebesgeschichte mit Ginevra, oder passte er sich ihrer wieder zunehmenden Ungeduld an? Trotz der nicht zu leugnenden Spannung, die sich während Brecianis Erzählung in ihr aufbaute, konnte sie ein Gähnen nicht unterdrücken.
»Ich komme gleich zum Punkt.« Sein Gesicht hatte sich noch eine Spur mehr gerötet, und die Angst in seinen Augen hatte die Freundlichkeit verdrängt. »Nach dieser Begegnung sah ich Lykke eine Zeit lang nur noch aus der Ferne. Ich spürte, dass sie es vermied, mich zufällig zu treffen, und das ging zu meinem Kummer einige Tage so. Dann, eines Abends, klopfte es leise an meiner Tür. Ich war gerade mit Sprachübungen beschäftigt in der Absicht, meinem Beo ganze Sätze beizubringen. Sie handelten von ewiger Liebe. Damit wollte ich Lykke überraschen und sie für mich gewinnen. Da ich eine meiner Schwestern vermutete, riss ich verärgert die Tür auf, doch es war Lykke, die draußen stand. Sie weinte, und ich zog sie schnell ins Zimmer. Stockend erzählte sie mir, sie würde ein Kind erwarten, und ich überlegte eine Schrecksekunde lang, ob unser Kuss am Strand der Grund sein könnte. ›Nicht von dir, kleiner Conte‹, sagte sie, als könnte sie meine Gedanken lesen, und lächelte unter Tränen. ›Von wem ist es?‹, fragte ich bestürzt, aber das wollte sie mir nicht verraten. ›Es muss weg. Es zerstört mein Leben. Bitte hilf mir‹, sagte sie und erklärte mir ihren Plan. Eine der alten Köchinnen kannte eine Frau, die Schwangerschaftsabbrüche vornahm. Dolores hieß sie, daran kann ich mich noch erinnern, weil der Name vom lateinischen Wort für Schmerz abstammt, und ich fand das sehr passend. ›Das ist gefährlich und verboten‹, sagte ich. Aber meine Einwände überzeugten sie nicht, und schließlich fuhren wir mit dem Moped nach Grado. Ich hatte niemandem ein Sterbenswörtchen von unserem Vorhaben erzählt, nicht einmal der Stallbursche sollte um den Grund der Ausfahrt wissen. Er war ein mürrischer Kerl, und er beobachtete Lykke auf eine unangenehme Weise.«
Breciani hielt einen Moment inne. »Als wir in Grado angekommen waren, klingelte Lykke an der Haustür der Villa Esperanza und verschwand für etwa zehn Minuten, die mir wie Stunden vorkamen. Ich wartete neben dem Eingang zum Garten, der einem tropischen Urwald glich. Überall lungerten Katzen, teilweise saßen sie auf kleinen Grabsteinen unter den Palmen und starrten mich böse an. Ich bekam große Angst, und als Lykke endlich herauskam, fuhren wir zum Strand. Wir setzten uns in eine Bar und aßen ein Eis. Sie wirkte bedrückt, und ihre Hände zitterten, als sie das Eis löffelte. ›Du darfst das nicht machen‹, sagte ich. ›So etwas kann schiefgehen. Es ist aus diesem Grund verboten. Ich werde dich heiraten. Dann kommt alles wieder in Ordnung.‹ Ich hätte es getan und dachte keinen Moment an die Folgen. Lykke wäre wegen Unzucht mit Minderjährigen ins Gefängnis gekommen, hätte ich das Kind als meines ausgegeben. ›Nichts wirst du tun‹, sagte sie. ›Ich fahre nach Schweden zurück. Meine Eltern werden mir helfen. Wenn du mir für die Reise ein wenig Geld geben könntest, wäre ich dir auf ewig dankbar.‹ Natürlich gab ich ihr, was sie wollte. Außer meinem eigenen Sparschwein knackte ich, kaum dass wir wieder zu Hause waren, auch die meiner Schwestern. Lykke wartete im Gemüsegarten auf mich. Ich war unendlich traurig, weil sie mich verlassen musste. Aber sie versprach mir, sich zu melden, und als Dank für das Geld schnitt sie sich eine Haarsträhne ab und wickelte sie in ein Stück Stoff. Danach habe ich sie nie wiedergesehen. Sie schrieb auch nicht wie versprochen. Am nächsten Tag war sie einfach verschwunden.«
Wieder seufzte Fanetti, und Maddalena konnte es ihm nicht verübeln. Das Gehörte machte auch sie traurig.
»Wenn ich Sie richtig verstehe, ist Lykke Ihrer Meinung nach nicht nach Schweden zurückgekehrt, sondern fuhr mit dem Geld auf direktem Weg zur Engelmacherin.«
»Ja. Zuerst war ich überzeugt, dass sie zu ihrer Familie zurückgegangen war. Aber nach einer Weile… Jedenfalls habe ich die Haarsträhne dabei.«
»Sehr gut«, hörte sie Fanetti aussprechen, was sie selbst in diesem Moment dachte.
Maddalena nahm ein Paar Handschuhe aus ihrem Schreibtisch und tütete die in ein Stück Stoff gehüllten blonden Haare ein. »Wir geben das zur Untersuchung an die Rechtsmedizin weiter und lassen einen Abgleich machen.«
»Gesetzt den Fall, dass es eine Übereinstimmung gibt, müssen wir die Hinterbliebenen kontaktieren. Wissen Sie, wo die Familie in Schweden gewohnt hat?«
»Leben die Eltern des Mädchens nach fünfzig Jahren überhaupt noch?« Fanetti konnte sehr direkt sein, aber er war aufmerksam, und das schätzte Maddalena an ihm.
»Das ist so eine Sache«, sagte Breciani. »Ich weiß nur, dass sie aus der Gegend um Uppsala stammte, kannte aber nicht einmal ihren Nachnamen. In den Unterlagen meiner Eltern aus dem Jahr konnte ich auch nichts Verwertbares finden. Und fragen können wir sie nicht mehr, sie sind, genau wie die Köchin, inzwischen verstorben. Der Stallbursche war nur wenige Jahre älter als ich und könnte Näheres gewusst haben, doch er hatte sich am Ende jenes Sommers in unserer Scheune erhängt. Man munkelte, er sei unglücklich in das Schwedenmädchen verliebt gewesen. Ich fragte mich damals, ob er Lykke etwas angetan haben könnte, sie vielleicht vergewaltigt hatte. Doch es erschien mir abwegig, dass er sich deswegen umgebracht haben sollte. Dann traten andere Dinge in den Vordergrund, und ich muss zugeben, dass Lykke langsam aus meiner Erinnerung verschwand«, schloss er seine Erzählung.
In wen war ich mit dreizehn verliebt, überlegte Maddalena und stellte betroffen fest, dass es damals einen Jungen in ihrer Schule gegeben hatte, an den sie wohl jahrzehntelang nicht mehr gedacht hatte.
»Gibt es sonst noch jemandem auf Ihrem Hof, der Lykke kannte?«
Er dachte kurz nach. »Nein, von den damaligen Angestellten ist keiner mehr bei uns. Meine beiden Schwestern könnten Sie befragen. Aber angenehm wäre mir das nicht, wenn sie, selbst nach all den Jahren, mitbekämen, was für eine Rolle ich in der Angelegenheit gespielt habe.«
Maddalena lächelte den Conte unbestimmt an, entschied, dass es nichts mehr zu sagen gab, und wandte sich an Fanetti. »Wenn Sie das Protokoll fertig haben, schließen Sie den Computer bitte wieder an den Strom an. Ich bin in einer Dreiviertelstunde zurück.«
Sie verabschiedete sich vom Grafen, dachte, armer Hund, in deiner Haut möchte ich nicht stecken, und zog ihre Lederjacke über. Dann holte sie bei Zoli ihre Tramezzini ab und ging in den späten Nachmittag hinaus.
2
Maria hatte Angst.
Und das lag nicht an den Toten. Der, der ihr Schrecken einflößte, war durch und durch lebendig.
Trotzdem würde sie es durchziehen. Heute war der Tag, an dem sie den Schlussstrich setzen musste.
Ihr Handy schnatterte. Erleichtert nahm Maria das Gespräch entgegen.
»Hallo, dumme Gans«, begrüßte sie ihre Cousine.
»Hallo, blöde Ziege«, antwortete Floriana keineswegs beleidigt.
Seit ihrer Kindheit waren sie füreinander jene Gestalten aus dem Tierreich, die oft als Schimpfwörter herhalten mussten. Und als die Handyhersteller begannen, individuelle Klingeltöne zu entwerfen, hatten Maria und Floriana ihre Freude daran, sich einander mit Ziegenmeckern und Gänseschnattern bemerkbar zu machen.
»Hast du es endlich hinter dich gebracht? Wenn nicht und wenn du das nicht mehr willst, steh ich dir trotzdem bei.«
Floriana konnte Maria beruhigen, wie kein anderer es vermochte. Sie waren im selben Jahr geboren, und ihre Mütter waren Schwestern, die Brüder geheiratet hatten. Ihre enge Verbindung, so meinten sie, ging darauf zurück, dass sie von Rechts wegen Zwillinge hätten sein müssen. Oft standen sie zusammen vor dem Spiegel und musterten sich.
»Wie ist es möglich, so unterschiedlich auszusehen und so gleich zu ticken?«, fragte Floriana dann und zerzauste ihr kurz geschnittenes hellblondes Haar, das kreuz und quer vom Kopf abstand. Maria lachte dazu und schüttelte ihre braunen langen Locken.
»Nein, Gans, lieb von dir. Doch diesmal ziehe ich es wirklich durch. Ich bin es meinem Stolz schuldig.«
»Vielleicht aber auch deiner Verliebtheit in den Mann aus dem Norden, Ziege?«
Vor einiger Zeit hatte sie bei einem Kurzurlaub mit ihrer Cousine auf dem italienischen Festland, weit weg von Sizilien, ihre große Liebe kennengelernt. Maria war vom ersten Moment an hin und weg gewesen von ihrem sanften »Mann aus dem Norden«, wie sie ihn seither nannten. Er passte so gar nicht in ihr Beuteschema, befand Floriana. Damit meinte sie wohl, dass er ihrem Dauerfreund, mit dem sie seit Jahren zusammen war und von dem sie sich nicht lösen konnte, nicht unähnlicher sein könnte. Und es stimmte. Der Mann aus dem Norden unterschied sich in jeglicher Hinsicht von Salvatore.
Floriana hatte ihre Zuneigung zu ihm eine Weile salopp als Schwärmerei abgetan, erkannte dann aber die tiefen Gefühle, die Maria für ihn hegte. Dabei war Maria in den ersten Monaten selbst nicht ganz sicher gewesen, ob diese Liebe eine Zukunft hatte. Natürlich gab es die Befürchtung, dass es ein Fehler wäre, ihr gewohntes Leben kurzerhand nach Norden zu verlegen, um es mit einem Mann zu teilen, den sie nur wenige Tage kannte. Doch nach unzähligen Telefonaten und zwei heimlichen Wiedersehen hegte Maria keinerlei Zweifel mehr. Sie würde ihren Freund verlassen und damit wohl auch Sizilien für immer den Rücken kehren.
Selbstverständlich hatte sie Angst gehabt, denn sie wusste um den archaischen Zorn ihres Dauerfreundes, wenn er sich verraten fühlte.
Doch dann hatte das Schicksal Salvatore in die Hände gespielt. Marias Vater war schwer erkrankt. Salvatore, der sich selbst gern als Familienmenschen bezeichnete, setzte alles daran, seinem zukünftigen Schwiegervater, wie er ihn stolz nannte, die bestmögliche Pflege zukommen zu lassen. Er hatte die Mittel dazu. Maria nicht. Natürlich nahm sie sein Angebot dankbar an. Ihr Vater sollte nicht leiden müssen. Ihre Abreise verschob sie auf später. Auf ein Später, an das sie nicht denken mochte, war es doch an den Tod ihres geliebten Vaters gebunden.
Tag für Tag saß sie an seinem Krankenbett. Salvatore, von dem sie sich zu diesem Zeitpunkt wieder einmal getrennt hatte, bedrängte sie, zu ihm zurückzukommen, bezahlte das Heim, danach das Hospiz, ersparte ihrem Vater dadurch große Qualen und starke Schmerzen, weswegen sie ihn nicht abweisen konnte.
Nachdem ihr Vater im letzten August verstorben war, hatte sie unter Tränen ihre Sachen gepackt und war in den Zug nach Norden gestiegen. Doch ein schlimmer Sturm hatte schon nach wenigen hundert Kilometern die Weiterfahrt verhindert, und Salvatore bekam Wind davon. Er ließ sie von einem seiner Freunde abholen und stellte sie danach monatelang unter Beobachtung. Eine furchtbare Zeit, in der sie seine Aggressionen ungefiltert hatte ertragen müssen, um ihn nicht vollends gegen sich aufzubringen. Außerdem kannte sie die Gerüchte, wie er mit Frauen verfuhr, die ihn verlassen hatten. Doch sie würde nicht aufgeben, denn seit jenem Sommertag, an dem sie ihn getroffen hatte, war ihr klar, was sie wirklich wollte.
Nun bot Floriana ihre Unterstützung an, weil sie wusste, wie schwierig sich die Trennung von Marias langjährigem Freund gestaltete.
»Ich habe das Leben im goldenen Käfig satt, das weißt du. Ich wähle bewusst zwischen einem Luxusgefängnis und einem ruhigen Dasein an der Seite meines Seelenverwandten. Diesmal wird es klappen. Es muss. Und Papa kann ich damit auch nicht mehr schaden.«
»Beruhige dich, ich will dir nur Mut machen. Wir alle stehen hinter dir. Niemand möchte, dass du Teil seiner Familie wirst. Du wusstest von Anfang an, wie ich darüber denke.«
»Ja. Ich war blind, ich wollte das damals nicht wahrhaben.«
Salvatore arbeitete, wie er es nannte, im Export-Import-Geschäft. Über die Jahre hatte Maria sich an den damit verbundenen Reichtum gewöhnt und Stück für Stück ihr Leben für seines aufgegeben. Einzig ihre kleine Wohnung mitten in Trapanis Altstadt hatte sie sich als ihr persönliches Refugium bewahren können und die Herausgabe eines Zweitschlüssels beharrlich verweigert.
Forscher, als sie sich fühlte, verabschiedete sie sich von ihrer Cousine. »Wir sehen uns dann nach der Prozession.«
»In Ordnung. Der Karfreitag ist ein würdiger Tag für dein Vorhaben. Bis später, kleine Ziege. Kopf hoch. Du schaffst es.«
Maria atmete tief durch und ließ das Handy in die Tasche ihrer Jeans gleiten.
Als es klingelte, öffnete sie mit klopfendem Herzen.