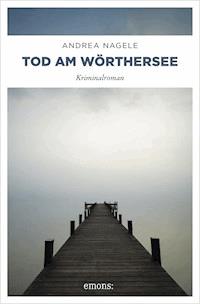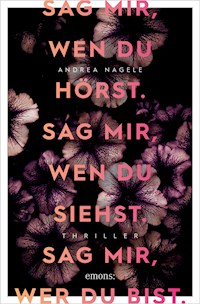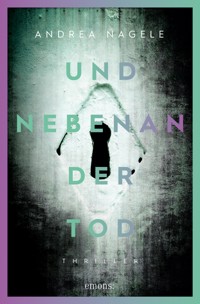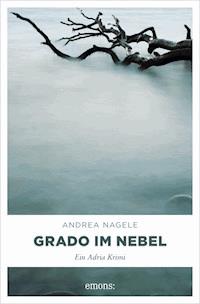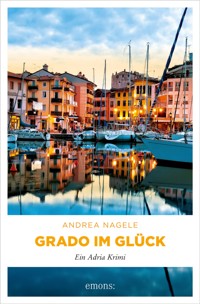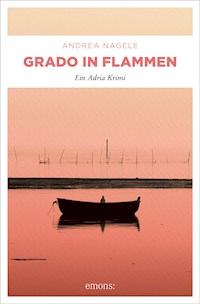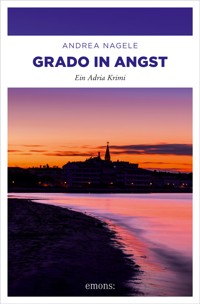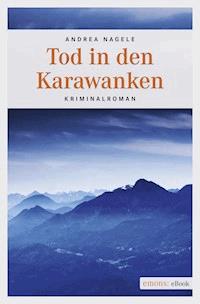
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kommissar Simon Rosner hat sich in eine Entzugsklinik zurückgezogen, um seine Alkoholsucht behandeln zu lassen. Sein Aufenthalt wird jedoch jäh unterbrochen, als ihn ein alter Schulfreund um Hilfe bittet. Dessen dreizehnjährige Tochter ist verschwunden; die Mutter des Kindes verhält sich seltsam unbeteiligt. Stück für Stück gewinnt Rosner Einblick in eine familiäre Katastrophe – und gerät in einen Strudel aus Erpressung und Mord.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Nagele ist mit Krimi-Literatur aufgewachsen und leitete über ein Jahrzehnt lang ein psychotherapeutisches Ambulatorium. Neben dem Schreiben betreibt sie eine psychotherapeutische Praxis. Sie lebt mit ihrer Familie in Klagenfurt am Wörthersee und in Grado in Italien.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: mauritius images/Simone Wunderlich Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-129-1 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für meine Mutter, die mir die Freuden des Lesens und infolgedessen jene des Schreibens geschenkt hat
1
Ein Handy schrillt.
Ich schrecke hoch.
Das muss Lena sein.
Verdammt, ich habe verschlafen!
Wo liegt das Telefon?
Die Balken vor den Fenstern haben alles Licht ausgesperrt und den Raum in eine Höhle verwandelt. Zwischen den Büchern auf dem Boden blinkt es grün.
»Lena?«
Statt meiner dreizehnjährigen Tochter antwortet Hanno: »Ich dachte, du meldest dich, sobald sie angekommen ist?« Seine Stimme klingt kratzig und vorwurfsvoll.
»Ja, ja«, murmle ich und fische das T-Shirt vom Bettrand.
Das Handy ans Ohr gepresst, schlüpfe ich in meine Jeans. Ich muss zum Busbahnhof. Lena verzeiht es mir nicht, wenn ich sie warten lasse.
»Ja, ja? Ist sie noch nicht da, oder was? Sag schon«, fährt Hanno mich an, so wie er es seit der Trennung häufig tut.
Seine Stimme, die mich früher verzauberte, löst nur noch Ärger in mir aus.
»Gleich. Ich rufe zurück.« Schnell unterbreche ich die Verbindung.
Ungeduldiger Hanno. Zornige Lena. Schlaftrunkene Lilo.
Die Flip-Flops stehen im Vorzimmer. Prompt stoße ich in der Dunkelheit gegen die Zimmertür. Verschlafen kann ich die Entfernungen noch nicht richtig einschätzen.
Es riecht nach frischer Wandfarbe– nach Essig und Kalk. Die Wohnung ist neu.
Und sie gehört mir.
Schon fünf.
Warum hat der Wecker nicht geklingelt?
Ich erinnere mich ganz genau, ihn auf sechzehn Uhr dreißig programmiert zu haben, als ich mich nach der Pasta und dem Glas Ribolla Gialla für ein Stündchen aufs Ohr legen wollte.
Der Autobus aus Udine soll um sechzehn Uhr fünfundfünfzig hier in Grado ankommen. Na ja, beruhige ich mich und springe das schummrige Stiegenhaus hinunter– meistens verspätet er sich ohnehin. Ich beschließe, Lena nicht anzurufen, da ich mir ihr wütendes Schimpfen ersparen will. Wenn ich mich beeile, bin ich in drei Minuten ohnehin bei ihr.
Draußen schlägt mir dieselbe bleierne Hitze entgegen, die mich vorhin so müde gemacht hat. Kaum dass meine Gummisohlen den Gehsteig berühren, krümmen sich meine Zehen. Der heiße Asphalt dampft mir entgegen. Unbeeindruckt scheuert Giorgio, der Pizzabäcker, den Gehsteig vor seiner Take-away-Bude. »Salve!«, rufe ich ihm vorbeieilend zu, doch er schaut nicht hoch.
Ach Giorgio, denke ich, wie viele Pizzen haben wir schon bei dir geholt? Trotzdem bin ich dir noch immer keinen Gruß wert.
Ich schaue nach links zu Salvatores Bar. Dort trinke ich gern meinen Espresso. Die Schirme über dem Sitzgarten lassen mich einen Moment an Schatten denken, an wohltuend kühlenden Schatten. Doch unter den aufgespannten Stoffen sammelt sich bloß feuchte Hitze.
Salvatore winkt mir zu und zieht dabei seine dunklen Augenbrauen in die Höhe. So als wolle er mich fragen, warum ich bei dieser Temperatur, um diese Zeit, so schnell unterwegs bin.
Nickend fächle ich mit der Hand unter meiner Nase. Er soll nicht glauben, dass die dumme österreichische Touristin zur Siesta-Zeit freiwillig joggt.
Ich überquere die Straße und laufe durch die schmale Gasse zum großen Platz.
Vor mir die vielen leeren Haltestellen. Dann biegt ein Autobus ein, und ich atme auf. Zum Glück hat der Bus auch heute Verspätung. Sofort drossle ich das Tempo. Lena soll nicht bemerken, wie spät ich dran bin.
Obwohl sie sich in einer heftigen Pubertätsphase befindet und die Trennung ihrer Eltern sie noch zusätzlich in ihrer Auflehnung bestärkt, freue ich mich von Herzen auf mein widerspenstiges Kind. Diesmal, beschließe ich, wird Lena es nicht verhindern können, dass ich sie in die Arme nehme. Ich werde sie so fest drücken, dass sie nicht die geringste Chance hat, mir zu entkommen.
Lächelnd nehme ich mir vor, geduldiger zu sein, ihre Launen liebevoll zu ertragen. Leicht wird das nicht.
Die Türen schwingen auf, und zwei ältere Frauen mit vollen Einkaufskörben klettern vorsichtig die Stufen hinab. Eine Gruppe Jugendlicher folgt lärmend, doch Lena ist nicht unter ihnen.
Jetzt muss sie doch kommen?
Doch von Lena nach wie vor keine Spur.
Die Türen falten sich zusammen, so als würde der Bus im nächsten Moment losfahren. Erschrocken laufe ich vor und klopfe gegen die Scheibe. Der Fahrer sieht mich überrascht an und drückt auf den Öffner.
Möglicherweise ist Lena eingeschlafen und kauert auf einem der Sitze. Doch die Bankreihen sind leer. Nur der stechende Geruch heißer Plastiküberzüge dringt in meine Nase.
Ungeduldig fordert der Fahrer mich auf, ein Ticket zu lösen, mich zu setzen oder auszusteigen.
Mit einem mulmigen Gefühl frage ich, ob ein junges Mädchen in Udine zugestiegen ist. Lena ist leicht zu beschreiben. Ihre langen roten Locken übersieht keiner so schnell.
Doch der Schaffner verneint. »Wir kommen nicht von Udine. Das hier ist die Haltestelle, an der die Busse aus Görz stoppen.«
»Wo, verdammt, ist dann der Autobus aus Udine?«
»Längst wieder auf dem Weg zurück«, meint der Fahrer lakonisch und schließt mit einem Achselzucken die Türen.
Ich beiße mir auf die Unterlippe und suche den Busbahnhof ab, laufe gehetzt zwischen Kanal, Kreisverkehr und den Gassen hin und her.
»Lena!«
Sie muss hier irgendwo sein. Vermutlich versteckt sie sich, um mich für meine Unpünktlichkeit zu bestrafen. Das würde zu meinem selbstgerechten kleinen Monster passen. Und mir würde es recht geschehen.
Ans Handy geht sie nicht. Sie scheint es ausgeschaltet zu haben, trotz unserer Ermahnungen, immer erreichbar zu sein. Vor allem dann, wenn sie irgendwohin unterwegs ist. Na toll.
Schließlich gehe ich zum Fahrkartenschalter und erkundige mich bei der gelangweilten Beamtin nach dem Bus aus Udine. Der sei zeitgerecht angekommen und längst wieder weg, wiederholt sie die Aussage des Fahrers. An ein Mädchen mit roten Locken könne sie sich nicht erinnern, aber sie sehe sich aussteigende Fahrgäste sowieso nicht an.
Verdammt.
Wo ist meine Tochter?
Inzwischen reichen mir ihre Versteckspielchen. Meine Wangen glühen. Schweiß rinnt unter dem T-Shirt meinen Rücken entlang. Und mein Herz pocht heftig.
Was du kannst, meine Süße, das kann ich schon lange.
Zielstrebig, ohne mich noch einmal umzudrehen, verlasse ich den Platz und marschiere im Schatten der Häuser zurück zur Wohnung. Denn jetzt bin ich mir sicher, dass Lena auf ihrem blitzblauen Trolley lümmelnd vor der Haustür auf mich wartet. Doch schon von Weitem sehe ich, dass mir niemand entgegengrinst.
Ich klatsche mir auf die Stirn. Ja, wie denn auch? Weder Lena noch Hanno kennen meine neue Wohnung. Nie hätte sie allein hierherfinden können. Also wieder zurück zum Busbahnhof.
Es riecht durchdringend nach frisch gebackener Pizza.
Das Handy in der Tasche meiner Jeans beginnt zu plärren.
Das wird sie sein. Das muss sie sein.
Es ist Hanno.
Nervös nehme ich den Anruf entgegen.
»Lilo, was soll das? Du wolltest mich zurückrufen, sobald Lena angekommen ist. Gib sie mir.«
»Das geht nicht. Lena ist nicht hier aufgetaucht.«
»Was?«
»Ich versteh es auch nicht.«
»Was verstehst du nicht? War sie nicht im Bus?«
»Also…«, beginne ich zögernd.
Hanno bemerkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Seine Antennen für meine Ausweichmanöver haben sich nicht abgenützt.
»Stopp«, unterbricht er mich wütend, »du willst mir doch nicht allen Ernstes erklären, sie verpasst zu haben? Du hast vergessen, unsere Tochter vom Bus abzuholen? Sag, dass das nicht wahr ist!«
»Hanno«, mein schlechtes Gewissen ist unüberhörbar, »es waren nur fünf Minuten, die ich mich verspätet habe, und der Bus war noch nie pünktlich. Das weißt du so gut wie ich. Also fahr mich nicht an, es hätte auch dir passieren können«, füge ich lahm hinzu.
»Hätte es nicht. Nicht ich treibe mich mit meinen italienischen Liebhabern in Grado herum und vergesse dabei das eigene Kind, sondern du.« Hanno hört sich an, als wolle er mich durch das Telefon ohrfeigen.
»Wann hattest du zuletzt Kontakt mit Lena?«, frage ich schnell, denn es bringt nichts, auf seine Unterstellungen einzugehen. Außerdem habe ich diese langen, unergiebigen Streitgespräche unendlich satt.
»Als ich sie beim Bus abgeliefert habe. Nein, warte, etwa eine halbe Stunde später hat sie mir eine SMS geschickt.«
»Und?«
»Willst du das wirklich wissen?«
Ich gebe mir einen Ruck: »Wieso nicht?«
»Mama soll bei ihren neuen Freunden bleiben. Papa, ich will lieber bei dir sein.«
Unwillkürlich schlucke ich. Doch obwohl es wehtut, lasse ich mir nichts anmerken. »Das klingt ja, als müsste die arme Lena in die Wüste übersiedeln und nicht eine Woche mit mir in Grado Urlaub machen.«
»Ich weiß«, sagt Hanno eine Spur versöhnlicher, »aber so ist sie nun mal, unsere Kleine.«
»Glaubst du, dass Lena gemütlich in einem Café sitzt und mich in der Hitze herumrennen und sie suchen lässt?«
Ein Auto donnert an mir vorüber.
»Verdienen würdest du es.«
Ich sehe ihn vor mir, wie er seine Stirn runzelt und eine lästige Haarsträhne zurückstreicht. Wenn er zornig ist, schillern seine Augen grün. Früher hatte mir das gefallen, jetzt bringe ich es nur noch mit seiner mürrischen Stimmung in Verbindung.
»Okay. Ich nehme das Rad und drehe eine Runde, vielleicht wartet sie am Strand. Wir verständigen uns sofort, falls einer von ihr hört.«
Ich will noch etwas sagen, aber Hanno hat bereits aufgehängt.
Nach wenigen Minuten bin ich zurück im zweiten Stock der alten Villa, in der meine Wohnung liegt. Trotz der Hitze ist mein Körper mit Gänsehaut überzogen. In der Küche lasse ich Wasser aus der Leitung in ein Glas laufen. Es schmeckt schal. Hanno trinkt auswärts nur Mineralwasser aus der Flasche, er meint, die Rohre wären aus Blei, rostig und mit Bakterien übersät. Nicht nur in diesem Punkt unterscheidet sich unsere Betrachtungsweise.
Nervös suche ich nach dem Fahrradschlüssel, den ich ständig verlege. Ich finde ihn neben der Gießkanne auf der Balkonbrüstung.
Unter mir lässt sich eine Möwe auf dem Abfalleimer nieder und beginnt, wild mit dem Schnabel auf ein Stück Brot einzuhacken. Sofort schwirrt eine zweite herbei. Mit lautem Gekreische versucht sie, der ersten das Brot zu entreißen. Wer gesagt hat, dass diese Vögel friedlich sind, muss sich geirrt haben. Raubtiere sind das. Keine Spur von Möwe Jonathan.
Schnell radle ich durch die Gassen hinunter zum Meer. Vielleicht wartet Lena in der Strandbar auf mich. Früher sind Hanno und ich Sommer um Sommer mit ihr nach Grado gefahren und haben Jahr für Jahr dieselbe Kabine an der »Spiaggia Principale«, dem Hauptstrand, genommen. Auch diesmal reservierte ich Lena zuliebe die Nummer52. Mir selbst habe ich solcherlei Sentimentalität längst abgewöhnt.
Erfolglos presse ich den Magnetstreifen meiner Eintrittskarte an die Maschine am Strandeingang. Das Gerät hat den Geist aufgegeben. Der Kontrolleur winkt mich achselzuckend durch.
Die Hitze des Sandes durchdringt meine Gummisohlen. Noch schlimmer ist die schweißtreibende Luftfeuchtigkeit von über achtzig Prozent.
Unbeeindruckt von alldem klatschen die Wellen ans Ufer. Die Flut hat begonnen. Um mich herum vermischen sich die unterschiedlichen Strandgeräusche zu einem einschläfernden Singsang. Es riecht nach Algen. Wahrscheinlich gab es heute Nacht Sturm, der Seegras und Tang ans Ufer getrieben hat.
Vor unserer Kabine erwartet mich eine leere Sonnenliege.
Mist!
In der Hektik habe ich die Schlüssel in meiner Wohnung vergessen. Die Tür bleibt verschlossen, sosehr ich auch am Knauf rüttle.
Ich frage Benedetto, den Bademeister, ob meine Tochter hier war. Mit den Spitzen meiner Flip-Flops bohre ich dabei Löcher in den heißen Sand. Bedauernd schüttelt er den Kopf. Er kennt Lena schon seit ihrer Geburt.
Ein einzelner Gedanke jagt durch mein Hirn, doch ich schiebe ihn sofort beiseite. Die Narbe an meiner linken Hand beginnt zu kribbeln. Keine Zeit für Erinnerungen.
Die Strandbar ist überfüllt, die Luft flirrt im gleißenden Licht. So angestrengt ich auch gegen die Sonne blinzle, nirgends kann ich den leuchtenden Rotschopf meiner Tochter entdecken. Ich erkundige mich bei der Serviererin, der Ticketverkäuferin und dem Kartenkontrolleur nach ihr. Niemand will sie gesehen haben.
Immer verunsicherter trete ich in die Pedale und nähere mich der steinernen Uferpromenade. Gerade als ich das Rad mit der Kette sichere, biegt mein Kind um die Ecke.
»Lena!«
Zornig und erleichtert zugleich laufe ich auf sie zu– nur um Zehntelsekunden später erkennen zu müssen, einem Trugbild meiner überreizten Phantasie aufgesessen zu sein.
Ein fremdes Mädchen wirft seinen hennafarbenen Zopf zurück und sieht mich erstaunt an. Entschuldigend hebe ich meine Arme und drehe die Handflächen nach außen.
So hat die Suche keinen Sinn.
Ich radle zu Salvatore. Alles in mir sehnt sich nach dem eiskalten cremig-schwarzen Espresso, den nur er so hinkriegt, wie ich ihn mag.
»Was ist los?«
Seinen aufmerksamen Augen entgeht nichts.
Stöhnend lasse ich mich auf einen der Plastikstühle unter den Sonnenschirmen fallen. Schweiß sammelt sich unter meinen Achseln. Meine Haare kleben am Nacken.
Erst als mein Getränk vor mir steht und ich einen Schluck genommen habe, antworte ich. Ihm gegenüber kann ich meine Verunsicherung zeigen. Er streicht mit dem Zeigefinger leicht über meinen nackten Oberarm, auf dem sich alle Härchen aufstellen.
»Kann ich dir helfen?«
»Nein. Ich weiß nicht. Warte…«
Heftig ziehe ich meinen Arm weg und greife nach meinem Handy, das schnarrend klingelt.
»Lilo!« Die Stimme meines Mannes hat den aufgeregten Klang, den ich nur zu gut kenne. Doch inzwischen habe ich verlernt herauszuhören, ob diese Tonlage etwas Gutes oder Schlechtes bedeutet.
»Hanno, ist Lena bei dir aufgetaucht?«
Viel zu laut frage ich, und einige Barbesucher drehen ihre Köpfe zu mir. Also springe ich auf und marschiere mit dem Handy am Ohr zum Hafen.
»Ich dachte, sie ist bei dir?«
Er ist kaum zu verstehen. Im Hafenbecken rufen sich Fischer etwas zu, das Ausflugsboot Richtung Laguneninsel legt gerade ab. Vom Fischgeschäft auf der anderen Straßenseite weht mir ein dumpfer Geruch entgegen.
»Dann hätte ich dich angerufen, Hanno. Wie vereinbart.«
»So wird das nichts«, bellt er in mein Ohr und unterbricht die Verbindung. Wie ich dieses Auflegen hasse. Es ist verantwortungslos.
Benommen starre ich ins trübe Hafenbecken. Während ich den schillernden Ölfilm beobachte, der an manchen Tagen die Wasseroberfläche bedeckt, spüre ich wieder, wie das Narbengewebe an meiner Hand zu prickeln beginnt. Wut steigt hoch.
»Verdammt!«, schleudere ich den Möwen entgegen.
Hanno gibt mir die Schuld an Lenas Verschwinden. Damit macht er es sich so einfach. Zugegeben, ich habe ein paar Minuten verschlafen. Doch Lena saß nicht im Bus, sonst wäre sie von irgendjemandem hier gesehen worden. Also hätte ich auch eine Stunde zu spät kommen können.
Siebenmal schlägt die Turmuhr der Basilika Santa Eufemia.
Mein Magen verknotet sich schmerzhaft, denn meine Italienischstunde hat bereits begonnen.
Auch das noch.
Wäre alles nach Plan gelaufen, hätte ich Lena mit einem Stück Pizza und einer Cola in meiner neuen Wohnung zurückgelassen. In dieser Hinsicht ist sie unkompliziert. Ein Ventilator, das frisch bezogene Bett, eine DVD– schon ist mein Kind zufrieden.
Jetzt muss ich mich wieder beeilen.
Wie sehr ich meinen Italienischlehrer verabscheue!
Zu keinem Scherz bereit, griesgrämig und zutiefst pessimistisch verdüstert er mir Stunde um Stunde. Doch ich mache gute Miene zum bösen Spiel. Außerdem war Signor Zuberti der Einzige, der bereit war, mich zu meinen Bedingungen zu unterrichten. Das heißt, ich gebe Themen und Zeit vor– so, wie es mir gefällt. In meinem Sabbatjahr bin ich nicht bereit, Zugeständnisse zu machen. Immerhin zahle ich gut für seine Leistung.
Es ist ja nicht so, dass ich diese Sprache nicht längst bis ins kleinste Detail beherrschen würde, schließlich unterrichte ich sie seit über zehn Jahren. Trotzdem erfordert mein Beruf an einem Gymnasium, das sich auf moderne Sprachen spezialisiert hat, ständige Weiterentwicklung. Das war jedoch nur einer der Gründe, warum ich mir dieses Auszeitjahr nahm.
»Sollte Ihre Tochter nicht heute Nachmittag mit dem Bus aus Udine kommen? Ich dachte, Sie bringen die Kleine vielleicht mit?« Signor Zuberti zieht eine buschige Augenbraue fragend in die Höhe und zupft an seinem Ziegenbart.
»Nein. Sie hätte zwar ankommen sollen, war aber nicht im Bus. Und mitgebracht hätte ich Lena sowieso nicht. Sie versteht kein Wort Italienisch und hätte sich nur gelangweilt«, entgegne ich verärgert.
»Wie… Verstehe ich richtig? Ihre Tochter ist nicht in Grado angekommen? Aber wo ist sie dann? Und warum sitzen Sie hier bei mir, statt sie zu suchen?« Er wirft mir einen Blick zu, der unmittelbar das Gefühl einer großen Schuld in mir auslöst.
»Wahrscheinlich, weil ich eine Rabenmutter bin. Nein, im Ernst, mein Mann und ich glauben, dass Lena uns nur ein wenig zum Narren hält. Sie wird bald wiederauftauchen. Falls es Sie beruhigt, sie macht gerade eine wilde Phase durch. Man nennt das Pubertät«, verteidige ich mich angriffslustig.
Verständnislos sieht er mich an und verzieht dabei geringschätzig die Lippen. Um ihn von weiteren Fragen abzuhalten, bitte ich ihn, mir Substantive, Adverbien und Adjektive zu nennen, die den Begriff Rabenmutter beschreiben. Dabei schmunzle ich über seine Verwunderung und blinzle ihm verschwörerisch zu.
Wer so eindeutig seine Defizite als Mutter definiert, kann vollkommen schlecht doch nicht sein.
Signor Zuberti erwidert mein Lächeln nicht. Kühl nimmt er das Geld für die Stunde entgegen. Als unsere Finger sich berühren, zuckt er zurück.
Ich werde mir eine geeignetere Person für den Italienischunterricht suchen müssen. Wie komme ich dazu, mir die Launen und Schrullen dieses ältlichen Mannes gefallen zu lassen?
Paula, die Besitzerin der kleinen Bar, in der wir uns regelmäßig zur Konversation treffen, wirft mir über den Tresen hinweg einen bedauernden Blick zu. Signor Zuberti ist für seine mürrische Art bekannt. Fragend deutet sie auf meinen fast leeren Aperol Spritz. Sofort schüttle ich verneinend den Kopf. In stillem Einvernehmen zwinkert sie mir zu.
Gerade heute Abend habe ich noch einiges vor.
Es ist ein besonderer Abend. Seit Tagen habe ich mich auf ihn gefreut, ihn herbeigesehnt. Und das lag nicht nur an Lenas erwarteter Ankunft.
Nach dem hastigen Ausmachen des nächsten Konversationstermins und dem Begleichen der Rechnung– natürlich zahle ich auch Signor Zubertis Orangensaft– verlasse ich eilig die Bar.
Mein Smartphone hat während der Unterrichtsstunde keinen einzigen Ton von sich gegeben. Wieder versuche ich, Lena zu erreichen. Nach wie vor ist ihr Handy ausgeschaltet.
»Wo bist du? Ich habe deine Dramen so satt. Melde dich, und zwar pronto«, tippe ich zornig. Irgendwann wird sie ihr Telefon einschalten. Hauptsächlich, um die Nachrichten ihrer Freundinnen abzurufen. Früher habe ich Lenas Aktivitäten durch WhatsApp recht gut überprüfen können, zumindest wusste ich immer, wann sie das letzte Mal online war. Bis mein raffiniertes Töchterchen das durchschaute und diese Funktion fallweise deaktivierte.
Doch wenn ich ehrlich bin, will ich im Moment weder eine Antwort, noch dass Lena mit anklagendem Blick in meiner Wohnung sitzt. Deutlich kann ich den vorwurfsvollen Ton in ihrer hellen Stimme hören: »Musst du ausgerechnet unseren ersten gemeinsamen Abend mit jemand anderem verbringen? Wo ich doch gerade erst angekommen bin? Mama, du bist unmöglich.«
Vielleicht bin ich unmöglich, und ja, ich muss.
Weil ich es so will.
Nie würde ich das sagen, aber es ist die Wahrheit. Viel zu lange habe ich nur nach Hannos und Lenas Pfeife getanzt. Damit ist endgültig Schluss.
Ich lasse mich von keinem der beiden mehr einschränken. Heute Abend wird geschehen, worauf ich seit Wochen hingearbeitet habe. Das lasse ich mir von niemandem verderben.
Um meinem Ehemann zuvorzukommen, wähle ich seine Nummer. Schon nach dem ersten Freizeichen geht er ran.
»Lilofee?«
Wie Strom fährt dieser längst vergessene Name meiner Vergangenheit durch mich hindurch. Ein brennender Stich in der Narbe an meiner Hand bleibt zurück. Was erlaubt Hanno sich, mich so anzusprechen?
»Lena ist immer noch nicht aufgetaucht.« Ich bin erstaunt, wie kühl meine Worte klingen, sprengt das Trommeln meines Herzens mir doch fast den Brustkorb entzwei.
»Oh mein Gott!«, brüllt er, anscheinend gläubig geworden, in mein gepeinigtes Ohr.
Ich will diese angsterfüllte Stimme nicht in mein Inneres lassen.
»Hanno, reg dich ab. Du machst dich lächerlich. Deine kleine, süße Tochter buhlt um Aufmerksamkeit, und du fällst wie üblich darauf herein. Wie ich das satthabe.« Selbst ich bin bestürzt, wie viel Herzlosigkeit in meinen Worten mitschwingt. »Es wird ihr schon nichts passiert sein«, versuche ich, das Gesagte abzuschwächen.
»Du bist unmöglich. Sie ist ebenso deine Tochter, auch wenn du das mitunter vergisst«, zischt er.
Zornig drücke ich auf den Ausschaltknopf.
Träge schwappt das Wasser gegen das Steinufer der Kaimauer vor Paulas Bar. Ein leichter Schwefelgeruch liegt in der Luft. Vordergründig beschwingt, innerlich jedoch tief beunruhigt, mache ich mich auf den Weg zurück zur Villa.
In weniger als einer halben Stunde treffe ich Ricardo. Endlich erfüllt sich mein Traum.
Ricardo arbeitet als Architekt in Grados historischer Altstadt. Wir haben uns vor Jahren über ein Projekt von Hanno kennengelernt. Die Chemie zwischen uns stimmte von der ersten Sekunde an. Daran konnten weder seine Frau noch mein Mann etwas ändern, abgesehen davon, dass die beiden ohnehin nichts davon bemerkten. Dafür waren sie viel zu sehr mit ihren eigenen Befindlichkeiten beschäftigt.
Es ist beileibe nicht so, dass Ricardo und ich diese geistige Abwesenheit ausgenützt hätten. Wir haben uns zurückgehalten, einander nie allein getroffen, nicht ein einziges Mal eine verräterische SMS oder E-Mail geschickt, uns nie angerufen. Bis zu dem Nachmittag, als wir uns zufällig in einem der kleinen Cafés gegenüber der Basilika wiedertrafen. Beide hatten wir uns kurz zuvor von unseren Partnern getrennt. Wer also hätte uns ein Date verübeln können?
Hanno mit Sicherheit nicht.
Den Spiegel über dem Waschbecken werde ich austauschen müssen. Mein Gesicht blickt mir daraus allzu verhärmt entgegen. Ist es wirklich nur das Licht, das mit vierzig Watt meine Falten allzu genau ausleuchtet?
Heute Abend will ich diesem Rätsel nicht auf die Spur kommen.
Meine glatten dunkelblonden Haare, einst hellblond und mein ganzer Stolz, fallen, geteilt durch den Mittelscheitel, weit über meine Brüste. Was mich in meinen jungen Jahren wie eine Fee aussehen ließ, macht mich jetzt älter. Morgen werde ich zum Friseur gehen und mir einen neuen Haarschnitt verpassen lassen. Etwas Peppiges, vielleicht auch eine andere Farbe.
Die Feen-Zeit ist eindeutig vorüber. Kein wirklicher Verlust. Die Männer haben mir ebenso wenig Glück gebracht wie der armen jungen Lilofee aus dem alten Volkslied.
Wieder macht sich die Narbe unangenehm bemerkbar.
Ich seufze und betrachte meine helle, fast durchscheinende Gesichtshaut. Mit geübten Strichen verteile ich Creme und Make-up auf meinen müden Zügen, tupfe etwas Rouge auf die Wangenknochen und tusche meine Wimpern. Ein Hauch Lipgloss, ein letzter Blick in den Spiegel und ein Lächeln, das meine Züge weicher macht.
Die Bodylotion lässt meine zarte Bräune samtig schimmern. Die Farbe meines kurzen Sommerkleides ist vom gleichen Wasserblau wie meine Augen.
Fast wäre ich barfuß die Stiege hinabgelaufen. Grinsend schlüpfe ich in meine neuen Sandaletten. Als ich die Tür hinter mir ins Schloss ziehe, wird mir speiübel.
Lena.
Wo treibt sie sich nur herum? Und warum muss sie mir das antun?
Gerade heute Abend.
Entschlossen kämpfe ich das aufkeimende Gefühl bohrender Besorgnis nieder und lasse das Telefon achselzuckend im Badezimmer liegen.
So leicht, kleines Fräulein, mache ich es dir nicht.
Zufrieden strecke ich zwei Etagen tiefer Ricardo meine kühle Hand entgegen. Er legt den Arm um meine nackten Schultern. Seine Nase ist in einem interessanten Winkel nach unten gebogen, und die düsteren Brauen über seinen Augen nehmen seinem Gesicht den allzu smarten Ausdruck.
»Und? Hat deine Tochter sich mit einer Pizza zufriedengegeben?«
»Nein, Lena zog es vor, uns einen bösen Streich zu spielen. Sie war nicht im Autobus, wird wohl bei einer Freundin geblieben sein. Wahrscheinlich will sie, dass wir vor Sorge um sie ausflippen.«
Ricardo wirft mir einen seltsamen Blick zu. »Ist das denn nicht so? Wenn mein Luca einfach verschwände… Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Vermutlich wäre ich vor Angst völlig aus dem Häuschen.«
»Du redest schon wie Hanno. Aber ich kenne meine Tochter besser als ihr beide zusammen.«
Auch wenn ich es mir nicht eingestehen will, ärgere ich mich, das Handy aus kindischem Trotz im Badezimmer liegen gelassen zu haben. Wenn sie ihr Telefon irgendwann wieder einschaltet und meine Nachricht liest, könnte es ja sein, dass sie darauf reagiert.
Unangenehm, wenn der störrische Hanno mitbekäme, dass ich böse Rabenmutter nicht erreichbar bin.
Schluss damit. Natürlich wäre dieser Abend um einiges entspannter, harmonischer und romantischer, wenn ich wüsste, dass Lena, nach Duschgel duftend, schmollend im Doppelbett auf mich wartet. Nach der notwendigen Versöhnung würden wir uns gemeinsam ein paar Folgen unserer Lieblingsserie ansehen und aneinandergekuschelt friedlich einschlafen.
Andererseits bedeutet Lenas Abwesenheit auch, dass dieses frisch bezogene Bett heute Nacht nur auf mich wartet. Doch vielleicht nicht auf mich allein.
Verliebt schmiege ich mich an Ricardo und atme seinen leichten Schweißgeruch ein.
Als könnte er meine Gedanken lesen, schiebt er mich ein wenig von sich. »Heiß heute, nicht? Sogar am Abend steht einem die Luftfeuchtigkeit bis zur Stirn.«
Seine merkwürdige Wortwahl bringt mich zum Lachen. Möglicherweise bin ich seiner Sprache doch nicht so mächtig, wie ich glaube.
Während des Abendessens schaue ich immer wieder über seine rosa-weiß gestreifte Schulter hinaus in die Nacht. Vielleicht läuft Lena dort irgendwo durch die Menschenmenge, auf der Suche nach mir?
Ricardo nimmt meine Hand in seine und sagt freundlich: »So wie ich ihn kenne, kümmert sich Hanno bestens um die Angelegenheit. Mach dir nicht zu viele Sorgen. Alles wird gut.«
Genau darauf habe ich gewartet. Endlich ist da jemand, der mir den Kummer nimmt, mich tröstet, meine verborgenen Befürchtungen errät. Schnell schiebe ich die leichte Unstimmigkeit, die vorhin zwischen uns aufkam, beiseite.
Hanno hat mich in unseren letzten gemeinsamen Jahren stets beschuldigt, mir ungerechtfertigte Vorwürfe gemacht, war aufbrausend, sogar aggressiv zu mir. Ricardo hingegen… Zwischen uns beiden scheint ein Band der Übereinstimmung, eine innige Verbindung zu bestehen. Während ich ihn mit Hanno vergleiche, muss ich über meine umständliche Art, zu denken, lächeln. Es ist fast so, als hielte ich mir selbst einen inneren Vortrag über nonverbale Kommunikationstechniken.
Dabei ist alles so einfach. Ich stehe nicht mehr auf Hanno, dafür umso mehr auf Ricardo, und dieser wunderbare Mann ist augenscheinlich in mich verliebt.
Lena.
Irgendetwas schwappt bedenklich hoch in mir. Es werden wohl die Miesmuscheln in Weißwein sein. Dann beginnt das Narbengewebe zu jucken.
»Lass uns gehen«, murmle ich gegen die Übelkeit an und konzentriere mich beim Laufen auf die Steine unter mir.
Grau, weiß, zackig und rund.
Es riecht nach Seetang. Ob es morgen wohl regnen wird?
Als wir Hand in Hand an der Kirche vorbeischlendern, beruhigt sich mein Magen.
»Wollen wir auf einen Digestif bei Salvatore vorbeischauen?« Ricardo bleibt neben dem Obelisken stehen und mustert den alten Stein.
»Nein«, sage ich ein wenig zu schnell, »ich habe uns einen guten Tropfen gekühlt. Die neue Wohnung muss begossen werden. Und wenn nicht mit dir, mit wem dann?«
Hanno fällt mir ein. Ohne sie zu kennen, hat er schon in Klagenfurt mit einer Flasche Champagner auf die Wohnung, die er finanziert, mit mir angestoßen. Nur dass seine großzügige Geste um Jahre zu spät kam.
Erstaunt spüre ich Ricardos Zögern.
Er entzieht mir seine Hand und beschleunigt den Schritt. »Auf alle Fälle begleite ich dich nach Hause, Lilo. Das ist Ehrensache.«
Diese Töne gefallen mir gar nicht. Ich bevorzuge direkte Ansagen. So leicht lasse ich mir den Abend nicht verderben. Zuerst Lena, dann Hanno und jetzt auch noch Ricardo.
Egoisten. Alle drei.
»Das ist nicht dein Ernst, oder? Mich einfach abblitzen zu lassen.« Ich lächle ihn an.
»So ist es nicht. Lilo, du verstehst das falsch«, murmelt er, als wir in die Gasse einbiegen, in der meine Wohnung liegt. Wieder flattern Möwen kreischend von den Abfalltonnen auf dem kleinen Platz in die Höhe.
Vor der Haustür bleibt Ricardo ruckartig stehen. Unbeholfen stolpere ich gegen ihn. Er fängt mich auf, und ich atme neben seinem Körpergeruch den Duft blumigen Waschpulvers ein. Ich spüre seine warmen Hände auf meinen nackten Schultern. Erwartungsvoll sehe ich zu ihm hoch.
»Lilo, es gibt da…« Zu meiner Enttäuschung verstummt er mitten im Satz und heftet den Blick auf etwas hinter mir.
»Ja? Sag schon, mach es nicht so spannend«, hake ich ungeduldig nach.
Bevor Ricardo antworten kann, werde ich von ihm weggerissen und unsanft an die Hausmauer gepresst. Erschrocken starre ich in Hannos funkelnde Augen. Mein Magen verknotet sich schmerzhaft.
»Bist du komplett durch den Wind? Lilo! Unser Kind ist verschwunden, und du treibst dich mit Fremden herum, anstatt Lena zu suchen?«
Feine Tröpfchen seines Speichels landen auf meinem Gesicht. Angewidert drehe ich meinen Kopf weg, und das Entsetzen weicht einem Gefühl der Überlegenheit. Mit mir macht Hanno das nie mehr, nie wieder. Da hat er sich die Falsche ausgesucht. Jahrelang habe ich solche Szenen ertragen müssen. Eifersuchtsanfälle bis hin zum Verfolgungswahn.
»Reg dich ab. Komm runter und mach nicht so einen Terror«, werfe ich ihm entgegen.
Ich balle meine Hand zur Faust und stoße sie hart gegen seine Brust.
Überrascht taumelt er zurück. Sein Gesicht leuchtet tiefrot in der Dunkelheit.
»Ricardo ist kein Fremder.« Lächelnd suche ich den Blick meines Freundes. Doch außer den schnatternden Möwen sind da nur Hanno und ich. Von Ricardo keine Spur.
»Lilo, lass uns reden. Die Sache ist ernst. Komm endlich zur Vernunft. Es geht um Lena. Hörst du? Es geht um unser gemeinsames Kind, das in Gefahr ist. Das ist nicht bloß ein kindischer Streich, den sie dir spielt. Lena ist verschwunden.«
»Woher weißt du, wo ich wohne?«
»Salvatore gab mir den Tipp. Ist das alles, was dich interessiert?«
Arschloch, denke ich und sperre die Haustür auf, wenig später die Wohnung.
»Ich will, dass du Grado verlässt.« Hanno, der mir nachgegangen ist, starrt mich aus kalten Augen an und macht einen Schritt auf mich zu. Seine Hände schießen vor und packen meine nackten Oberarme.
Ich winde mich in seiner Umklammerung. Was erlaubt er sich? Ist er jetzt völlig durchgedreht?
Bevor ich sagen kann, was ich denke, fährt er fort: »Ich habe mich wohl nicht klar ausgedrückt. Ich will es nicht nur, ich bestehe darauf. Du kommst sofort mit mir nach Hause. Lilo, hast du mich verstanden? Lilo?«
»Lass los«, fauche ich.
Aber er tut nichts dergleichen, verstärkt eher noch den Druck. Es tut weh. Gleich werden sich seine Finger rot auf meiner Haut abzeichnen und morgen bläuliche Spuren hinterlassen haben. Wütend versuche ich, seine Hände abzuschütteln. Er lässt mich so abrupt los, dass ich taumle. Rücklings kippe ich aufs Bett.
»Tickst du noch richtig?«, brülle ich und richte mich auf.
»Mit dir ist nicht vernünftig zu reden, Lilo. Nicht ich, sondern du stehst neben dir. Ist dir nicht klar, dass wir sofort handeln müssen? Lena ist weg. Nicht auffindbar. Ich habe ihre Freundinnen angerufen, die Polizei verständigt… und…«
»Jetzt beruhige dich und mach kein Drama draus. Lena hat sich aus Zorn auf mich irgendwo versteckt. Du willst doch wohl nicht behaupten, alle ihre Freundinnen zu kennen? Nicht einmal du bist allwissend.«
Mit einem erschöpften Gesichtsausdruck setzt sich mein Ehemann neben mich aufs Bett.
»Lilofee.«
Wärme schießt in meine Wangen. Schweiß unter meinem Kleid, über der Oberlippe, auf meiner Stirn. Unangenehm berührt kämme ich die feuchten Haare zurück und streiche über die feine Haut meiner Narbe.
»Wenn es dir denn so wichtig ist…« Ich stehe auf, reibe über die schmerzenden Stellen an meinen Oberarmen. Die Haut brennt unter der Bewegung meiner Finger.
Hanno schwingt die Beine vom Bett. »Soll ich dir beim Packen helfen?«
Sein Blick eilt über die Gegenstände, die überall herumliegen, die Möbel, und bleibt wehmütig an dem gerahmten Foto an der Wand neben mir hängen.
Es zeigt uns drei. Lena lehnt mit einem schiefen Grinsen zwischen Hanno und mir. Damals war sie elf und konnte noch mit uns lachen. Ihre roten Locken ringeln sich über Hannos und meine Schultern, als hätte sie ihr Haar extra so drapiert. Ihre Arme umfassen unsere Nacken und ziehen uns dadurch ein Stück näher zusammen.
Sie ist das Band, das uns hält.
»Nein. Ich krieg das allein hin. Geh du in die Küche und mach uns Espresso, schön stark.«
Ich möchte Hanno weder dabeihaben, wenn ich meine persönlichen Sachen in den Koffer werfe, noch will ich, dass er die Rührung bemerkt, die mich erfasste, als er mit traurigen Augen das Familienfoto betrachtet hat. Meine Gefühle verberge ich prinzipiell vor anderen, häufig auch vor mir selbst. Es bringt nichts, mich auf das einzulassen, was mich manchmal überwältigt. Abschalten, den Hebel einfach umdrehen, ist eine Technik, die ich mir selbst beigebracht habe.
Als wir jünger waren, wollte Hanno mich zu einer Psychotherapeutin schicken. Er wäre auch mitgekommen, damit wir unsere »Traumen«– er nannte das so– aufarbeiten, jeder für sich oder gemeinsam als Paar. Ich bin ohne diesen Psychoquatsch entschieden besser dran. Er konnte mich zu keiner Therapie zwingen. Darüber hinaus war mir nicht klar, warum ich dort überhaupt hinsollte. Mit den merkwürdigen Gefühlen, die sich mitunter wohl jedem aufdrängen, kam und komme ich jederzeit klar. Genauso klar wie mit den Kapriolen, die das Wetter schlägt, oder den unterschiedlichen Windströmungen hier am Meer.
Hanno schafft das anscheinend weniger gut. Drei Jahre lang, einmal die Woche, pilgerte er zu einem Psychotherapeuten. Er wollte unbedingt zu einem Mann, denn er fand, dass Frauen sein Leben schon zu sehr beeinflusst hätten. Geändert haben diese Sitzungen nichts. Er war danach genauso wie davor. Als ich ihn fragte, ob er seine »Traumen« denn in den Griff bekommen hätte, wurde er zornig. Er beschuldigte mich, an einem Empathie-Defekt zu leiden, eine oberflächliche Zynikerin mit fehlenden Spiegelneuronen zu sein. Den »Empathie-Defekt« habe ich in einem psychologischen Bedeutungswörterbuch nachgeschlagen. Hannos Ansicht nach fehlt mir die Fähigkeit, Mitgefühl zu entwickeln.
Ich habe ihn nie wieder darauf angesprochen.
Eilig stürze ich den lauwarmen Espresso hinunter. Mir ist es unverständlich, warum niemand außer Salvatore den Kaffee so hinkriegt, dass er auch schmeckt: heiß oder eiskalt, aber immer so stark, dass er cremig in der Tasse stockt.
Ich werfe einen letzten wehmütigen Blick auf die glänzend polierten Flächen meiner Küche. Wie viele interessante Speisen wollte ich hier in der nächsten Zeit zubereiten, wie viele interessante Menschen zu mir einladen.
Obwohl ich spüre, dass Lena bald wiederauftauchen wird, gesund und munter, wird mich diese Angelegenheit einige Zeit in Klagenfurt festhalten.
Beim Gedanken an Kärnten überrieselt ein jäher Schauer meinen Körper. Wieder juckt meine Narbe unerträglich.
Rasch öffne ich den Kühlschrank und lege bis auf die geöffnete Flasche Weißwein sämtliche Lebensmittel in einen Pappkarton. Hanno beobachtet mich ungeduldig.
»Hol schon mal das Auto«, knurre ich. Ich halte seine vorwurfsvollen Blicke keine Sekunde länger aus.
»Okay, ich klingle dann, und du kommst herunter. Ich warte im Wagen.« Seine Stimme klingt unerwartet sanft.
Überrascht sehe ich hoch.
Aber Hanno hat schon die Tür hinter sich ins Schloss gezogen.
Obwohl es draußen nachtkühl ist, schaltet Hanno die Klimaanlage ein. Fröstelnd ziehe ich meine Sweatshirt-Jacke fester um mich und versuche, dem kalten Hauch aus der Düse zu entkommen. Achselzuckend drosselt Hanno das Gebläse. Meine nackten Oberschenkel unter dem kurzen Kleid kleben am Ledersitz.
Hannos Mercedes ist mehr als nur ein Beförderungsmittel, er ist das Symbol seines Erfolges. Für ihn steht neben seiner Tochter Prestige an erster Stelle. Ausgestattet wie eine teure Yacht, verströmt der Innenraum den Duft nach frisch eingelassenem Holz und poliertem Leder.
Mich beeindruckt so etwas nicht. Mein Auto ist ein in die Jahre gekommener VW, zu dem ich, anders als Hanno zu seinem Wagen, keine persönliche Beziehung aufgebaut habe.
Die Fahrt nach Klagenfurt wird dauern.
Angespannt kauere ich neben meinem verbissen dreinschauenden Ehemann. Der Weg über den Damm, der Grado mit dem Festland verbindet, beeindruckt mich immer wieder.
Zu beiden Seiten der Straße dehnt sich die Lagune aus, tagsüber grünblau schillernd, in der Nacht bedrohlich schwarz.
Es war, als hätte der mondlose Himmel sich im Wasser versenkt.
Bis zur Autobahnauffahrt Palmanova wechseln Hanno und ich kein Wort miteinander. Alles Gesprochene hätte zu Streit geführt. Schweigend fahren wir die endlos erscheinende Allee entlang, vorbei an Häusern der Mittelklasse, gepflegten Gärten, Pizzerien und vernachlässigten Industrieanlagen.
Erst auf der Autobahn bricht Hanno die Stille.
»Sag mir, dass ich es mir nur einbilde, dass ich falsch damit liege… Verschwendest du wirklich keinen einzigen Gedanken an unser Kind? Ist Lena dir völlig gleichgültig? Interessieren dich Bananenstauden in Vorgärten und Restaurantnamen mehr als alles andere? Sollte es so sein, fahre ich bei der nächsten Gelegenheit ab und bringe dich zurück, damit du in Ruhe weiter dein Sabbatjahr genießen kannst. Ohne unwillkommene Störung von außen.« Er macht eine dramatische Pause und sagt dann mit einem anklagenden Unterton: »Lilofee, bitte. Überzeuge mich vom Gegenteil.«
Wieder habe ich das Gefühl, als würde etwas in meinem Inneren reißen. Was erlaubt er sich? Ich presse den Zeigefinger meiner rechten Hand auf die Narbe, um das Kribbeln zu unterbrechen. Und es funktioniert.
»Hanno.« Sein Name klingt, so scharf in die Nacht gesprochen, wie ein Peitschenhieb.
Sofort löst sich sein Blick von der Straße und geht in meine Richtung. Um ihm zu entkommen, lehne ich meinen Kopf an die kühle Fensterscheibe.
»Was?«
»Reiß dich zusammen. Ich habe es satt, mir deine Unterstellungen anzuhören. Es reicht. Ich sitze hier in deiner Luxuskarosse, wie du es wolltest, und fahre mit dir zurück, um unsere pubertierende Tochter zu finden. Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass es sich nicht um eine bedrohliche Situation handelt, sondern bloß um eine weitere ihrer kleinen Teenager-Unverschämtheiten. Es ist Lenas verkorkste Art, uns zu zeigen, dass ihr nicht gefällt, wie wir leben. Um nichts anderes geht es hier. Und jetzt konzentriere dich auf die Straße. Du machst mir Angst mit deinem Geschwindigkeitsrausch. Ob wir eine halbe Stunde früher oder später in Klagenfurt ankommen, spielt keine Rolle.«
2
Simon Rosners Welt gerät in Bewegung.
Gedankenverloren starrt er aus dem Fenster seines Einzelzimmers. Vor ihm breiten sich grüne Wiesen im Morgentau aus. Ein undefinierbarer Duft weht ihm entgegen.
Alice.
Er sehnt sich nach ihr. Sein letzter Kontakt war ihre Mail aus Koh Samui. Dort faulenzt sie seit einiger Zeit und erholt sich von den Städtetouren auf ihrer Reise. Er stellt sich vor, wie sie durch das Blau des Ozeans taucht und sich unter einer Palme im Sand räkelt, und ein ironisches Grinsen verzieht sein Gesicht. Alice, seine Alice, bedient nicht solche Klischees. Da sieht er sie schon eher in einer Ecke des Hotelzimmers an die Wand gelehnt, ängstlich den Flug unbekannter Insekten beobachtend. Oder im Speisesaal, wo sie prüfend das Buffet mustert, um sich endlich maximal eine Handvoll Gemüse auf den Teller zu schieben.
Rosners Grinsen wird breiter. Auch das sind Klischees.
Ein Gespräch über Skype hat sie für die nächsten Tage angekündigt. Als wenn das Gewissheit schaffen und den Abstand zwischen ihnen verringern könnte. Aber man muss einen Schritt nach dem anderen gehen.
Er sieht ihr hageres Gesicht umgeben von sonnengebleichten Haaren vor sich, die Augen funkeln ihn an, ihr Mund ist spöttisch verzogen.
»Na, Rosner, schon den ersten Rückfall überstanden?«, wird sie ihn mit rauer Stimme fragen.
»Noch war nichts zu überstehen«, wird er ihr antworten und dabei nicht einmal lügen.
Dennoch freut er sich närrisch darauf, sich von ihr provozieren zu lassen.
Erwartungsvolles Herzklopfen, ausgetrockneter Mund.
Rosner, weit davon entfernt, ein romantischer Träumer zu sein, ordnet diese Kapriolen seines Körpers dem langwierigen Prozess des Alkoholentzugs zu. Da macht er sich nichts vor.
Nach der körperlichen Entwöhnung im Klinikum Klagenfurt musste er sich im Krankenhaus De La Tour anmelden und wochenlang auf einen Platz warten. Trocken. Freundlich, aber bestimmt hatte man ihm die Strategie der Entzugsklinik erklärt: Nur wer nach dem Aufnahmegespräch über Wochen den Kontakt hält, sei wirklich bereit, sein Leben zu ändern.
Und Rosner war und ist eisern entschlossen, mit dem Trinken aufzuhören. Klara, seine Tochter, bringt es ihm nicht mehr zurück, doch vielleicht Alice. Entzug und Abstinenz waren ihre Bedingungen für ein Wiedersehen. Mehr wollte sie ihm nicht versprechen. Seit Alices Abreise hatte er keinen Tropfen angerührt.
Geduscht und rasiert macht er sich auf den Weg in den Frühstückssaal, als das Handy in seiner Jeanstasche zu vibrieren beginnt.
Vielleicht Alice, denkt er, und erkennt enttäuscht die Nummer seiner Dienststelle auf dem Display.
»Ah, Spahic. Guten Morgen. Was verschafft mir das Vergnügen?«
Er weiß keinen vernünftigen Grund, warum seine eifrige Kollegin ihn im Krankenstand stören sollte. Vielleicht wollen sie und sein Chef Brunner ihm einen Höflichkeitsbesuch abstatten. Wie er es von ihr gewohnt ist, kommt Admira Spahic gleich zur Sache. Jedoch anders als erwartet.
»Ich weiß, es ist unverschämt von mir, Sie anzurufen. Wo Sie doch