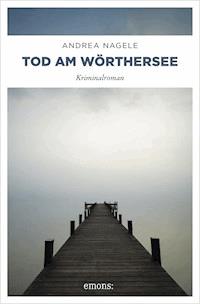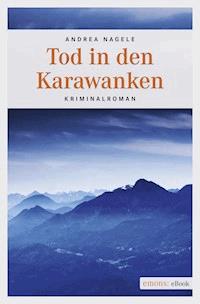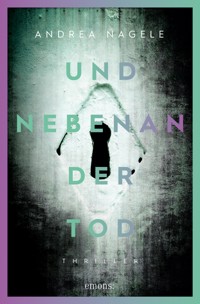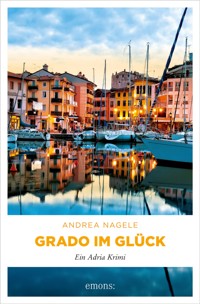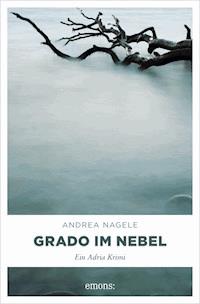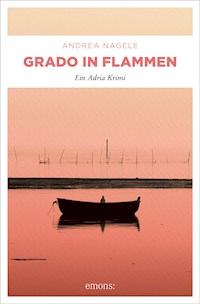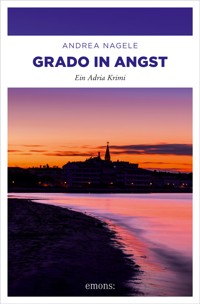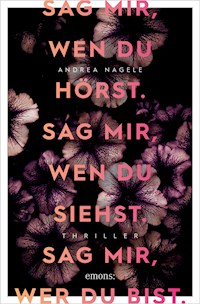
Sag mir, wen du hörst. Sag mir, wen du siehst. Sag mir, wer du bist. E-Book und Hörbuch
Andrea Nagele
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Glänzend recherchiert, psychologisch fundiert. Laura wird Zeugin eines Mordes, nur knapp kann sie dem Täter entkommen. Doch weder ihre Mutter noch die Polizei glauben ihr. Fand das Verbrechen womöglich nur in ihrer paranoiden Phantasie statt? Als ein weiterer Mord geschieht, wird Laura von einem jahrelang verdrängten Geheimnis eingeholt, das sie zutiefst verstört. Und die Schlinge zieht sich immer enger um ihren Hals.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Anna Jonczyk/Arcangel.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-796-5
Thriller
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Meinem sehr lieben Freund Stefano Cappai
MONTAG
TAG EINS
LAURA
Schreie.
Das sind Schreie.
Mitten im Laufen bleibe ich ruckartig stehen. Fast wäre ich umgekippt und auf das Kopfsteinpflaster geknallt. Meine Ellbogen schnellen zurück. Gerade noch halte ich mein Gleichgewicht.
Alarmiert drehe ich mich um.
Ich bin allein.
Auf dem gegenüberliegenden Gehweg befindet sich niemand. Kein Auto auf der Straße, kein Fahrrad, kein Moped, nicht einmal einer dieser Scooter, die aus dem Straßenbild kaum mehr wegzudenken sind.
Vom Asphalt steigt Dampf auf.
»Lass mich los. Tu mir das nicht an. Hilfe!«
Woher kommt die Stimme?
Ich wirble herum, suche hektisch die Umgebung ab. Mein Atem geht schnell.
»Hilfe!«
Der Schrei gellt in meinen Ohren.
Das Haus, neben dem ich stehe, ist grau. Es unterscheidet sich kaum von den angrenzenden Gebäuden.
Abgesehen davon, dass da drinnen ein Unglück geschieht.
Was soll ich tun?
Ich lege meine Handfläche auf die Klingelknöpfe, auf alle gleichzeitig. Kein Ton ist zu hören, kein Läuten. Niemand öffnet. Alle Fenster sind geschlossen.
Zögernd umfasse ich die Klinke des Haustores. Sie kommt mir merkwürdig kühl vor an diesem schwülen Nachmittag. Ehe ich sie loslassen kann, schwingt das Tor auf. Und ich trete ein.
Es ist dunkel. Und es riecht nach Minestrone.
Befangen blicke ich mich um.
Zaghaft lege ich mein Ohr auf das Holz der beiden Türen im Erdgeschoss.
Auch hier läute ich. Niemand öffnet.
Meine Knie zittern, als ich die Treppe hochsteige.
Erster Stock. Dasselbe Spiel.
Zweiter Stock.
Da. Eine der Wohnungstüren steht einen Spaltbreit offen. Leise trete ich ein und presse mich an die Wand im Flur. Bedacht darauf, kein Geräusch zu machen, schleiche ich weiter und verberge mich in der Garderobe hinter Mänteln und Jacken. Durch die Kleidungsstücke hindurch erhasche ich einen undeutlichen Blick auf ein vollgeräumtes Wohnzimmer.
»Hör auf. Bitte!«
Das ist sie. Die Stimme, die so verzweifelt um Hilfe ruft.
Derbe Flüche begleiten ihr Flehen.
Ich kann mich nicht rühren. Mein Herz hat aufgehört zu schlagen. Das Blut stockt in meinen Adern. Ich sterbe. Schon schließen sich meine Augen zum letzten Stoßgebet. Es ist an einen Gott gerichtet, an den ich schon lange nicht mehr glaube. Ich drohe mich zwischen den Mänteln und Jacken zu verheddern, als meine Lunge zu brennen beginnt. Gierig hole ich Luft.
Ich öffne die Augen.
Und sehe eine Gestalt, die eine andere packt. Sie rüttelt, schüttelt und stößt.
Ein Schrei zerreißt die Luft. Etwas Großes, Schweres poltert gegen ein Möbelstück und kracht zu Boden. Bedeckt altmodisches Mosaikparkett. Der Kopf ist verdreht, das Gesicht abgewandt.
Ein metallischer Geruch breitet sich im Raum aus.
Das leise Weinen eines Kindes durchbricht die nun folgende Stille. Ein kleines Mädchen mit blonden Zöpfen in einer blau-weiß gestreiften Latzhose hockt neben einer Vitrine aus Glas, die mit Puppen aus Porzellan bestückt ist. Es hält ein Stofftier fest an seine Brust gedrückt. Ein rosa Plüschhase.
Tränen tropfen.
Ich mache mich winzig, versuche mich aufzulösen, versuche, mit den Kleidungsstücken zu verschmelzen. Doch aus meinem Mund dringt ein Wimmern, ähnlich dem Weinen des Mädchens.
»Was machst du denn da?«
Es ist, als hätte jemand die Pausentaste gedrückt. Das Bild erstarrt. Meine Zeit hält an. Ich versteinere.
Die Kreatur überragt mich um Meter. Ihr Gesicht ist verzerrt. Die Augen funkeln, der Mund ist ein dünner Strich. Vor mir steht das Monster aus einem Horrorfilm.
Es will mich packen, greift aber an mir vorbei. Seine Krallen verheddern sich im Stoff eines Blousons.
Das ist meine Chance. Ich schiebe die Mäntel, die Jacken und die Capes beiseite. Zwänge mich an ihnen vorbei.
Die verzweifelten Schreie sind verstummt. Das Flehen. Das Bitten.
Und das Weinen des Kindes.
Das Monster will mich schnappen. Es ist allmächtig. Meine Hände haben sich selbstständig gemacht, sie stoßen, klatschen und schlagen um sich. Meine Füße treten nach ihm.
Ich mache einen Satz vorwärts. Renne um mein Leben.
Drehe mich kein einziges Mal um.
Ich stürze die Treppe hinab. Springe über die Stufen. Fürchte, unmittelbar gepackt zu werden.
Unten angekommen, bin ich schweißüberströmt und taumele vor Angst. Meine Gelenke knacken, und mein Skelett scheint nur mehr aus Glasknochen zu bestehen, die jeden Moment brechen können.
Gerade noch gelingt es mir, das Tor zu öffnen.
Mein Kopf schwenkt zur Seite. Niemand zu sehen. Ich fülle meine Lungen, und dann laufe ich und laufe, bis ich, von Seitenstechen gepeinigt, innehalte.
Ein Park breitet sich vor mir aus.
Grünanlagen haben es mir nicht angetan. Einzig den Rosengarten von San Giovanni mag ich und gewiss auch den Geruch des Grases, der Erde, und ich genieße natürlich den Schatten, den die großen Bäume spenden.
Straßen und Gehwege sind mir jedoch vertrauter. Trotzdem hechte ich über eine Hecke, betrete fremdes Terrain und haste die Kieswege entlang, bis ich nicht mehr kann.
Nach Luft ringend, werfe ich meinen erschöpften Körper auf eine Bank, gut verborgen hinter blickdichten Sträuchern, deren Blattwerk sich wie ein schützender Schirm vor mir ausbreitet.
Zum ersten Mal, seit ich das Haus verlassen habe, fühle ich so etwas wie Geborgenheit und tiefe Dankbarkeit, entkommen zu sein.
Bin ich denn entkommen?
Gab es dieses Grauen überhaupt?
Oder habe ich mir das vorhin eingebildet?
Das Durcheinander in meinem Kopf nimmt zu und macht mich benommen. Mir wird schwindlig, und ich verschränke meine Finger so fest ineinander, dass die Knöchel weiß hervortreten.
Ich muss sofort aufhören zu grübeln, mich mit Fragen zu quälen. Angestrengt zwinge ich mich, jeden weiteren Gedanken an meine Flucht auf später zu verschieben.
Langsam beruhige ich mich und sauge die von Blumen- und Grasdüften durchtränkte Luft ein. Das gibt mir ein weiteres Stück Frieden, vermag die Panik etwas zu lindern.
Ich heiße Laura.
Meine Mutter hat mich nach einer der Mumien aus Venzone benannt. Ihr gefiel, dass Schimmel die Gewebe der Leichen austrocknet und so deren Verwesung verhindert.
Damit habe ich zu leben gelernt. Es besänftigt mich, dass ich erst achtundzwanzig bin und keine Hunderte von Jahren auf dem Buckel habe.
Unter meinem Baumwollshirt und der Laufjacke schwitze ich inzwischen unerträglich. Das Shirt kann ich nicht ausziehen, ich trage darunter nur einen Sport-BH, aber die Jacke knote ich um meine Hüften.
Nichts brauche ich dringender als eine Dusche. Aber immer noch sitze ich da und zittere. Meine Knie klacken gegeneinander, meine Finger spreizen sich, fühlen sich steif an. Die Luft scheint mir auf einmal dünn wie hoch oben in den Bergen. In meinem Kopf blitzen grelle Farben auf und Bilder von Krallen, die sich nach mir recken. Mir ist schummrig. Konzentriert atme ich, reguliere den Sauerstoffgehalt in meinem Blut.
Darin bin ich geübt.
Um mich herum ist es inzwischen laut geworden. Kinder spielen Fangen, werfen einander auf der Wiese bunte Bälle zu. Menschen führen ihre Hunde aus. Lachen und Plaudern. Vögel zwitschern in den Baumkronen.
Niemand beachtet mich. Trotzdem ist mir nicht wohl in meiner Haut. Verstohlen checke ich die Spazierwege, überprüfe die Grünflächen, vergewissere mich, dass man mir nicht hinter den Büschen oder Bäumen auflauert.
Irgendwann rapple ich mich von der Bank hoch und mache ein paar Dehnübungen.
Und wieder laufe ich.
Mein Weg nach Hause führt über Gehsteige, die von einer Reihe monumentaler historistischer Gebäude gesäumt werden. Die parallel angelegten Straßen haben etwas Unendliches.
Die Luft ist schwer von Feuchtigkeit. Drückend hängt sie über der Stadt. Der Himmel spannt sich wie ein anthrazitfarbenes Tuch hinunter zum Meer. Im Golf von Triest verschmilzt er übergangslos mit dem Horizont.
Um diese Stunde klammert sich ein Auto ans andere. Stoßzeit. Lärm. Hupen. Großstadtgeräusche. Menschen treiben an mir vorbei, vertieft in ihre eigene Welt. Müde und ausgelaugt, vielleicht nach einem anstrengenden Arbeitstag. Streift ein Blick mein Gesicht, wende ich mich ab. Ich versuche, unsichtbar zu bleiben. Lautlos leiere ich Mantras herunter. Sie lenken mich von düsteren Gedanken ab.
Was, durchfährt es mich, was, wenn das Monster wirklich hinter mir her ist?
Wieder gellen die Schreie in meinen Ohren, wieder weint das Kind.
Es ist nicht mehr weit. Fast schon habe ich es geschafft. Gleich bin ich da.
Unser kleines Haus steht in einer belebten Straße, eingekeilt zwischen einem Werkzeugladen und einem Handyladen.
Ich erreiche den Eingang. Im Blumentopf auf der untersten Stufe ist die Erde trocken. Die gelbe Gießkanne steht leer daneben, und ein Stück Normalität kehrt zurück. Vor Erleichterung fange ich zu summen an.
Bevor ich die Wohnungstür aufstoße, drehe ich mich um.
Und starre in eine Fratze.
ANGELA
Die Wohnungstür fliegt auf. Laura stürmt herein. Die Sneakers schleudert sie in eine Ecke des Flurs. Ihr ist völlig egal, dass sich Erdbrocken über den frisch gefegten Boden verteilen. Ihre Laufjacke reißt sie sich von den Hüften und wirft sie auf die Ablage neben dem Spiegel. Der Reißverschluss scharrt über das Glas. Inzwischen kann ich fast jede ihrer Bewegungen ihren jeweiligen Emotionen zuordnen. Meine Tochter ist fahrig und aufgeregt. Hoffentlich ist nichts passiert.
Dann steht sie in der Küche.
Ihr Gesicht ist totenblass, übersät mit roten Stressflecken.
Masern, Röteln, Scharlach, das hatten wir alles schon. Ekzeme und allergische Reaktionen auf unterschiedliche Medikamente ebenso.
Ihr rosa gefärbtes Haar klatscht ihr um die Wangen. Die Brüste zeichnen sich unter dem feuchten T-Shirt deutlich ab.
Wie sieht sie bloß wieder aus?
Sie will etwas sagen, reißt den Mund weit auf und beginnt zu husten. Hustet und hört nicht mehr auf. Ihre hellblauen Augen treten aus den Höhlen, sie krümmt sich. Ihre Finger klammern sich an die Lehne des Stuhls. Der Raum riecht scharf nach ihrem Schweiß.
Angst greift nach mir. Was, wenn sie einen Asthmaanfall hat? Einen richtigen?
»Laura, atme ein, halt die Luft an und atme dann langsam aus. 4 – 7 – 8. Du kennst die Übung. Es kann dir nichts passieren. Alles ist gut.« Ich bemühe mich um einen beruhigenden Tonfall, wohl auch, um mich selbst zu besänftigen. Entschlossen mache ich einen Schritt vom Fenster weg auf sie zu.
Wieder setzt sie zum Sprechen an. Öffnet den Mund. Bringt aber kein Wort heraus. Wir sollten den Notarzt rufen. Ich greife nach meinem Handy.
Laura setzt sich und schüttelt heftig den Kopf. Sie schnappt nun nicht mehr nach Luft, sondern atmet einige Zeit so, wie die Ärztin es ihr beigebracht hat. Der Hustenreiz legt sich. Ich drehe mich weg. Sie soll sich nicht beobachtet fühlen.
»Willst du Tee und Toast?« Schon während ich es sage, ärgere ich mich darüber. Sie ist kein Kind mehr, sondern bald neunundzwanzig Jahre alt. Ich darf sie nicht so behandeln.
Laura ist eine junge Frau mit großen Problemen.
Endlich redet sie. Ohne nachzudenken, schneide ich eine dicke Scheibe vom Ciabatta ab, beschmiere sie hastig mit Butter und Erdbeermarmelade.
»Mama.« Sie löst ihre Finger von der Lehne des Stuhls. »Mama, wir müssen die Polizei verständigen.«
»Die Polizei?« Etwas umschließt mein Herz, verwandelt es in eine klumpige Masse. »Ich dachte eher an einen Arzt. Dir geht es offensichtlich nicht gut«, entgegne ich. »Warum die Carabinieri?«
»Carabinieri?«
»Entschuldigung.« Laura hasst es, wenn ich mich nicht korrekt ausdrücke. »Du meintest die Polizei hier vor Ort«, verbessere ich mich schnell.
»Nein«, giftet sie. »Die von Dschibuti Island. Natürlich die von hier!«
Ich zögere. »Findest du diese Idee gut?«
»Ich sehe keine andere Möglichkeit. Es ist Gefahr im Verzug.«
»Gefahr im Verzug?« Ich kann nicht anders, als verdutzt ihre letzten Worte zu wiederholen. Sie scheint bestens vertraut mit dem juristischen Jargon. »Vielleicht könntest du mir zuerst in aller Ruhe und der Reihe nach erklären, was dich so aufregt?«
Die Punkte und Flecken auf Lauras Wangen fließen zu einem tiefroten Kreis zusammen.
»Mutter.« Zornig holt sie aus und schleudert ein Glas über den Tisch. Es ist meines, das mit gutem Chardonnay gefüllt war. Die Flüssigkeit verteilt sich auf der Tischplatte und schwappt zu Boden.
Ich werde nicht überreagieren, denke ich still, hier geht es um Laura, die sich nicht im Griff hat.
»Mir ist klar, du stehst unter enormem Druck«, sage ich sanft. »Aber Schatz, kannst du dich nicht ein wenig zusammennehmen? Das musste jetzt wirklich nicht sein.« Ich gebe meiner Stimme einen warmen Klang.
»Halt mal«, entgegnet sie unbeeindruckt und reicht mir ein Geschirrtuch, während sie mit einem Schwamm den Weißwein von Tisch und Boden wischt, so sorgfältig, als hätte ich mir ihren Wutausbruch bloß eingebildet. Dann nimmt sie ihr Handy, das sie zum Aufladen hiergelassen hat. Verstört drückt sie darauf herum.
»Liebes.« Anders als meine Tochter weiß ich, was jetzt zu tun ist. Mit einer schnellen Bewegung entwende ich ihr das Telefon. Der Stecker löst sich aus der Buchse, und das Kabel schnellt über den Tisch. »Lass den Unsinn. Es ist nur zu deinem eigenen Vorteil.«
»Benimm dich nicht wie eine Eule.« Abschätzig starrt Laura mich an.
»Eule?«, wiederhole ich ratlos. »Was meinst du damit?« Ich wundere mich über den unpassenden Vergleich.
Meine Verwirrung lässt sie auflachen. »Deinen Kopf kannst du zwar nach rechts und links drehen. Jedoch nicht um zweihundertsiebzig Grad.«
»Keine Frage, Schatz, das gelingt niemandem«, versuche ich sie zu beschwichtigen. »Aber bitte wähle nicht den Notruf.«
»Gut, Mama. Wie sollte ich auch, nachdem du mir mein Handy weggenommen hast? Ich habe mich anders entschieden. Wir gehen persönlich zur Polizei. Jetzt.«
»Laura, glaubst du, das ist die richtige Art, damit umzugehen? Wie oft hatten wir das schon. Und auch das danach.«
»Lass das, stell mich nicht so hin«, zischt sie und schiebt sich das Brot in den Mund. Mit abgrundtiefer Verachtung wischt sie die Marmelade aus ihrem Mundwinkel.
»Ich will dich nur schützen, Liebes.«
»Diesmal ist es anders.« Sie stockt und schluckt. »Ich hätte sofort die Polizei rufen sollen. Aber … aber verdammt, ich hatte das blöde Telefon nicht dabei.«
Meine Tochter sieht mich an, und ihre innere Qual spiegelt sich in ihren großen meerblauen Augen. Zum ersten Mal keimt in mir der Verdacht, dass wirklich Gefahr im Verzug sein könnte.
Schweigend verrühre ich zwei Löffel Honig in lauwarmer Milch und stelle das Glas vor sie auf den Tisch. »Du hast mir noch immer nicht erzählt, worum es überhaupt geht. Was ist denn geschehen?«
Laura lässt ihre Schultern sinken. Ein Zeichen, dass sich ihre verkrampften Muskeln lockern. »Ich … Beim Laufen kam ich in eine Gegend der Stadt, die ich nicht gut oder gar nicht kenne, und da waren auf einmal diese … diese verzweifelten Schreie. Hilferufe.«
Sie trinkt von der Milch, und ich warte. Es bringt nichts, sie zu unterbrechen.
»Ich blieb stehen, weil ich zuerst dachte, mir etwas eingebildet zu haben. Oder dass irgendwelche Jugendlichen den Lärm verursachen. Aber da war niemand außer mir. Auch die Straße war leer.«
»Du meinst, du warst allein da? Wann soll das gewesen sein?«, werfe ich ein.
»Weiß ich nicht. Irgendwann am Nachmittag.«
»Normalerweise sind die Straßen von Triest zu dieser Zeit mit Menschen und Fahrzeugen überfüllt.« Zweifel nagen an mir. Laura liest sie in meinem Gesicht und dreht sich weg.
»Wenn du mir schon das nicht glaubst, kann ich den Rest ja gleich für mich behalten.«
Wie soll ich sie wie eine Erwachsene behandeln, wenn sie sich wie ein bockiges Kind verhält?
Instinktiv beuge ich mich über den Tisch, nehme ihr Kinn zwischen Zeigefinger und Daumen und zwinge sie so, mich anzuschauen. »Schatz, hör endlich auf, mich abzublocken, und rede bitte mit mir. Ich möchte dir doch helfen.«
Laura stößt meine Hand weg. Sie schiebt das Milchglas beiseite und steht auf. Zu meiner Überraschung spricht sie aber weiter.
»Als ich mir sicher war, dass die Schreie aus dem Gebäude kamen, neben dem ich stehen geblieben war, öffnete ich die Haustür und trat ein.«
»Bist du von Sinnen?« Ich schnappe nach Luft. »Es kann gefährlich sein, einfach so in ein fremdes Haus einzudringen und irgendwelchen Schreien zu folgen.«
»Mutter«, sagt sie und wirft mir einen verächtlichen Blick zu. »Es war gefährlich.«
Jetzt bin ich es, die sich setzen muss. Mit einer Kopfbewegung fordere ich sie auf, es mir gleichzutun. Ich unterdrücke das Zittern meiner Hände, indem ich sie unter meine Oberschenkel schiebe. Was hätte meiner Kleinen dort alles zustoßen können? Nicht auszudenken. Meine Laura allein in einem fremden Haus, in dem jemand um Hilfe ruft.
»Im zweiten Stock ist es passiert. Ich habe es gesehen.«
»Was ist passiert? Was hast du gesehen?« Ich muss an mich halten, nicht gleich wieder aufzuspringen. »Du jagst mir Angst ein.«
»Dir? Ich hatte Todesangst. Ich war starr vor Schreck. Und dann erschlug ein Mensch einen anderen. Es war so viel Blut auf dem Boden. Ein kleines Mädchen musste alles mit ansehen. Es weinte. Umklammerte einen rosa Plüschhasen. Der Mörder verließ das Zimmer und entdeckte mich. Aber ich konnte flüchten.«
Übelkeit, wie in den ersten Wochen meiner Schwangerschaft, steigt in mir hoch. Der Raum beginnt zu schwanken. Ich springe hoch und übergebe mich schwallartig in die Spüle.
»Mama!«, ruft Laura alarmiert. »Es ist mir nichts geschehen. Ich konnte entkommen. Krieg dich wieder ein.«
»Laura«, stammle ich.
Mir ist schwindlig. Vor meinen Augen scheint die Küche im Nebel zu verschwinden. Ich wanke unsicheren Schrittes ins Badezimmer.
»Das Kind hat alles beobachtet?«, frage ich, nachdem ich mir die Zähne geputzt und den Mund mit Wasser ausgespült habe und wieder vor Laura stehe. Meine Besorgnis hat sich in nackte Angst verwandelt. »Die arme Kleine. Wo ist dieses Haus?«
»In einem Teil der Stadt, den ich nicht gut kenne. Hab ich doch schon gesagt. Du hörst mir nie richtig zu. Vielleicht bin ich auch zum ersten Mal dort gewesen. Keine Ahnung.« Sie betrachtet mich argwöhnisch, und ich fühle mich durchschaut. Manchmal wenn ich in Gedanken bin, ziehen ihre Sätze einfach so an mir vorbei. Da hat sie recht. Dafür schäme ich mich.
»Ach, Laura.« Ich seufze. »Es tut mir leid. Ich werde mich bessern. Verzeih mir meine Unaufmerksamkeit.«
Ihre Enttäuschung ist spürbar. »Du glaubst mir nicht.«
»Doch, das tue ich. Aber ich weiß nicht recht, was ich von der Geschichte halten soll. Ich verstehe das alles nicht.«
»Wusste ich’s doch. Ich rufe die Polizei an. Sollen die sich darum kümmern.«
»Warte!« Der scharfe Klang meiner Stimme erschreckt mich. Doch ich muss handeln. Mir bleibt keine Wahl. »Liebes«, sage ich um einiges sanfter, »wir gehen gemeinsam zu dem Haus. Wenn an deiner Geschichte wirklich etwas dran ist, melden wir es danach unverzüglich der Polizei. Abgemacht?«
»Meinst du das ernst? Oder ist das nur eines deiner Verzögerungsmanöver?«
»Blödsinn. Komm. Lass uns gleich losgehen.« Es ist die einzige Möglichkeit, Laura vor einer riesengroßen Dummheit zu bewahren. Ich nehme sie an der Hand, und wir betreten das Vorzimmer. Ohne aufzubegehren, lässt sie sich von mir führen und schlüpft ergeben in ihre Sneakers, während ich meine Schuhe anziehe. Ich mustere die Garderobe. Mein Blick fällt auf eine Jacke. Ich ziehe sie vom Bügel.
»Das ist meine«, murrt sie, »aber lass nur.«
Es geschieht oft, dass wir unsere Kleidungsstücke tauschen. Es ist zu einer lieben Gewohnheit geworden. Eine, an der sich keine von uns beiden stört. Laura wiegt zwar mindestens zehn Kilo mehr als ich. Was an mir schlottert, spannt sich um ihren Körper. Aber das hindert uns nicht.
»Los«, bellt sie, als würde sie befürchten, dass ich es mir anders überlege.
Gemeinsam treten wir hinaus in den frühen Abend. Die Luft sirrt und stinkt nach Abgasen. Immer noch kämpfe ich gegen das Unbehagen an, das mich bei Lauras Schilderung erfasst hat.
Ich muss sie beschützen und einen weiteren Zusammenbruch verhindern.
LAURA
Vorsichtig drehe ich mich um.
Kurz bevor ich vorhin unser Haus betrat, war mir, als hätte ich jemanden gesehen. Eine Fratze, die mich anstarrte.
Jetzt sind da nur mehr wir beide.
Mama und ich.
Es wird wohl doch nur die Spiegelung meines eigenen verzerrten Gesichts im Fenster eines vorüberfahrenden Autos gewesen sein. Das hoffe ich und balle meine Hände zu Fäusten.
Jemand knufft mich sanft in die Seite. Ich zucke zusammen.
»Plagen dich schon wieder Gespenster, Laura?«
Ich wende mich meiner Mutter zu. »Keines hier außer dir.«
»Du musst nicht flapsig werden.«
Sie hat recht. »Tut mir leid.«
Angela ist eine gute Mutter. Unter großen Anstrengungen versucht sie stets, mir zu helfen. Wie eine strenge Schutzgottheit wacht sie über mein Wohlbefinden. Sie bemüht sich rührend um mich und gibt mir das Gefühl, nicht allein mit meinen Problemen dazustehen.
»Entschuldige, Mama«, wiederhole ich beschämt. »Ich war in Gedanken.«
Den Stups trage ich ihr nicht nach, hat er mich doch aus meiner Traumwelt in die Realität zurückgeholt. Ich hake mich bei ihr unter. Mein hauchdünner grüner Parka, der an mir eng wie eine Wurstpelle sitzt, umspielt ihre Arme locker wie Seidenpapier.
Der Missmut, der mich jedes Mal befällt, wenn sie meine Klamotten trägt und sie an ihr noch dazu so gut aussehen, ist nichts gegen die Erleichterung, von ihr zu dem Haus begleitet zu werden.
Eine Zeit lang traben wir schweigend nebeneinanderher. Nach und nach steigt die Straße steil an und fällt dann wieder ab. So ist das hier in Triest.
Mama wirkt fit, während ich keuche und schwitze.
»Schatz. Liebes. Engelchen«, unterbricht sie die Stille zwischen uns.
Je mehr Koseworte kommen, desto deutlicher spüre ich ihre Nervosität.
Was verbirgt sie?
Spielt sie mir etwas vor?
Will sie mich in die Irre führen?
Oder gleich ins Krankenhaus?
In die Psychiatrie?
Wollte sie nie mit mir zum Haus?
Stopp, Laura, befehle ich mir.
Ich bin nicht immer paranoid. Meistens versuche ich bloß, die Wirklichkeit Gramm für Gramm richtig einzuschätzen. Leider fällt mir das oft verflixt schwer.
Bevor ich reagieren kann, beendet sie den angefangenen Satz.
»Engelchen, weißt du wenigstens ungefähr, wohin wir müssen? Stadtteil und so weiter. Oder streifen wir nur unbedacht herum?«
»Was für eine Frage«, erwidere ich brüskiert und spüre im selben Moment, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, wohin wir müssen. Es waren so viele Straßen, die ich heute wie in Trance entlanggelaufen bin. Und alle ähneln sie einander.
War ich wirklich noch nie in diesem Viertel?
Mit Blick auf meine täglichen Wanderungen durch die Stadt kann das nicht stimmen. Wahrscheinlich ist mir die Gegend nicht besonders aufgefallen, weil aus keinem der Häuser bisher jemand um Hilfe gerufen hat.
Das ist die einzig logische Erklärung.
Etwas weiß ich jedoch gewiss: Ein Park befindet sich in unmittelbarer Nähe des Gebäudes.
Mama macht sich los. Sie seufzt und läuft ein Stück vor mir her. Ich bin ihr zu langsam. Es ist ihr ein Anliegen, alle zu überholen. Das war immer so. Sie ist ein Konkurrenzmensch, ehrgeizig bis zum Erbrechen, sie will immer die Beste sein. Mich wundert, dass sie nie an einem Stadtmarathon teilgenommen hat. Ich starre auf ihren gebeugten Rücken, und Schuldgefühle überschwemmen mich.
Wie oft schon habe ich meiner Mutter unrecht getan?
Vorhin, bei unserem Gespräch in der Küche, befürchtete ich ernsthaft, dass sie mich mit ihren sanften Worten bloß täuschen will. Um mich in mein Zimmer zu schicken, den Schlüssel im Schloss umzudrehen, mich wegzusperren, bis der Krankenwagen mich holt. Und auch jetzt verdächtige ich sie, mich geradewegs in die psychiatrische Abteilung der Klinik zu bringen.
Als hätten wir das nicht alles schon gehabt. Mehrfach sogar.
»Zu deinem Besten, Schatz«, wie sie jedes Mal betonte.
Sobald es mir nach so einem Aufenthalt wieder besser ging, konnte ich ihre Reaktion natürlich verstehen. Ihr war ja nichts anderes übrig geblieben, um mich vor mir selbst zu schützen.
Aber diesmal tut sie nichts dergleichen.
Wieder habe ich mich in ihr geirrt.
»Hast du die Wohnungsschlüssel eingesteckt, Laura?« Sie bleibt abrupt stehen und dreht sich zu mir um. Ihr Gesicht ist blass. Ihre Lippen sind von zarten senkrechten Falten gezeichnet.
»Ja, klar. Warum denn nicht? Ich habe meine Schlüssel doch immer dabei. Wer ist als Einzige überzeugt, dass ich sie ständig vergesse? Du.«
Sie duckt sich unter meinen hingeschleuderten Worten.
Immer treffen meine Pfeile direkt ins Schwarze, sosehr ich mich auch bemühe umzusetzen, was ich in den vielen Therapiestunden gelernt habe. Es will mir einfach nicht gelingen, meine Aggressionen unter Kontrolle zu halten. Längst schon reagiere ich zwanghaft auf Mamas Forderungen nach Ordnung und Pünktlichkeit. Meine Schlüssel lasse ich daher nirgendwo liegen. Bei jedem meiner Schritte klirren sie in meiner Jackentasche wie der Goldschatz der Piraten.
»Stimmt. Mein Fehler«, gibt sie reumütig zu.
Sie verletzt mich nicht absichtlich. Das weiß ich. Trotzdem kränken mich ihre Worte. Es klingt so, als würde sie nichts als Unzulänglichkeiten von mir erwarten. Vielleicht liegt es auch nur an der unglücklichen Art, wie sie sich ausdrückt.
Nicht dass es an mir nicht einiges zu beanstanden gäbe.
Ich schlucke den Groll hinunter, atme tief die benzingeschwängerte Luft des frühen Abends ein, und gemeinsam suchen wir weiter nach dem rätselhaften Haus.
Mama wird immer hektischer. So reagiert sie, wenn etwas komplizierter ist als erwartet, wenn etwas nicht nach ihrem Kopf geht. Damit habe ich mich abgefunden. So ist sie halt.
Auch Schutzgöttinnen haben ihre Fehler.
»Laura.« Ihre Stimme bebt vor Ungeduld. »Hast du eigentlich die geringste Vorstellung davon, wo du warst, als du die vermeintlichen Hilferufe vernommen hast?«
In einem Anflug von Duldsamkeit reiße ich mich zusammen und gehe nicht auf ihre »vermeintlichen Hilferufe« ein. »Nein. Ich habe nicht auf die Straßenschilder geschaut. Davor nicht, und danach schon gar nicht. Es war Horror pur. Ich wollte so schnell wie möglich weg von dort.«
»Konzentriere dich endlich.« Ihre Ungeduld ist nachvollziehbar, verleiht ihr aber eine Aura der Selbstgefälligkeit. Ich glaube, sie merkt das selbst gar nicht. Sie ist so überzeugt von sich, wie ich es gern von mir wäre.
»Tue ich ja«, blaffe ich sie an.
Meine Mutter schweigt. Sie teilt gern aus, doch sie scheut den Konflikt.
Meine Finger tasten nach meinem Scheitel und beginnen zu kratzen. Dünne Haare verfangen sich in den abgekauten Rillen meiner Nägel.
»Hör auf damit!«
Mama schüttelt sich und gibt erneut das Tempo vor. Wir sind jetzt so schnell unterwegs, dass mir die Luft wegbleibt.
Immer höher schraubt sie die Geschwindigkeit, unsere Füße fliegen nur so über den Asphalt, aber wir kommen und kommen nicht an. Ich bin völlig orientierungslos und außer Atem.
»Laura«, sagt Mama und bleibt stehen. Sie packt meinen Oberarm. Ich spüre ihre gefeilten Nägel durch den Stoff meiner Jacke. »Das funktioniert so nicht. Die Polizei wird dir kein Wort glauben. Du findest ja weder das Stadtviertel noch die Straße und erinnerst dich auch nicht an die Hausnummer.«
»Na und?« Ich reiße meinen Arm weg. Morgen werden mich kleine blaue Punkte auf meiner Haut an diesen Moment erinnern. »Auch wenn du mir nicht glaubst, das Verbrechen ist passiert. Ich habe es gesehen und gehört.«
Oder ist alles doch nur in meinem Kopf geschehen?
Eine weitere akustische und optische Halluzination? So nennen sie in der Klinik die Bilder und Stimmen, die mein Hirn fluten, sobald meine Neurotransmitter durcheinanderwirbeln. Sie beklemmen mich nicht mehr so wie früher, sind sie doch seit Langem ein Teil meiner Person geworden.
Gefasst schaue ich zu Boden, betrachte das Kopfsteinpflaster, das in seiner Unregelmäßigkeit anmutig scheint.
»Wir kehren um. Das bringt nichts.« Mamas Stimme reißt mich aus meiner Versunkenheit.
Bevor ich etwas erwidern kann, werde ich von jemandem grob angerempelt.
»Idiot, unhöflicher!«, rufe ich der Person erbost nach und beobachte, wie sie an den hupenden Autos vorbei über die Straße hetzt. Jetzt ist der Mann auf dem Gehweg gegenüber angekommen und läuft weiter. Mein Blick folgt ihm noch ein Stück.
Dann verharre ich still.
»Da.«
»Laura?«
»Dort drüben. Da ist das Haus.«
Ich schicke mich an, die Straße zu überqueren, aber meine Mutter hält mich zurück. »Wo?«, fragt sie und sucht mit den Augen aufgeregt die Häuserreihe ab. »Bist du dir sicher?« Sie klingt matt. Fahrig streicht sie die Stirnfransen zurück, auf ihrer hellen Haut perlt Schweiß.
»Ja.«
»Was, wenn stimmt, was du erzählt hast, und der Mörder noch drinnen ist?«
»Wieso sollte er? Er hat mich bemerkt und ist mir nachgejagt. Der rechnet doch damit, dass ich inzwischen die Polizei verständigt habe.« Was ich sofort hätte tun sollen. Stattdessen bin ich in den Park gerannt, habe mich hinter Sträuchern versteckt und bin dann nach Hause gelaufen.
Heim zu Mama wie ein verstörtes Kleinkind.
Natürlich ist die Entschuldigung, mein Handy nicht dabeigehabt zu haben, halbherzig, aber sie saugt immerhin etwa dreißig Prozent meiner Schuldgefühle auf.
»Also gut«, antwortet meine Mutter widerstrebend. Sie nimmt mich an der Hand, und gemeinsam überqueren wir vorsichtig die belebte Straße.
Schon stehen wir vor dem Gebäude.
Es ist grau und sieht verwittert aus. Der Putz bröckelt von der Fassade. Wieder sind alle Fenster geschlossen, die Scheiben wirken blind.
»Mama.« Sie steht da, als wäre sie unfähig, sich zu bewegen. Ich rüttle sie. »Was ist los?«
Schlagartig erwacht sie aus ihrer Betäubung. »Lass uns von hier verschwinden. Ich habe Angst, dass der Mörder uns auflauert«, stammelt sie. »Ich will nicht, dass uns etwas zustößt. Man weiß nie. Vielleicht verbirgt sich der Irre da noch irgendwo und wartet nur darauf, dass du zurückkommst.«
»Wie bitte? Mama. Jetzt, wo wir endlich hier sind, willst du einfach so aufgeben?«
Sie stöhnt und atmet betont laut aus. »Nein, nein.« Ihre Stimme klingt verzagt.
Eine neue Facette. So kenne ich meine Mutter nicht.
Aber lange schon habe ich aufgehört, mich über ihre oft seltsamen Reaktionen zu wundern, und gelernt, ihre Widersprüchlichkeit nicht ständig zu hinterfragen.
»Los«, zische ich.
Das Tor schwingt nicht auf, so wie ich es in Erinnerung habe, ich muss mich kräftig dagegenstemmen, bis es sich bewegt. Mama steht neben mir, hilft aber nicht mit.
Dann gibt die Tür nach. Das Geräusch, das sie dabei macht, erinnert an rostiges Eisen, das durch die Bewegung quietscht und ächzt. Abermals betrete ich das Haus. Diesmal zerre ich meine Mutter hinter mir her.
Kein würziger Geruch nach Minestrone liegt in der Luft. Es riecht ungelüftet und muffig wie in einem vergessenen Kleiderschrank. So als hätten Jahrzehnte hier ihren Staub abgelegt.
Durch ein schmales Fenster im Treppenhaus dringt diffuses Licht herein.
»Komm schon.« Ich kann meine Ungeduld kaum noch im Zaum halten.
»Wo … welche ist es?« Meiner Mutter steht die Furcht ins Gesicht geschrieben. Sie deutet auf eine der Wohnungen im Erdgeschoss.
»Nein. Nicht diese hier. Oben auf der zweiten Etage. Das habe ich dir doch alles erzählt.« Verwundert schaue ich sie an. Sie ist blass, zittert und hat sich in ein Nervenbündel verwandelt. Ich kann ihre Angst um mich körperlich spüren. Dafür liebe ich sie umso mehr.
Unbeholfen tastet sie sich an der Wand entlang, sucht nach dem Lichtschalter und hämmert, als sie ihn gefunden hat, dagegen.
»Es lässt sich nicht einschalten«, stellt sie fest, und ich knipse die Taschenlampe meines Handys an.
So tappen wir im Schein des schmalen Lichtkegels hintereinander die Treppe hinauf.
Kein Ton dringt an unsere Ohren.
Um diese Zeit müssten die Hausbewohner eigentlich gemütlich vor dem Fernsehapparat oder plappernd beim Abendessen sitzen. Küchengeräusche, Radios, Türenschlagen wären zu hören. Doch alles ist still.
Da ist die Wohnung.
Der Lichtschein meines Handys gleitet suchend über den Türrahmen. Das Holz ist an einigen Stellen gesplittert. Entsetzt sehe ich, dass die Tür nicht mehr, wie vorhin, offen steht.
Mein Herz hämmert gegen meine Rippen, und in meinem Mund sammelt sich Speichel. Der Mut von gerade eben ist Panik gewichen. »Mama«, flüstere ich, »bitte … bitte lass uns von hier verschwinden.«
Doch gegen jede Erwartung nimmt meine Mutter mich nicht erleichtert an der Hand und verlässt mit mir das Gespensterhaus. Stattdessen streckt sie den Arm zum Türrahmen aus.
»Da wir nun schon hier sind, ziehen wir die Sache auch durch.« Ihr Zeigefinger legt sich auf den Klingelknopf, und ich drohe umzukippen.
Kein Schrillen, kein Gebimmel.
Dann drückt Mama die Klinke hinunter. »Die Türe klemmt.« Sie zögert. »Nein, sie ist verschlossen.« Wieder rüttelt sie daran. Diesmal so fest, dass die Klinke abbricht.
»Was machst du, Mama?«
Ihre nächsten Worte lassen mich auf die Treppe sinken.
»Liebes, Laura, Schatz. Es ist so, wie ich befürchtet habe. Du hast einen neuerlichen Schub.«
Mein Mund ist trocken, und meine Augen brennen. In meinem Kopf wirbeln grelle Spiralen.
Mama setzt sich neben mich. Sanft legt sie ihren Arm um meine Schulter, die Finger ihrer anderen Hand tippen monoton auf mein Knie. Ihre Schuhspitzen berühren die Stufe unter uns. Jegliche Unsicherheit ist von ihr abgefallen.
»Dieses Haus steht leer.« Sie sagt es so kraftvoll, dass das Echo ihrer Stimme von den Wänden widerhallt.
Ständig tippt sie auf mein Knie.
Ich muss mich bemühen, das Bein nicht zurückzuziehen wie bei einem dieser neurologischen Tests meiner Reflexe. Fast erwarte ich, dass sie anerkennend nickt.
»Ich verschiebe deinen Termin bei Dottor Milo, den du erst in zwei Wochen hättest, auf morgen früh. Wir müssen diese Episode rechtzeitig abfangen.«
»Ich … ich habe das alles wirklich gesehen. Den Mord, das kleine Mädchen, die Porzellanfiguren, den rosa Plüschhasen. Die Hilferufe waren echt. Da war der intensive Geruch nach Minestrone, das viele Blut. Ich bin vor dem Täter geflohen und –« Ich stocke mitten im Satz, weil ich mir selbst nicht mehr glaube. Diese Zweifel sind nicht neu.
»Komm, mein Schatz«, sagt Mama und nimmt mich fürsorglich in den Arm, ehe wir aufstehen und das Haus verlassen.
Müde wandern wir durch den späten Abend. Wir reden nicht über das Erlebte.
Später, im Wegdämmern, wundere ich mich darüber, wie ein Haus sich innerhalb weniger Stunden so verändern kann.
Da stimmt doch etwas nicht.
Das Weinen des kleinen Mädchens begleitet mich in meinen tablettenunterstützten Schlaf.
ANGELA
Endlich schläft Laura.
Es hat gedauert, bis sie ruhiger wurde. Unermüdlich beteuerte sie, keiner optischen oder akustischen Halluzination auf den Leim gegangen zu sein.
Meine arme kranke Tochter.
Ein kleines Mädchen mit Zöpfen. Porzellanfiguren, rosa Plüschhasen. Ein Mord. Und Blut. Dann eine wilde Flucht. Wie konnte es ihr gelingen, einem so brutalen Killer zu entkommen?
Ich unterdrücke meine Tränen.
Es passt alles haargenau zum Bild ihrer Erkrankung.
Warum habe ich sie dorthin begleitet?
Manchmal geht eine so gewaltige Energie von ihr aus, dass ich mich ihrem Sog nicht entziehen kann. Dabei will ich nichts anderes, als meine Kleine beschützen, sie vor großem Unheil bewahren.
Laura war als Kind anschmiegsam. Sie freute sich auf den ersten Schultag, verehrte ihre Klassenlehrerin, fand anfangs mühelos Zugang zur Gruppe der anderen Erstklässler. Doch schon damals war sie von einer gewissen Scheu geprägt, kam mit bestimmten Situationen nicht gut klar. Sie fürchtete sich zum Beispiel vor Puppen und ebenso vor der Toilette, musste dorthin begleitet werden. Ein Umstand, dem die anderen Schüler bald mit Hohn und Spott begegneten.
Manche Geräusche und Gerüche ließen sie erstarren. Gab es zu Mittag Gemüsesuppe, begann sie zu würgen. Bleich stand sie dann in einer Ecke des Raums, konnte niemandem erklären, was los war. Von den Mitschülern wurde sie da schon gemieden und von den Lehrern mit besonderer Vorsicht bedacht.
Mehr als nur einmal musste ich in der Schule erscheinen, um mich einem Gespräch mit der Direktorin über Lauras Verhalten zu stellen. Der Psychologe, ein gutmütiger älterer Mann, beschäftigte sich eingehend mit ihr, ließ sie unterschiedliche Tests machen, zeichnen, malen, Figuren und Tiere auf Tafeln anordnen. Letztlich befand er jedoch, dass mit ihr alles in Ordnung sei.
»Die Kleine ist ein wenig schrullig. Ja, sie hat so ihre Marotten. Vielleicht liegt es daran, dass sie künstlerisch sehr begabt ist. Ihre Bilder sind großartig. Da ist sie den meisten Gleichaltrigen um Längen voraus.«
Damit gaben wir uns zufrieden, die Lehrer, die Direktorin und ich. Leider gelang es Laura später nicht, etwas aus ihrem Talent zu machen.
Irgendwann hörte sie auf zu malen.
Wir waren gerade erst wieder nach Triest zurückgezogen, und ich trat eine neue Arbeitsstelle an. Mit meinem Job im James-Joyce-Museum hatte ich großes Glück. Brauchte Laura mich, konnte ich jederzeit weg. Für jemanden, der sich im permanenten Notfallmodus befindet, war und ist das die reinste Offenbarung. Wie tolerant hatte Gloria, meine Chefin, vom ersten Moment an auf unsere spezielle Situation reagiert!
Sie ist inzwischen eine meiner wenigen Freundinnen.
Gloria verstand mich immer, sie erkennt auch jetzt, nach so langer Zusammenarbeit, noch die Lage an, in der ich mich befinde. Und sie ist die Letzte, die mir daraus einen Strick drehen würde.
Mein Arbeitsplatz ist in der Straße mit dem schönen Namen der Madonna angesiedelt, und ich bin umgeben von den Werken meines Lieblingsschriftstellers.
Ich seufze. Der heutige Abend hat auch mich sehr aufgewühlt.
Im Badezimmer hole ich ein Fläschchen mit Melissenextrakt aus dem Medizinschrank und tröpfle mir die Flüssigkeit direkt auf die Zunge. Mit chemischen Substanzen habe ich es nicht so. Ich sehe ja, was sie Laura antun. Nicht dass ich etwas gegen ihre notwendige medikamentöse Einstellung hätte, weit gefehlt. Dennoch weiß ich, wie mein Kind auf verschiedene Pharmazeutika reagiert.
Die einstmals schlanke junge Frau hat sich in eine antriebslose, dickliche Patientin verwandelt. Leider gibt es daran wenig zu ändern. Entweder nimmt meine Tochter regelmäßig ihre Pillen ein, oder der nächste Krankenhausaufenthalt steht zweifellos bevor.
Der Blick in den Badezimmerspiegel schüchtert mich ein. Die vielen Falten. Eben noch waren sie nicht da. Wann sind die alle entstanden?
Betroffen ziehe ich mit den Kuppen der Zeigefinger meine Gesichtshaut zum Haaransatz zurück. Doch statt des erwarteten Effekts einer vorübergehenden Glättung begegnet mir eine Grimasse.
Eine Straffung würde also nichts bringen. Davon abgesehen verabscheue ich solcherlei künstliches Eingreifen in die Natur.
Mit der üblichen Routine drücke ich einen Klecks Feuchtigkeitscreme mit Hyaluronsäure aus der Tube und verreibe ihn auf Stirn, Wangen und Hals.
Die spröden Lippen bestreiche ich mit Balsam.
Unter meine Augen tupfe ich sanft Olivenöl.
Einmal jährlich findet unten am Meer in der Nähe der Molo Audace, am Kai des alten Hafens, eine Messe statt, zu der Olivenölbauern aus ganz Italien anreisen. Dort habe ich mir eines der gepriesenen Erstpressöle aus dem Piemont gekauft. Es soll für die Haut besser sein als so manche teure Creme.
Ich seufze wieder auf.
Laura.
Meine Sorge um sie nimmt zu.
Sie war heute so getrieben, so rastlos und gleichzeitig voller Furcht. »Frei flottierende Ängste« nennen ihre Psychiater diese alarmierenden Zustände, die von diffusen Angstgefühlen geprägt sind, ohne dass dafür ein konkreter Grund vorläge.
Lauras Verstrickung in verwirrende Phantasiegebilde beunruhigt mich immer wieder aufs Neue.
Ich schlüpfe in mein Nachthemd und ziehe es glatt. Die Seide schmiegt sich an meine Beine.
Gleich werde ich mir den restlichen Chardonnay aus der Flasche im Kühlschrank genehmigen und in James Joyces »Liebesbriefe an Nora« schmökern.
Aber zuerst wähle ich die Nummer des Arztes meiner Tochter.
DIENSTAG
TAG ZWEI
LAURA
»Signorina«, beginnt mein Psychiater und stockt. »Signora«, verbessert er sich verlegen.
Es ist die Macht der Gewohnheit. Die Signorina sei ihm verziehen, schließlich kennt er mich schon lange.
»Ja?«
Ich mag diesen Mann, trotz seiner Selbstverliebtheit und Schwierigkeit, mich zu verstehen. Dieses Unvermögen scheint seiner Berufsgattung eingepflanzt zu sein. Ich weiß, ich bin überheblich, aber allzu gute Erfahrungen habe ich mit Nervenärzten bisher nicht gemacht.
Wahrscheinlich kapiert Dottor Milo dennoch besser als jeder andere, was in meinem Kopf vor sich geht. Immerhin hört er sich meine Geschichten an und verschreibt mir die benötigten Medikamente.
Meine Diagnose lautet paranoide Schizophrenie. Einer der jüngeren Ärzte in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses hat einmal »schizoaffektive Störung« in mein Krankenblatt geschrieben. Damit meinte er, dass ich auch Elemente der bipolaren Erkrankung aufweise. Was die Sache natürlich einen Atemhauch schlimmer macht. Klar habe ich es gegoogelt. Beide Beschreibungen beinhalten üble Wahnvorstellungen und ein für meine Mitmenschen mitunter schwer nachvollziehbares Verhalten. Manchmal erscheine ich manisch, dann wieder zurückgezogen und verstört. Psychisch krank bin ich immer. Keine Definition meiner seelischen Verfassung ist besser als die andere.
Trotz der vielen Pillen, die ich schlucke, tauchen die Stimmen und Geschichten auf, beklemmende Bilderfolgen, die manchmal wie aus dem Nichts in mein Bewusstsein schießen.
»Entschuldigen Sie«, sagt der Arzt, »ich sehe eben immer noch das junge Mädchen in Ihnen.«
Auch er war anders, als wir uns kennenlernten. Jünger und schlanker. Dick ist er nicht geworden, nur wohlstandsmäßig gut genährt. Der einst dunkle Haarkranz auf seinem Kopf ist in den letzten Monaten zunehmend verblasst – im Gegensatz zu der Röte, die seine Wangen aufglühen lässt.
Hoher Blutdruck?
Maße ich mir jetzt etwa an, meinen Doktor zu diagnostizieren?
»Laura. Ihre Mutter rief an. Sie wirkte sehr besorgt.«
Außenanamnese.
Schweigepflicht.
Er darf sich nicht mit Mama über mich unterhalten. Ich muss bei solchen Gesprächen anwesend sein. Es sei denn, ich gebe dazu meine ausdrückliche Erlaubnis.
Nicht ich bestimme das.
Es ist gesetzlich so festgelegt.
Ich vermute: Meine Mutter hat getratscht. Und mein Psychiater weiß nun mehr, als ihm zusteht.
Soll ich es ihm verübeln?
Weit käme ich damit nicht.
Eigentlich ist mir das ganz angenehm so. Zumindest erfährt er auf diese Weise einiges vom Plappermaul, was ich ihm nie im Leben erzählen würde.
Die Situation macht ihm sichtlich zu schaffen. »Ihre Mutter bat nachdrücklich um einen früheren Termin. Den musste ich extra einschieben.« Er blättert in seinem Kalender, als wollte er mir für die vorgezogene Stunde einen Strafeintrag ins Klassenbuch schreiben.
»Hier bin ich, Dottore. Was liegt an?«
Ich gebe es zu. Manchmal reizt es mich geradezu, alle vor den Kopf zu stoßen. Gelangweilt nehme ich eine Haarsträhne und beginne, daran zu kauen. Der Arzt kennt dieses Spiel und nennt es salopp ein vorhersehbares, leicht durchschaubares Ablenkungsmanöver. Ganz daneben liegt er damit nicht, aber bei aller Taktik behagt es mir, die gesplitteten Spitzen meiner Haare mit meinem Speichel zu umhüllen, um sie dadurch in meiner Vorstellung zu kurieren.
Vermutlich sollte ich mir einen Conditioner aus dem Drogeriemarkt besorgen.
Meine Mutter schwört auf die unverbrüchliche Kraft der Natur. Nichts ist besser für ihre feine Haut und ihr kraftvolles Haar als eine Cuvée der besten Oliven versetzt mit einer Prise Meersalz.
»Also. Signora Laura.« Jetzt versucht der Doktor, seine professionelle Seite hervorzukehren. Er lehnt sich zurück, und sein Drehstuhl knarrt. »Gestern Nachmittag kam es zu einer Krise.«
»Krise?« Ich dehne das Wort in die Länge. »Eine Krise war das nicht.«
»Eine Krise war das nicht?«
Diese Technik ist mir vertraut.
Er wiederholt meinen Satz und lässt ihn als Frage zwischen uns stehen. Mama beherrscht diese Technik ebenfalls. Ich übrigens auch.
Traurigkeit erfasst mich. »Auch wenn Sie es mir nicht glauben, Dottore.« Ich hole tief Luft, weil mein Brustkorb eng wird. »Da gab es etwas. Und was ich erlebt habe, war weit entfernt von einer Wahrnehmungsstörung. Meilenweit sogar.«
Er setzt zum Sprechen an, schweigt aber nach einer heftigen Handbewegung von mir.
»Ich habe ein Verbrechen mit angesehen.«
Dottor Milo wartet einige Sekunden lang geduldig. Als ich nicht weiterspreche, sagt er: »Wir haben schon so viele unterschiedliche Medikamente ausprobiert, um Ihr Leben erträglicher zu gestalten, Signora Laura. Was läuft diesmal schief? Nehmen Sie Ihre Medizin denn nicht regelmäßig ein? Sie müssten um einiges distanzierter sein. Viel gefasster. Aber Sie sind so aufgebracht, so … außer sich. Das –«
»Darum geht es nicht, Dottor Milo.« Ich schneide ihm radikal das Wort ab. Das habe ich gelernt, und es bereitet mir kein geringes Vergnügen, diesen Fixpunkt der Distanz zwischen uns beide zu setzen.
»Worum geht es dann?«
»Alles verläuft nach Plan. Ich halte mich streng an Ihre Vorgaben. In der Früh, zu Mittag und am Abend öffne ich meinen Mund für Ihre Pillen. Und ich schlucke das Zeug sogar hinunter.« Dem rebellischen Kind in mir versetze ich einen Tritt. Es soll seine Klappe halten.
Schnell krame ich die Tablettenbox aus meinem Rucksack und halte sie ihm hin. »Frisch aufgefüllt. Nur die von heute Morgen fehlen. Weil ich sie ja bereits genommen habe.«
Er nickt, sieht mich dabei aber skeptisch an.
»Als Ihre Mutter anrief, hatte ich den Eindruck, dass sie weinte.«
»Das tut mir leid. Die Arme. Aber Mama reagiert mitunter übertrieben. Kennen wir das nicht schon?« Ich formuliere Offensichtliches als Frage und möchte mir nicht auf die Schulter klopfen, aber auch darin bin ich inzwischen besser als er.
»Wir müssen die Dosis erhöhen oder auf ein anderes Präparat umsteigen.«
Präparieren.
In meinem Kopf überschlagen sich die Bilder von verstorbenen Katzen und Hamstern. Ich fasse mir an die Stirn. Bin ich für meinen Psychiater jetzt ein Haustier, das ausgestopft wird?
Eine Mumie aus Venzone?
»Dottore.« Ich kann mich kaum zurückhalten. »Ich lebe noch. Sie müssen nicht so tun, als wollten Sie mich für die Ewigkeit haltbar machen.«
»Hören Sie auf.« Der Doktor kratzt sich an der Stirn und schiebt seine Hornbrille hoch. »Ihre Mutter meinte, Sie würden sich in einer schwierigen Phase befinden. Und ich sehe das auch so. Dieser Gedankensprung gerade eben war ein klarer Hinweis darauf.«
»Nur weil ich bei ›Präparat‹ an ›präparieren‹ denken musste? Das ist …«, ich suche nach dem richtigen Begriff, »also, das kennen Sie doch bei mir. Ich habe es mit den Worten, drehe sie um und ergründe ihre Bedeutung.«
»Laura, das ist Kinderkram. Ihre Wortspiele sind eine simple Taktik, um mich außen vor zu lassen. Damit sollten Sie aufhören. So kommen wir nicht weiter«, weist er mich schroff zurecht.
Ich spüre Blut in meine Wangen schießen und senke beschämt den Kopf. Hoffentlich bemerkt er nicht, wie sehr er mir zusetzt.
Doch es kommt noch schlimmer.
»Ihre Mutter ruft nur an, wenn es notwendig ist.«
»Das stimmt nicht. Sie ist hysterisch, und das wissen Sie!«, schreie ich ihn an.
»Überlassen Sie diese Beurteilung mir. Eine mögliche Überreaktion Ihrer Mutter ist nicht das Thema. Ihre psychische Gesundheit steht im Vordergrund. Sie, Laura, haben einen Schub, und den müssen wir abfangen.«
»Habe ich nicht. So ein Blödsinn. Meine Mutter versteht da etwas grundlegend falsch, sie schätzt mein Erlebnis nicht richtig ein.« Ich beiße mir auf die Lippe, um nicht wieder loszubrüllen. Das hätte bloß den Effekt, dass der Arzt mir einen weiteren Klinikaufenthalt verordnet.
Meine Fingernägel kerben sich in die nackte Haut meiner Knie unter dem Saum des Sommerkleids. »Dottor Milo, bitte glauben Sie mir. Da waren Menschen in dem Haus, und etwas Schreckliches ist geschehen. Als ich mit meiner Mutter gemeinsam dort war, hatte sich das Gebäude verändert. Es war älter und schäbiger. Irgendwie verlassen. Es roch anders, abgestanden und muffig. Und doch war es dasselbe Haus. Ich blicke nicht durch, ich kann es einfach nicht verstehen.«
»Nun.« Der Psychiater mustert mich nachdenklich. »Könnte es sein, dass Sie einer Chimäre aufgesessen sind?«
Jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Will der Mann mich etwa in die Irre führen. »Chimäre? Das sind doch Mischwesen. Meinen Sie das mythologisch? Oder eher ein Trugbild? Vielleicht so etwas wie eine Fata Morgana?«
Er geht auf meine Korrektur nicht ein, sondern gibt die Frage an mich zurück. »Was glauben Sie, Laura?«
»Ich bin auf alle Fälle keinem Mischwesen begegnet. So viel steht fest. Sie haben sich mit Ihrer Chimäre vertan, Herr Doktor. Es waren eindeutig Menschen aus Fleisch und Blut. Viel Blut. Sie glauben, dass ich halluziniert habe. Stimmt doch? Habe ich aber nicht. Es ist wirklich passiert.«
»Fühlten Sie sich verfolgt?«
»Gehsteige ohne Straßen, gibt es die?«, kontere ich zornig. Ich bin auf hundertachtzig.
»Das, Laura, ist wieder eine dieser Fragen, die Sie immer dann stellen, wenn Sie sich in Ihren Hirngespinsten verstricken. Ich bitte Sie um Konzentration. Sie müssen mitarbeiten. Sonst wird das heute nichts.«
Er treibt mich in die Enge, und ich spüre, wie mir heiß wird. »Sackgassen bereiten mir Unbehagen. Die haben es in sich. Sie enden an einem Punkt und verweigern jeglichen Ausgang. So wie unser Gespräch. Ja, verdammt noch mal, ich wurde verfolgt. Da war einer hinter mir her, Dottor Milo. Das habe ich mir nicht bloß eingebildet.«
»Damit sind wir am entscheidenden Punkt angelangt. Sie reden wirres Zeug, bleiben nicht beim Thema und wirken aggressiv. Wir sollten Sie da schleunigst rausholen, bevor der Weg aus Ihrer selbst geschaffenen Sackgasse tatsächlich versperrt ist. Denn dann folgt unweigerlich Ihr nächster Aufenthalt in der psychiatrischen Abteilung der Klinik. Aber das wissen Sie. Ich will Ihnen helfen. Dafür bin ich da.«
»Das stelle ich nicht in Frage. Doch Sie würden mir helfen, indem Sie mir einfach glauben. Ich habe mir das alles nicht ausgedacht. Es gab keine unwirklichen Stimmen, keine biochemischen Prozesse, die mich halluzinieren ließen. Es waren echte menschliche Hilferufe. Bitte.«
Auf einmal liegt mir viel daran, dass Dottor Milo nicht an meinem Verstand zweifelt. Aber der Arzt tippt, von meiner Bitte unbeeindruckt, stumm irgendetwas in seinen Computer. Beharrlich vermeidet er jeden Blickkontakt mit mir.
Dann knattert der Drucker.
Milo reicht mir das Rezept. Ohne es anzusehen, stecke ich es in die Außentasche meines Rucksacks.
Die hellgelb gestrichenen Wände seines Behandlungszimmers rücken näher.
Die Bücherregale bilden Mauern.
Das Licht aus der Deckenlampe strahlt zu hell.
Ich fühle mich gefangen.
Eingeschlossen.
Weggesperrt in mir selbst.
Es war ein Fehler, hierherzukommen.
ANGELA
»Du siehst müde aus.«
Glorias Stimme reißt mich aus meinem Trübsinn. Sie runzelt die Stirn und setzt sich mir gegenüber. Mit einer raschen Handbewegung dreht sie den Bildschirm meines Notebooks zur Seite, sodass ich sie direkt ansehen muss.
Meine Chefin ist einen halben Kopf größer als ich, und mit ihrer langen, leicht gekrümmten Nase und der hellen Haut wirkt sie wie eine griechische Statue. Ihr Gesicht ist ebenmäßig, als wäre es in Stein gemeißelt. Heute glänzen ihre Augen silbern. Sie weiß nicht, wie schön sie ist.
»Ja. Ich bin erschöpft. Habe mich in der Nacht von einer Seite auf die andere gewälzt. Kurz vor dem Aufwachen hatte ich dann stürmische Träume.«
»Stürmisch? Im Sinn von sexy?« Sie hebt aufmunternd ihr Kinn, als erwarte sie eine Beschreibung.
»Nein. Keineswegs«, entgegne ich verlegen und schäme mich meiner Lüge nicht. Was ich mir zusammenphantasiere, geht niemanden etwas an. Vor allem sie nicht.
»Ich habe auch nicht besonders gut geschlafen. Die Hitze macht mich noch krank – oder vielmehr diese unerträglich hohe Luftfeuchtigkeit, die vom Meer her kommt. Was war bei dir los? Ging es wieder um Laura?«
Ich nicke und dränge den Kloß, der mich am Sprechen hindern will, tapfer die Kehle hinunter. »Es ist mal wieder so weit. Ich konnte Dottor Milo überzeugen, das Kind gleich heute früh dranzunehmen. Hoffentlich kann er ihr helfen.«