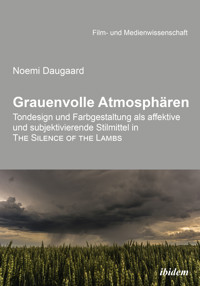
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Film- und Medienwissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Psychothriller spricht die Sinne der Zuschauer gezielt und intensiv an, wodurch unmittelbare affektive Reaktionen und Momente der Immersion erzeugt werden. Gestalterische Mittel, die nicht in erster Linie kognitiv verarbeitet werden, spielen dabei eine zentrale Rolle, so zum Beispiel Farbgestaltung und Sounddesign. Die ›grauenvollen Atmosphären‹, die dadurch generiert werden, erweisen sich als grundsätzlich für das Filmerleben und sorgen dafür, dass die Zuschauenden konstant zwischen Schreckensmomenten, falscher Sicherheit, empathischer Angleichung und moralischer Abneigung schwanken – ein gänzlich ambivalentes Filmerleben. Noemi Daugaard untersucht, wie die Atmosphären des Psychothrillers zustande kommen und welchen Beitrag Farbgestaltung und Tondesign leisten. Dazu werden genretheoretische, psychologische und ästhetische Konzepte auf die Analyse der visuellen und akustischen Ebenen angewandt, wobei den sensorischen und taktilen Qualitäten der Gestaltungsmittel eine besondere Rolle zugesprochen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Fragestellung und Hypothesen
Methodik und Filmauswahl
2. Der Psychothriller
2.1. Ein Versuch der Genredefinition
2.2. Charakteristika
3. Filmische Atmosphären. Definition und Stand der Forschung
4. Film, Subjektivierung und Affekt
4.1. Film und Affekt
4.2 Subjektivierung. Allegiance und Alignment
5. Farbgestaltung und Tondesign zwischen Narration und Atmosphäre
5.1. Film, Materialität und Wahrnehmung
5.2. Atmosphärische Dimensionen der Farbe. Harmonien, Kontraste und Haptik
5.3. Atmosphärische Dimensionen des Tons. Sensorische Aspekte, Materialien und Klanglichkeit
6. Analyse. The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, USA 1991)
6.1. Allgemeines zum Film
6.2. Analyse von Schlüsselsequenzen
6.2.1. The Silence of the Lambs. Szene 1: Das erste Treffen (08:33-17:42)
6.2.2. The Silence of the Lambs. Szene 2: Hannibal Lecters Flucht (01:11:10-01:15:10)
6.2.3. The Silence of the Lambs. Szene 3: Clarice Starling findet Buffalo Bill (01:35:22-01:38:47)
6.3. Gemeinsamkeiten und übergreifende Funktionen von Tondesign und Farbgestaltung
7. Charakterisierung der filmischen Atmosphären im Psychothriller am Beispiel von The Silence of the Lambs
8. Schlussbetrachtungen und Fazit
9. Bibliografie
10. Filmografie
11. Abbildungsverzeichnis
Film- und Medienwissenschaft
Impressum
1. Einleitung
Die Filmgattung des Psychothrillers zeichnet sich insbesondere durch den Thrill aus. Es stellt sich jedoch die Frage, was diese spezielle Stimmung ausmacht und wie sie den Zuschauern vermittelt wird. Damit verbunden ist die Problematik der Wahrnehmung von filmischen Inhalten und deren Wirkung auf den Rezipienten. Hermann Kappelhoff argumentiert, Filme entwerfen
[…] spezifische sinnliche Wahrnehmungsverhältnisse in den Modi unserer Alltagswahrnehmung. Sie präsentieren eine Welt, die wir anschauen wie unsere alltägliche Welt, die aber anderen Gesetzen des Wahrnehmens, einer anderen Sinnlichkeit gehorcht. (Kappelhoff 2007: 306)
Es ist die Thematik dieser ‚anderen Sinnlichkeit‘ die dieser Untersuchung als Ausgangspunkt dient. Um dieser Problematik nachzugehen, erweist sich vor allem das Forschungsfeld, das sich mit der filmischen Atmosphäre, das heißt, mit der grundlegenden und vorherrschenden Stimmung eines Films befasst, als fruchtbar. Die filmische Atmosphäre setzt sich aus unzähligen narrativen, dramaturgischen und ästhetisch-stilistischen Elementen zusammen. Nur ein Bruchteil davon wird während der Filmrezeption bewusst wahrgenommen, jedoch trägt jedes dieser Elemente auf bedeutsame Weise dazu bei, die Atmosphäre eines Films zu gestalten und die Wahrnehmung seitens der Zuschauenden zu beeinflussen. In den letzten Jahren haben sich die Publikationen zur Atmosphäre im Film zwar vermehrt,1 jedoch ist dies noch immer ein relativ unbearbeitetes Forschungsfeld.
In dieser Untersuchung werde ich mich auf nur zwei der unzähligen Bestandteile der filmischen Atmosphäre konzentrieren: Farbgestaltung und Tondesign. In der klassischen, stark inhaltlich ausgerichteten Filmanalyse werden diese beiden Gestaltungsmittel oftmals auf narrative und dramaturgische Funktionen reduziert. Dabei wird das Argument verfolgt, dass sowohl die Farbgestaltung als auch das Sounddesign die Funktion haben, die Narration zu unterstützen und Bedeutungen mitzutragen. Obschon dies sicherlich bei einem Großteil der Filmproduktionen der Fall sein mag, möchte ich im Folgenden aufzeigen, dass Farbe und Ton unabhängig davon auch weitere, nicht narrativ oder dramaturgisch verankerte Funktionen innehaben. In dieser Studie werde ich mich dabei auf zwei nicht narrative Funktionen konzentrieren, welche sich innerhalb des breiteren Kontexts der filmischen Atmosphäre abspielen, nämlich erstens auf die Erzeugung von filmischen Affekten, automatische und unbewusste körperlichen Reaktionen auf filmische Stimuli, und zweitens, damit verbunden, auf die Subjektivierung der Perspektive.
Fragestellung und Hypothesen
Um eine strukturierte und nützliche Annäherung an die oben genannten Themen zu ermöglichen, konzentriert sich die Analyse auf sehr wenige Aspekte und einige zentrale Fragestellungen. Dementsprechend gibt es durchaus noch zahlreiche weitere Fragen, die in Verbindung mit diesem Themenfeld zu beantworten wären. Für den Fokus dieser Studie kreisen meine Untersuchungen jedoch um die Frage, inwiefern filmisch geschaffene Atmosphären affektive und subjektivierende Reaktionen bei den Zuschauern auslösen und somit die spezifische Stimmung des Psychothrillers entscheidend beeinflussen. Das zentrale Interesse ist dabei, herauszuarbeiten, wie ein gewisses Genre oder eine Filmgattung, in diesem Fall der Psychothriller, den Rezipienten in seinen Bann zieht und eine spezifische Stimmung erzeugt, die den Zuschauer nachhaltig in seinen Erwartungen, in seiner Wahrnehmung des Films und in seinem Filmschauen beeinflusst. Damit verbunden ist die Frage, welche Gemeinsamkeiten und übergreifenden Funktionsweisen sich in diesem Mechanismus zwischen Farbgestaltung und Tondesign feststellen lassen. Zuletzt wird auch die Frage danach, wie sich diese filmischen Atmosphären charakterisieren lassen und welche affektiven Reaktionen sie bei den Zuschauenden auslösen, beantwortet werden.
Eine grundlegende Annahme dieser Analyse ist also, dass filmische Atmosphären sich zwar durchaus auf einer stilistischen Ebene abspielen, jedoch auch signifikante Auswirkungen auf die Filmrezeption und -wahrnehmung seitens der Rezipienten haben. Eine weitere Annahme, die ich zu Beginn erwähnen möchte, ist, dass Farbgestaltung und Tondesign nicht nur zwei voneinander unabhängige filmische Stilmittel sind, sondern, dass diese zwei Ebenen der ästhetischen Erfahrung auch gemeinsame Funktionen innehaben. Damit ist gemeint, dass Farbgestaltung und Tondesign in gewissen Kontexten zusammenarbeiten, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Meine These ist, dass dies vor allem in Zusammenhang mit der Erschaffung filmischer Atmosphären der Fall ist.
Methodik und Filmauswahl
Der methodische und analytische Ansatz der vorliegenden Abhandlung lässt sich als grundsätzlich phänomenologisch beschreiben und konzentriert sich auf eine analytische Darstellung der filmischen Gestaltungsmittel Farbgestaltung und Sounddesign. Dabei stehen nicht die narrativen Funktionen dieser beiden Parameter im Zentrum, sondern deren atmosphärische, affektive und subjektivierende Verwendungen, welche durch eine dichte Beschreibung und Analyse herausgearbeitet werden.
Da das Themenfeld dieser Untersuchung sehr breit angelegt ist und verschiedene Aspekte der Filmwissenschaft vereint, ist auch die Auswahl der Literatur sehr vielfältig. Nichtsdestotrotz ist es das Ziel, eine Synthese der verschiedenen Herangehensweisen und Denkansätze zu generieren. Im Rahmen dieser Studie wird, dementsprechend, auf Literatur zum Thema des Psychothrillers, zu filmischen Atmosphären, zu Farbe und Ton im Film, zu filmischen Affekten, Film und Subjektivierung und zur Materialität des Films zurückgegriffen.
Für die Analyse habe ich den Film THE SILENCE OF THE LAMBS von Jonathan Demme (USA 1990) ausgewählt. Die sehr erfolgreiche Verfilmung des Romans von Thomas Harris markiert für Inga Golde (2002: 128) einen signifikanten Wechsel in der narrativen Struktur des Psychothrillers und lässt sich im Allgemeinen als typischer Psychothriller charakterisieren. Außerdem zeichnet sich THE SILENCE OF THE LAMBS durch sehr präzise und durchkomponierte Sound- und Farbkulissen aus, wie auch durch die Erschaffung besonders bedrückender und beängstigender filmischer Atmosphären.
1.3. Aufbau
Der erste Teil meiner Untersuchung hat das Ziel, eine präzise Definition des Psychothrillers als Genre herauszuarbeiten, wobei die spezifischen Merkmale des Genres ausgeführt werden. Außerdem werden in diesem Kapitel wichtige narrative und dramaturgische Konventionen und Stereotype des Psychothrillers zusammengefasst, sowie eine Diskussion der spezifischen Atmosphäre des Psychothrillers angestrebt. Dieser Teil der Studie stellt also einerseits eine Einführung in das Genre des Psychothrillers dar, dient andererseits aber auch als Grundlage für die nachfolgende Analyse. Im darauffolgenden Kapitel wende ich mich der filmischen Atmosphäre zu. Mit Hilfe von philosophischen und filmwissenschaftlichen Ansätzen werde ich mich einer Definition der filmischen Atmosphäre annähern, wie sie im weiteren Verlauf der Analyse angewendet wird.
Danach folgt ein kurzer Überblick über Theorien zu Affekt und Affektlenkung im Film und zu filmischer Subjektivierung. Dabei wird das Augenmerk darauf liegen, diese zwei Konzepte mit der vorhergegangenen Definition von filmischer Atmosphäre zu verbinden und somit die theoretischen Grundlagen der nachfolgenden Ausführungen festzuhalten. Anschließend findet ein kurzer Exkurs zur Materialität des Films und deren Signifikanz für die Wahrnehmung filmischer Inhalte und atmosphärischer Qualitäten statt. In einem letzten Schritt vor der Filmanalyse wird zusätzlich auf die filmischen Stilmittel Farbgestaltung und Tondesign eingegangen. In beiden Teilen liegt der Fokus auf den sensorischen, haptischen, taktilen und klanglichen Qualitäten der zwei Gestaltungsmittel.
Den Kern dieses Beitrags bildet wiederum die Analyse. Aufbauend auf den zuvor herausgearbeiteten Konzepten und theoretischen Grundlagen werden mittels einer dichten Beschreibung und Untersuchung einzelner Sequenzen die anfänglichen Fragestellungen und Thesen hinterfragt. In einem weiteren Analyseschritt werde ich mich schlussendlich den übergreifenden Funktionen von Filmfarbe und Tongestaltung zuwenden. Im letzten Kapitel der Analyse wird verstärkt auf die filmische Atmosphäre des Psychothrillers eingegangen, indem die Resultate der Analyse mit den anfänglichen Überlegungen zu Genre und den Charakteristika und Stereotypen des Psychothrillers zusammengeführt werden. Damit wird eine Charakterisierung der filmischen Atmosphäre des Psychothrillers anhand eines konkreten Beispiels angestrebt.
1Siehe zum Beispiel Zorica Vilotics Studie Atmosphäre im Spielfilm. Exemplarische Analyse der Evokation von Angst im Horrorfilm (2013) oder der Sammelband Filmische Atmosphären, herausgegeben von Philipp Brunner, Jörg Schweinitz und Margrit Tröhler (2013).
2. Der Psychothriller
Den Psychothriller als Genre zu definieren erweist sich als nicht unkompliziertes Unterfangen. Die Kritiker sind sich uneins bezüglich der Definition und so betont Virginia Aguado (2002: 163), dass es einige sogar gänzlich vermeiden, vom Thriller als Genre zu sprechen. Im folgenden Kapitel wird jedoch ̶ ohne sich in genretheoretische Debatten verstricken zu wollen ̶ eine kurze Definition des Psychothrillers als Filmgenre angestrebt, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit hilfreich ist und die Analyse unterstützt.
2.1. Ein Versuch der Genredefinition
Eine Definition des Psychothrillers muss zwangsläufig von einer Definition des Thrillers ausgehen. Aguado (2002: 163) betont, dass der Thriller, im Gegensatz zu anderen Genres, wie dem Western oder der Komödie, in der Filmwissenschaft oftmals beiseitegelassen wird und es demzufolge nur wenige filmwissenschaftliche Studien diesbezüglich gibt. Die Erklärung dafür ist einerseits, dass das Filmgenre Thriller viele verschiedene Unterkategorien beinhaltet und vereint, wie unter anderem den Polizeithriller, den Erotikthriller, den Mystery-Thriller, den Politthriller, den Science-Fiction-Thriller oder den Psychothriller. Alle diese Filmgattungen sind relativ unterschiedlich und zeichnen sich durch spezifische Handlungsabläufe, Stereotypen und Figuren aus. Als einziges gemeinsames Element lässt sich der Thrill erwähnen, welcher als Grundstimmung dieser Gattungen gelten kann.1 Inga Golde (2002: 15) fügt an, ein weiteres Problem der Genredefinition sei, dass der Thriller in all seinen Varianten „über keine unverwechselbaren Rituale [verfügt]“. Dadurch ist das Genre viel weniger klar und eindeutig definiert als beispielsweise der Western, ein Genre, das auf verschiedenen Ebenen sehr genauen Mustern folgt. Was jedoch auf ganz grundsätzlicher Weise die verschiedenen Subkategorien des Thrillers zusammenhalte, sei, so Golde (2002: 15), dass sie „sich vordergründig mit einem Verbrechen beschäftigen und dabei Spannung erzeugen wollen“.
Es ist dieser Begriff der Spannung, der einen ersten wichtigen Hinweis zur Natur des Thrillers liefert, denn es handelt sich hierbei um ein Filmgenre, das auf die Gefühle der Zuschauer abzielt. Die zentralen Gefühle oder die zentralen Stimmungen sind dabei die des Schauerns und des Nervenkitzels, die im Rezipienten aufgrund der Ereignisse im Film und der übergreifenden filmischen Atmosphäre erzeugt werden.Dementsprechend wird für die Definition des Thrillers eine Art der Genretheorie benötigt, welche die Effekte dieser Filme auf die Zuschauenden in ihrer Zuordnung berücksichtigt. Aus diesem Grund bestehen Filmwissenschaftler wie Tom Ryall (1998: 330-331) darauf, dass gewisse Genres wie der Horrorfilm, die Komödie oder der Thriller nicht anhand ikonografischer Charakteristika oder des Settings klassifiziert werden sollen, sondern anhand ihrer Effekte auf die Zuschauenden, genauer gesagt, aufgrund der affektiven und somatischen Reaktionen, die sie in ihnen hervorrufen. Rick Altman (1984) schlägt eine Herangehensweise vor, bei der zwei komplementäre Kategorien ins Zentrum gerückt werden: die syntaktische und die semantische Ebene. Der semantische Zugang berücksichtigt gemeinsame und wiederkehrende Elemente wie Schauplätze, Figuren und Kostüme, während die syntaktische Ebene sich auf die tieferliegenden Strukturen der Filme bezieht (vgl. Altman 1984: 10). Wenn nun die starke Affektkomponente des Thrillers als syntaktische Struktur begriffen wird, ermöglicht sich eine Definition, welche sowohl einzelne semantische Elemente als auch die affektiven Elemente zu berücksichtigen vermag.
Martin Rubin (1999: 4) hingegen versteht den Thriller als ein Metagenre, das viele Unterkategorien versammelt:
One cannot consider the thriller a genre in the same way that one considers, say, the western or science fiction a genre. The range of stories that have been called thrillers is simply too broad. […] The concept of ‚thriller‘ falls somewhere between a genre proper and a descriptive quality that is attached to other, more clearly defined genres – such as spy thriller, detective thriller, horror thriller. There is possibly no such thing as a pure, freestanding ‚thriller thriller‘.
Das impliziert auch, dass immer präzisiert werden muss, um welche Art von Thriller es sich handelt, da das Wort Thriller alleine nicht ausreicht, um ein genaues Bild des Filmgenres zu vermitteln. Als vereinendes Merkmal sieht Rubin (vgl. 1999: 5), dass der Thriller weniger auf intellektuelle Reaktionen oder emotional schwerwiegende Gefühle abzielt, wie vielleicht das Drama, sondern auf instinktive Bauchgefühle, das heißt auf psychosomatische Reaktionen seitens der Zuschauenden, welche auch im Fokus der vorliegenden Untersuchung stehen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Thriller ein Metagenre ist, das verschiedene Subgenres zusammenfasst. Was diese Subgenres zusammenhält und als Thriller qualifiziert, ist, dass sie nicht nur mit Spannungserzeugung arbeiten, sondern auch großen Wert legen auf die Erweckung von instinktiven, somatischen und affektiven Reaktionen seitens der Rezipienten und dabei darauf abzielen, deren emotionale Stabilität herauszufordern.
Der Psychothriller ist also in erster Linie ein Subgenre des Thrillers und zeichnet sich demzufolge dadurch aus, dass er eine bestimmte Stimmung erzeugt und die Zuschauer dahingehend manipuliert, dass sie instinktiv und affektiv auf die Filminhalte reagieren, seien diese narrativer oder atmosphärischer Natur. Was den Psychothriller von anderen Thriller-Arten unterscheidet, ist die Präsenz einer Täterfigur, welche als ‚Psychopath‘ bezeichnet wird, im Sinne eines Kriminellen, dessen Handlungen sich auf psychologische Beweggründe zurückführen lassen. Anders als im klassischen Kriminalfilm steht dabei nicht die Frage nach der Verbrechensaufklärung im Zentrum, sondern nach den psychologischen Mechanismen, die zu der kriminellen Tat geführt haben (vgl. Rubin 1999: 203). Das bedeutet jedoch nicht, dass die Verbrechensaufklärung nicht auch Teil der Narration ist, sondern, dass sie nicht so zentral ist wie beispielsweise in einem Detektivfilm. Der Psychothriller interessiert sich also für die Täterfigur und aus diesem Grund wird deren Identität schon sehr früh im Verlauf des Films enthüllt und charakterisiert. Sonja Heinrichs (2010: 60) betont allerdings, dass es sich dabei oft um Amateurpsychologie und nicht um eine wissenschaftliche Analyse der Persönlichkeit des Täters handelt und, dass diese psychologischen Erklärungen vor allem die Funktion hätten, den Zuschauer zu beruhigen und von der Täterfigur zu distanzieren. Parallel dazu muss auch festgehalten werden, dass der Begriff ‚Psychopath‘, anders als in der Psychiatrie, in Hollywood wie im Alltagsleben eine wertende und negative Deutung erfahren hat und oftmals fälschlicherweise mit dem Begriff ‚Soziopath‘ gleichgesetzt wird (vgl. Golde 2002: 7).
2.2. Charakteristika
Innerhalb der Filmgattung Psychothriller lässt sich, zusätzlich zu den bereits erwähnten, eine ganze Reihe weiterer Merkmale, Charakteristika und Stereotype festhalten. Dies bestätigt auch die Spezifität des (Sub-)Genres und legitimiert somit den Anspruch dieser Abhandlung, den Psychothriller als eigenständiges Genre zu betrachten.
In ihrer Studie Der Blick in den Psychopathen. Struktur und Wandel im Hollywood-Psychothriller geht Inga Golde (2002: 50, 87) davon aus, dass es zwei Arten von Psychothrillern gibt, nämlich eine, die die Vergangenheit in den Film und in die Charakterisierung des Täters miteinbezieht und eine, in der die Vergangenheit ausgegrenzt wird und der Fokus auf der Gegenwart liegt. Als Beispiel für die erste Variante kann Michael Powells PEEPING TOM (GB 1960) genannt werden. Im selben Jahr wie PSYCHO (Alfred Hitchcock, USA 1960) erschienen, der meistens als erster Psychothriller überhaupt bezeichnet wird, wurde dieser Film schon vor seiner Premiere von der Presse zerrissen und sorgte für einen regelrechten Skandal.2 Aus diesem Grund ist PEEPING TOM weit weniger bekannt als PSYCHO. Nichtsdestotrotz lässt er sich zweifelsfrei ebenfalls als Psychothriller bezeichnen. In diesem Film wird wiederholt argumentiert, dass die Taten des skopophilen Mörders Mark auf seine Kindheit zurückzuführen sind, während der er über Jahre hinweg von seinem Vater als Testkaninchen für dessen psychologische Experimente missbraucht wurde. Ein Großteil der Handlung in PEEPING TOM fokussiert sich auf die Figur des Täters, welche auch die Hauptfigur des Films ist. Die zweite Kategorie konzentriert sich hingegen auf die Gegenwart der Narration, ohne dass die Taten des Mörders biografisch oder psychisch motiviert würden (vgl. Golde 2002: 87). Als Beispiel für diese Kategorie lässt sich David Finchers SEVEN (USA 1995) nennen. Obwohl die Morde des Serienmörders hier den sieben Todsünden folgen, wird in diesem Film nicht versucht, eine psychologische Erklärung basierend auf der Vergangenheit des Mörders zu liefern. Die meisten Psychothriller lassen sich der ersten Kategorie zuteilen und widmen der Charakterisierung des Täters und seiner Vergangenheit entsprechend viel Zeit. Als weiteres Merkmal des Genres erwähnt Golde (1999: 19-20), dass der amerikanische Psychothriller ohne fantastische, übernatürliche, utopische oder futuristische Elemente auskommt und als Motiv oftmals die Verbindung von Sexualität und Gewalt aufweist.
Sonja Heinrichs (2010) führt in ihrem Werk Erschreckende Augenblicke. Die Dramaturgie des Psychothrillers gleich mehrere charakteristische Eigenschaften des Psychothrillers auf. So argumentiert sie, dass der Psychothriller eine bestimmte dramaturgische Struktur aufweist, die sich in den meisten Vertretern dieses Genres wiederfinden lässt (vgl. 2010: 122 ff.).3 Des Weiteren fügt Heinrichs (2010: 45) hinzu: „[e]in Hauptmerkmal der Handlung ist der Gebrauch von Actionelementen. Während der Protagonist in der Detektivgeschichte analytisch vorgeht, muss er im Thriller aktiv handeln“. Dies lässt sich auch am Beispielfilm THE SILENCE OF THE LAMBS ausführen. Um den Serienmörder Buffalo Bill zur Strecke zu bringen und das Leben seines letzten Entführungsopfers zu retten, muss FBI-Anwärterin Clarice Starling schnell handeln. Infolgedessen geht sie den Hinweisen des verurteilten Kannibalen Dr. Hannibal Lecter nach und begibt sich in mehrere gefährliche Situationen, die schlussendlich darin kulminieren, dass sie, mehr oder weniger zufällig, alleine vor der Tür des gesuchten Serienmörders steht. Heinrichs (2010: 45-46) erwähnt zwei weitere Charakteristika des Psychothrillers, nämlich die strikt chronologische Abfolge der Narration und eine sozialkritische Komponente. Dabei folge der Psychothriller einem seiner Vorgänger, nämlich dem Film noir (vgl. 2010: 60). Damit verbindet Heinrichs (2010: 46) auch, dass der Psychothriller oftmals in Großstädten angesiedelt wird, die hier, ähnlich wie im Film noir, eine gefährliche und kriminelle Energie ausstrahlen und ein düsteres Gesellschaftsbild vermitteln sollen. Was die typischen Hauptfiguren des Psychothrillers betrifft, lässt sich festhalten, dass es sich dabei meistens um einen Serienmörder mit psychischen Problemen und um einen Vertreter oder eine Vertreterin der ‚rechtschaffenen‘ und ‚moralischen‘ Gesellschaft handelt. Dabei lassen sich verschiedene Variationen bemerken. Im klassischen Psychothriller PSYCHO werden die ‚rechtschaffenen‘ Gesellschaftsmitglieder von zwei zivilen Personen, die also weder Polizisten noch Agenten sind, vertreten. In RED DRAGON (Brett Ratner, USA 2002) ist der Vertreter der Gerechtigkeit ein ehemaliger FBI-Agent, der für diesen Fall in den Dienst zurückkehrt, und in THE SILENCE OF THE LAMBS wird diese Rolle von der FBI-Anwärterin Clarice Starling besetzt. In diesem Sinne gibt es keine Regeln, die die Anzahl, das Geschlecht oder den Beruf der ‚rechtschaffenen‘ Hauptpersonen bestimmen, jedoch, so Heinrichs (2010: 70), lassen sich bei diesen oftmals psychische Hemmfaktoren finden, die die Aufklärung der Morde erschweren: „Auch die Identifikationsfigur leidet an ihrer Vergangenheit. Genau wie ihr Gegner muss sie sich verdrängten Ängsten stellen, um den Antagonisten schließlich fassen zu können“.4 Auch in THE SILENCE OF THE LAMBS leidet Clarice Starling seit ihrer Kindheit an ihrem Unvermögen, die Unschuldigen zu retten und wird davon regelrecht getrieben.
Die spezifischen atmosphärischen Qualitäten des Psychothrillers orientieren sich zu einem großen Teil an den Affekten, die im Rezipienten ausgelöst werden sollen. Martin Rubin (1999: 5) klassifiziert diese wie bereits erwähnt als instinktive Bauchgefühle. Als weitere Kennzeichen erwähnt Rubin (1999: 6) auch eine gewisse Ambivalenz der Zuschauergefühle, ein Hin- und Hergerissensein zwischen Unbehagen und Vergnügen, Masochismus und Sadismus, Identifikation und Distanziertheit und dass diese Spannung wie auch die Unterwanderung der emotionalen Stabilität der Rezipienten einen großen Teil der Anziehungskraft des Thrillers ausmache. Sonja Heinrichs (2010: 105) fügt hinzu: „Genau wie die Erotik ist der ‚Thrill‘ eine sinnliche Erfahrung, die uns erregt und aus der wir Lustgewinn schöpfen. Auch der ‚Thrill‘ spielt, wie die Erotik, mit unserem Begehren, Grenzsituationen zu erfahren“. Daraus lässt sich schließen, dass die Atmosphäre des Psychothrillers einerseits bedrohlich und angstauslösend wirken kann, andererseits aber genau dadurch zum Lustgewinn seitens der Zuschauenden führt. Weitere Überlegungen zur Atmosphäre im Psychothriller folgen sowohl während der Analyse des Filmbeispiels (Kapitel 6) als auch in Kapitel 7 Charakterisierung der filmischen Atmosphären im Psychothriller am Beispiel von THE SILENCE OF THE LAMBS. Das nachfolgende Kapitel widmet sich jedoch zunächst der filmischen Atmosphäre im Allgemeinen.
3. Filmische Atmosphären. Definition und Stand der Forschung
Gernot Böhme (2001: 46) unterscheidet außerdem zwei Arten der Wahrnehmung von Atmosphäre: Ingression und Diskrepanz. Er beschreibt: „Als Ingressionserfahrungen will ich solche Wahrnehmungen bezeichnen, bei denen man ein Etwas wahrnimmt, indem man in es hineingerät. Typisch dafür ist das Betreten eines Raumes, in dem eine gewisse Atmosphäre herrscht“ (2001: 46). Als Diskrepanz bezeichnet Böhme (2001: 47) hingegen die Wahrnehmungserfahrung einer Atmosphäre, die von der Stimmung des Wahrnehmenden divergiert. Als Beispiel hierfür lässt sich folgende Situation nennen: An einer ausgelassenen und fröhlichen Party hat ein Paar heftigen Streit. Die Stimmung des Paares (wütend, enttäuscht, traurig) unterscheidet sich hier klar von der sie umgebenden Stimmung (fröhlich, festlich, ausgelassen). Böhme (2001: 48) betont, dass diese Diskrepanz auf jeden Fall vom wahrnehmenden Subjekt wahrgenommen wird und allenfalls auch dessen Stimmung beeinflusst. Auf den Film angewendet, könnte man sagen, dass die Atmosphäre innerhalb des Films durch eine Ingressionserfahrung wahrgenommen wird, wobei sich die Stimmung von Szene zu Szene ändern kann. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit der Diskrepanz zwischen der grundlegenden Atmosphäre des Films und der filmunabhängigen Stimmung des Zuschauers, wie beim Schauen einer Komödie bei Liebeskummer.
Daraus lässt sich schließen, dass die Atmosphäre eines Films bewusst konstruiert wird und dem Filmzuschauer durchgängig etwas mitteilt. Dabei lässt sich vor allem eine zentrale Funktion festhalten, nämlich die Vermittlung einer bestimmten Stimmung und der damit verbundenen Emotionen und Affekte.5 Hans J. Wulff (2012: 110) schreibt: „Atmosphären sind also Gefühlsqualitäten, die bewusst für den Adressaten gestaltet werden, so dass dieser affektiv-emotional in eine besondere Wahrnehmung des dargestellten Gegenstandes hineingeführt wird“. Greg M. Smith (1999: 113) betont, dass filmische Atmosphären (Smith nennt diese Moods) die Funktion haben, den Zuschauer darauf einzustimmen, was sich demnächst auf emotionaler Ebene im Film abspielen wird. Wenn die Atmosphäre einer Szene von Beginn an düster und bedrohlich ist, ist der Zuschauer darauf eingestellt, dass in dieser Szene etwas passieren wird, das ihn erschrecken oder schockieren könnte, genauer, dass ein affektiver Höhepunkt stattfinden wird. Laut Smith (1999: 113) besteht die emotionale Struktur eines Films einerseits aus solchen Moods, welche etwas länger andauern können, und andererseits aus kürzeren Momenten hoher affektiver Intensität. Viele Filmgattungen, wie zum Beispiel der Horrorfilm, funktionieren zu einem Großteil anhand dieser Struktur, während andere, wie der Mock-Horror, damit spielen und durch Moods falsche Erwartungen erwecken können. Eine weitere Funktion der filmischen Atmosphäre beschreibt Daniel Wiegand, der deren Wirkung mit der Konstruktion einer übergreifenden Stimmung in Literatur oder Theater vergleicht:
Stimmung figuriert hier als Möglichkeit, einem längeren Werk, das möglicherweise aus recht disparaten Einzelteilen besteht, abgesehen von einer schlüssigen und zusammenhängenden Handlung auch eine Art gefühlsmäßig oder sinnlich wahrnehmbaren Zusammenhalt zu geben. (Wiegand 2012: 197 [kursiv im Original])
Filmische Atmosphären beeinflussen also den Zuschauer maßgeblich in der affektiven Rezeption von Filminhalten und in der Wahrnehmung der filmischen Einheit. Zorica Vilotic (2013: 14) besteht jedoch darauf, dass der Zuschauer nicht nur der passive Empfänger der Atmosphäre ist, sondern zu einem großen Teil auch an der Konstruktion der Atmosphären und deren Wirkung beteiligt ist. Einerseits verweist dies auf Zuschauertheorien im Sinne Bordwells (1985: 30), die für einen aktiven Zuschauer plädieren, andererseits evoziert diese Aussage wiederum phänomenologische Theorien der Wahrnehmung. Als eine Schwierigkeit erweist sich dabei, dass das Medium Film sich in wesentlichen Zügen von unserer Alltagswelt und unserer alltäglichen Wahrnehmung unterscheidet. So basiert ein Großteil unserer Wahrnehmung im alltäglichen Leben nicht nur auf visuellen und akustischen Informationen, sondern auch auf dem Beitrag der anderen Sinne (Geruch-, Tast- und Geschmackssinn), sowie auf unserer eigenen Präsenz im Raum (vgl. Vilotic 2013: 20). Folglich muss die filmische Atmosphäre nicht nur die Affekte der Zuschauer ansprechen, sondern auch ihre fehlenden Sinne kompensieren (vgl. Vilotic 2013: 20). Zorica Vilotic (2013: 22) führt aus, dass der Film „dazu in der Lage [ist], durch akustische und visuelle Elemente die fehlenden Sinne wie Geruchs- oder Geschmackssinn zu kompensieren. Voraussetzung für die Integration dieser Elemente ist die zielgerichtete Zusammenstellung von Bildelementen“. Zudem erweisen sich in diesem Kontext auch die sensorischen Qualitäten von Farbgestaltung und Tondesign als bedeutsam. Auf diese wird in den Kapiteln 5.2 und 5.3 weiter eingegangen. Im Allgemeinen unterstreicht Vilotic die Wichtigkeit von Tondesign und Farbgestaltung für die Erschaffung filmischer Atmosphären, obwohl sie selbst ihre Analyse trotzdem auf der narrativen Ebene des Films ansiedelt und die visuellen und akustischen Mittel eher als Unterstützung der Narration versteht. Den Mechanismus der atmosphärischen Wirkung auf den Zuschauer beschreibt Margrit Tröhler in ihrer Einleitung zum Band Filmische Atmosphären (2012) wie folgt:





























