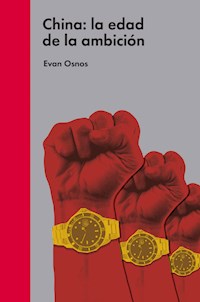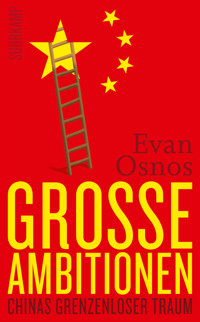
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Acht Jahre lang lebt und arbeitet Evan Osnos in China – in dieser Zeit wird er Zeuge einer unglaublichen Transformation: Das Land verändert sich in einem Tempo und Ausmaß, das selbst das der industriellen Revolution übertrifft. (Tatsächlich berührt der Wandel alle Gesellschaftsbereiche und jeden Einzelnen.) Osnos spürt diesen Umwälzungen nach und zeichnet ein eindrückliches Bild des Kampfes um Glück, Erfolg und Wahrheit, der China und seine Einwohner im 21. Jahrhundert prägt.
Sein einzigartiges Porträt Chinas versammelt die Geschichten der Männer und Frauen, die alles dafür geben, ihr eigenes Leben oder gleich das ganze Land zu verändern – Osnos spricht mit Glücksrittern auf der Jagd nach Reichtum, begleitet den Künstler Ai Weiwei und den Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo, trifft lyrikverliebte Straßenkehrer und Internetmillionäre. Die Erwartungen, Hoffnungen und Enttäuschungen der Menschen werden durch seine fundierten Schilderungen greifbar und erlauben ein tieferes Verständnis der heutigen chinesischen Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 808
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
National Book Award 2014
16. Mai 1976. Unter Lebensgefahr entfernt sich ein angesehener junger Offizier von der Truppe und wagt die Flucht über das Südchinesische Meer – doch er möchte sich nicht, wie so viele andere, aus der Volksrepublik China absetzen. Er will weg aus Taiwan. Lin Zhengyi ist davon überzeugt, ihm stehe auf dem Festland eine goldene Zukunft bevor. Die Geschichte gab ihm recht: Zhengyi profitierte vom rasanten Aufstieg Chinas und wurde ein weltbekannter Ökonom.
Erfolgsgeschichten wie diese sind aber nur eine Seite der Medaille. Wie in kaum einem anderen Teil der Erde prallen in China heute Erwartungen, Hoffnungen und Enttäuschungen aufeinander. Evan Osnos, der acht Jahre als Korrespondent für amerikanische Zeitungen und Magazine aus dem Reich der Mitte berichtete, schildert in seinem einzigartigen Porträt diese Konflikte. Er sprach mit Glücksrittern auf der Jagd nach Reichtum, begleitete Künstler wie Ai Weiwei oder den Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo, und er wurde Zeuge einer neuen Spiritualität, die trotz der Herrschaft der Kommunistischen Partei gedeiht. Die vorsichtige Öffnung des Landes in den neunziger Jahren, so sein Fazit, hat eine Sehnsucht nach Wohlstand, Wahrheit und Glaube ausgelöst, die kaum noch zu kontrollieren ist.
Evan Osnos, geboren 1976, war von 2005 bis 2013 China-Korrespondent, zunächst für die Chicago Tribune, später für den New Yorker. Zusammen mit Kollegen erhielt er 2008 den Pulitzerpreis für investigativen Journalismus. Für Age of Ambition wurde er 2014 mit dem National Book Award ausgezeichnet.
Evan Osnos
Große Ambitionen
Chinas grenzenloser Traum
Aus dem Englischen von Laura Su Bischoff
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel Age of Ambition. Chasing Fortune, Truth, and Faith in the New China bei Farrar, Straus and Giroux (New York).
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2015.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlagabbildung: Christoph Niemann
Für Sarabeth, die alles erlebt hat.
»Warum sollte ich wie alle anderen sein wollen, nur weil ich in eine arme Familie geboren wurde?«
Michael Zhang, Lehrer
»Der Anführer eines großen Heeres kann besiegt werden. Aber den festen Entschluss eines Einzigen kannst du nicht wankend machen.«
Konfuzius
Inhalt
Prolog
Teil I: Wohlstand
1. Von Fesseln befreit
2. Der Ruf
3. Zivilisationstaufe
4. Hunger des Geistes
5. Kein Sklave mehr
6. Halsabschneider
7. Erworbener Geschmack
Teil II: Wahrheit
8. Tanz in Fesseln
9. Die Freiheit führt das Volk
10. Wunder und Wundermaschinen
11. Ein Chor aus Solisten
12. Die Kunst des Widerstands
13. Sieben Sätze
14. Das Virus im Hühnerstall
15. Sandsturm
16. Das Gewitter
17. Alles, was glänzt
18. Die harte Wahrheit
Teil III: Glaube
19. Die spirituelle Leere
20. Wegsehen
21. Seelenhandwerk
22. Kulturkämpfe
23. Wahre Gläubige
24. Der Ausbruch
Epilog
Prolog
Immer wenn sich ein neuer Gedanke in China ausbreitet – sei es eine neue Mode, eine neue Philosophie oder eine neue Lebensart –, sprechen die Chinesen von einem »Fieber«. In den ersten Jahren nach der Öffnung des Landes fingen sich die Leute »Westliches-Geschäftsanzug-Fieber«, »Jean-Paul-Sartre-Fieber« und »Mobiltelefon-Fieber« ein. Es war schwer zu sagen, wann und wo der Virus ausbrechen und welche Folgen er haben würde.
In dem 1564 Einwohner zählenden Ort Xiajia brach ein Fieber aus, in dessen Zentrum die amerikanische Polizeiserie Hunter stand, die in China Kommissar Heng Te heißt. Als das chinesische Fernsehen in den neunziger Jahren mit der Ausstrahlung begann, versammelten sich die Bewohner von Xiajia, um Sergeant Rick Hunter und seiner Partnerin Sergeant Dee Dee McCall vom Los Angeles Police Department bei ihren Undercover-Einsätzen zuzusehen. Und diese Bewohner erwarteten, dass Sergeant Rick Hunter in wirklich jeder Folge wenigstens zwei Mal seinen Lieblingsspruch »Arbeit für mich« zum Besten gab – obwohl ihn der auf Chinesisch zu einem religiös veranlagten Menschen machte, weil aus seinem Markenzeichen aufgrund eines Übersetzungsfehlers »Was immer Gott verlangt« geworden war. Das Fieber griff von einem zum anderen über und wirkte sich doch auf jeden unterschiedlich aus. Als die Polizei einige Monate später das Haus eines Bauern durchsuchen wollte, erklärte der, sie sollten wiederkommen, wenn sie einen »Durchsuchungsbefehl« hätten – diesen Begriff hatte der Mann von Kommissar Heng Te gelernt.
Als ich 2005 nach China zog, war es üblich, die Geschichte von Chinas Wandel in dramatischen, ausladenden Pinselstrichen nachzuzeichnen, mit Hinweisen auf große Veränderungen in Politik und Wirtschaft wie auch auf die Tatsache, dass ein Sechstel der Weltbevölkerung in diesem Land lebte. Schaute man jedoch genauer hin, ereigneten sich die einschneidendsten Veränderungen auf der intimeren Ebene der individuellen Wahrnehmung; sie waren hinter den alltäglichen Routinen der Bevölkerung verborgen, weshalb man sie leicht übersehen konnte. Das stärkste Fieber von allen war dabei der Ehrgeiz: der schiere Glaube an die Möglichkeit, sich ein neues Leben aufbauen zu können. Manche, die sich daran versuchten, hatten Erfolg, andere hingegen nicht. Eindrucksvoller war jedoch, dass all diese Menschen einer historischen Erfahrung trotzten, die ihnen nahelegte, es erst gar nicht zu versuchen. Lu Xun, der meistgefeierte chinesische Autor der Moderne, schrieb einmal, die Hoffnung sei »wie die Straßen im Antlitz der Erde; sie waren nicht da gewesen; die Füße der Wanderer hatten sie geschaffen«.
Ich habe acht Jahre in China verbracht und wurde dabei Zeuge, wie das Zeitalter der großen Ambitionen Gestalt annahm. Vor allem handelt es sich bei diesem um eine Ära des Überflusses – um den Gipfel hundertmal größerer und zehnmal schnellerer Veränderungen, als sie jene Umwälzungen der ersten industriellen Revolution darstellten, die das moderne Großbritannien schufen. Heute hungert das chinesische Volk nicht mehr nach Nahrung – ein durchschnittlicher Chinese isst mittlerweile sechsmal so viel Fleisch wie noch im Jahr 1976 –, sondert nach etwas ganz anderem: nach einer Zeit, in der ein Drang nach neuen Gefühlen, neuen Ideen und neuem Respekt im Volk erwacht. China ist der größte Energie- und Platinverbraucher weltweit; die Menschen dort schauen die meisten Filme und trinken das meiste Bier; außerdem bauen sie mehr Hochgeschwindigkeitseisenbahnstrecken und Flughäfen als alle anderen Länder der Welt zusammen.
Der Boom in China hat dafür gesorgt, dass ein paar seiner Bewohner unermesslich reich geworden sind: Nirgendwo sonst wächst die Zahl der neuen Milliardäre so schnell wie in diesem Land. Einige der neuen Plutokraten gehören zu den leidenschaftlichsten Dieben des Planeten, andere haben hohe Staatsposten inne. Auf manche trifft beides zu. Für den Großteil der Chinesen brachte der Aufschwung jedoch keinen gewaltigen Wohlstand: Stattdessen ermöglichte er ihnen die ersten zögerlichen Schritte heraus aus der Armut. Die Früchte von Chinas Aufstieg zeitigten einerseits hochgradig widersprüchliche und andererseits überaus tiefgreifende Veränderungen, die zu einer der umfassendsten Wohlstandssteigerungen in der Moderne geführt haben. Im Jahr 1978 betrug das Durchschnittseinkommen rund zweihundert Dollar; 2013 waren es bereits sechstausend Dollar. Es ist beinahe egal, welchen Maßstab man anlegt: Die Bevölkerung des heutigen China hat eine höhere Lebenserwartung, sie ist gesünder und verfügt über einen höheren Bildungsstand als je zuvor in der Geschichte des Landes.
In den Jahren, die ich in Peking lebte, gewann ich den Eindruck, dass das Vertrauen in die eigenen Vorstellungen (insbesondere im Hinblick auf die Zukunft des Landes) sich umgekehrt proportional zu der Zeit verhält, die man dort verbringt. Die Komplexität der Lage dämpft den Impuls, der Sache eine allzu simple Logik aufzuzwingen. Und so suchen wir in gewisser Weise Zuflucht in Statistiken, um hinter alldem ein Muster zu erkennen: Während meiner Zeit in China verdoppelte sich die Zahl der Flugzeugpassagiere, während sich die Verkaufszahlen von Mobiltelefonen verdreifachten und sich die Größe des Pekinger U-Bahn-Netzes vervierfachte. Von diesen Angaben war ich jedoch weniger beeindruckt als von einem Spektakel, das sich nicht so einfach in Zahlen ausdrücken lässt: Noch vor einer Generation war es die absolute Gleichheit im Land, über die Chinareisende am meisten staunten. Außenstehende erkannten im Großen Vorsitzenden Mao den »Herrn der blauen Ameisen«, wie er in einem denkwürdigen Buchtitel genannt wurde – einen weltlichen Gott in einem Land der »Produktionsbrigaden« und einheitlichen Baumwollanzüge. Klischees, nach denen es sich bei den Chinesen um kollektiv denkende, undurchschaubare Drohnen handelte, konnten sich zum Teil gerade deshalb halten, weil die Politik des chinesischen Staates sie stützte: Beständig erinnerte das offizielle China seine Gäste daran, dass es ein Land der Arbeitseinheiten, Volkskommunen und unermesslichen Opfer war.
In dem China, das ich kennenlernte, wurde die landeseigene Geschichte nicht mehr wie früher von einem Ensemble dargeboten, sondern fächerte sich in Milliarden Einzelgeschichten auf – Geschichten aus Fleisch und Blut, Geschichten über persönliche Eigenarten und einsame Kämpfe. Es handelt sich um eine Zeit, in der die Beziehungen zwischen den beiden mächtigsten Ländern der Welt, der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten von Amerika, durch den Ehrgeiz eines einzelnen Bauernanwalts auf den Prüfstand gestellt werden konnten, der den Zeitpunkt genau wählte, an dem er sein Schicksal für immer zu verändern gedachte. Es handelt sich um eine Phase der Geschichte, in der eine Bauerntochter derart schnell vom Fließband in den Sitzungssaal aufsteigen kann, dass keine Zeit bleibt, die Traditionen ihres Dorfes zu verletzen oder dort Ängste zu schüren. Es handelt sich um eine Epoche, in der das Individuum zu einer stürmischen Macht im politischen, ökonomischen und privaten Leben und damit so zentral für das Selbstbild einer aufstrebenden Generation geworden ist, dass der Sohn eines Bergarbeiters in dem Glauben heranwächst, nichts sei wichtiger als sein Name auf einem Buchdeckel.
In gewisser Weise profitiert die Kommunistische Partei Chinas am meisten vom Zeitalter der großen Ambitionen. Im Jahr 2011 feierte sie ihren neunzigsten Geburtstag – ein Meilenstein, der zum Ende des Kalten Krieges noch undenkbar schien. In den Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion studierten die chinesischen Führer die Geschichte deren Niedergangs und schworen, dass sie nie dasselbe Schicksal erleiden würden. Als die arabischen Diktaturen 2011 fielen, blieb die chinesische bestehen. Um ihr Überleben zu sichern, ließ die Kommunistische Partei von ihrer heiligen Schrift ab, hielt jedoch an ihrem Heiligen fest: Sie gab Marx' Theorien auf, beließ Maos Antlitz allerdings, wo es war: am Tor des Himmlischen Friedens, von dem es auf den Tiananmen-Platz hinabblickt.
Mittlerweile verspricht die Partei keine vollkommene Gleichheit oder das Ende aller Mühen mehr, sondern nur noch Wohlstand, Stolz und Stärke. Und für eine Weile war das auch genug. Im Lauf der Zeit begannen die Menschen jedoch, sich nach mehr zu sehnen – vielleicht nach nichts mehr als nach dem Zugang zu Informationen. Neue Technologien brachten eine flüchtige politische Kultur hervor; was früher einmal geheim war, ist es heute nicht mehr; die Menschen sind nicht mehr allein, sondern verbunden. Und je mehr sich die Partei darum bemüht zu verhindern, dass das chinesische Volk an ungefilterte Ideen kommt, desto mehr fordert es eben diese ein.
Das heutige China ist von Widersprüchen zerrissen: In keinem Land der Welt werden mehr Louis-Vuitton-Produkte verkauft, und nur die Vereinigten Staaten nehmen mehr Rolls-Royce und Lamborghinis ab als China, aber trotzdem wird das Land von einer marxistisch-leninistischen Partei regiert, die am liebsten das Wort »Luxus« von den Werbetafeln streichen würde. Hinsichtlich Lebenserwartung und Einkommen entspricht das Gefälle zwischen den reichsten Städten Chinas und seinen ärmsten Provinzen dem zwischen New York und Ghana. China verfügt über zwei der größten Internetunternehmen der Welt; täglich gehen dort mehr Menschen online als in den Vereinigten Staaten, und das obwohl der chinesische Staat seine Anstrengungen im Zuge des größten Zensurvorhabens in der Geschichte verdoppelt hat. China ist nie facettenreicher, urbaner und wohlhabender gewesen, und doch ist es das einzige Land der Welt, in dem ein Friedensnobelpreisträger im Gefängnis sitzt.
Hin und wieder wird China mit dem Japan der achtziger Jahre verglichen, als man ein Zehnquadratmeterapartment in der City von Tokio für eine Million Dollar verkaufen konnte und Wirtschaftsmagnaten Cocktails mit Eiswürfeln schlürften, die sie vom Südpol hatten herbeischaffen lassen. Ab 1991 erlebte Japan dann die größte Deflation in der Geschichte des modernen Kapitalismus. Aber hier hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf, denn als die Wirtschaftsblase platzte, war Japan bereits ein voll entwickeltes Land. China bleibt trotz seiner heiß laufenden Wirtschaft eine arme Nation, in der das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen so hoch liegt wie im Japan des Jahres 1970. In anderen Augenblicken ruft China mit seinen im Stechschritt marschierenden Soldaten, Überläufern und Dissidenten Erinnerungen an die Sowjetunion oder gar Nazi-Deutschland wach. Solche Vergleiche sind jedoch unbefriedigend. Die chinesische Führung droht nicht damit, die Vereinigten Staaten zu »begraben«, wie es einst Chruschtschow tat, und selbst Chinas leidenschaftlichsten Nationalisten steht der Sinn nicht nach Eroberungen und ethnischer Säuberung.
Am meisten erinnert mich China an die USA zur Zeit ihres eigenen größten Wandels – an die Epoche, die Mark Twain und Charles Warner als »Gilded Age«, als »Vergoldetes Zeitalter«, bezeichnet haben, in dem »jedermann seinen Traum, seinen Lieblingsplan« hatte. Nach dem Bürgerkrieg machten sich die Vereinigten Staaten daran, ein größerer Stahlproduzent zu werden als Großbritannien, Deutschland und Frankreich zusammen. Im Jahr 1850 lebten in Amerika weniger als zwanzig Millionäre; 1900 waren es bereits vierzigtausend, manche davon so anmaßend und hochmütig wie James Gordon Bennett, der kurzerhand ein ganzes Restaurant in Monte Carlo kaufte, nachdem man ihm dort einen Fensterplatz verwehrt hatte. Ganz wie in China wurde auch die Entstehung des amerikanischen Wohlstands von einer spektakulären Verkommenheit begleitet. »Unsere Geschäftsmethoden«, erklärte der Eisenbahn-Unternehmer Charles Francis Adams jr., Enkel von Präsident John Quincy Adams und Urenkel von Präsident John Adams, »basieren auf Lug, Trug und Diebstahl.« Und schließlich schenkte uns F. Scott Fitzgerald die Geschichte vom gerissenen James Gatz aus North Dakota, der sich selbst auf der zum Scheitern verurteilten Suche nach Liebe, Reichtum und Glück in eine neue Welt katapultierte. Wenn ich im Schatten eines der kürzlich errichteten Wolkenkratzer Chinas stand, musste ich zuweilen an das New York des Großen Gatsby denken: »Die Stadt […] sehen, heißt immer wieder, sie zum ersten Mal sehen, wenn sie einem im ersten Überschwang alle Geheimnisse und alle Schönheit der Welt verheißt.«
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts bestand China aus zwei Welten: der Welt der neuen Supermacht und der Welt des größten autoritär geführten Staats der Erde. Manchmal verbrachte ich den Tag mit irgendeinem Wirtschaftsmagnaten und den Abend mit einem unter Hausarrest stehenden Dissidenten. Es wäre allzu einfach gewesen, diese beiden als Repräsentanten des neuen und des alten Chinas zu begreifen, als Vertreter der getrennten Sphären von Wirtschaft und Politik. Schließlich gelangte ich jedoch zu der Auffassung, dass sie ein und dasselbe sind und der Kontrast einen instabilen Naturzustand darstellt.
Dieses Buch berichtet vom Zusammenprall zweier Mächte: der Ambitionen und des Autoritarismus. Noch vor vierzig Jahren hatten die Chinesen so gut wie keinen Zugang zu Wohlstand, Wahrheit oder Glauben – drei Dinge, die ihnen aus Gründen der Politik und der Armut versagt blieben. Weder hatten sie die Chance, sich ein Geschäft aufzubauen oder ihren eigenen Wünschen nachzugehen, noch verfügten sie über die Macht, gegen Propaganda und Zensur anzukämpfen oder moralische Inspiration außerhalb der Partei zu finden. Im Laufe nur einer Generation sind alle drei Dinge in ihre Reichweite gerückt – und es verlangt sie nach mehr. Die Menschen in China haben sich Freiheiten in Bereichen erkämpft, die vorher fast vollständig von anderen bestimmt wurden, Entscheidungen darüber, wo sie arbeiten, wohin sie reisen und wen sie heiraten. Als diese Freiheiten größer wurden, unternahm die Kommunistische Partei jedoch nur sehr wenig, um dem Rechnung zu tragen. Der Kontrolldrang der Partei, die nicht nur entscheidet, wer das Land führt, sondern auch, wie viele Zähne eine Zugbegleiterin beim Lächeln zeigen soll, steht im krassen Gegensatz zum lebhaften Aufruhr auf der Straße. Je mehr Zeit ich in China verbrachte, desto stärker hatte ich den Eindruck, dass die Menschen das politische System, das ihren Aufstieg genährt hat, längst hinter sich gelassen haben. Die Partei brachte die größte Entfaltung menschlicher Leistungsfähigkeit in der Geschichte hervor – und schuf damit vielleicht die größte Bedrohung für ihr eigenes Überleben.
Dieses Buch basiert auf Gesprächen, die ich in acht Jahren geführt habe. Während meiner Recherche waren es vor allem die Aufsteiger im Land, die mich am meisten anzogen: all die Männer und Frauen, die sich mit ihren Ellbogen einen Weg gebahnt haben, und das nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in den Welten der Politik, der Ideen und des Geistes. Viele von ihnen durfte ich während meiner Arbeit für die Chicago Tribune und später für den New Yorker kennenlernen. Ich verfolgte ihren Werdegang, während sich unsere Wege immer wieder kreuzten. Für einen im Ausland tätigen Amerikaner ist es nur allzu verlockend, Chinas Stärken in Bereichen zu bewundern, in denen die Vereinigten Staaten als schwach erscheinen, und umgekehrt mit dem Land hart ins Gericht zu gehen, wo sich die Umstände vor Ort mit den eigenen Wertvorstellungen reiben. Ich habe mich jedoch vor allem darum bemüht, das Leben der Chinesen auf eine Weise zu beschreiben, die ihnen gerecht wird.
In den meisten Fällen habe ich die tatsächlichen Namen verwendet. Wo ich die wahre Identität meiner Gesprächspartner verschleiert habe, weil ich sie sonst in politische Schwierigkeiten bringen könnte, wird dies angemerkt. Alle Aussagen basieren auf Berichten einer oder mehrerer Personen, die bei den jeweiligen Ereignissen zugegen waren. Der erste Teil beginnt zu Anfang des Booms, und ich stelle darin einige Männer und Frauen vor, die während der Frühzeit des Aufschwungs in China der Armut entkamen, und beschreibe, welche Risiken sie auf sich nahmen und was sie dabei antrieb. Je erfolgreicher die Menschen in wirtschaftlicher Hinsicht wurden, desto mehr verlangte es sie danach zu erfahren, was auf der Welt um sie herum vor sich ging. Aus diesem Grund berichte ich im zweiten Teil vom Widerstand gegen Propaganda und Zensur. Im letzten Teil verschmelzen diese Bedürfnisse auf der Suche nach einer neuen moralischen Grundlage, im Zuge deren sich Männer und Frauen der unteren Mittelschicht auf die Jagd nach etwas begeben, an das sie glauben können.
Die Geschichte Chinas im 21. Jahrhundert wird oft als ein Wettlauf zwischen Ost und West beschrieben, zwischen staatlich gelenktem Kapitalismus und freier Marktwirtschaft. Tatsächlich steht jedoch ein sehr viel direkterer Widerspruch im Vordergrund: der Kampf um die Macht, zu definieren, was China ist. Um dieses Land zu verstehen, bedarf es nicht nur einer Messung der Licht- und Wärmemenge, die von der hell leuchtenden neuen Supermacht ausgeht, sondern auch einer Untersuchung der Quelle dieser Energie – der Männer und Frauen im Zentrum von Chinas Werden.
Teil IWohlstand
1. Von Fesseln befreit
16. Mai 1979
Im Schein des sichelförmigen Mondes entfernte sich ein sechsundzwanzigjähriger Hauptmann unbemerkt von seinem Posten auf einer Insel vor der chinesischen Küste und machte sich auf den Weg zum Meer. Er bewegte sich so geräuschlos wie nur möglich und schlug sich durch das Unterholz des Pinienwalds, bis er einen Felsvorsprung über dem Strand erreichte. Sollte sein Vorhaben entdeckt werden, würde er in Ungnade fallen und hingerichtet werden.
Hauptmann Lin Zhengyi war ein vorbildlicher Soldat, einer der am meisten gefeierten jungen Offiziere Taiwans, der von den Kontrahenten der Kommunistischen Partei Chinas regierten Inselprovinz. Dreißig Jahre lang hatte sich Taiwan der kommunistischen Herrschaft widersetzt, und Hauptmann Lin war ein Symbol dieses Widerstandes: ein überragender Universitätsstudent, der das ruhige Lebens eines Zivilisten gegen das eines Soldaten eingetauscht hatte – eine dermaßen ungewöhnliche Tat, dass sie sogar Taiwans zukünftigen Präsidenten dazu veranlasst hatte, ihm die Hand zu schütteln, woraufhin das Bild der beiden in allen Zeitungen des Landes abgedruckt und Lin zu einem Aushängeschild des »Heiligen Gegenangriffs« geworden war, des Traums von der Rückeroberung des chinesischen Festlands.
Zhengyi (ausgesprochen »Dschön-ji«) war über 1,80 Meter groß, hatte eine aufrechte Körperhaltung, eine breite, flache Nase und abstehende Ohren, die unter seinem Hut hervorlugten. Sein Einsatz für die Sache Taiwans hatte ihm einen Posten an der empfindlichsten Stelle der Front eingebracht: auf der winzigen Insel Quemoy, die auf Hochchinesisch Jinmen heißt und die kaum eine Meile von der felsigen Küste des chinesischen Festlands entfernt liegt.
Hauptmann Lin hütete jedoch ein für ihn und seine Familie gefährliches Geheimnis, und er wagte nicht, es mit seiner Frau zu teilen, die sich zu Hause um den gemeinsamen Sohn kümmerte und ein zweites Kind erwartete. Denn Hauptmann Lin hatte erkannt, dass um ihn herum Geschichte geschrieben wurde. Nach über dreißigjährigen Konflikten drängte China das taiwanesische Volk zum Anschluss an das »große Vaterland«.
Jeder Soldat, der zu desertieren und das Festland zu erreichen versuchte, wurde auf der Stelle erschossen. Es kam äußerst selten vor, dass es trotzdem jemand wagte, denn was ihn bei einem Fehlschlag erwartete, war allen klar – der jüngste Fall hatte sich vor weniger als einem Monat ereignet. Lin jedoch folgte dem Ruf. Er glaubte, China könne wieder zu alter Stärke zurückfinden, und er plante, gemeinsam mit dem Land erfolgreich zu sein.
In der Dunkelheit fand er den sandigen Weg, der ihn sicher einen mit Landminen übersäten Hügel hinabführte. Die knochigen Palmen auf der Insel bogen sich im vom Meer herüberwehenden Wind. Das Wasser, tagsüber von einem strahlenden Kristallgrün, war nun zu einer endlosen schwarzen Masse geworden, die wogend anschwoll und sich wieder zurückzog. Um eine Invasion abzuwehren, hatte man die Strände mit langen, aus dem Sand ragenden Metallspeeren versehen, die auf das Meer ausgerichtet waren. Bevor Hauptmann Lin aus dem Schutz der Bäume trat und auf das Ufer zulief, löste er die Schnürsenkel seiner Schuhe und spürte den Sand und die Steine unter seinen nackten Sohlen. Er war bereit: Er würde seine Kampfgefährten, seine Familie und seinen Namen hinter sich lassen.
Nahezu jeder, der sich in der Vergangenheit daran versucht hatte, durch dieses Gewässer zu schwimmen, war aus der entgegengesetzten Richtung gekommen. Das kommunistische China des Jahres 1979 war ein Land, dem die Menschen zu entfliehen suchten.
Im 18. Jahrhundert kontrollierte das kaiserliche China ein Drittel des weltweiten Vermögens; die am weitesten fortgeschrittenen Städte des Reichs waren ebenso wohlhabend und vom Handel geprägt wie die Großbritanniens und der Niederlande. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde China allerdings von Invasionen, Bürgerkriegen und politischen Unruhen gelähmt. Nachdem die Kommunistische Partei 1949 die Macht übernommen hatte, führte sie eine Landreform durch, im Zuge deren einerseits die kleinen, familienbetriebenen Bauernhöfe in Kollektive eingegliedert und anderseits Millionen Grundherren und andere vermeintliche Feinde getötet wurden. 1958 brachte der Vorsitzende Mao den Großen Sprung nach vorn ins Rollen, um sein Land in nur fünfzehn Jahren an Großbritannien vorbeizukatapultieren. Manch ein Berater Maos meinte, das sei unmöglich, doch der Vorsitzende ignorierte und demütigte seine Kritiker; der Leiter der Staatlichen Technologiekommission sprang in dieser Zeit aus dem Fenster. Die Propagandisten umjubelten eine fantastische Ernte nach der anderen und nannten sie »Sputnik-Ernten«, weil man sie als ebenso große Erfolge betrachtete wie den Flug des sowjetischen Satelliten gleichen Namens. Aber die Zahlen waren frei erfunden, und während der Hunger wuchs, wurden unzählige Chinesen, die sich beklagt hatten, gefoltert oder getötet. Die Partei untersagte der Bevölkerung, auf der Suche nach Nahrung ihre Heimat zu verlassen. Maos Großer Sprung nach vorn führte zur größten Hungersnot der Welt, der zwischen dreißig und fünfundvierzig Millionen Menschen zum Opfer fielen – mehr als dem Ersten Weltkrieg. Als Hauptmann Lin Taiwan verließ, war die Volksrepublik ärmer als Nordkorea und das Pro-Kopf-Einkommen geringer als im subsaharischen Afrika.
Damals war Deng Xiaoping gerade mal seit knapp einem halben Jahr der wichtigste politische Führer des Landes. Er war fünfundsiebzig Jahre alt und ein überzeugender Staatsmann, der sich stets in klaren, einfachen Worten ausdrückte. Außerdem war er ein Überlebender, denn zweimal hatte ihn Mao bereits seiner leitenden Ämter enthoben, nur um ihn später wieder zu rehabilitieren. Seitdem hat man ihn oft als den alleinigen Baumeister des Booms bezeichnet, doch diese Ansicht geht auf die Arbeit von Parteihistorikern zurück. Deng kannte die Grenzen seines Wissens. Was die Wirtschaftspolitik betraf, waren seine raffiniertesten Züge die Zusammenarbeit mit Chen Yun – ebenfalls ein Parteipatriarch, der gegenüber dem Westen dermaßen skeptisch eingestellt war, dass er auf den Gedanken an Reformen mit einer abermaligen Lektüre von Lenins Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus reagierte – und die Kollaboration mit Zhao Ziyang, einem jüngeren, progressiveren Parteiführer, dessen Bemühungen, der Armut Herr zu werden, die Bevölkerung zu dem Sprichwort inspirierten: »Wollt ihr essen, sucht nach Ziyang.«
Die ersten Veränderungen kamen allerdings von unten. Maos ökonomische Visionen und der Winter des Vorjahres hatten die Bauern der im Landesinneren gelegenen Ortschaft Xiaogang in so große Armut gestürzt, dass sie das gemeinschaftliche Land nicht länger bestellten und sich dem Betteln zuwandten. In ihrer Verzweiflung teilten achtzehn Bauern das Land untereinander auf und begannen, es individuell zu bewirtschaften; sie stellten ihre eigenen Zeitpläne auf, verkauften alle über die staatliche Quote hinaus produzierten Waren auf dem Markt und behielten die Profite. Außerdem schlossen sie einen geheimen Pakt, dass sie im Falle einer Verhaftung gegenseitig auf ihre Familien aufpassen würden.
Bereits im folgenden Jahr verdienten sie zwanzigmal mehr als zuvor. Als das Experiment schließlich entdeckt wurde, warf manch ein Apparatschik den Bauern vor, sie »hebelten die Eckpfeiler des Sozialismus aus«; umsichtigere Parteifunktionäre erlaubten jedoch den Fortgang des Projekts und weiteten die Methode schließlich auf achthundert Millionen Bauern im ganzen Land aus. Die Rückkehr zu den sogenannten Bauernhaushalten ging so schnell vonstatten, dass ein Bauer das Ganze mit einem Erreger im Hühnerstall verglich. »Fängt sich das Huhn einer Familie den Virus ein, bekommt ihn das ganze Dorf. Ist die Krankheit erst in einer Ortschaft ausgebrochen, wird sich bald das ganze Land anstecken.«
Deng und die anderen Parteiführer stritten sich ständig, doch das Zusammenspiel von Dengs Charisma, Chens Zurückhaltung und Zhaos Kompetenz war überraschend erfolgreich. Das von ihnen geschaffene Model hielt Jahrzehnte: eine »Vogelkäfig-Ökonomie«, wie Chen Yun sie nannte, die durchlässig genug war, den Markt gedeihen zu lassen, aber nicht so frei, dass er der Kontrolle der Partei entgleiten konnte. Als junge Revolutionäre hatten diese Parteiältesten die Hinrichtung von Grundherren, die Enteignung von Fabriken und die Schaffung von Volkskommunen überwacht. Und nun sicherten sie ihre Macht, indem sie die Revolution auf den Kopf stellten: Sie erlaubten freies Unternehmertum und öffneten ein Fenster zur Außenwelt, auch wenn dabei »ein paar Mücken« hineinflogen, wie Deng es ausdrückte. Für Chinas Reformen gab es keine Blaupause. Die Strategie, so Chen Yun, bestand aus Wachstum ohne Kontrollverlust – man wollte »den Fluss überqueren, indem man nach den Steinen tastet« (unvermeidlicherweise erhielt Deng die Anerkennung für diesen Spruch).
1979 verkündete die Partei, von nun an niemanden mehr als »Grundherrn« oder »reichen Bauern« zu kategorisieren, und später beseitigte Deng Xiaoping sogar das letzte Stigma: »Lasst zunächst einige Menschen zu Reichtum kommen«, erklärte er, »damit nach und nach alle gemeinsam reicher werden.« Die Partei weitete das Wirtschaftsexperiment aus. Privatunternehmen war die Anstellung von mehr als acht Mitarbeitern offiziell zwar nicht gestattet, weil Marx der Meinung gewesen war, Firmen mit mehr als acht Arbeitern basierten auf Ausbeutung, dennoch schossen kleinere Unternehmen schließlich so schnell aus dem Boden, dass Deng Xiaoping einer jugoslawischen Delegation mitteilte, es käme ihm so vor, »als wäre eine seltsame Armee plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht«. Das Verdienst reklamierte er nicht für sich selbst. »Das ist nicht die Errungenschaft unserer Zentralregierung«, erklärte er. Im ganzen Land verließen Bauern die landwirtschaftlichen Kollektive, die so lange ihr Leben bestimmt hatten. Wenn sie darüber sprachen, sagten sie, sie seien songbang – »von ihren Fesseln befreit worden« –, ein Begriff, der zuvor eher in Bezug auf entlassene Gefangene oder freigelassene Tiere verwendet wurde. Die Menschen begannen, über Politik und Demokratie zu sprechen. Aber auch Deng Xiaoping kannte Grenzen. Im März 1979, kurz bevor Lin Zhengyi seine abenteuerliche Reise Richtung Festland antrat, sprach Deng zu einer Gruppe hoher Funktionäre und fragte: »Können wir eine Art der Meinungsfreiheit zulassen, die schamlos die Prinzipien unserer Verfassung verletzt?« Nie werde die Partei eine »individualistische Demokratie« gutheißen. Sie strebe nach wirtschaftlicher Freiheit, wolle die politische Kontrolle aber behalten. Damit China gedeihen könne, dürfe die »Befreiung des Geistes« nicht ausufern.
Als sich die Folgen der politischen Wende auf dem Festland abzuzeichnen begannen, schaute Lin Zhengyi aus der Ferne zu. Geboren wurde er 1952, also drei Jahre nachdem China und Taiwan die ideologische und politische Pattsituation erreicht hatten, die jahrzehntelang Bestand haben sollte. Als die Nationalisten 1949 den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten verloren, flohen sie auf die Insel Taiwan, wo sie das Kriegsrecht ausriefen und sich zumindest theoretisch auf den Tag vorbereiteten, an dem sie die Macht über ganz China zurückerlangen würden. Das Leben in Taiwan war hart und beschwerlich. Lin wuchs in der an einem üppigen Flussdelta gelegenen Stadt Yilan in einer entlegenen Ecke der taiwanesischen Hauptinsel auf. Seine Familie stammte von Festlandeinwanderern ab. Für die auf der Insel eintreffenden Streitkräfte der Kuomintang gehörten diese Einwanderer zur Unterklasse und waren daher politisch nicht vertrauenswürdig, weshalb sie einer breiten Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und im Bildungsbereich ausgesetzt waren.
Lins Vater, Lin Huoshu, betrieb einen Friseurladen; seine Mutter wusch Wäsche für die Nachbarn. Die Familie lebte in einer armseligen Hütte am Stadtrand. Trotzdem brachte der Vater seinen Kindern alte chinesische Lehren sowie chinesisches Staatswesen bei und erzählte ihnen von der einst so fortschrittlichen Zivilisation der Chinesen, die vierhundert Jahre vor Gutenberg den Buchdruck erfunden hatten. Er las ihnen aus den Klassikern vor – aus Die Geschichte der Drei Reiche oder aus Die Reise nach Westen – und drillte seine Kinder darauf, an den Traum der Wiedergeburt Chinas zu glauben. Sein viertes Kind nannte er Zhengyi, weil der Name »Gerechtigkeit« bedeutet.
Als Lin noch klein war, fragte er sich oft, warum seine Familie trotz Chinas glorreicher Vergangenheit kaum in der Lage war, sich zu ernähren. Sein älterer Bruder erkundigte sich bei ihrer Mutter nie nach dem Essen, weil sie das nur in eine unangenehme Situation gebracht hätte, wie Lin sich erinnerte. »Er lehnte sich stattdessen an den Herd. War dieser warm, hieß das, es würde etwas zum Mittagessen geben.« War dies nicht der Fall, mussten sie hungrig bleiben. Diese Erfahrungen lösten bei Lin einen äußerst pragmatischen Charakterzug aus: Er betrachtete die Menschenwürde und damit zusammenhängende Angelegenheiten durch die Linse der Geschichte und der Ökonomie.
Als Teenager faszinierten ihn vor allem Geschichten über das Ingenieurwesen, etwa Berichte über Li Bing, der im 3. Jahrhundert v. Chr. den Statthalterposten in der heutigen Provinz Sichuan bekleidete und acht Jahre lang einen Kanal durch einen Berg hauen ließ, um lebensgefährliche Überschwemmungen kontrollieren zu können. Dabei kamen Tausende von Arbeitern zum Einsatz, die das Gestein mithilfe von Heufeuern erhitzten und es anschließend mit Wasser so weit abkühlten, dass Risse entstanden. Ergebnis des Ganzen war ein gewaltiges, überaus langlebiges Bewässerungssystem, das oft mit den sieben Weltwundern verglichen wird; noch dazu verwandelte es eine der ärmsten Regionen Chinas in eine außerordentlich fruchtbare Gegend, die heute »Land des Himmels« heißt.
Lin Zhengyi war der vielversprechendste aller Söhne der Familie; 1971 gelang es ihm, einen der begehrten Plätze an der Nationaluniversität Taiwan zu ergattern und Bewässerungstechnik zu studieren. Um die Gebühren zahlen zu können, brachen seine drei Brüder die Schule ab und begannen im Friseurladen ihres Vaters zu arbeiten. Lin nahm sein Hochschulstudium just zu der Zeit auf, als der Campus von Diskussionen über die Zukunft Taiwans und Festlandchinas in Aufruhr versetzt wurde. Jahrelang hatte man der taiwanesischen Jugend erzählt, die Volksrepublik werde von »kommunistischen Banditen« und »Dämonen« beherrscht. Die Nationalisten instrumentalisierten diese Bedrohungsszenarien, um das Kriegsrecht zu legitimieren, und verletzten in großem Maßstab die Menschenrechte politischer Gegner sowie kommunistischer Sympathisanten.
Als Lin sein Studium antrat, geriet die Position Taiwans allerdings ins Wanken. Im Juli 1971 kündigte der amerikanische Präsident Richard Nixon seinen Besuch in Peking an. Das Festland gewann an Einfluss. Im Oktober desselben Jahres entschieden die Vereinten Nationen in einer Abstimmung, Taiwan seinen Sitz in der UN-Generalversammlung abzunehmen und ihn der Volksrepublik China zu geben, was einer Anerkennung der Festlandregierung als rechtmäßiger Vertretung des chinesischen Volkes gleichkam. In diesem Klima fand Lin Zhengyi seine Stimme. Er wurde zum Präsidenten des Erstsemesterjahrgangs seiner Universität ernannt und entwickelte sich zu einem der engagiertesten jungen Aktivisten Taiwans. Bei einer Studentendemonstration mit dem Titel »Kampf den kommunistischen Banditen, die sich in die Vereinten Nationen einschleichen!« ergriff er das Mikrofon und rief zu inselweiten Protesten auf, was zur Zeit des Kriegsrechts allerdings derart radikal war, dass sich noch nicht einmal seine eigenen Mitstreiter dazu durchringen konnten. Bei einer anderen Gelegenheit kündigte er an, in den Hungerstreik zu treten, doch der Universitätspräsident brachte ihn schließlich davon ab.
Als Lin seinen Wechsel an eine Militärakademie bekannt gab, erklärte er den Reportern: »Sollte meine Entscheidung dazu führen, dass der Nationalismus in der taiwanesischen Jugend erwacht […], wird das weitreichende Folgen haben.« Außerdem hatte Lin ganz praktische Gründe für seinen Entschluss: Er konnte an der Akademie kostenlos studieren und erhielt sogar einen Sold.
Während seiner Studentenzeit lernte Lin schließlich im Haus eines Freundes eine junge Frau namens Chen Yunying kennen; sie war ebenfalls Aktivistin und studierte Literatur an der Nationalen Universität Chengchi. Nach dem Abschluss heirateten die beiden und bekamen einen Sohn. Lin verbrachte zwei Jahre mit den Vorbereitungen auf seinen Masterabschluss in Betriebswirtschaft, doch dann wurde ihm das Kommando über eine Kompanie auf der Insel Quemoy übertragen, die während des Kalten Krieges als »Leuchtturm der freien Welt« bekannt war, weil es sich dabei um das letzte Stück Land vor der kommunistischen Küste handelte. In der Vergangenheit hatten sich die beiden Seiten gegenseitig so heftig mit Granaten eingedeckt, dass das taiwanesische Militär die Insel mit Bunkern und unterirdischen Gaststätten überzogen und ein Krankenhaus so tief im Inneren eines Bergs errichtet hatte, dass es einem Atomschlag hätte standhalten können.
Als Lin 1978 auf Quemoy eintraf, führte man dort eher einen psychologischen als einen physischen Krieg. Taiwan und die Volksrepublik beschossen sich zwar immer noch, folgten dabei allerdings einem genauen Zeitplan: Das Festland feuerte an ungeraden Tagen; Taiwan erwiderte das Feuer den Rest der Woche. Inzwischen bekämpften sich beide Seiten vor allem mit Propaganda: Sie beschallten sich mit riesigen Hochleistungslautsprechern und warfen Flugblätter aus Heißluftballons. Sie ließen softballgroße Glasbehälter an das gegnerische Ufer treiben, die mit Gegenständen gefüllt waren, die potenziellen Deserteuren einen Vorgeschmack auf den Wohlstand auf der jeweils anderen Seite gewähren sollten. Taiwan schickte Poster und Miniaturzeitungen mit Informationen zur Außenwelt, außerdem saubere Unterwäsche, Kassetten mit Popmusik und Anleitungen für den Bau einfacher Radioempfänger – das Ganze versehen mit dem Versprechen, Geld, Gold und Ruhm warteten auf jeden willigen Deserteur. Das Festland antwortete mit Schnaps, Tee, kleinen Honigmelonen und Broschüren über lächelnde taiwanesische Diplomaten und Wissenschaftler, die bereits zur Volksrepublik übergelaufen waren – beziehungsweise, wie es die Partei ausdrückte, »das Licht gegen die Schatten« getauscht hatten.
Im Dezember 1978 erklärte Jimmy Carter, die Vereinigten Staaten würden die kommunistische Regierung Pekings offiziell anerkennen und alle formalen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan beenden. Diese Meldung begrub jegliche noch verbliebene Hoffnung, die Insel könnte eines Tages die Kontrolle über das Festland erlangen. In Taiwan, meinte ein Korrespondent, seien die Menschen so »nervös wie eine Katze, die eine stark befahrene Straße zu überqueren versucht, auf der der Verkehr von Minute zu Minute stärker wird«. Am Neujahrstag 1979 teilte der chinesische Staat mit, er werde das Bombardement Quemoys einstellen. Außerdem sandte er einen Appell an die Bevölkerung Taiwans und erklärte, dass »die strahlende Zukunft […] uns gehört. Die Wiedervereinigung mit dem Vaterland ist die heilige Pflicht unserer Generation, die uns von der Geschichte zugeteilt wurde.« Die Regierung prahlte, »der Aufbau im Vaterland« schreite »bereits energisch voran«.
Am 16. Februar wurde Lin noch näher ans Festland versetzt: Man vertraute ihm die Leitung des winzigen, auf einer einsamen, windgepeitschten Felszunge gelegenen Kommandopostens Berg Ma an, der unter Soldaten als »die Front der Welt« bekannt war – die letzte Bastion vor dem kommunistischen Bollwerk China. Es war ein prestigeträchtiger Posten, doch laut Ermittlern der Armee war Lin mit seiner Aufgabe nicht glücklich, weil er auf den äußeren Inseln vom Rest der Welt abgeschnitten war, obwohl er zur selben Zeit ebenso gut an der Militärakademie lehren oder die Prüfung für eine hochrangige Position hätte ablegen können. Persönlichkeiten des politischen Lebens machten an seinem Posten jedoch ganz besonders gerne halt und ließen sich mit den jungen Patrioten in Uniform fotografieren. Im April nahm Lin Urlaub, um seine Familie und seine Freunde zu besuchen. Eines Abends erzählte er einem alten Kommilitonen namens Zhang Jiasheng, er sei der Meinung, Taiwan könne nur gemeinsam mit der Volksrepublik gedeihen.
Als er zum Berg Ma zurückkehrte, war Lin dem Festland so nahe, dass er durch sein Fernglas die Gesichter der Soldaten auf der anderen Seite erkennen konnte. In Gedanken befand er sich längst in China. Obwohl Taiwan und das kommunistische China verfeindet waren, sah das einfache Volk in beiden immer noch zwei Zweige derselben Sippschaft, verbunden durch eine gemeinsame Geschichte und ein gemeinsames Schicksal. Wie einst der amerikanische Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten, riss der Konflikt einige Familien in der Mitte entzwei. In einem Fall konnte ein Mann vierzig Jahre nicht nach Hause zurückkehren, weil ihn seine Mutter zum Einkaufen aufs Festland geschickt hatte, kurz bevor die Kommunisten den Schiffsverkehr zwischen beiden Ländern beendeten.
In den Jahren nach der Trennung hatte manch ein Soldaten bereits versucht, von Quemoy ans Festland zu schwimmen; da dort aber sehr starke Strömungen herrschten, wurden die erschöpften Deserteure jedes Mal wieder an Land zurückgespült und als Verräter verhaftet. Zur Abschreckung zerstörte die Armee die meisten Fischerboote auf der Insel, und bei den wenigen, die übrig blieben, wurden nachts die Ruder eingeschlossen. Im Lauf der Jahre musste jedes als Schwimmhilfe einsetzbare Utensil registriert werden, und das Militär führte Stichproben auf der Insel durch, klopfte an Türen und kontrollierte, ob alle Basketbälle, Fahrradreifen und Rohre im Haus auch wirklich angegeben worden waren.
Im Frühjahr 1979 hatte ein anderer Soldat den seltenen Versuch gewagt, zur Gegenseite überzulaufen, war allerdings ebenfalls erwischt worden. Aber Lin ließ sich nicht beirren. Er war zwar der Ansicht, sein Plan sei besser, er wollte jedoch die Konsequenzen für die befehlshabenden Offiziere minimieren. Im Mai sollte er von einer Kommandantur zur nächsten wechseln, und er hoffte, wenn er zu diesem Zeitpunkt desertierte, könnten sich die Offiziere glaubhaft gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, weil sie Hinweise übersehen hatten. Noch dazu herrschte im Frühjahr starker Nebel auf der Insel, denn dann traf feuchte Luft auf kaltes Meerwasser und tauchte die Küste in einen grauen Dunstschleier, der gerade dick genug war, um eine ins Wasser gleitende Gestalt vor allzu neugierigen Blicken zu verbergen.
Mit jedem Frühlingstag nahm die Strömung allerdings zu, und im Sommer würde sie schließlich so stark sein, dass jeder zurück an den Strand gespült werden würde, ganz gleich, wie sehr er auch dagegen ankämpfte. Wollte Lin ans Festland schwimmen, musste er es jetzt tun.
Am Morgen des 16. Mai befand er sich auf seinem Kommandoposten. Er erkundigte sich beim Kompaniesekretär, Liao Zhenzhu, nach der aktuellsten Gezeitentabelle. Die Flut sollte ihren Höhepunkt um 16 Uhr erreichen und sich dann wieder zurückziehen.
Am selben Abend nahm Lin nach Sonnenuntergang an einer Sitzung im Hauptquartier des Bataillons teil und kehrte zum Essen zum Berg Ma zurück. Um 20:30 Uhr besuchte ihn ein Kompaniesekretär namens Tung Chin-yao an seinem Tisch, um ihm Bescheid zu sagen, dass er zum Hauptquartier des Bataillons hinübergehen und einen neuen Soldaten abholen wollte. Als Tung eine Stunde später zurückkehrte, war Lin nicht mehr im Speisesaal. In seiner Unterkunft war er auch nicht. Um 22:50 Uhr gaben zwei Hauptmänner seine Abwesenheit zu Protokoll und stellten einen Suchtrupp auf die Beine. Bis Mitternacht hatten die Kommandeure eine großangelegte Aktion in Gang gesetzt, bei der die gesamte Insel durchkämmt wurde – eine Blitzoperation, wie sie es nannten – und bei der zehntausende Menschen zum Einsatz kamen, darunter Soldaten und Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder. Sie rissen die Scheunen von Bauern auf und stocherten mit Baumbusstöcken in den Teichen. Dann stieß der Suchtrupp auf eine erste Spur: Am Ende des mit Minen übersäten Pfades, der vom Berg zur Küste führte, fanden sie Lins Turnschuhe, versehen mit den Schriftzeichen für »Kompaniechef«. Sie durchsuchten sein Zimmer und entdeckten, dass einige Gegenstände fehlten: eine Feldflasche, ein Kompass, ein Erste-Hilfe-Set, die Flagge der Kompanie und eine Rettungsweste.
Zu diesem Zeitpunkt war ihnen Lin bereits weit voraus. Von seinem Kommandoposten musste er noch nicht einmal dreihundert Meter hinter sich bringen, um die graubraunen Gesteinsbrocken am Ufer zu erreichen. Dort glitt er ins Wasser. Er hatte ausgerechnet, dass er das Meer vor der Ebbe um 22 Uhr erreichen musste, damit ihn die kraftvolle Strömung vom Land wegzog. Sicherheitshalber hatte er eine weitere wichtige Vorsichtsmaßnahme getroffen: Laut den Nachforschungen der Militärermittler hatte Lin zwei Tage vor seiner Flucht die entlang der Küste stationierten Wachposten inspiziert und sich bei dieser Gelegenheit an die jungen Rekruten gewandt, die das Meer im Auge behielten. Er erzählte ihnen eine merkwürdige Geschichte: Entdeckten Sie nachts Schwimmende, die allerdings keine Anzeichen machten, angreifen zu wollen, sollten sie nicht schießen, denn es handele sich sehr wahrscheinlich um »Wassergeister«; sollten sie dennoch feuern, forderten sie die Geister geradezu heraus, Rache an ihnen zu üben. In Taiwan waren alle möglichen Formen des Aberglaubens an Omen und Geister weit verbreitet, und eine wie nebenbei in die Runde geworfene Bemerkung eines befehlshabenden Offiziers konnte ausreichen, um einen nervösen Jugendlichen zweimal darüber nachdenken zu lassen, ob er wegen eines geheimnisvollen Plätscherns auf nächtlicher See wirklich den Alarm auslösen wollte.
Lin schwamm angestrengt und schnell. Die Strömung zerrte an ihm, doch schon bald hatte er die seichten Gewässer hinter sich gebracht und war allein auf dem tiefschwarzen Meer, nur umgeben von Wasser und einem schier endlosen Himmel. Er musste nur die halbe Strecke bis zum Festland schaffen, ab dort würde ihn die steigende Flut den Rest des Weges mit sich tragen.
Er kraulte bis zur Erschöpfung und ließ sich dann auf dem Rücken treiben, um neue Kraft zu schöpfen. Nach drei Stunden näherte er sich mit schmerzenden Beinen und vor Kälte starrem Körper dem Ufer. Vor ihm lag die östlichste Spitze Chinas: die kleine Insel Jiaoyu. Sie bestand nur aus einem Viertelquadratkilometer Sand und Palmen, der abgesehen von chinesischen Wachposten und Artilleriegeschützen keine Menschenseele beherbergte. Lin wusste, dass dieser Strand ebenfalls mit Landminen übersät war. Er griff in seine Kleidung, wo er eine Taschenlampe in einer Plastiktüte verstaut hatte. Seine tauben Finger fummelten am Schalter. Er schaltete die Lampe ein und signalisierte den chinesischen Soldaten seine Anwesenheit; schon bald sammelten sich diese am Ufer.
Lin erreichte das seichte Wasser. Es gab viel, worauf er sich freuen konnte: Die kommunistischen Flugblätter hatten neben Geld und Gold ein Willkommen versprochen, das eines Helden würdig war. In der Dunkelheit watete ein einzelner chinesischer Soldat auf Lin Zhengyi zu und stellte ihn unter Arrest.
2. Der Ruf
Jede Reise nach China beginnt mit einer Geschichte über Anziehungskraft. Der amerikanische Schriftsteller John Hersey, dessen Eltern als Missionare in Tianjin tätig waren, nannte das »den Ruf«.
In meinem ersten Jahr am College schlenderte ich in einen Einführungskurs über moderne chinesische Politik: Revolution und Bürgerkrieg; die tragische, proteische Kraft des Großen Vorsitzenden Mao; Aufstieg und Fall Deng Xiaopings, der China aus der Isolation führte und der Welt öffnete. Seit den Protesten auf dem Tiananmen-Platz waren gerade einmal fünf Jahre vergangen. Studenten, kaum älter als ich, hatten damals eine Zeltstadt inmitten der Kathedrale der Parteimacht errichtet – eine winzige Stadt in der Stadt, erfüllt von einem impulsiven Idealismus. Im Fernsehen hatte es so ausgesehen, als wären diese Studenten hin- und hergerissen gewesen zwischen Ost und West: Sie hatten unordentliche Frisuren, nutzten Gettoblaster und zitierten Patrick Henry, sangen jedoch auch die Internationale und warfen sich bei der Übergabe ihrer Forderungen vor Männern auf die Knie, die wie eh und je in hochgeschlossene Mao-Anzüge gehüllt waren. Ein Student erklärte gegenüber einem Reporter: »Ich weiß zwar nicht genau, wonach wir suchen, aber was es auch ist, wir möchten mehr davon.« Die Proteste endeten in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni in einem Blutbad. »Das ist nicht der Westen – das ist China«, verkündete die Obrigkeit über Lautsprecher, und das Politbüro setzte zum ersten Mal seit der Revolution die Volksbefreiungsarmee gegen die eigene Bevölkerung ein. Die Partei rühmte sich, diese Herausforderung erfolgreich gemeistert zu haben, war sich aber des Schadens für ihren Ruf aufs Schmerzlichste bewusst, weshalb sie ihre Geschichte in den folgenden Jahren systematisch von den Vorkommnissen bereinigte, bis nur noch schemenhafte Umrisse blieben.
Nachdem mein Interesse für China erwacht war, flog ich 1996 das erste Mal nach Peking, um mich ein halbes Jahr dem Erlernen des Hochchinesischen zu widmen. Die Stadt verblüffte mich. Film- und Fotokameras hatten mir nicht vermitteln können, wie nahe sie geistig und geografisch den windgepeitschten Ebenen der Mongolei war, besonders im Vergleich zu Hongkong. In Peking roch es nach Kohle und Knoblauch, nach verschwitzter Wolle und billigem Tabak. In einem Sammeltaxi mit fest verschlossenen Fenstern, in dem sich die Hitze staute, konnte man diesen Geruch fast schmecken. Peking lag von Bergen umgeben in der Nordchinesischen Ebene, und im Winter wehten die Winde, die sich in den Ländern Dschingis Khans gesammelt hatten, von den Anhöhen herab und pfiffen den Leuten um die Ohren.
Peking war ein lauter, wenig glanzvoller Ort. Eines der schönsten Gebäude der Stadt war das Jianguo Hotel, das von seinem Architekten voller Stolz als perfekter Nachbau des Holiday Inn im kalifornischen Palo Alto bezeichnet wurde. Chinas Volkswirtschaft war kleiner als die Italiens. Die Provinz schien nie fern zu sein: Abends aß ich meist in einem muslimisch geprägten Viertel, das als Xinjiang-Dorf bekannt war, denn dort lebten die Uiguren, eine ethnische Gruppe aus dem entfernten Westen Chinas. Vor ihren winzigen Restaurants aus grauem Backstein hatten sie ängstliche Schafe angebunden, und zur Abendessenszeit verschwanden diese Tiere eines nach dem anderen in den Küchen. Nachdem die Gäste die Lokale verlassen hatten, kletterten die Kellner und Köche auf die Tische, um dort zu schlafen.
Zwei Jahre zuvor hatte das Internet China erreicht; allerdings standen für hundert Menschen nur je fünf Telefonleitungen zur Verfügung. Ich hatte mir aus den Vereinigten Staaten ein Modem mitgebracht, aber als ich es mit der Wandsteckdose in meinem Studentenwohnheim verband, machte es laut »Plop«, und das Gerät rührte sich nicht mehr.
Als ich zum ersten Mal den Tiananmen-Platz besuchte, konnte ich von der Mitte aus an der Süd-, West- und Nordseite die Gedenkhalle für den Vorsitzenden Mao, die Große Halle des Volkes und das Tor des Himmlischen Friedens erkennen. Von den Demonstrationen gab es natürlich keine Spur mehr, und seit Maos einbalsamierte Überreste 1977 in einem Glaskasten aufgebahrt worden waren, hatte sich auf dem Platz nicht mehr viel verändert. Für einen Ausländer war es nur allzu verlockend, die von der Partei errichteten stalinistischen Denkmäler zu betrachten und daraus zu schließen, die Partei wäre dem Untergang geweiht. In jenem Sommer veröffentlichte die New York Times einen Artikel mit dem Titel »Der lange Marsch in die Bedeutungslosigkeit«, in der sie die Behauptung aufstellte, »die einstmals allgegenwärtige Partei« sei »so gut wie gar nicht mehr präsent«.
Eine Seite des Platzes war der Zukunft gewidmet: Dort befand sich eine gewaltige, fünfzehn Meter hohe und knapp zehn Meter breite Digitaluhr, mit der die Sekunden heruntergezählt wurden, bis »die chinesische Regierung die Herrschaft über Hongkong wiedererlangt«, wie man über der Uhr lesen konnte. In weniger als einem Jahr sollte Großbritannien, das die Insel seit Chinas Niederlage im Ersten Opiumkrieg 1842 kontrolliert hatte, Hongkong an die Volksrepublik zurückgeben. Die Chinesen nahmen den ausländischen Mächten diese Invasion und die Tatsache, dass man das Land »wie eine Melone aufgeschnitten« hatte, immer noch bitter übel. Deshalb handelte es sich bei der Rückgabe Hongkongs um eine symbolische Wiederherstellung der nationalen Würde. Chinesische Touristen machten Bilder unter der Uhr, und in den Lokalzeitungen standen Artikel über Paare, die dort Hochzeitsfotos aufnehmen ließen.
Die Rückgabe Hongkongs führte zu einer Explosion des Patriotismus. Nach fast zwei Jahrzehnten der Reformen und der Verwestlichung wehrten sich chinesische Schriftsteller gegen Hollywood, McDonald's und die Verbreitung amerikanischer Werte. Ein Bestseller dieses Sommers trug den Titel China kann Nein sagen. Das von einer Gruppe junger Intellektueller verfasste Werk prangerte Chinas »Vernarrtheit in Amerika« an, die, so argumentierten sie, die Vorstellungskraft des Landes unterdrückte, weil das chinesische Volk mit der Aussicht auf Visa, ausländische Entwicklungshilfe und Werbung gefüttert werde. Sollte sich China dieser »kulturellen Strangulation« nicht widersetzen, werde es zum »Sklaven« und setze somit letztlich die bis ins Jahr 1842 zurückreichende Geschichte erniedrigender Übergriffe aus dem Ausland fort. Der chinesische Staat, der brisanten, sich schnell ausbreitenden Ideen stets misstraut hatte, ließ das Buch schließlich aus den Regalen nehmen, allerdings hatte bereits zuvor eine Reihe weiterer Autoren versucht, die Stimmung mit schnell zusammengeschusterten Titeln à la Warum China Nein sagen kann, China kann immer noch Nein sagen und China sollte immer Nein sagen für sich zu nutzen. Als das Land am 1. Oktober seinen Nationalfeiertag beging, war auch ich vor Ort. Ein Leitartikel in der People's Daily erinnerte die Menschen daran, dass »der Patriotismus von uns verlangt, das sozialistische System zu verehren«.
Zwei Jahre später kehrte ich zurück, um an der Pädagogischen Universität von Peking zu studieren. Das meiste, was ich von der Hochschule wusste, stammte aus der Zeit um 1989, als ihre Studenten zu den aktivsten Teilnehmern der Proteste auf dem Tiananmen-Platz gehört hatten: An manchen Tagen waren neunzig Prozent aller Studenten zum Platz marschiert, um dort zu demonstrieren. Als ich eintraf, hatte ich den Eindruck, dass fast alle, die ich in diesem Sommer kennenlernte, vor allem eins wollten: einem lang aufgestauten Konsumverlangen nachgeben. Man kann gar nicht überschätzen, wie groß die Veränderung war. Während der Blütezeit des Sozialismus lief ein Film mit dem Titel Man darf nie vergessen in den Kinos, der davon handelte, dass ein Mann von seiner Gier nach einem neuen Wollanzug in den Wahnsinn getrieben wird. Dagegen gab es mittlerweile eine Zeitschrift namens Anleitung für den Erwerb exklusiver Waren, in der Themen behandelt wurden wie »Wer erhält nach einer Scheidung das Haus?«. In einem Artikel über Getränke war ein kleiner Kasten mit dem Titel »Männer, die sich für Mineralwasser entscheiden« eingeklinkt, in dem es hieß, diese seien bekannt für ihre »große Selbstachtung, ihre Ideale, ihren Ehrgeiz sowie ihre niedrige Toleranz für Mittelmäßigkeit«.
Der Staat bot seinem Volk einen Handel an: Wohlstand im Tausch gegen Loyalität. Während der Große Vorsitzende Mao noch gegen bürgerliche Genusssucht gewettert hatte, förderten chinesische Führer nun aktiv die Sehnsucht nach dem guten Leben. Im ersten Winter nach den Protesten auf dem Tiananmen-Platz teilten Arbeitseinheiten in Peking Übermäntel, Decken, Cola, Instantkaffee und zusätzliche Rationen Fleisch an die Beschäftigten aus. Der Staat ließ in der Stadt eine neue Losung verbreiten: »Leiht Euch Geld, um Eure Träume zu verwirklichen.«
Die Bevölkerung war noch damit beschäftigt, sich an ein Leben jenseits der Arbeit zu gewöhnen. Erst vor zwei Jahren hatte man statt der vorher üblichen Sechs-Tage-Woche die Fünf-Tage-Woche eingeführt. Als Nächstes war der traditionelle sozialistische Kalender neu gestaltet worden, um etwas vorher vollkommen Unvorstellbares möglich zu machen: drei Wochen Urlaub. Chinesische Wissenschaftler begrüßten diese Entwicklung und riefen ein neues Forschungsgebiet, die sogenannten Freizeitstudien, ins Leben, das sich diesem »bedeutenden Stadium in der gesellschaftlichen Entwicklung der Menschheit« widmete. Eines Wochenendes machte ich mich gemeinsam mit chinesischen Kommilitonen auf den Weg in die Innere Mongolei. Der Zug war überfüllt, das Belüftungssystem atmete Dieselabgase ein und in die Abteile wieder aus. Trotzdem beschwerte sich niemand, weil es einfach so eine große Freude war, überhaupt auf Reisen zu sein.
Nach dem College begann ich, als Zeitungsreporter in Chicago, New York und dem Nahen Osten zu arbeiten, bis die Chicago Tribune 2005 schließlich anfragte, ob ich mir vorstellen könnte, nach China zurückzukehren. Also packte ich den Inhalt meiner Kairoer Wohnung in Kartons und landete in einer stickigen Juninacht in Peking. Eine Viertelmilliarde Chinesen lebte immer noch von weniger als 1,25 Dollar am Tag. Dass dieser Bevölkerungsteil, der fast so groß war wie die Einwohnerzahl der gesamten Vereinigten Staaten, in den Beschreibungen des neuen China oft unerwähnt blieb, war sicher falsch, auch wenn dies in Anbetracht des Ausmaßes und der Geschwindigkeit des Wandels durchaus nachvollziehbar war. Ich erkannte die Stadt nicht wieder und machte mich auf die Suche nach den nächtlichen Verkaufsständen und den Schafen des Xinjiang-Dorfes, aber sie waren allesamt während eines Anfalls von Verschönerungswut verschwunden. Das Einkommen im Land begann, schneller zu steigen als jemals zuvor in einem vergleichbar großen Land auf der Welt. Als ich das letzte Mal in China gewesen war, betrug das jährliche Pro-Kopf-Einkommen dreitausend Dollar – wie 1872 in den Vereinigten Staaten. Die amerikanische Bevölkerung benötigte fünfundfünfzig Jahre, um auf siebentausend Dollar zu kommen. China schaffte dasselbe innerhalb eines Jahrzehnts.
In sechs Stunden exportierte die Volksrepublik nun so viel wie im gesamten Kalenderjahr 1978, also kurz bevor Hauptmann Lin Zhengyi ans Festland schwamm. Und so war es auch die Wirtschaft, die mich bis an Lins Haustür führte. Ich war auf der Suche nach Wissenschaftlern, die mir erklären konnten, was hinter dem Wandel in China steckte. Lin war mittlerweile ein bekannter Ökonom in seinen späten Fünfzigern, mit einem grauen Bürstenhaarschnitt, dicken Augenbrauen und einer Drahtgestellbrille, die ständig von seiner Nase glitt. Von seiner Vorgeschichte wusste ich nichts. Als ich seinen Namen gegenüber einem seiner Kollegen erwähnte, meinte der, Lins Vergangenheit könne mir wahrscheinlich mehr über den Motor von Chinas Boom sagen, als es mein Stapel Bücher jemals würde.
Als ich mich das erste Mal bei Lin nach seinem Werdegang erkundigte, antwortete er höflich: »Das ist eine alte Geschichte.« Er sprach nur sehr selten von seiner Flucht, und das verstand ich, obgleich meine Neugierde anhielt. Nach unserem ersten Treffen besuchte ich Lin noch sehr oft; und bei diesen Gelegenheiten erzählt er mir stets von seinen neuesten Studien. Eines Tages stellte er sich endlich meinen Fragen zu seiner Vergangenheit. Ich sammelte Unterlagen über seinen Fall und besuchte den Küstenabschnitt, von dem er losgeschwommen war. Als er Taiwan verließ, sagte er, habe er sich einfach nur »in Luft auflösen« wollen.
In der Hoffnung, doch noch das mir bekannte China wiederzufinden, klammerte ich mich zunächst an das Leben auf dem Land – das China der Literatur und der Tuschemalerei. Einen Monat lang tat ich nichts anderes, als die Flüsse der Provinz Sichuan entlangzuwandern und zu trampen. Ich schlief in kleinen Ortschaften, die mir so gut wie verlassen vorkamen, weil der Ruf aus der Stadt jeden weggelockt hatte, der nicht zu jung oder zu alt war, um diese Anziehungskraft zu spüren. Die Dorfältesten scherzten gern, dass nach ihrem Tod niemand da sein würde, um ihre Särge zu tragen.
Sollte es je eine Zeit gegeben haben, in der sich chinesische Städte wie Ausnahmen anfühlten, wie Inseln inmitten eines Meeres der Armut, so war dies nun immer seltener der Fall. Alle zwei Wochen wurde in China eine Fläche von der Größe Roms bebaut. (2012 lebten erstmals mehr Chinesen in Städten als auf dem Land.) Ich begann, es auf gewisse Weise als belastend zu empfinden, eine in kürzester Zeit hochgezogene Stadt mit ihren kilometerlangen, sich ungehindert durch die Ortschaft ziehenden Straßen aus schwarzem Asphalt zu betreten, die von noch menschenleeren Gebäuden flankiert wurden. Der ständige Wandel war die einzige Konstante. Als sich ein chinesischer Freund bei mir erkundigte, welche amerikanischen Städte er bei seiner nächsten Reise in die Vereinigten Staaten besuchen sollte, schlug ich New York vor, worauf er so taktvoll wie möglich entgegnete: »Jedes Mal, wenn ich dort bin, sieht es gleich aus.« In Peking schlug ich nie eine Einladung aus, weil Orte – und Menschen – verschwanden, bevor man die Chance auf ein Wiedersehen hatte.
Im Zuge der Wohnungssuche stieß ich auf Inserate für die »Merlin Champagne Town«, die »Venice Water Townhouses« oder das »Moonriver Resort Condo«. Ich entschied mich für das »Global Trade Mansion«. Dabei handelte es sich um eine Insel inmitten eines Meeres endloser Bauarbeiten. Wer auch immer das Gebäude errichtet hatte, war so vorausschauend gewesen, es mit schalldichten Fenstern zu versehen, weil es in Zukunft von ständigem Baulärm umgeben sein würde. Ich lebte im zweiundzwanzigsten Stock, und bevor ich morgens ins Büro fuhr, lernte ich am Fenster etwas Chinesisch, während ich hinunterblickte auf eine kleine Armee von Arbeitern mit orangefarbenen Schutzhelmen, die neben einem ruhelosen Kran auf und ab liefen. Nachts übernahm eine andere Schicht, und das gleißende Licht der Schweißgeräte fiel durch meine Fenster. Das Global Trade Mansion schien sich so gut wie jeder andere Ort dafür zu eignen, herauszufinden, was die Kommunistische Partei mit »Sozialismus chinesischer Prägung« meinte.
Neun Jahre nachdem die Times den langen Marsch in die Bedeutungslosigkeit ausgerufen hatte, war die Partei größer und reicher als je zuvor; sie bestand aus achtzig Millionen Mitgliedern – immerhin jeder zwölfte Erwachsene – und hatte keinerlei organisierte Opposition zu fürchten. Selbst in stark westlich geprägten Technologie- oder Finanzunternehmen wurden Parteizellen gegründet. Bei der Volksrepublik handelte es sich um eine sehr gut funktionierende Diktatur – allerdings ohne Diktator. Die Partei kontrollierte den Staat, sie ernannte die Vorstände von Konzernen, die Bischöfe der katholischen Kirche und die Redakteure der Zeitungen. Sie riet Richtern, welche Urteile sie bei heiklen Gerichtsfällen zu fällen hatten, und lenkte die Oberbefehlshaber der Volksbefreiungsarmee. Auf der niedrigsten Ebene schien die Partei wie ein Netzwerk für Fachpersonal zu sein. Eine talentierte junge Journalistin, deren Bekanntschaft ich in Peking gemacht hatte, erklärte mir, sie sei an der Hochschule Parteimitglied geworden, weil sie so die Zahl der ihr zugänglichen Arbeitsplätze verdoppeln konnte. Außerdem hatte einer ihrer Lieblingsprofessoren sie inständig darum gebeten, da es galt, die Frauenquote bei Neumitgliedern zu erfüllen.
Als ich in China eintraf, war die Partei gerade damit beschäftigt, sich mithilfe der sogenannten »Bildungskampagne zur Erhaltung des fortschrittlichen Zustands der Kommunistischen Partei Chinas« eine Verjüngungskur zu verpassen. Nach Parteistandards war die geradezu optimistisch angelegt. Anders als noch zu den Zeiten öffentlicher Denunziationen und Konfrontationen in den sechziger und siebziger Jahren, ermutigte die Partei die Bevölkerung nun, den eigenen »roten Geburtstag« zu feiern (den Jahrestag des Parteibeitritts); dazu sollte jedes Mitglied eine etwa zweitausend Worte lange Selbsteinschätzung verfassen. Der Markt witterte eine gute Gelegenheit, und bald schon boten gewiefte Geschäftsleute im Internet »Modell-Selbsteinschätzungen« an. Diese waren bereits mit allen benötigten Geständnissen versehen, etwa dem Satz: »Ich habe der Herausbildung meiner wissenschaftlichen Weltsicht nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt.« Doch meine Journalisten-Freundin, die an der Hochschule Parteimitglied geworden war, versuchte allen Ernstes, ihren Report selbst zu schreiben. Als sie ihren Text beim monatlichen Parteitreffen laut vorlas, wurde sie dafür kritisiert, nicht die offiziell zugelassenen Begriffe und Wendungen benutzt zu haben. Und so griff auch sie wieder auf die Standardliste zurück.
In den sieben Jahren meiner Abwesenheit hatte sich auch die chinesische Sprache verändert. Das Wort tongzhi für »Genosse« war von Schwulen und Lesben als eine ironische Selbstbezeichnung vereinnahmt worden. Eines Nachmittags wartete ich in der Schlange vor einer Bank, als ein alter, ungeduldig dreinschauender Herr »Tongzhi, schneller!« nach vorne rief und sich zwei Teenager vor Lachen kaum halten konnten. Der Begriff für Kellnerinnen und Verkäuferinnen, xiaojie, hatte ebenfalls eine neue Bedeutung erhalten und bezog sich nun hauptsächlich auf Prostituierte. Auf diese neuen xiaojie traf man nun ebenfalls überall im Land, das überschwemmt wurde von Geschäftsreisenden mit viel Bargeld in den Taschen.
Am meisten verblüffte mich jedoch die Veränderung, die der Begriff für »Ehrgeiz« durchgemacht hatte: ye xin – was wörtlich »wildes Herz« bedeutet. Für die Chinesen hatte fast jedes »wilde Herz« nach unzivilisierter Hemmungslosigkeit und absurden Erwartungen geschmeckt – nach einer Kröte, die davon träumt, einen Schwan zu verschlingen, wie es in einem alten Sprichwort heißt. Vor mehr als zweitausend Jahren hatte eine Sammlung politischer Empfehlungen namens Huainanzi die Herrscher des Landes ermahnt, »mächtige Posten ebenso wenig in die Hände von Ambitionierten fallen zu lassen, wie man scharfe Gegenstände Narren überlässt«. Aber nun begegneten mir plötzlich überall Anspielungen auf »wilde Herzen«: in Fernseh-Talkshows und in Regalen voller Selbsthilfebücher. In den Buchhandlungen konnte man Bände mit Titeln wie Große wilde Herzen: Die Höhen und Tiefen wegweisender Helden des Unternehmertums oder Wie man in seinen Zwanzigern zu einem wilden Herzen kommt erwerben.
Als die Sommerhitze langsam nachließ, machte ich mich auf den Weg, um einen Mann namens Chen Guangcheng zu besuchen, über den ich bereits viel gelesen hatte. Chen war der jüngste von fünf Söhnen einer Bauernfamilie aus dem fünfhundert Einwohner zählenden Dorf Dongshigu. Bereits in seiner Kindheit war er wegen einer Krankheit erblindet, weshalb er bis zu seinem siebzehnten Lebensjahr keinerlei Schulbildung erhalten hatte. Sein Vater las ihm Romane und Abenteuergeschichten vor. Er hörte gern Radio und fand Inspiration im Werdegang seines Vaters, der noch bis ins Erwachsenenalter Analphabet gewesen war, bis er schließlich eine Schule besucht und eine Anstellung als Lehrer gefunden hatte.