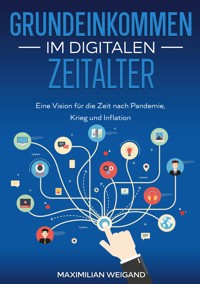
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Welt im Dauerkrisenmodus ist die Zeit für neue Visionen und Paradigmen Die Welt durchlebt eine Zeit, in der die Krise zu einem Dauerzustand geworden ist. Das tägliche Geschehen rund um Pandemie, Krieg und Inflation bestimmt unseren Alltag. Gleichzeitig werden Wirtschaft und Gesellschaft durch technologische Entwicklungen in nie dagewesener Weise transformiert. Der rapide Erfolg von ChatGPT und Co. ist dabei erst der Beginn eines neuen Zeitalters. Wie fangen wir diese Gemengelage auf? Was ist unsere Vision von einer modernen Gesellschaft, in der sich jeder Mensch in Frieden und Freiheit selbstverwirklichen kann? »Grundeinkommen im digitalen Zeitalter« skizziert eine Perspektive für eine resiliente Gesellschaft, die diese strukturellen Veränderungen und Verwerfungen auffängt. Es zeigt auf, wie uns ein neuartiges, technologiebasiertes Grundeinkommen den Weg in ein sinnstiftendes und freiheitliches Zeitalter bahnen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der moderne Mensch wird in einem Tätigkeitstaumel gehalten, damit er nicht zum Nachdenken über den Sinn seines Lebens und der Welt kommt.
(Albert Schweitzer)
Inhalt
1 Einführung
Welt im Würgegriff von Pandemie, Krieg und Inflation
Struktureller Wandel als Ausgangspunkt für ein neues Gesellschaftskonzept
2 Rahmenbedingungen eines Grundeinkommens
Accelerating Change
– Der Weg in das digitale Zeitalter
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen des digitalen Wandels
Übergreifende Treiber
Konzentration durch digitale Plattformen
Disruptiver Wandel der Arbeitswelt
Technologie und Gesellschaft
Ökonomische und gesellschaftliche Ungleichgewichte
Soziale Ungleichheit
Strukturelle Treiber und Probleme
3 Zusammenfassung der Rahmenbedingungen für ein Grundeinkommen
4 Das Plattform-Grundeinkommen
Quo vadis Grundeinkommen
Warum ein Basis-Grundeinkommen zu kurz greift
Entwicklung eines neuen Ansatzes für ein Grundeinkommens
Einkommen und Grundeinkommen im digitalen Zeitalter
5 Bausteine für ein dezentrales Grundeinkommen
Vorbemerkungen
Eine Plattform gegen Plattformkapitalismus
Der Staat im Plattform-Grundeinkommen
Grundeinkommen zwischen Zentralität und Dezentralität
Ein neuer gesellschaftlicher Raum
Plattform-Grundeinkommen im Spannungsfeld von Technologie und Gesellschaft
Plattform-Grundeinkommen als Ideenmarktplatz
Plattform-Grundeinkommen als Datenmarktplatz
Aufbau des digitalen Ökosystems
Gedanken zur Finanzierung
Abschließende Worte
Endnoten
1 Einführung
Welt im Würgegriff von Pandemie, Krieg und Inflation
Eine Pandemie, die noch immer nicht vorbei ist. Gestörte Lieferketten und eine enteilende Inflation. Ein Krieg mitten in Europa. Eine fortwährende Energiekrise und ihre sozialen Folgen in den kommenden Wintern. Geopolitische Spannungen und Säbelrasseln rund um Taiwan. Was sich heute als neue Normalität im Alltag der Menschen festgesetzt hat, wäre bis vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. In dem Moment als dieses Buch begonnen wurde, neigte sich das Jahr 2020 dem Ende zu. Der Übergang von einer „heilen“ Welt im Jahr 2019 in das Krisen-Jahr 2020 wird wohl jedem Menschen auf der Welt in Erinnerung bleiben: Ein Jahr als tiefer Einschnitt, gar als Zäsur einer immer schnelllebigeren Zeit tiefgreifender ökonomischer, politischer und gesellschaftlicher Eingriffe und Veränderungen. Während die gesundheitlichen Herausforderungen der Pandemie weitestgehend bewältigt werden konnten, werden die ökonomischen und sozialen Folgen unseren Alltag noch über Jahre hinaus beeinträchtigen.
Das Jahr 2021 war hierfür nur ein erster Vorgeschmack. In vielen Branchen wie im Einzelhandel oder der Hotellerie konnten Unternehmen nur durch staatliche Hilfen am Leben erhalten werden. Kurzarbeitergeld und die zeitweise Aussetzung des Insolvenzrechtsregime in seiner angedachten Form haben Arbeitnehmer, Verbraucher und Unternehmen in einem nie dagewesenen Ausmaß vor gravierenden Auswirkungen bewahrt. Mithin konnten durch massive fiskal- und geldpolitische Maßnahmen von Staaten und Zentralbanken die pandemiebedingten Einbrüche überraschend schnell und effektiv aufgefangen werden. Selbst, als mit Störungen der globalen Lieferketten zum Ende des Jahres 2021 die Erzeuger- und Verbraucherpreisinflation in die Höhe schnellte, erschien es, als könnten diese temporären Schocks im Jahr 2022 wieder weitestgehend abgefedert werden. So wurde nicht selten mit Blick auf die Inflation von einem vorübergehenden („transitory“) Problem gesprochen.1
Dass es anders gekommen ist, spürt mittlerweile jeder Bürger bei seinem Einkaufsverhalten, an der Tankstelle und mit bangem Blick auf seine Nebenkostenabrechnung. Der Krieg in der Ukraine hat eine ohnehin angespannte Gesamtgemengelage in einer Weise verschärft, die insbesondere Deutschland und Europa vor eine historische Herausforderung stellt. Die Energiekrise wird zur übergreifenden Zerreißprobe für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Dabei steht nicht weniger als der gesamte Wohlstand der Nation zur Disposition. Anders als bei den Pandemiefolgen sind wir scheinbar an einem Punkt angekommen, an dem der Staat eine Krise nicht mehr durch zusätzliches Geld auffangen kann. Wenn reale Güter fehlen, weil die Lieferketten kollabiert sind, kann mit kreditbasiertem Geld keine Lücke mehr gefüllt werden. Gleichzeitig droht der soziale Zusammenhalt zu kippen, wenn Menschen ihre Strom- und Gasrechnungen nicht mehr zahlen können. Umso schlimmer kann es werden, wenn es zu temporären Engpässen – gar Blackouts – kommt. Die damit verbundenen Konsequenzen mag sich niemand vorstellen, der in einem von Wohlstand und Wachstum geprägten, vergangenen Jahrzehnt in Deutschland gelebt hat. Unverkennbar befinden sich unser Land und ganz Europa vor einer historischen Herausforderung. Daraus stellt sich die Frage, wie es weitergehen kann. Ganze Industrien wie Stahl und Aluminium werden in Deutschland an den Rande ihrer Existenz gebracht. Ihre Arbeitnehmer müssen auf einen milden Winter und ein möglichst baldiges Kriegsende hoffen. Doch scheint es nicht so, dass bei der Summe an strukturellen Problemen ein baldiges Ende der Krise(n) in Sicht sein wird. Vielmehr ist es Zeit, die Vielzahl der Probleme als Anlass zu nehmen, um übergeordnete Lösungsansätze zu finden.
Nicht zuletzt bestehen die Herausforderungen, die das laufende Jahrzehnt der 20er-Jahre prägen werden, nicht erst seit oder durch die Pandemie oder den Krieg in der Ukraine. Im Gegenteil: Deutschland, Europa und im Grunde die gesamte westliche Welt haben sich in eine Ausgangssituation manövriert, die sie für derlei Schocks besonders anfällig machten. Dies gilt augenscheinlich für die Energieversorgung in Deutschland. Ein Ausstieg aus Atomkraft und Kohle sowie eine einseitige Abhängigkeit von russischem Gas wurde nicht hinreichend durch den Ausbau erneuerbarer Energien kompensiert. Ebenso wurde der Aufbau einer zukunftsträchtigen digitalen Infrastruktur sträflich vernachlässigt. Dass Deutschland bei vielen Entwicklungen den Anschluss zu verlieren droht, hat die Corona-Pandemie umso sichtbarer gemacht. Man denke exemplarisch an die oft mangelnde digitale Infrastruktur an deutschen Schulen. Viel weitgreifender ist die bedrohte Wettbewerbsfähigkeit in Zukunftsfeldern wie der Künstlichen Intelligenz (KI). Neben dem Silicon Valley positioniert sich insbesondere China als ambitionierte Weltmacht mit massiven Investitionen in die Technologie. Auch wenn es noch Jahrzehnte dauern dürfte, bis eine KI die menschliche Intelligenz übertrifft, sind ihre Auswirkungen bereits heute in nahezu allen Branchen ersichtlich. Die Marktmacht von zentralisierten, digitalen Plattformen führt zu einer globalen Konzentration von Marktmacht auf eine kleine Zahl von Tech-Unternehmen. Dass sie in der aktuellen Lage Stellen abbauen und Kursverluste hinnehmen müssen, sollte dabei nicht zu einem Trugschluss verleiten. In einer zunehmend vernetzten Welt dürften auch in Zukunft die Technologie-Unternehmen die großen Weichen stellen.
Damit verbundene Ungleichgewichte zwischen digitaler und analoger Wirtschaft wurden im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter verstärkt. Während es analogen Geschäftsmodellen zeitweise verwehrt blieb, ihrem normalen Geschäftsbetrieb nachzugehen, konnten die Digitalkonzerne ihre Stellung weiter ausbauen. Selbst wenn dieser Aspekt unter dem täglichen Geschehen von Pandemie, Krieg und Inflation gegenwärtig nicht so präsent sein mag, ist sich jedoch vor Augen zu führen: Was übergreifend stattfindet, ist eine gewaltige, technologische Disruption von Wirtschaft und Gesellschaft in nie dagewesener Weise. Zugleich sind wir Zeuge eines fortschreitenden Entkopplungsprozesses („Decoupling“) der westlichen Welt von der östlich-asiatischen Hemisphäre. Hafenlockdowns und die damit zusammenhängende Chip-Krise haben insbesondere der deutschen Automobilindustrie vor Augen geführt, wie abhängig wir von unserem Handelspartner China geworden sind. Dies betrifft sowohl die Rolle von China als Endkundenmarkt als auch als Zulieferer von vielerlei Rohstoffen und Komponenten. Der Umgang China’s mit der Pandemie, die Haltung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sowie die anhaltenden Spannungen mit Taiwan und den USA treiben einen zunehmenden Keil zwischen die internationalen Beziehungen und belasten den Waren- und Finanzverkehr.
So kommt es zu einer zunehmenden Divergenz des freiheitlich-demokratisch geprägten Bild des Westens von einem immer autoritärer agierenden Weltmacht China. Letztere hat nicht zuletzt aufgrund der kolonialen Vergangenheit die machtpolitische Ambition, den Westen zu übertrumpfen und eigene Interessen rigoros durchzusetzen. Dementgegen hat der Westen schon lange keine klare Strategie mehr: Die einstige Führungsmacht Amerika ist in sich gespalten und verliert an Machtanspruch, wenn sich mehr und mehr Länder dem chinesischen Modell zuwenden. So werden viele Länder auf dem afrikanischen Kontinent oder in Zentralasien zum Eckpfeiler in Chinas globalen Seidenstraßen. Europa hat sich mit einem überbordenden, regulatorischen Korsett de facto seiner Innovationskraft und damit seinem Führungsanspruch selbst beraubt. Neben einer fatalen Geldpolitik im USD- sowie im Euro-Raum sind keine klare geo- und industriepolitische Richtung erkennbar.
Bei dieser Ausgangslage wird nicht wenigen Menschen mulmig zumute. War unsere Welt vor einigen Jahren schon durch große Megatrends einem disruptiven Wandel unterworfen, entfaltet sich im Zusammenspiel der globalen Krisen eine bedrohliche Melange. Gewiss mag am Ende dieser Veränderungsprozesse eine bessere und resilientere Welt stehen. Allerdings kann der Weg dahin für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen über einen längerfristigen Zeitraum mit großen Belastungen verbunden sein.
Jedoch sollte diesen Entwicklungen nicht mit Ohnmacht und Lethargie begegnet werden. Vielmehr sollten sie als Anlass gesehen werden, strukturelle Probleme grundlegend anzugehen. Hierfür ist festzuhalten, dass es sich im Kern um Entwicklungen handelt, die den Wohlstand eines jeden Einzelnen bedrohen. So fragen sich viele Menschen bei steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen, ob sie weiterhin all ihre Rechnungen bezahlen können. Kann ich mir meine Wohnung weiterhin leisten? Kann ich mit meinen Kindern noch in den Urlaub fliegen? Dass sich der Großteil der Gesellschaft substanziell einschränken muss, ist dramatischer Vorbote eines kaum schätzbaren Wohlstandsverlusts. Das mögliche Ausmaß dessen wird wahrscheinlich selbst zum jetzigen Zeitpunkt noch vielfach unterschätzt. Ferner ist fraglich, ob die Politik die Tragweite der gegenwärtigen Entwicklung ernsthaft erkannt hat.
Wenn wir diese gesamthafte Entwicklung als Wohlstandsproblem begreifen, müssen wir in der Problemlösung da ansetzen, wie Wohlstand erwirtschaftet und durch jedes Individuum in der Gesellschaft erlangt wird. Mithin gibt diese Entwicklung Anlass, sich mit der Frage von menschlicher Arbeit und Einkommen auseinanderzusetzen: Wie schaffen wir es, niemanden auf dem Entwicklungspfad durch Disruptionen, Schocks und Krisen zu verlieren? Auf welche Weise kann Aufstieg und Innovationskraft eines jeden Einzelnen ermöglicht und gefördert werden? Wie kann in einem immer volatileren Umfeld sichergestellt werden, dass Menschen sich trauen, ihre Ideen und Träume zu verwirklichen? Wie kann jeder Einzelne einen gerechten Anteil am Wohlstand der Gesellschaft erhalten und ebenso gewinnbringend dazu beitragen?
All dies sind Fragen, die in diesem Buch gesamthaft adressiert werden. Angesichts der vorherrschenden Gemengelage und vor dem Hintergrund des technologischen Wandels soll ein Gesellschaftskonzept für das digitale Zeitalter entworfen werden. Dabei geht mitnichten darum, eine individuelle Lösung für ein einzelnes Problem zu identifizieren: Dieses Buch ist entsprechend nicht als unmittelbarer Ratschlag an die Politik zu verstehen. Vielmehr soll ein Zielbild – eine Vision – für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft im digitalen Zeitalter entworfen werden. Letztlich ist es das, woran es uns fehlt: Eine Vorstellung des Miteinanders für eine gewinnbringende und friedliche Koexistenz aller Individuen in einer Gesellschaft, die zweierlei vereint: Die Freiheit und Absicherung des Individuums verbunden mit den Anreizen und Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen.
Struktureller Wandel als Ausgangspunkt für ein neues Gesellschaftskonzept
In unserer Gesellschaft ist die Frage der individuellen Selbstverwirklichung untrennbar mit der beruflichen Tätigkeit verbunden. Es ist Konsens, dass ein Beitrag zum Wohlstand durch Arbeitsleistung erbracht wird und eben durch einen Teil des Wohlstands belohnt wird. Unterstellen wir, dass das Leistungsprinzip gilt, wird härtere und/oder höherqualifizierte Arbeit in größerem Umfang entlohnt als eine geringer qualifizierte Beschäftigung. Aktuell wird dieser Mechanismus mehr und mehr außer Kraft gesetzt. Die gegenwärtige Gemengelage schafft durch eine Vielzahl von Schocks wie Hafenlockdowns, Krieg und Inflation eine Situation, in der die Partizipation an Wohlstand nicht bzw. nur noch bedingt an die individuelle Leistung gekoppelt ist. Die Bäckerin, die ihre gestiegenen Energiekosten nicht weitergeben kann, wird nicht mehr wirtschaftlich produzieren können. Die Restaurantbesitzerin wird einen großen Teil ihrer Kellner nicht mehr beschäftigen können, wenn die Auslastung aufgrund inflationsbedingter Konsumzurückhaltung zu gering ist. Die betroffenen Personen sind willens und fähig ihrer unternehmerischen oder angestellten Tätigkeit nachzugehen, werden jedoch durch einen exogenen Schock daran gehindert. Dies alles sind – so zumindest die Hoffnung – temporäre Effekte, die sich jedoch aktuell in wechselseitiger Abhängigkeit der Vielzahl an Problemen gegenseitig bestärken.
Neben diesen Schocks erleben wir strukturelle Veränderungen ganzer Märkte und Branchen im Zuge der Digitalisierung. Wenn beispielsweise der chinesische Versicherungskonzern Ping An Insurance Milliardenbeträge investiert, um Schadensfälle automatisiert über eine KI abzuwickeln, hat dies gravierende Auswirkungen auf den Beruf eines jeden Sachbearbeiters. Eine aufwendige (menschliche) Bearbeitung von Vorgängen entfällt damit für eine Vielzahl von Fällen, die in ihrer Komplexität keine menschliche Arbeitskraft erfordern. Gleiches gilt für digitale Plattformen wie Amazon und Uber, die sich dieser Technologie bedienen. Amazon’s Algorithmen identifizieren Kundenwünsche effektiver als jede durch Menschen durchgeführte Marktforschung. Uber bringt Fahrtsuchende und Fahrer effizienter zusammen als jede Taxizentrale es bewerkstelligen könnte. Gleichzeitig werden die Algorithmen mit weltweit steigenden Nutzerzahlen fortlaufend trainiert und errichten damit kaum überwindbare Hürden für bestehende und neue Wettbewerber. Angesichts dessen fällt es schwer, zu glauben, dass beispielsweise deutsche Einzelhändler trotz beachtlicher Investitionen langfristig dagegenhalten können. Vielfach gibt es schlichtweg keinen Grund für eine Koexistenz weiterer, lokaler Plattformen, wenn Konsumenten einen höheren Mehrwert daraus ziehen, bei einer einzelnen Plattform zu kaufen. Warum sollte der Kunde zu einem teureren und langsameren Online-Shop deutscher Einzelhändler wechseln, wenn Amazon eine derart überlegene Leistung bietet.
Aus derlei Entwicklungen stellt sich unweigerlich die Frage: Wieviel und welche Art menschlichen Inputs benötigen vollständig technologiegestützte Wertschöpfungsketten in Zukunft überhaupt noch? Dabei ist es schwierig, eindeutige Aussagen zu treffen. So geben Studien kein eindeutiges Bild und reichen von geringen Beschäftigungswirkungen bis hin zu drastischen Szenarien mit hoher Arbeitslosigkeit. Eine vielzitierte Studie der OECD kommt für die USA und Deutschland zu dem Ergebnis, dass 47 % bzw. 42 % aller Jobs gefährdet seien. Mit Blick auf derartige Szenarien wird oft argumentiert, dass der technologische Fortschritt seit jeher mehr Arbeitsplätze geschaffen als vernichtet hat. Dabei ist fraglich, ob dieses empirische Phänomen auf die digitale Revolution des 21. Jahrhunderts übertragen werden kann. Im Vergleich zu den industriellen Revolutionen des 19. und 20. Jahrhunderts beschleunigt sich die Entwicklung und Verbreitung von Technologie in nie dagewesenem Ausmaß. Entsprechend steigt der Anpassungsdruck auf die Arbeitswelt und die Sozialsysteme. In Reaktion auf diese Entwicklungen wird oft das Bild eines „Arbeitnehmerselbstständigen“ gezeichnet, der flexibel und anpassungsfähig ist und sich stetig für ein veränderndes Arbeitsumfeld in Interaktion zwischen Menschen und Maschine weiterbildet. „Lebenslanges Lernen“ wird zur Leitidee einer sogenannten „Arbeit 4.0“. Eine solche Idee verspricht natürlich Chancen für eine Aufwertung einer Vielzahl von Tätigkeiten. Der Fabrikarbeiter in der Automobilindustrie wird zum „Augmented Operator“, der über Daten-Brillen den Zustand von autonomen und vernetzten Maschinen inspiziert. Aber geht die Idee des „lebenslangen Lernens“ nicht an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen vorbei? Sind wir systemisch auf eine solche Übergangsphase vorbereitet? Können wir jedem Menschen gleichermaßen zumuten, sich in hoher Eigenverantwortung ständig weiterzubilden?
Es darf bezweifelt werden, dass wir gegenwärtig die Rahmenbedingungen geschaffen haben, um den Übergang in die neue, digitale Arbeitswelt zu meistern. Es wird nicht ausreichen, sich auf das Entstehen neuer Jobs und den Anpassungswillen der Erwerbsbevölkerung zu verlassen. Wird der Taxi-Fahrer, der durch autonome Fahrzeuge ersetzt wird, wirklich in eigenständiger Motivation zum Data Scientist? Auch wenn langfristig eine Vielzahl neuer Jobs entsteht, muss für Menschen, die gefährdeten Tätigkeiten nachgehen, eine kurz- bis mittelfristige Übergangsphase berücksichtigt werden. Ein solcher Übergang erfordert Zugang, Befähigung und Motivation zur Weiterbildung. Vielfach dürfte es angesichts ungleicher Bildungsvoraussetzungen bereits an Zugang und Befähigung scheitern. Menschen mit geringeren Bildungsabschlüssen werden es mit exponentiell steigender technologischer Komplexität immer schwieriger haben. Zudem wird es der jüngeren Generationen, die mit der Technologie aufgewachsen ist, leichter fallen, sich ständig an neue Gegebenheiten anzupassen. Folglich drohen immer stärkere Ungleichgewichte zwischen hoch- und geringer qualifiziert oder zwischen Jung und Alt. Gesellschaftliche Polarisierungen sind die Folge und lassen sich bereits heute in zunehmendem Maß weltweit feststellen. Die US-Wahlen im Jahr 2020 haben bereits ein erschreckendes Beispiel zunehmender gesellschaftlicher Spaltungen gegeben.
Eng damit verbunden sind steigende ökonomische Ungleichheiten mit Blick auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen. Die Digitalisierung und die Folgen der Corona-Pandemie haben diese Entwicklung beschleunigt. Die Energiekrise im Kontext der Ukraine-Kriegs sowie das aktuelle, inflationäre Umfeld werden die Diskrepanz weiter nach oben treiben. Bereits im Jahr 2017 besaßen die obersten 10 % der privaten Haushalte in Deutschland rund 56 % des gesamten Vermögens.2 Die ungleiche Verteilung von Vermögen wurde durch die expansive Geldpolitik von Zentralbanken wie der EZB weiter verschärft. Wer bereits über Vermögen und damit Eigenkapital verfügte, konnten sich in diesem Umfeld zu geringen Zinsen verschulden und Vermögen in Form von Eigentumswohnungen und Aktien anhäufen. Kleinsparer konnten hingegen auf ihr Erspartes keine Zinserträge generieren. Insbesondere die vielen deutschen Sparer partizipieren nicht an den steigenden Finanzmärkten, die infolge der Geldpolitik insbesondere nach Beginn der Pandemie stetig neue Allzeithochs erreichten. An den Nebenwirkungen dieser Politik – einer enteilenden Inflation – leiden wiederrum vor allem die untere und mittlere Einkommensschicht, die sich in Zeiten niedriger Zinsen kein inflationssicheres Portfolio verschiedener „Assets“ aufbauen konnten.
Es ist ersichtlich, wie verschiedene Trends in ihrer Interdependenz zu historischen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen führen werden. Die Digitalisierung und steigender globaler Wettbewerb verwerfen bestehende Strukturen in nie dagewesener Geschwindigkeit. Ungleichheit bei Bildung, Einkommen und Vermögen schaffen ungleiche Voraussetzungen, um sich auf diese Veränderungen einzustellen. Die Corona-Krise hat diese Entwicklungen weiter befeuert und einen inflationären Druck entfaltet. Der Krieg in der Ukraine und die nachgelagerte Energiekrise werden zur Zerreißprobe für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und den Wohlstand der gesamten Nation.
Diese Entwicklungen verleiten dazu, sich allein auf das „hier und jetzt“ zu fokussieren. Nicht zuletzt erfordert das schiere Ausmaß der Krisen ein drastisches und schnelles Handeln von Wirtschaft und Politik. Doch darf uns jene Dringlichkeit der gegenwärtigen Lage nicht davon absehen lassen, das große Ganze im Blick zu behalten. Ein neues Gesellschaftskonzept für das digitale Zeitalter muss diese Gemengelage und die technologischen Entwicklungen aufgreifen. Ausgangspunkt dieses Konzepts ist die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE).
Abbildung 1: Leitbild Grundeinkommen vor dem Hintergrund struktureller Veränderungen
Die Idee eines BGE sieht ein regelmäßiges Einkommen vor, das jedem Bürger unabhängig von seiner Betätigung bedingungslos gezahlt wird. Ein solches Grundeinkommen wird immer häufiger als Antwort auf die Folgen der digitalen Transformation aufgeführt. Es wird zunehmender Bestandteil von Diskussionen in Medien, Unternehmen, Wissenschaft und Politik. Prominente Vertreter im deutschsprachigen Raum sind beispielsweise der DM-Gründer Götz Werner oder der Philosoph Richard David Precht. Auch Vertreter aus der Wirtschaft wie Siemens CEO Joe Kaeser oder Tech-Unternehmer des Silicon Valley haben sich bereits für ein Grundeinkommen ausgesprochen. Im Zuge der Corona-Pandemie hat die Idee eines BGE weiteren Zuspruch gewonnen. Im März 2020 wurde die größte Online-Petition der Geschichte des Bundestags eingereicht. Erklärtes Ziel der Petition war die Einführung eines vorübergehenden Grundeinkommens, um die finanziellen Folgen der Pandemie abzufedern. Angesichts der sichtbar steigenden Bedeutung könnte der Zeitpunkt nicht passender sein, sich mit der Ausgestaltung eines Grundeinkommens auseinanderzusetzen.
Im Laufe der Zeit ist eine Vielzahl verschiedener Modelle für ein Grundeinkommen vorgestellt worden. Sie unterschieden sich im Wesentlichen mit Blick auf die Höhe des zu zahlenden Betrags, die Finanzierung und die Einbindung in bestehende Renten- und Sozialsysteme. Das in diesem Buch dargestellte Konzept soll sich nicht in die technische und finanzwirtschaftliche Diskussion von Modellen einreihen. In Abgrenzung zu den bisherigen Ansätzen wird nicht versucht, ein BGE in unser bestehendes Wirtschafts- und Sozialsystem hineinzupressen. Hingegen wird ein fundamental neuartiges Konzept entworfen, das unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen des digitalen Zeitalters entwickelt wird. Dies beinhaltet den Einbezug von neuen Technologien wie der künstlichen Intelligenz, Blockchain und Virtual Reality (VR). Zudem lösen wir uns von einem verengten Ansatz, der sich auf die Höhe eines Grundeinkommens bezieht. Sich auf einen fixen Betrag von € 1000 oder € 2000 pro Monat zu versteifen, wird der Dynamik der Digitalisierung und dem Wandel der Arbeitswelt mitnichten gerecht. Es kann nicht darum gehen, Menschen mit einem fixen Betrag abzufertigen, sie in eine staatliche Abhängigkeit zu treiben und in einer immer schnelleren und komplexeren Welt sich selbst zu überlassen. Das klingt nicht nach einem überzeugenden Zukunftskonzept. Gar hat es einen dystopischen Charakter: Wer nicht mithält, gerät in die staatliche Obhut eines BGE und lässt sich fortan in einem Sog von buntem Content der digitalen Welt bespaßen. Wer großes Vermögen hat, ist darauf nicht angewiesen und produziert hingegen den Content zur Bespaßung der passiv-lethargischen Masse, die den Anschluss verloren hat. Das kann und darf nicht unser Zielbild für ein digitales Zeitalter sein.
Dagegen ist es der Anspruch dieses Buches, einen Ansatz zu entwerfen, der zweierlei vereint: Zum einen gilt es, jedes Individuum in der Gesellschaft durch ein BGE gegen technologische, wirtschaftliche und sonstige Disruptionen und Schocks abzusichern. Zum anderen soll, die Möglichkeit und der Anreiz geschaffen werden, sich weiterzubilden, eigene Projekte und Engagements zu verfolgen und sich proaktiv im digitalen Zeitalter selbst zu verwirklichen. Jeder Mensch soll zum proaktiven und aufgeklärten Gestalter seines individuellen (Grund-)Einkommens werden. Das hier vorgestellte Konzept wird mithin keine rein technische Erweiterung eines bestehenden Ansatzes. Vielmehr bringt es im Kern ein neues Paradigma mit Blick auf das Verhältnis von Arbeit, Gesellschaft und Einkommen hervor. Das System wird zur dynamischen Plattform einer Vielzahl von gesellschaftlichen, beruflichen und sozialen Beziehungen und Interaktionen, die es vergütet und fördert. Es ist eine Symbiose zwischen dem Grundeinkommen und der Technologie. Als solche soll es sich nahtlos in das digitale Zeitalter einfügen und einen freiheitlichen Rahmen für alle Individuen in einer Gesellschaft darstellen.
Gleichzeitig wagt es, gedanklich einen Schritt zu gehen, den die Politik aus sich selbst heraus nicht gehen kann. Statt langfristig zu gestalten, wirkt sie in der gegenwärtigen Gemengelage wie eine Feuerwehr, die immer wieder ein brennendes Haus löscht, ohne die Konstruktion des Hauses zu überdenken. Zudem werden zu oft nur die Probleme adressiert, denen medial der höchste Geltungsdruck zuteilwird oder die durch die lauteste oder finanzstärkste Lobby hervorgebracht werden. Anstelle dieses Mikromanagements von Problemen braucht es wieder langfristige, visionäre Reformen, um die richtigen Weichen für das digitale Zeitalter zu stellen.
Hierfür soll dieses Buch einen Denkanstoß darstellen. Es soll dazu aufrufen, nicht nur die Bedrohungen immer schnelleren Wandels zu sehen. Zu häufig verharren wir auf zum Teil dystopischen Szenarien mit Blick auf das künftige Verhältnis von Mensch und Maschine. Dabei sollten wir stattdessen begreifen, dass wir es jetzt in der Hand haben, die Weichen neu zu stellen, um eine bessere Welt zu schaffen. Eine Welt, die Chancen und Aufstieg bietet. Eine Welt, die fordernd ist, aber zugleich ermutigt, sich weiterzuentwickeln und unternehmerisch tätig zu werden. Eine Welt, die ein starkes Gemeinwesen hervorbringt und zugleich die Freiheit des Individuums stärkt. All das wird nicht allein durch ein (wie auch immer gestaltetes) Grundeinkommen erreicht. Aber es kann in der richtigen Ausgestaltung das Fundament setzen, auf Grundlage dessen wir das gesellschaftliche Miteinander der Zukunft neu denken. Hierfür wird das Grundeinkommen weniger mit Blick auf die Frage der „Machbarkeit“ betrachtet. Vielmehr wird eine gestaltende und ganzheitliche Perspektive eingenommen.
Im folgenden Teil des Buches wird das Modell schrittweise aufgebaut werden. Zunächst wird im ersten Teil des Buchs ein Verständnis für die technischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der aktuellen und künftigen technologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung vermittelt. Konkret steht die Frage im Vordergrund, wieso wir ein Grundeinkommen benötigen und welche Probleme mit dem neuartigen Konzept bewältigt werden müssen. Zugleich werden verschiedene Bausteine („Building Blocks“) dargestellt, die für die Konzeption des Modells benötigt werden. Auf dieser Grundlage wird im zweiten Teil des Buches das Modell für ein neuartiges Grundeinkommen im digitalen Zeitalter aufgebaut.
2 Rahmenbedingungen eines Grundeinkommens
Accelerating Change – Der Weg in das digitale Zeitalter
Die technologische Entwicklung ist elementarer Treiber der künftigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Das digitale Zeitalter ist das Ergebnis eines beachtlichen technischen Fortschritts der vergangenen zwei Jahrhunderte. Um dieses Umfeld für ein Grundeinkommen zu verstehen, ist es notwendig, dessen Entwicklung sowie die damit verbundenen Auswirkungen nachzuvollziehen. Nur wenn wir begreifen, wie die Menschheit an ihren bestehenden, technologischen Status Quo gelangt ist und wo der Weg noch hin führt, bekommen wir ein Gefühl dafür, unter welchen Rahmenbedingungen und in welcher Ausgestaltung ein Grundeinkommen funktionieren kann.
Technischer Fortschritt entsteht, indem bestehendes mit neu erlangtem Wissen so kombiniert wird, sodass neuartige Fertigungsverfahren, Produkte oder Methoden entstehen.3 Die Menschheit nutzt ihr Wissen und ihre Fähigkeiten, um etwas Neues zu schaffen. Produkte können effizienter, schneller oder qualitativ hochwertiger produziert werden. Beispielsweise kann es technischer Fortschritt ermöglichen, bei der Produktion von Batteriezellen weniger Ressourcen wie Lithium oder Kobalt zu verbrauchen. Zudem können neuartige Produkte und Märkte entstehen wie z. B. soziale Netzwerke, Drohnen oder Flugtaxen. Technischer Fortschritt umfasst all diese (Weiter-)Entwicklungen und ist in seiner Gesamtheit Treiber von globalem Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Er bewirkt zugleich ökonomische und gesellschaftliche Veränderungen. Die Technologie wirkt dabei wie eine „schöpferische Zerstörung“4. Produkte, Prozesse und Unternehmen, die nicht mehr mithalten können, scheiden vom Markt aus. Zugleich entstehen neue Geschäftsfelder, Chancen und Arbeitsplätze. So wurde die Kutsche durch das Automobil ersetzt. Das Individual-Automobil wird es schwer haben, sich gegen Mobilitätsplattformen mit autonom fahrenden Fahrzeugen zu behaupten. Autonom fahrende Fahrzeuge werden möglicherweise durch Beförderungsdrohnen ersetzt oder ergänzt usw. Auch Produkte und Unternehmen, die heute als Innovationsführer dastehen, sind nicht davor geschützt. Beispielsweise stagniert der technische Fortschritt bei Smartphones. Wenn Apple’s CEO Tim Cook jedes Jahr erneut das „beste iPhone aller Zeiten“ vorstellt, gibt es selten große Überraschungen. Dagegen könnten Augmented Reality-Brillen und -Kontaktlinsen dazu führen, dass ein haptisches Smartphone in einem Jahrzehnt ebenso relevant sein wird wie die Kutsche als Fortbewegungsmittel der heutigen Zeit. Die „schöpferische Zerstörung“ ist dabei ein kontinuierlicher Prozess. Es gibt keine uns bekannte natürliche Limitation des verfügbaren Wissens, sodass der technische Fortschritt theoretisch unbegrenzt voranschreiten kann.
Im historischen Zeitverlauf des technologischen Fortschritts wird regelmäßig von vier industriellen Revolutionen gesprochen. Die erste industrielle Revolution begann im späten 18. Jahrhundert und prägte nahezu das gesamte 19. Jahrhundert. Es war der Beginn der ersten maschinellen Massenproduktion, die erstmals in Konkurrenz zur menschlichen Arbeitskraft trat. Der mechanische Webstuhl symbolisierte dieses Konkurrenzverhältnis. Klassische Webereien mit Handwebstühlen konnten nicht mehr mit kapitalintensiven, (teil-)automatisierten Produktionsstätten mithalten. Getrieben von Dampf- und Wasserkraft begann zugleich ein Übergang der Agrar- in die Industriegesellschaft. Neue infrastrukturelle Voraussetzungen durch Eisenbahnen sowie einheitliche Zollsysteme beschleunigten zugleich das Entstehen dynamischer Binnenmärkte in Deutschland und anderen Volkswirtschaften.
Die zweite industrielle Revolution baut ab den 1870er Jahren auf der entstandenen industriellen Basis der ersten industriellen Revolution auf. Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Chemie und der Physik wurden wirtschaftlich nutzbar gemacht. Die chemische Industrie wurde zur Schlüsselindustrie der deutschen Wirtschaft. Fossile Brennstoffe wurden zum wichtigen Rohstoff chemischer Produkte und schufen die Grundlage für den Verbrennungsmotor. Das Automobil, Busse, LKWs und die Luftfahrt boten flexible Mobilitätsmöglichkeiten für Waren und Personen. In den Mittelpunkt rückte zudem die Elektrizität als Antriebskraft für die Industrie. Zusammen mit dem Aufkommen der arbeitsteiligen Fließbandfertigung konnten weitreichende Produktivitätszuwächse erzielt werden.
Die damit verbundenen Möglichkeiten für eine Arbeitsteilung beförderten eine steigende Spezialisierung von Arbeitskräften. Dies steigerte die ökonomische Effizienz, schuf indes eine Vielzahl monotoner Tätigkeiten. Produkte wie Fleisch oder Automobile konnten in neuen Rekordzeiten produziert werden. Neben den Tätigkeiten der Produktion konnten ferner verwaltende Tätigkeiten durch technische Neuerungen effektiver durchgeführt werden. Kommunikation über Telegramme oder Telefonate ermöglichten einen schnellen Verkehr von Informationen und Nachrichten. Eine steigende Komplexität in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb konnte aufgefangen werden. Verbunden mit einem stetigen Ausbau von Infrastruktur in Form von Kommunikationsnetzwerken, Straßen, Brücken, Schienen und Kanälen wurde eine zunehmende Integration von Märkten befördert. Geographische Distanzen wurden zu einem geringeren Hindernis für Wertschöpfung und Welthandel. Darin kann bereits eine erste Stufe dessen gesehen werden, was später als Globalisierung bezeichnet werden würde. In dem Zusammenhang kann ferner die Rolle des weiterentwickelten Bank- und Finanzwesens angeführt werden. Für die industrielle Fertigung wurden große Kapitalvolumina benötigt, um in Anlagen, Maschinen und Infrastruktur zu investieren. Eine wachsende Bankenlandschaft versorgte die Wirtschaft mit den notwendigen Krediten, um größere Investitionen stemmen zu können.
Die dritte industrielle Revolution legte ab den 1970er Jahren die Grundlage für eine vollautomatisierte Produktion. Durch Einsatz von Elektronik und Informationstechnologie konnten Fertigungsstraßen vollautomatisiert werden. Im Zusammenspiel aus Computern und Sensorik wurde zugleich die Grundlage für den Einsatz von Robotik geschaffen. Industrieroboter ersetzten menschliche Tätigkeiten, die beispielsweise vormals am Fließband erbracht wurden. Roboter wurden in großem Stil zunächst in der Automobilindustrie eingesetzt. Später wurden weitere Einsatzbereiche in anderen Branchen wie der Lebensmittelindustrie erschlossen. Über alle Branchen wurde der Computer zur elementaren Unterstützung für Maschine und Mensch. Neben industriellen Anwendungen verhalfen neu gegründete Technologieunternehmen wie Microsoft (1975) oder Apple (1976) dem Personal Computer für den privaten Gebrauch zum Durchbruch.
Auf die bisher skizzierten drei industriellen Revolutionen folgt die gegenwärtige vierte industrielle Revolution bzw. Industrie 4.0. In Abgrenzung zu den vorangegangenen drei Stufen ist die Industrie 4.0 schwieriger zu durchdringen. Der technische Fortschritt der ersten drei Revolutionen kann von der Dampfmaschine über die elektrifizierte Massenfertigung und die erste Form computergestützter Automatisierung stringent nachvollzogen werden. Die Industrie 4.0 verläuft hingegen vielschichtiger und in einer nie dagewesenen, Dynamik. Im Mittelpunkt steht die digitale und intelligente Vernetzung von Menschen, Maschinen, Prozessen und Systemen.5 Die Grundlage für diese Vernetzung schafft das Internet, das eine globale Infrastruktur für den Austausch von Daten, Informationen und Wissen bietet. Das Internet fungiert als Plattform, die es jedem Netzwerkteilnehmer ermöglicht, auf globales Wissen zuzugreifen und mit neuem Wissen zu bereichern. Menschen, Maschinen und Objekte können diese Möglichkeit nutzen, um eine exponentiell steigende Menge an Daten, Informationen und Wissen6 zu verarbeiten und stetig zu lernen. Wissen diffundiert weltweit und kann mit steigender Geschwindigkeit fortlaufend neu rekombiniert werden – die Grundlage für weiteren technischen Fortschritt. Eine sich selbst beschleunigende Spirale beginnt.
Neben dieser Wissensexplosion spielt die technische Weiterentwicklung von Computerchips eine elementare Rolle. Speicher- und Rechenchips können eine stetig steigende Menge an Daten speichern und immer schneller verarbeiten. Ein Smartphone ist heute millionenfach leistungsfähiger als jeder Supercomputer aus den 60er-Jahren.7 Umgekehrt hätte es vor 60 Jahren wohl nicht genug Rohstoffe auf der Erde gegeben um bei gegebenen Wissensstand einen annähernd leistungsfähigen Rechner zu bauen. Durch das Zusammenwirken der steigenden Rechen- und Speicherkapazität mit der Reichweite und Wissensdiffusion des Internets liegt der vierten industriellen Revolution eine nie dagewesene Dynamik zugrunde. Tech-Pioniere wie Ray Kurzweil reden in dem Zusammenhang von einem sich selbst beschleunigenden Wandel, einem sog. „Accelerating Change“. Die Digitalisierung im Zuge der Industrie 4.0 kann durch ein Zusammenwirken dieser Beschleunigungsvorgänge charakterisiert werden. Die Folge dieser Entwicklung sind stetige Disruptionen, die sowohl die Wirtschaft als auch das gesellschaftliche Miteinander tiefgreifenden Veränderungen unterziehen.
In der wirtschaftlichen Produktion von Gütern zentriert sich die Industrie 4.0 um die Idee einer smarten Fabrik. Gegenstände, Produkte und Maschinen werden vernetzt und können miteinander kommunizieren und interagieren. Das Internet of Things (IoT) beschreibt in dem Kontext die Idee, physische und virtuelle „Dinge“ zu vernetzen. Dies schafft zahlreiche Möglichkeiten zur Automatisierung und Optimierung von Fertigungsprozessen. Durch die Vernetzung aller an der Wertschöpfung beteiligten Maschinen können Millionen von Daten generiert und nutzbar gemacht werden. Mithilfe der verbesserten Speicher- und Rechenkapazitäten können diese Daten sofort verarbeitet werden. Auf Grundlage eines gewaltigen Inputs an Daten trifft die smarte Fabrik in Echtzeit Entscheidungen über die optimalen Produktionsabläufe. Es schafft zugleich die Möglichkeit, schnell auf Veränderungen des Marktumfelds reagieren zu können. Der sich beschleunigende technische Fortschritt zwingt alle Marktteilnehmer, sich schneller an neue Gegebenheiten anzupassen.
Die Anpassungsfähigkeit der smarten Fabrik beschränkt sich dabei nicht auf einzelne Stufen der Produktion. Stattdessen wird die gesamte Wertschöpfungskette zum cyber-physischen System, das mittels Sensoren, Kameras, und elektromagnetischen Wellen (RFID-Technologie) beginnt, sich selbst und seine Umwelt wahrzunehmen. Millionen von Zuständen fließen damit in ein System, das sich über Datenanalyse und künstliche Intelligenz fortlaufend selbst optimiert. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen den einzelnen Stufen der Wertschöpfung von Herstellern und Zulieferern. Eine Vielzahl von Vorgängen kann damit theoretisch ohne menschliche Eingriffe passieren. Anstelle der menschlichen Koordination der Abläufe tritt die Kommunikation zwischen den Maschinen (Machine-to-Machine Communication, M2M). Daneben kommt der Interaktion zwischen Menschen und Maschine (Human-to-Machine Communication, H2M) eine immer stärkere Bedeutung zu. Beispielsweise kann die smarte Fabrik den Zustand ihrer Abnutzung an menschliches Wartungspersonal weiterleiten, das die notwendigen Reparaturen vornimmt. Oder sie liefert Daten, die für strategische und kreative Entscheidungen relevant sind, wie z. B. die Produktentwicklung, Vertriebsstrategien oder die Lieferantenauswahl. Daten werden in Summe über die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktentwicklung bis zum Vertrieb zum elementaren Faktor für die Entscheidungsfindung von Menschen und Maschine. Verstärkt wird diese Entwicklung dadurch, dass mit steigender Vernetzung die Menge an generierten Daten exponentiell ansteigt. Jeder Maschinenzustand, jeder Prozessschritt und jedes (Vor-)Produkt können theoretisch weltweit erfasst und in einen stetigen Koordinations- und Lernprozess einbezogen werden. Vernetzte Geräte in einem Konzern lernen potenziell weltweit im Kollektiv. Über das Internet greift eine Maschine in Deutschland auf den Erkenntnisgewinn ihres Pendants in Japan zu. Dies beschleunigt gleichermaßen die Entwicklung von neuen Technologien und Produkten.
Es wird deutlich, dass der natürliche Lernprozess von Versuch und Irrtum auf diese Weise in einem nie dagewesenen Ausmaß beschleunigt wird. Erkenntnisgewinne müssen nicht analog protokolliert, niedergeschrieben und verbreitet werden. Im Internet of Things beginnen die „Dinge“, ihre Umgebung selbstständig wahrzunehmen und zu analysieren. Darauf basiert treffen sie Entscheidungen. Diese Verselbstständigung von Maschinen wird durch eine Schlüsseltechnologie befördert: Künstliche Intelligenz (KI).
Künstliche Intelligenz soll einen Computer in die Lage versetzen, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Dabei wird die Entscheidungsfindung des menschlichen Gehirns nachgebildet. Wer beispielsweise eine Dating App nutzt und nach links „swiped“, ist sofort Teil eines sich selbst optimierenden KI-Algorithmus. Jede Auswahlentscheidung in der Dating-App kann auf eine Vielzahl von bewussten und unbewussten Entscheidungsparametern heruntergebrochen werden. Die KI lernt zu identifizieren, welche Faktoren zu einer bestimmten Entscheidung geführt haben. Die KI versucht auf diese Weise Vorhersagen und Entscheidungen zu treffen. Auf Grundlage von Daten aus einer Vielzahl von Interaktionen auf der Dating-Plattform identifiziert der Algorithmus gewichtete Zusammenhänge. Mit ständig neuen „Usern“ und „Matches“ auf der Plattform gehen immer mehr Daten in diesen Lernvorgang ein. Sie bringen neue Zusammenhänge zutage oder führen zu neuen Gewichtungen bereits identifizierter Beziehungen. Damit trainieren sie kontinuierlich ein komplexes, datengestütztes System funktionaler Zusammenhänge.
Abseits des hier gewählten Beispiels einer Dating-App gibt es faktisch keine Branche und kein Gebiet, in dem KI nicht zum Einsatz kommen könnte. KI-Pionier Kai-Fu Lee spricht in dem Zusammenhang von einem „Zeitalter der Implementierung“8. Demnach ist die Funktionsweise der KI als solche nicht als Innovation zu betrachten. Nicht zuletzt sind die theoretischen Grundzüge hierfür bereits in den 50er Jahren gelegt worden. Stattdessen kann KI mit den heutigen technologischen Kapazitäten und der Vielzahl von Daten überhaupt erst zur Geltung kommen. KI erhält Einzug in alle Bereiche des wirtschaftlichen und privaten Lebens. Eine Omnipräsenz von Algorithmen prägt künftig das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenleben; sei es in der Produktion, beim Shoppen, bei der Unterhaltung oder bei der Partnersuche. Zudem wird bereits heute ein Großteil aller Finanztransaktionen an den Börsen über Algorithmen abgewickelt.9
Gegenwärtig beschränkt sich der Einsatz von KI auf weitestgehend abgrenzbare Bereiche. KI ist damit noch weit vom Ziel vieler Entwickler entfernt, eine allgemeine KI zu erschaffen, die ein übergreifendes Verständnis besitzt und sich fortlaufend selbst optimiert. Der Zeitpunkt, an dem eine solche KI den Menschen übertreffen soll, wird auch als „technologische Singularität“ bezeichnet. Laut Ray Kurzweil ist dies zugleich die logische Konsequenz des „Accelerating Change“ und verortet den Zeitpunkt hierfür bereits im Jahr 2029.10 Andere Schätzungen reichen indes bis in das Jahr 2200. Kritiker bezweifeln dagegen, dass eine solche allgemeingültige KI überhaupt realistisch ist. Abseits dieser technischen Diskussion ist viel entscheidender, dass eine durch KI getriebene Algorithmisierung von Wirtschaft und Gesellschaft in einem sich selbst beschleunigenden Prozess stattfindet. Je stärker die Vernetzung und Adoption dieser Technologie voranschreitet, desto schneller sind ihre Lernprozesse.
Mit entsprechend steigendem Verständnis von Zusammenhängen und der notwendigen digitalen Infrastruktur qualifiziert sich KI für immer komplexere Aufgaben. Sie dringt damit zunehmend in Bereiche, die vormals geistigen menschlichen Tätigkeiten vorbehalten waren. Die aktuelle und vierte Revolution hat damit das Potenzial ein neuartiges Verhältnis zwischen Menschen und Maschine zu entfalten. Vernetzte und lernfähige Maschinen treten einerseits in ein Konkurrenzverhältnis zu einer Vielzahl menschlicher Berufe. Andererseits entstehen neue Interaktionen bis hin zu Symbiosen zwischen Menschen und Technologie. Es ergibt sich somit ein Spannungsverhältnis inmitten von Konkurrenz und Symbiose.
Ein Gesellschaftskonzept für das digitale Zeitalter bewegt sich in diesem Umfeld. Eine zunehmend vernetzte, sich selbst beschleunigende Welt, in der reale und virtuelle Welt verschmelzen und bestehende Strukturen verwerfen. Die Corona-Pandemie hat diesen Wandel weiter beschleunigt bzw. gar forciert. Wenn Menschen aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nicht direkt interagieren konnten, musste zwangsläufig ein virtuelles Umfeld geschaffen werden, um privat oder beruflich zusammenzufinden.
Abbildung 2: Vier industrielle Revolutionen
Digitale Interaktion und Zusammenarbeit werden ein wichtiger Baustein für das neuartige Grundeinkommen werden. Gleichzeitig macht dieses Kapitel deutlich an welchem Punkt einer sich selbst beschleunigenden technologischen Dynamik wir stehen. Das Modell muss in seiner Komplexität und Ausgestaltung so beschaffen sein, dass es im schnelllebigen, disruptiven Umfeld des Accelerating Change funktioniert. Um dies sicherzustellen, müssen wir verstehen wie sich die Technologie in dieser Dynamik auf Wirtschaft und Gesellschaft auswirkt.
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen des digitalen Wandels
Übergreifende Treiber
Technologischer Fortschritt ist seit jeher Treiber ökonomischer und gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Manche Menschen schaffen es, den Wandel als Chance zu begreifen, sich anzupassen oder gar aktiv mitanzustoßen. Anderen gelingt dies nicht oder sie haben aufgrund ungleicher Voraussetzungen gar nicht die Möglichkeit, daran zu partizipieren. Mithin schafft technologischer Fortschritt regelmäßig Gewinner und Verlierer. Zugleich werden bestehende Strukturen derart verändert oder verworfen, dass es nicht selten Wertvorstellungen und Leitideen ändern. Mitunter kommt es zu Paradigmenwechseln. Gesellschaftlichen Reformen und Veränderungsprozesse sind die Konsequenz. Die erste industrielle Revolution bietet hierfür eine Analogie.
Mit dem Übergang der Agrar- in die Industriegesellschaft im Zuge der ersten industriellen Revolution entstand mit der Arbeiterschaft eine neue gesellschaftliche Klasse. Bauern und Handwerker zogen vom Land in die Städte und konkurrierten um schlechtbezahlte Arbeitsplätze in der entstehenden Industrie. Schlechte Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und Verelendung charakterisierten die frühe Phase der Industrialisierung. Gewerkschaften entstanden und verbesserten die Verhandlungsbasis der Arbeiterschaft. In Reaktion auf eine erstarkende Sozialdemokratie wurden im Kaiserreich unter Bismarck die ersten Sozialversicherungen eingeführt. Zudem wuchs unter den Unternehmern das Bewusstsein für eine bessere Bezahlungen von Arbeitskräften, was nicht zuletzt auch ökonomisches Wachstum befeuert. Besser bezahlte Arbeiter konsumierten mehr und schaffen damit Absatzmärkte für ein breiteres Spektrum an industriell erzeugten Konsumgütern. Im Wechselspiel zwischen Ökonomie und sozialem Ausgleich stieg somit das Wohlstandsniveau der gesamten Gesellschaft.





























