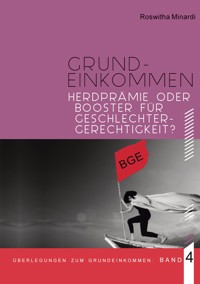
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Überlegungen zum Grundeinkommen
- Sprache: Deutsch
Was bedeutet ein bedingungsloses Grundeinkommen für Frauen? Ist es tatsächlich eine "Herdprämie", die Frauen wieder zurück ins Haus an den Herd drängt oder wird es für sie im Beruf wie im Privaten neue Verhandlungs- und Existenzvoraussetzungen schaffen? In einem der reichsten Länder der Welt ist Altersarmut von Frauen immer noch ein Thema, ebenso wie Kinderarmut. Wie wird das BGE hier wirksam werden? Werden beide Phänomene abgeschafft? Diese und andere Themenbereiche weiblicher Lebensrealitiäten werden im Band 4 der Reihe "Überlegungen zum Grundeinkommen" behandelt und sollen zu weiterer Diskussion anregen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 60
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Nadine, Romeo und Matteo
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Grundeinkommen – Um was geht’s da genau?
Definition des bedingungslosen Grundeinkommens
Der Arbeitsbegriff
Frage 1 – Ist das BGE eine versteckte „Herdprämie“?
Feministische Kritik am BGE
Die Rolle der Care-Arbeit für die Ökonomie
Ein Rechenbeispiel
Herdprämie ja oder nein?
Ein alter Menschheitstraum
Frage 2 – Höhere Scheidungsrate durch BGE?
Frage 3 – Hat das BGE Einfluss auf den Gender-Pay-Gap?
Arbeit als sinnstiftende Tätigkeit
Frage 4 – Weibliche Altersarmut: abgeschafft durch BGE?
Frage 5 – Sollen sich Frauen für das BGE einsetzen?
Anhang
Literaturliste
Literaturhinweis
Vorwort
von Margit Appel
Wer macht denn noch die schlecht bezahlte Arbeit, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) gibt? Ohne diese Frage kommt kaum eine Diskussion zum BGE aus. Über die Jahre meines Engagements für das Grundeinkommen ist mir immer stärker aufgefallen, dass eine andere Frage nie kommt: Wer macht dann noch die unbezahlte Arbeit rund ums Kinderhaben, Haushalt, Kranken- und Altenpflege – die sogenannte Sorge- oder Care-Arbeit? Menschen sorgen sich, dass Jobs in der Reinigung, im Handel, im Bereich der persönlichen Dienstleistungen, im Pflege- und Gesundheitswesen, in der Gastronomie aufgrund der schlechten Bilanz zwischen Einkommen und Arbeitsbedingungen nicht mehr nachgefragt werden, wenn es ein Grundeinkommen gibt. Sie haben aber keine Sorge, dass die unbezahlte Sorge-Arbeit nicht mehr gemacht wird, wenn es ein Grundeinkommen gibt!
Wir Durchschnitts- und Besserverdiener:innen sind ganz zufrieden damit, dass andere zu jeder Bedingung erwerbsarbeiten müssen und aus Angst vor Jobverlust und Arbeitslosigkeit nicht wählerisch sein dürfen. So müssen wir nicht auf individuelle Bequemlichkeiten verzichten, weil immer irgendwer den Essensboten-Job oder die Stelle als mobile Heimpflegerin dringend braucht. Politische Lösungen für den Bereich der Pflege etwa oder der Plattformarbeit können ohne große Konsequenzen für die politisch Verantwortlichen auf die lange Bank geschoben werden. Die Systemerhalter:innen, zu einem großen Teil Frauen und uns erst in der Corona-Pandemie so wirklich aufgefallen, halten unser Wirtschaftssystem ohnehin am Laufen. Man kann diese Zusammenhänge pragmatisch sehen, man kann aber auch sehr unzufrieden damit sein, dass wir vom Zwang zur Erwerbsarbeit so deutlich profitieren. Die Frage, wer wird noch die schlecht bezahlten Dinge machen, wenn es ein Grundeinkommen gibt, ist jedenfalls eine sehr verräterische Frage.
Dass nicht danach gefragt wird, wer die unbezahlte Arbeit macht, ist alarmierend. Alarmierend, weil davon ausgegangen wird, Frauen ändern auch mit einem BGE nichts an ihrer Hauptzuständigkeit für die unbezahlte und stets übersehene Sorge-Arbeit. Alarmierend für die Grundeinkommensdiskussion, weil damit deutlich wird, welche Bedeutung die Wirkung eines BGE für mehr Freiheit und mehr soziale Sicherheit von Frauen hat, und weil diese Bedeutung in der Grundeinkommens-Debatte selbst noch zu wenig angekommen ist.
Roswitha Minardi hat die Bedeutung erkannt, die es hat, in der Konzeption des BGE, in Finanzierungsfragen, in der theoretischen Fundierung, in der konstruktiven Verknüpfung mit bisherigen frauenpolitischen Positionen, wie sie schreibt „die Frauen-Brille“ aufzusetzen, die Brille der Geschlechtergerechtigkeit. Mit ihrem Buch „Bedingungsloses Grundeinkommen. Herdprämie oder Booster für Geschlechtergerechtigkeit?“ stellt sie sich – das zu bearbeitende Spannungsfeld schon im Titel pointiert gefasst – der zu leistenden Aufgabe. Damit liegt ein Beitrag auf dem Tisch, der – klar für das Bedingungslose Grundeinkommen werbend – zentrale Aspekte der bisherigen frauenpolitischen Debatte um das BGE aufgreift, darüber hinausgeht und zur Auseinandersetzung mit den ausgeführten Argumenten und Sichtweisen einlädt.
Niemandem ist mit einer naiven Sicht auf das BGE geholfen, schon gar nicht Frauen. Wunder hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit sind keine zu erwarten. Aber Frauen und hoffentlich auch viele Männer haben die Lektion aus der bisherigen Geschichte der Frauenbewegungen und der Bemühungen um Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit gelernt: ohne Kampf und enormes Durchhaltevermögen bewegt sich nichts in Richtung einer „postpatriarchalen“ Gesellschaft, wie Minardi sie beschreibt. Die Bemühungen um ein BGE ersetzen in keiner Weise die vielen frauen- und gleichstellungspolitischen Bemühungen, die am Weg sind. Ein BGE ersetzt auch in keiner Weise einen gut ausgebauten Sozialstaat in Form einer qualitativ hochwertigen, für alle zugänglichen Infrastruktur für Wohnen, Energie, Mobilität, Gesundheit, Kinderbetreuung, Bildung. Was das BGE aber gerade auch aus feministischer Sicht zu all diesen Bemühungen beisteuert, ist die soziale Innovation eines bedingungslosen Einkommens, in existenzsichernder Höhe, als allgemeines individuelles Recht verankert. Eine solche Form von Einkommenssicherheit und sozialer Sicherheit hat es historisch noch nicht gegeben. Es könnte das bislang fehlende Element sozialer Sicherheit sein, das es mehr Frauen als bisher und vielen Frauen in größerem Ausmaß möglich macht, eine Änderung der sie diskriminierenden Arbeitsteilung – im Bereich der bezahlten und der unbezahlten Arbeit – durchzusetzen, individuell und für eine geschlechtergerechte Gesellschaft. Es könnte aber auch – und vielleicht ist das sogar der wesentlichere Aspekt eines Grundeinkommens – ein entscheidender Anstoß für die gerade in den Frauenbewegungen intensiv geführte Debatte über Freiheit sein. Feminismus ist nicht reduzierbar auf soziale Fragen, wenngleich diese eine große Rolle spielen. Noch wichtiger ist die politische Vision der Freiheit der Frauen, im (individuellen und gemeinschaftlichen) Handeln, die Welt umzugestalten. Wie schon Simone de Beauvoir gefordert hat, geht es darum, neue Optionen zu schaffen, statt sich lediglich zwischen bestehenden Alternativen zu entscheiden.1
Dem vorliegenden Buch wünsche ich viele Leser:innen. Die damit ausgelösten Gespräche und Debatten – durchaus auch um Details der Ausgestaltung des Grundeinkommens, da ja verschiedene Modelle vorliegen – mögen zahlreich sein!
Margit Appel
Mag.a Margit Appel ist Politikwissenschafterin und Erwachsenenbildnerin. Sie ist als freie Referentin und Autorin tätig. Engagiert ist sie im Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt – BIEN Austria und in der Österreichischen Armutskonferenz.
1 Zerilli, Linda M.G.: Feminismus und der Abgrund der Freiheit; 2010, S. 250
Einleitung
Das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) wird seit vielen Jahren immer wieder diskutiert, das Interesse daran flammte über die Jahrzehnte fast regelmäßig auf, um dann auch wieder abzuebben. In den letzten dreißig Jahren erlebte die Bewegung der Befürworter:innen ein dynamisches Wachstum, das nicht zuletzt durch die Pandemie befeuert wurde und vor diesem Hintergrund an eine breitere Öffentlichkeit gelangte. Die Persönlichkeiten und Denker:innen, die sich damit in der Vergangenheit auseinandersetzten und auch heute dazu publizieren, kommen weitgehend aus den Bereichen Soziologie, Wirtschaftswissenschaft und Philosophie. Beiträge von sozialpolitisch engagierten Menschen bereichern die Diskussion. Die meisten Thesen und Betrachtungen beziehen sich auf die Auswirkungen, die das BGE auf die Gesellschaft, das Individuum und die Wirtschaft haben wird. Ein großes Kernthema ist natürlich die Finanzierung; die Debatten dazu werden meistens sehr polarisierend geführt.
Dank der Experimente2 in diversen Ländern mit verschiedenen Ansätzen zum Grundeinkommen ist es mittlerweile unbestritten, dass diese Existenzsicherung auf die Bezieher:innen selbst sehr positive Auswirkungen hat. Die Menschen leben mit BGE gesünder, haben weniger Stress und bekommen wieder mehr Selbstvertrauen. Diese Resultate sind überall die gleichen und empirisch untersucht, egal ob die Experimente in Kalifornien3, Finnland4 oder Kenia5 stattgefunden haben.
Zu den Auswirkungen auf die Wirtschaft und das Geldsystem gibt es bislang keine empirischen Studien. Die dazu entwickelten Thesen und Antithesen kommen zu unterschiedlichen Resultaten, je nach Wirtschaftstheorie und dahinterstehendem Menschenbild. Bisher wurde weltweit noch nirgends ein Experiment in ausreichendem Umfang, über einen ausreichend langen Zeitraum und in einem aussagekräftigen, alle Lebensbereiche einer Gesellschaft und vor allem alle ihre Mitglieder einbeziehenden Ausmaß durchgeführt. Ein Experiment in dieser Größenordnung würde allerdings schon der Einführung eines BGE entsprechen.





























