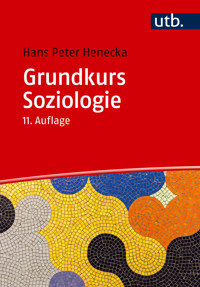
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinem bewährten „Grundkurs Soziologie“ vermittelt Hans Peter Henecka klar und verständlich Gegenstand, Grundbegriffe, basale Theorien und Methoden der Soziologie. Seine praxisnahe Einführung stellt die Grundthemen soziologischen Denkens vor. Dabei geht der Autor auch auf die Vorväter und Begründer der Soziologie ein, darunter Auguste Comte, Herbert Spencer und Max Weber. Er beschreibt die Sicht der Soziologie auf den Menschen und dessen Rollen in der Gesellschaft. Ebenso erklärt er die zahlreichen Gruppierungen innerhalb einer Gesellschaft sowie den Wandel der Gesellschaft. Im abschließenden Kapitel dieser 11., überarbeiteten Auflage stellt der Autor verschiedene empirische Methoden der Soziologie vor, wie die Beobachtung, die Befragung und die Inhaltsanalyse. Mit vertiefenden Literaturhinweisen der ideale Einstieg in das Fach!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hans Peter Henecka
Grundkurs Soziologie
UVK Verlag
Umschlagabbildung: © Juan Podrigues Pazos – iStock
Autorenphoto: © Mirjam Henecka
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838564616
© UVK Verlag 2025— Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 1323
ISBN 978-3-8252-6461-1 (Print)
ISBN 978-3-8463-6461-1 (ePub)
Inhalt
Vorwort zur 11. Auflage
Dieses Buch soll als »Grundkurs« eine elementare Einführung in den Gegenstand, die Grundbegriffe und die Methode der Soziologie vermitteln. Es richtet sich deshalb vor allem an Studienanfängerinnen und Studienanfänger, die sich – im Haupt- oder Nebenfach – auf das Wagnis der Soziologie eingelassen haben: die Beobachtung, Beschreibung und Analyse menschlichen Zusammenlebens.
Darüber hinaus zählen zu den Adressaten dieser Einführung Studierende aller Lehrämter, für die im Rahmen ihrer erziehungswissenschaftlichen Ausbildung soziologische Inhalte in den Studienplänen und Prüfungsordnungen zum verbindlichen Kanon gehören sowie auch Studierende an Fachschulen und Fachhochschulen für Sozialwesen. »Last but not least« ist dieses Buch aber auch geschrieben worden für all jene interessierten »Laien«, die sich – aus welchen Gründen auch immer – einen handlichen und allgemein verständlichen Zugang zur soziologischen Perspektive erhoffen.
Didaktisch orientiert an der Konzeption von Peter L. Berger, demzufolge die wissenschaftliche Erstbegegnung mit der Soziologie durchaus als »Einladung« realisiert werden kann, soll dieser Grundkurs sowohl von der sprachlichen wie von der inhaltlichen Seite für soziologische Fragestellungen und Sichtweisen motivieren.
Durch die Annahme dieser »Einladung« sollen die Leserinnen und Leser neue Einsichten gewinnen in das mitmenschliche Zusammenleben, in die sozialen Prozesse des Handelns, Denkens und Fühlens sowie in gesellschaftlich-politische Zusammenhänge, die der Alltagserfahrung gemeinhin versperrt bleiben. Da uns das tägliche Leben in der Gesellschaft betriebsblind machen kann, sind besondere Anstrengungen notwendig, die soziale Welt in ihrer Entwicklung und Struktur, ihrer Dynamik und Beharrlichkeit, ihren Wirkungen und Anforderungen neu zu entdecken. Hierzu gehören beispielsweise Fragen, was Menschen veranlasst, sich zusammenzutun, welche Formen des sozialen Lebens dabei entstehen, was sich in diesen abspielt und wie wir als Einzelne dadurch in unserem Verhalten beeinflusst werden.
Mit dieser Einführung sollen zunächst die notwendigen Grundlagen geschaffen werden für eine soziologische Perspektive, mittels derer gesellschaftliche Erscheinungen und Vorgänge genauer betrachtet und besser »verstanden« werden können (= Beitrag zur diagnostischen Qualifikation). Ferner soll der Grundkurs in exemplarischer Absicht eine praxisorientierte Hinführung zu den sozialwissenschaftlichen Erkenntnis- und Untersuchungsmethoden leisten (= Beitrag zur methodischen Qualifikation). Und schließlich sollen über eine bloße Vermittlung semantischer Bedeutungen hinaus pragmatische Benutzungsregeln vermittelt werden, die es den Leserinnen und Lesern erlauben, gesellschaftliche Phänomene und Prozesse in ihren vielfältigen Zusammenhängen und Ursachen besser beobachten, erklären und beurteilen zu können (= Beitrag zur professionellen Qualifikation).
Einladungen sind häufig mit neuen Bekanntschaften verbunden, die wiederum neue Einladungen auslösen. Diese Funktion erfüllen die am Ende jedes Abschnittes angebotenen Hinweise zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre. Die Annahme dieser Einladungen sei den Studierenden herzlich empfohlen, da dem Autor die Unvollständigkeit und die Subjektivität seiner thematischen Auswahl bewusst ist: Das Ausmaß an Systematik und fachwissenschaftlicher Information erfuhr sein Korrektiv durch die gewählte didaktische Orientierung.
Entstanden ist das vorliegende Buch aus einem Fernstudienprojekt des vormaligen Deutschen Instituts für Fernstudien (DIFF) an der Universität Tübingen. Den Kollegen aus dem wissenschaftlichen Beirat sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Projektgruppe »Politische Bildung« bin ich für ihre anregende und ermutigende Kritik zu diesem Projekt sehr verbunden.
Wenn der »Grundkurs Soziologie« nach seiner Erstauflage 1985 jetzt zu seinem 40-jährigen Jubläum in 11., überarbeiteter Auflage erscheinen kann, dann freut mich das sehr. Dies ist nicht zuletzt auch dem verlässlichen utb-Engagement der UVK Verlagsgesellschaft (ehem. Konstanz, jetzt München) zu verdanken.
Frau Nadja Hilbig, der Lektorin von UVK, danke ich sehr herzlich für ihr umsichtiges Lektorat und ihre hilfreichen Anregungen zu dieser neuen Auflage.
Im Januar 2025
Hans Peter Henecka
1Ansatzpunkte und Grundthemen soziologischen Denkens
1.1Wir und die anderen: Das Rätsel der Gesellschaft
Mit Adam und Eva kann man auch in der SoziologieSoziologie anfangen. Denn als sich die beiden im Paradies zum ersten Mal begegneten, waren sie vermutlich außer sich vor Staunen über dieses Rendezvous. Und in ähnlicher Weise mag es einem neugeborenen Kind ergehen, das zum allerersten Mal seiner Mutter oder seines Vaters gewahr wird und in seinem Lächeln die »Taufrische dieses ersten gesellschaftlichen Erlebnisses« (Berger & BergerBerger, P.L.Berger, B. 1974, 12) spiegelt. Kurz: Die Verwunderung über die Tatsache, dass Menschen uns begegnen und miteinander leben, ist schon ein erster Schritt auf dem Weg zur Soziologie.
Längst bevor wir darüber nachdenken und grübelnd forschen, stellt die einfache ErfahrungErfahrung(s), dass wir nicht allein auf dieser Welt existieren, sondern in irgendeiner Weise immer mit anderen Menschen und Gruppen verbunden sind, den Zusammenhang her zu allem, was uns umgibt: zur Natur und zur Technik, zur Kunst und zur Wissenschaft, zur PolitikPolitik und zur Wirtschaft, zum RechtRecht, zur Religion, zur Musik usw. Denn auch die Erfahrungen mit all diesen Bereichen werden uns von anderen vermittelt, aufbereitet und interpretiert. So sind die »anderen«, auf die wir dann zeitlebens angewiesen sind und mit denen wir – wenn auch manchmal unter Mühen und Enttäuschungen – zusammenleben und -arbeiten, für uns eine grundlegende und lebenslange ErfahrungErfahrung(s), – die wichtigste und entscheidendste Lebenserfahrung obendrein. Oder anders ausgedrückt: Wir befinden uns immer schon in einer von Menschen gestalteten und gedeuteten KulturKultur. Ohne sie ist menschliche Existenz nicht möglich.
Manchmal sinnieren wir über uns selbst und die anderen. Ausgelöst werden solche »besinnlichen« Anlässe meist durch unerwartete Situationen oder krisenhafte Erfahrungen, durch persönliches Betroffensein und durch ein unerklärliches Unbehagen: Wir wundern oder ärgern uns gar über Mitmenschen, die sich plötzlich ganz anders verhalten als wir erhofft oder befürchtet haben. Wir durchschauen unsere eigene Lage nicht mehr und beginnen an uns selbst und unseren Fähigkeiten zu zweifeln. Wir kommen aus dem routinierten Gleichgewicht des Alltags, weil sich Entwicklungen abzeichnen, mit denen wir nicht rechneten. Solche Alltagserfahrungen im privaten Bereich wären etwa eine unvorhergesehene Konflikt- oder schwierige Entscheidungssituation, der Verlust eines geliebten Partners, eine nachhaltige Veränderung unserer vertrauten Umwelt. Im öffentlichen Bereich könnten solche »Anstöße« beispielsweise ausgelöst werden durch eine wachsende Arbeitslosigkeit, durch Inflationen und Energiekrisen, durch politische Spannungen oder das Aufkommen von neuen Technologien, die unser bisheriges berufliches Wissen in Frage stellen und uns zum Umdenken und Umlernen zwingen. Plötzlich verstehen wir die Welt nicht mehr und fühlen uns abhängig oder gar bedroht von anonymen, gesichtslosen Mächten und Kräften oder undurchschaubaren globalen Entwicklungen, deren Ursprünge, Absichten und Wirkungen wir nicht mehr erkennen und auch nicht mehr kalkulieren, geschweige denn kontrollieren können.
Daneben stehen dann unsere ganz gewöhnlichen RoutineerfahrungenRoutine mit anderen und uns selbst, bei denen der BrauchBrauch als vertraute Gewissheit die Regie führt. Es sind die Erfahrungen des üblichen Alltags, die wir im Großen und Ganzen gemacht haben und die uns immer wieder in gleicher oder sehr ähnlicher Weise begegnen. Alltägliche Erfahrungen und Erlebnisse, Vorgänge ohne Überraschungen und voller Selbstverständlichkeiten, die uns auch darum kaum noch bewusst werden, erregen oder gar zu einer Auseinandersetzung provozieren. Denn wir kennen ja das Leben und wissen, »wo es lang geht« und »was angesagt ist«.
So haben wir feste Vorstellungen darüber, wie die anderen beschaffen sind; meinen, die anderen deshalb auch »richtig« einschätzen zu können und verhalten uns ihnen gegenüber jeweils entsprechend. Ohne viel darüber nachzudenken wissen wir, dass es Menschen und Gruppen gibt, die »über uns« stehen und denen »es besser geht« oder auch andere, die »schlechter dran« sind als wir. Wir wissen, dass damit auch in unterschiedlichem Maße Macht, Einfluss und gesellschaftliches Ansehen verbunden sind. Wir argumentieren bei der Verteilung häuslicher Arbeiten mit dem »Wesen der Geschlechter« und haben recht klare Vorstellungen darüber, was nun einmal »typisch männliche bzw. typisch weibliche Arbeitsbereiche« im Haushalt sind. Wir haben gelernt, dass unsere Lebensbereiche in der Familie, im Beruf oder in der Freizeit teilweise recht verschieden, vielleicht sogar widersprüchlich sind und wissen ziemlich genau, wie wir uns jeweils in typischen Situationen zu verhalten haben, wie »man« sich beispielsweise zu bestimmten Anlässen zu kleiden pflegt, wie »man« sich eben hier oder dort begegnet und grüßt, wie »man« bei dieser oder jener Gelegenheit miteinander umgeht und miteinander spricht, ob »man« sich sachlich kühl und distanziert gibt oder sich persönlich einbringt, mitteilt und engagiert.
Wir und die anderen folgen dabei weitgehend denselben SpielregelnSpielregeln, gesellschaftliche und RoutinenRoutine, deuten unsere jeweiligen Handlungen und Verhaltensweisen gleich oder zumindest ziemlich ähnlich. Der Großteil unseres AlltagsAlltag(s) und unserer Begegnungen mit anderen folgt so bereits vorgespurten Linien fester gegenseitigerErwartungen: Wir stellen so beispielsweise montags früh unseren Mülleimer vor die Haustür und verlassen uns darauf, ihn am Abend geleert vorzufinden; wir gehen zum Bäcker, um dort mit frischen Brötchen bedient zu werden; wir besteigen die Straßenbahn der Linie 7, weil wir wissen, dass sie uns zum Bahnhof bringt; wir bedanken uns beim Nachbarn, der in unserer Abwesenheit das für uns bestimmte Paket in Empfang nahm …
Zwar mag gerade hinsichtlich schematischer Verhaltensregeln und eingeschliffener Machtverteilungen, schablonenhafter Informationsprozesse oder traditionell befolgter SittenSitte und GewohnheitenGewohnheit dieser RoutinecharakterRoutine unserer Alltagserfahrungen ziemlich eintönig und langweilig sein, gelegentlich gar als unliebsame Einengung empfunden und ärgerlicher ZwangZwang beklagt werden, doch wirkt er in den von uns täglich neu geforderten Entscheidungssituationen auch entlastend und schenkt uns die notwendige Verhaltenssicherheit im Umgang miteinander. Ja ohne diese vertrauten Erwartungen, Gewissheiten und Regelmäßigkeiten unseres gesellschaftlichen Alltags wäre wohl überhaupt keine vernünftige Verständigung und gegenseitig verlässliche Orientierung möglich.
Das Gegenteil hierzu könnten wir uns vielleicht folgendermaßen gedanklich ausmalen: Alle Menschen müssten bei jedem Zusammentreffen jeweils neu ihre Verhältnisse zueinander festlegen und könnten jeweils nach Lust und Laune, jedenfalls willkürlich, ihr jeweiliges Verhalten und Handeln bestimmen. Wenn es so etwas überhaupt gäbe – was nicht der Fall ist – wäre das für alle Beteiligten zumindest außerordentlich anstrengend. Stellen wir uns beispielsweise vor, es gäbe keine kulturelle Konvention bei der Begrüßung eines Fremden: Wir wüssten nicht, ob wir die Hand schütteln, ihn auf die Wange küssen, unsere Nasen aneinander reiben oder ihm ins Gesicht spucken sollten! – Wahrscheinlich würden wir unter solchen Bedingungen recht bald die Nerven oder gar den Verstand verlieren.
Wenn uns daher gelegentlich – halb verwundert, halb ärgerlich – die langweilige Eintönigkeit der AlltagsbräucheAlltag(s) und Rituale aufstößt oder wir vielleicht über irritierende Ereignisse, die sich in unser vertrautes Weltbild nicht mehr einordnen lassen, tiefer greifend reflektieren, dann beschäftigen wir uns tatsächlich bereits mit dem Gegenstand der SoziologieSoziologie, – meist ohne zu wissen, dass das, worüber wir gerade räsonnieren, überhaupt eine soziologische Fragestellung ist. Denn indem wir beginnen, über solche Erfahrungen nachzudenken, versuchen wir die Vielfalt unserer Eindrücke und Erlebnisse zu ordnen und zu interpretieren. Wir versuchen, trotz lauter Bäumen, den Wald zu sehen.
Auch die Soziologie sucht nämlich nach Ordnungen und Deutungen. Sie versucht, in den alltäglich erlebten Vorgängen »Gewebe aus immer wiederkehrenden Verhaltensmustern« (Berger & Berger)Berger, P.L.Berger, B. zu erkennen und hierbei die Bedingungen zu erschließen, unter denen Menschen zusammen leben und arbeiten. Und sie untersucht darüber hinaus die mehr oder weniger konstanten Beziehungsformen oder »NetzwerkeNetzwerk, soziales«, die zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Gruppe, zwischen Gruppen und GesellschaftGesellschaft(s) entstehen, mehr oder weniger lange andauern, abgeschwächt oder verstärkt werden, sich verändern oder sich auch wieder ganz auflösen.
Wie wir noch sehen werden, sind also sowohl die menschlichen Individuen wie die von ihnen geschaffenen Gemeinschaften bzw. (fachlicher ausgedrückt:) »sozialen Systeme« (von Kleingruppen über OrganisationenOrganisation bis hin zu ganzen Gesellschaften) zentrale Themen der SoziologieSoziologie. Einerseits geht es hierbei der Soziologie um die Erforschung menschlichen Handelns und Verhaltens im Allgemeinen sowie zwischenmenschlicher InteraktionenInteraktion, soziale, KommunikationenKommunikation und sozialer Beziehungen im Besonderen; zum anderen untersucht sie die Entstehungsbedingungen sowie die grundlegenden Entwicklungsprozesse und Veränderungen unserer modernen sozialen Welt. Diese soziale Welt werden wir dabei als ein strukturiertes Gebilde erkennen, das in höchst komplexer Weise aus unzähligen Gewebsmustern zusammengesetzt (d. h. »vernetzt«) ist und das in unterschiedlicher Weise unsere Beziehungen zueinander bestimmt. So ist das Netz unseres noch unmittelbar überschaubaren Lebenskreises (z. B. Familie, Freundeskreis) in größere, schon komplexere soziale Gebilde (z. B. Verwandtschaft, Nachbarschaft, Hochschule oder Arbeitsplatz, Verein oder Freizeitgruppen) eingebunden, diese in zunehmend unübersichtliche, ja oft unsichtbare, zuweilen aber auf höchst reale Art und Weise wirksame NetzwerkeNetzwerk, soziales (wie z. B. Gemeinde, Berufsorganisationen, Kirchen, Parteien, Wirtschaft, Staat) verwickelt – bis hin zu einer fließenden Grenze (z. B. deutsche Sprachgruppe, Europäische Gemeinschaft, Industrienationen, westliche Hemisphäre,… »Weltgesellschaft«), an der die Verknüpfungen und Verbundenheiten immer schwächer werden oder ganz abbrechen.
Kurz und bündig formuliert: SoziologieSoziologie befasst sich mit dem Zusammenleben der Menschen, ihrem zwischenmenschlichen Handeln und Verhalten und sucht dabei die gesellschaftlichen »Webmuster« und Verknüpfungszusammenhänge – die Strukturen, Funktionen und Prozesse der verschiedenen sozialen Systeme (einschließlich deren Rückwirkungen auf das Individuum) – zu beschreiben, zu analysieren und zu erklären.
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre
Peter L. Berger,Berger, P.L. (2017): Einladung zur Soziologie. Eine humanistische Perspektive. (Darin insbesondere Kapitel 1 »Soziologie als Fröhliche Wissenschaft« und Kapitel 2 »Soziologie als Bewusstsein«. 2. Aufl. UVK: Konstanz.
1.2Die Gesellschaft als Erfahrungsfeld: Fallstricke des Alltagswissens und die soziologische Suche nach Ursachen
Es gibt Kritiker der SoziologieSoziologie, die behaupten, Soziologie sei die Kunst, eine Sache, die eigentlich jeder versteht, so auszudrücken, dass sie keiner mehr kapiert. Soziologie wäre damit der Missbrauch einer zu diesem Zweck erfundenen Terminologie. Dieser geläufige Vorwurf beinhaltet einen formalen und einen inhaltlichen Aspekt.
Was die formale Seite soziologischer Aussagen betrifft, so muss man auch als berufsmäßiger Soziologe zugeben, dass manche Fachvertreter durch ihren »Soziologenjargon« Sprach- und Verständnisbarrieren errichten, die in der Tat nicht geeignet sind, die Popularität des Faches zu fördern. Indem künstliche und sachlich nicht mehr vertretbare Kommunikationsschranken zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft aufgebaut werden, deren Erkenntnisse lediglich einer Handvoll »Eingeweihter« mehr oder weniger noch zugänglich sind, erscheint der eigentliche Auftrag von Wissenschaft in Frage gestellt: aufzuklären, Wissen zu vermitteln und damit auch einen Beitrag zum »Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« (Kant)Kant, I. zu leisten. Dort und nur dort, wo sich Soziologen hinter einer abgehobenen Expertensprache verschanzen, erscheint dieser Vorwurf berechtigt. Allerdings ist dies nicht nur ein Problem von Soziologen: »Wissenschaftliches« Imponiergehabe lässt sich auch bei Vertretern anderer akademischer Disziplinen beobachten, die gleichfalls durch übermäßige und unnötige Strapazierung eines elitären Fachjargons ihre »besondere Kompetenz« auszuweisen trachten.
Auf der anderen Seite sind jedoch wissenschaftliche Aussagen nicht beliebig vereinfachbar, so dass zugestanden werden muss, dass die SoziologieSoziologie – wie jede andere Wissenschaft auch – als Handwerkszeug bestimmte BegriffeBegriffe benötigt, die bestimmte Sachverhalte präziser zu erfassen und zu bezeichnen in der Lage sind als die teilweise unscharfe und »oberflächliche« Begrifflichkeit unserer Umgangssprache. Insofern kommt man auch in der Soziologie um die Einführung und Verwendung spezifischer fachlicher BegriffeBegriffe nicht herum, so dass die Benutzung von bestimmten Grundbegriffen und die Anwendung einer entsprechenden soziologischen Grammatik nicht nur wissenschaftlich legitim, sondern auch sachlich geboten erscheint.
Die inhaltliche Seite des einleitend zitierten Vorwurfs wiegt schwerer. Denn in der Tat reden Soziologen oft von Dingen, von denen jeder schon etwas weiß oder zumindest zu wissen glaubt. Anders als etwa bei der Physik oder in der Medizin sind wir Menschen ja im Bereich des »Sozialen« keine unbedarften Anfänger mehr, sondern in gewissem Sinne »Amateursoziologen«, wie schon der amerikanische Sozialwissenschaftler Robert MacIverMacIver, R. (1882–1970) bemerkte. Allein schon aufgrund unserer Biografie verfügen wir über Gesellschaftserfahrung und AlltagswissenAlltag(s)-wissen, was einen Anspruch auf eine allgemeine soziale Kompetenz zu begründen scheint, – lange bevor die SoziologieSoziologie als »Wissenschaft vom Sozialen« auf den Plan tritt.
Kennzeichnend für diese Art des Alltagsverständnisses ist, dass wir für fast jede Lebenssituation nicht nur bestimmte Rezepte und Strategien zur Verfügung haben, sondern auch in der Regel ganz präzise erklären können, warum beispielsweise Frau Schmidt sich von ihrem Ehemann scheiden lässt, warum die Tina von Müllers in der Schule nicht mitkommt und die Zwillinge von nebenan immerzu streiten und die Verbote des Hausmeisters missachten.
Wie erklären die Leute im Allgemeinen solche Probleme?
Wenn wir uns selbst einmal bei derartigen Gelegenheiten beobachten und kontrollieren könnten oder anderen bei ihren Erklärungen aufmerksam und vielleicht etwas kritischer als üblich zuhörten, würden wir rasch feststellen, dass bei der Konfrontation mit Alltagsproblemen bereits gewisse Vorstellungen über deren Ursachen abgerufen werden. Persönliche Erfahrungen und übernommene Meinungen, allzu oft auch – meist unbewusste – soziale VorurteileVorurteil, soziales, spielen dabei eine wichtige Rolle. So werden wohl im Hinblick auf bestimmte Probleme in der Regel kaum sorgfältig abgewogene oder wohlüberlegte Gedanken und klare, präzise Kausalketten entwickelt, sondern eher spontane, für »richtig« und »plausibel« gehaltene Deutungen der Situation, die für uns dann »wirklich so ist«, zum Ausdruck gebracht. Die Alltagsprobleme werden von der eigenen Perspektive aus wahrgenommen und von den eigenen Werten, NormenNorm(en) und Überzeugungen her beurteilt. Ausgangspunkt ist jeweils das eigene, für »selbstverständlich« und »natürlich« gehaltene Bezugssystem. Die Sicht des anderen oder dessen Interpretation des Problems bleibt unberücksichtigt. Oft werden (vor-)schnell »Etiketten« verteilt und komplexere Zusammenhänge damit auf bestimmte Beziehungen zwischen Personen oder auf deren angenommene Eigenschaften reduziert. Erfahrungen, die sich solchen Zuschreibungen entziehen, werden dann meist fatalistisch als undurchschaubares Schicksal oder als in der Natur der Sache liegend begriffen.
Der Philosoph und Begründer der phänomenologischen Soziologie Alfred SchützSchütz, A. (1899–1959) bezeichnet unser AlltagswissenAlltag(s)-wissen als »natürliche Einstellung«, die sich unterscheidet von der wissenschaftlichen Erkenntnis mittels eines spezifischen Erkenntnisstils: In unserer »natürlichen Einstellung« stellen wir die Wirklichkeit nicht in Frage und haben keinen Zweifel, ob die Welt und ihre »Tatsachen« anders sein könnten. Unser AlltagswissenAlltag(s)-wissen und unser Alltagsverständnis bestimmen also, welche Zusammenhänge bei gewissen Problemfällen in unseren Gesichtskreis rücken, welche Faktoren wichtig sind. Oft wird das Denken dabei von bewertenden Kategorien und absoluten Begriffen wie »gut« und »böse«, »schuldig« oder »unschuldig«, »richtig« oder »falsch« geleitet; zudem werden unsere »Erklärungen« von den durch das Problem ausgelösten eigenen Gefühlen und Eindrücken überlagert und – eben meist unbewusst – gesteuert:
Herr Schmidt ist ja bekannt als recht aufbrausender »Alkoholiker«, die 12-jährige Tina flirtet bereits mit einem »Punker« (was offensichtlich in der Familie liegt, denn die Mutter hat ja seinerzeit auch schon »früh angefangen«), die Zwillinge von nebenan sind »schlecht erzogen« oder vielleicht hat auch der Hausmeister eine »unsoziale Einstellung«, weil er die Kinder nicht auf dem gepflegten Rasen spielen lässt. Für Frau Schmidt ist die Ehe sicher eine einzige Tortur, denn man »weiß« ja, dass Alkoholiker sehr labil sind, sich nicht beherrschen können und sich so ihr Schicksal selbst zuzuschreiben haben. Man »weiß« auch, dass bei »Frühreifen« die Triebhaftigkeit und sexuelle Aktivität im Blut steckt, was man aber durch geeignete Erziehungsmaßnahmen sicherlich in den Griff bekäme. Es ist »ganz offensichtlich«, dass die Nachbarin depressiv ist und mit der Geburt der Zwillinge total überfordert wurde. Und man kennt ja schließlich auch den übereifrigen Hausmeister, der im ganzen Viertel als Kinderschreck gilt.
Dass es sich bei diesen »Eigenschaften« um etwas handelt, das mit der »Veranlagung« der Betreffenden zu tun hat, wird hierbei oft stillschweigend vorausgesetzt. Dass es sich bei den beklagten Verhaltensweisen jedoch gar nicht so sehr um individuelle Veranlagungen handeln könnte, sondern vielleicht eher um Eigenschaften, die sich erst unter ganz bestimmten Bedingungen des Zusammenlebens entwickelt haben, – diese Möglichkeit bleibt meist außerhalb unseres gewohnten Denkhorizonts.
Oder denken wir daran, dass beispielsweise Alkoholismus weniger ein individuelles Problem ist, insofern dieses Problem ja besonders in Gesellschaften verbreitet ist, die den Alkoholkonsum als Zeichen von Männlichkeit und Lebensfreude ansehen oder auch als Seelentröster und probaten Konfliktlöser empfehlen?
Denken wir daran, dass bestimmte Persönlichkeitseigenschaften und bestimmte Ausdrucksformen des Protests (wozu aggressive sowie depressive Formen zu rechnen sind) sich eigentlich erst im Anschluss an ganz bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse in zwischenmenschlichen Beziehungsfeldern (z. B. in der Partnerschaft, in der Familie, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz usw.) bilden?
Oder denken wir daran, dass – wie beim Beispiel des »unsozialen« Hausmeisters – vielleicht auch eine mangelhafte Wohnungspolitik für Familien oder kinderfeindliche Leitbilder von Architekten, Baugesellschaften und Raumplanern eine Rolle spielen könnten?
Die »Gewissheit« mit der wir aus unserem Alltagsverständnis heraus derartige Probleme beschreiben und erklären, wird eigentlich viel zu selten in Frage gestellt. Daher ist es auch kaum erstaunlich, wie selbstsicher und souverän wir im Umgang miteinander gewissermaßen »aus der Hüfte geschossene« Diagnosen abgeben, ohne die vielen komplexen Umweltbedingungen und Lebenserfahrungen zu kennen, die diese Menschen und ihre Probleme erst zu dem machten, was sie in den Augen der anderen sind.
Hier hat die SoziologieSoziologie eine kritische und aufklärende Funktion. Sie macht darauf aufmerksam, dass die raschen und intuitiven Zuordnungen und plausibel erscheinenden Zuschreibungen unserer privaten Alltagsinterpretationen nur allzu oft trügerisch sind und den tatsächlichen Problemhintergründen keineswegs gerecht werden. Es genügt nämlich nicht, irgendeine Meinung über ein Problem im zwischenmenschlichen Verhalten von sich zu geben, sondern diese Meinung muss an der konkreten Situation aufgewiesen, belegt und überprüft werden. Manche Erklärungen und Beschreibungen der Soziologie stimmen dann mit unseren bisherigen Meinungen und Überzeugungen nicht mehr überein. Manche beliebte »individualisierende« Denkfigur, manch gesellschaftlich akzeptiertes (und so bisweilen recht nützliches) Argument, manche gewohnte und vertraute Vorstellung von der sozialen Welt wird hierdurch fragwürdig. Indessen: Im Aufwerfen solcher »kontra-intuitiver« Fragen liegt gerade der besondere Nutzen der Soziologie. Oder um es mit Peter BergerBerger, P.L. (2017, 41) zu formulieren: »Die erste Stufe der Weisheit in der Soziologie ist, dass die Dinge nicht sind, was sie scheinen«.
Indem die SoziologieSoziologie ihr ErkenntnisinteresseErkenntnisinteresse vor allem auf die sozialen Bedingungen richtet, die hinter den beobachtbaren Tatsachen wirksam werden, und indem sie auf die Einbettung vieler Probleme in umfassendere gesellschaftliche Strukturzusammenhänge aufmerksam macht, leuchtet sie Bereiche aus, die vom naiven Alltagsdenken oft ausgeblendet werden oder deren Zugang versperrt bleibt. Damit eröffnet uns die Soziologie neue und rational anregende Sichtweisen, die eine Hilfe sein können für ein besseres Verständnis von uns selbst und von der GesellschaftGesellschaft(s), in der wir leben.
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre
Arbeitsgruppe Soziologie (2004): Denkweisen und Grundbegriffe der Soziologie. Eine Einführung. (Darin Kapitel1 »Die Soziologen – Notorische Besserwisser?«, S.9–22). Campus: Frankfurt/M.
Peter L. BergerBerger, P.L. & Thomas LuckmannLuckmann, T. (2009): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der WissenssoziologieWissenssoziologie. 22.Aufl. (Darin Kapitel 1 »Die Grundlagen des Wissens in der Alltagswelt«, S.21–48). Fischer: Frankfurt/M.
Hartmut EsserEsser, H. (1999): Soziologie. Allgemeine Grundlagen. (Darin Kapitel 3 »Soziologische Forschungsfragen: Fünf Beispiele«, S.31–37). Campus: Frankfurt/M.
1.3Soziologie als Wissenschaft von der Gesellschaft
1.3.1Zum Begrifflichen: Was heißt »sozial«?
Wir haben bisher – ohne besondere semantische Reflexion – die Wörter »sozialsozial, Soziales« und »soziologisch« benutzt bzw. von der »SoziologieSoziologie« gesprochen. Um Missverständnissen vorzubeugen, soll vor unseren weiteren Überlegungen der Bedeutungsgehalt dieser elementaren Begriffe untersucht und unsere Verwendungspraxis erläutert werden.
Beginnen wir bei dem Wort »sozial«. Hier hat die klassische Feststellung Senecas, dass »es sozial sei, ein gutes Werk zu tun« (»beneficium dare socialis res est«, SenecaSeneca, De beneficiis, V. 11) die alltagssprachliche Sinngebung und Benutzung dieses Wortes bis heute beeinflusst.
Mit »sozial« in diesem Sinne wird eine ethisch-moralische Haltung angesprochen, wie sie beispielsweise nach christlichem Verständnis in den Seligpreisungen der Bergpredigt zum Ausdruck gebracht wird: Es ist »sozial«, den Armen und Behinderten zu helfen, Witwen und Waisen zu unterstützen, kranke und alte Menschen zu besuchen, Haftentlassenen eine berufliche Chance zu geben, für Katastrophenopfer oder für die Hungernden in der Dritten Welt zu spenden. Dieses Sinnverständnis unterliegt auch noch der »säkularisierten« Redewendung, wenn wir umgangssprachlich von einem »sozialen Typ« sprechen, der heute seinen »sozialen Tag« hat, weil er großzügig einen ausgibt.
Neben diese menschenfreundliche, durch das christliche Gebot der Nächstenliebe oder einen säkularen Humanismus normativ bestimmte und meist durch eine persönliche Zuwendung zum Ausdruck gebrachte soziale Handlung tritt mit der Entwicklung des modernen Staates, insbesondere mit dem Aufkommen des IndustrialismusIndustrialisierung und des expansiv sich entfaltenden Kapitalismus,Kapitalismus ein neuer Bedeutungsgehalt: In der sogenannten »sozialen Frage« verdichten sich jetzt Problembündel, die nicht mehr von Einzelnen aufgrund privater ethisch-moralischer Verpflichtung und fürsorglichen Engagements gelöst werden können, sondern einer gemeinschaftlichen politischen Lösung zugeführt werden müssen. Das Wort »sozialsozial, Soziales« gewinnt damit eine öffentlich-politische Dimension, ausgedrückt etwa in Wortverbindungen wie »Sozialpolitik«, »Sozialhilfe«, »Sozialreform«, »soziale Revolution«, »soziale Gerechtigkeit« oder »Sozialstaat«.
In diesem Zusammenhang entsteht auch in programmatisch-politischer Zuspitzung das mit »sozialsozial, Soziales« verwandte Wort »sozialistischGesellschaft(s)-, sozialistische«. Es bezeichnet die Gesamtheit der Ideen und Bewegungen, die über eine Verstaatlichung der ProduktionsmittelProduktionsmittel und durch eine sozial gerechte Verteilung der Güter an alle Mitglieder der Gesellschaft die Überwindung der gesellschaftlichen und politischen UngleichheitenUngleichheit, soziale und Klassenverhältnisse Klasse, sozialeanstreben, die durch die kapitalistischeGesellschaft(s)-, kapitalistische Industrialisierung geschaffen wurden (MarxMarx, K.). Wie jedoch auch dieser ursprünglich politisch-aggressive und gesellschaftlich-moralisch aufgeladene Begriff durch die Praxis desavouiert wurde, zeigte sich in der historischen Tatsache, wie sich selbst als »sozialistischGesellschaft(s)-, sozialistische« reklamierende Staaten dann über viele Jahrzehnte mit höchst menschenfeindlichen Mitteln ihre Machtverhältnisse und ihre »neue Klasse«Klasse, soziale (DjilasDjilas, M.) zu erhalten trachteten.
Neben dem moralischen und politischen Gebrauch des Wortes »sozialsozial, Soziales« im Sinne von »dem Gemeinwohl, der Allgemeinheit dienend, die menschlichen Beziehungen in der Gemeinschaft regelnd und fördernd und den (wirtschaftlich) Schwächeren schützend« (Duden) erfährt dieser Begriff nun allerdings in seiner wissenschaftlichen (soziologischen) Verwendung eine entscheidende Erweiterung des Bedeutungsrahmens. Ausgehend von der Grundtatsache, dass der Mensch als »soziales WesenWesen, soziales« von anderen Menschen in hohem Maße abhängig ist, nur in Gemeinsamkeit vorkommt und nur darin existieren kann, wird als »sozial« hier schlechterdings jedes zwischenmenschliche, wechselseitig orientierte Handeln und Verhalten von Menschen bezeichnet, – gleichgültig, ob es sich um »gute« Taten oder »schlechte« Formen des Miteinanderumgehens, um moralische Verbundenheiten oder unmoralische Verhaltensakte handelt. Es bezeichnet also nicht nur karitative Werke der Nächstenliebe und Fürsorge oder der produktiven Kooperation, sondern ebenso Akte der Gleichgültigkeit und Ablehnung, der Inhumanität und Grausamkeit, des Wettbewerbs, der Auseinandersetzung oder des offenen Konflikts. In deutlichem Gegensatz zum normativen Alltagsgebrauch wird durch die bewusste Ausscheidung von einseitig positiven Bewertungen und Gefühlen der wissenschaftliche Begriff des »Sozialen« wertneutral benutzt. Sozial in diesem Sinne sind nach einer Umschreibung einer der Pioniere der amerikanischen Soziologie, Edward A. RossRoss, E.A. (1866–1951) »alle Phänomene, die wir nicht erklären können, ohne dabei den Einfluss des einen Menschen auf den anderen einzubeziehen« (Ross 1905, 7, zit. nach JagerJager, H. & MokMok, A.L., 1972, 22).
»Das Soziale in diesem Verständnis kann schöne und schreckliche Züge haben. Moralisch gesprochen kann es menschliche und un-menschliche Züge tragen; sozialwissenschaftlich gesehen ist es in jedem Falle menschlich, weil es zwischen Menschen geschieht, von ihnen gewollt und ausgeführt wird. Eine im moralischen Sinne unsoziale Handlung kann also im wissenschaftlichen Sinne durchaus sozialsozial, Soziales sein, weil das Wort als wissenschaftlicher Begriff die zwischen Menschen geschehenden Handlungen beobachtet und sehr viele Handlungen gar nicht in den Blick der Wissenschaft gerieten, wenn nur die moralisch ›sozialen‹ beobachtet, die moralisch ›unsozialen‹ wegen wertmäßiger Anschauungen der Wissenschaftler nicht beachtet würden. Die neutrale Bedeutung des Wortes ›sozial‹ ermöglicht also bessere Erkenntnis.« (DeichselDeichsel, A. 1983, 20 ff.).
1.3.2Was sich Soziologen unter »Soziologie« vorstellen
Für die neutrale Beschreibungsart menschlichen Handelns und Zusammenlebens verwendete zum ersten Mal (1837) der französische Sozialphilosoph Auguste ComteComte, A. (1798–1857) »faute de mieux« den Namen »SoziologieSoziologie«.
ComteComte, A. selbst war über diesen, seiner Ansicht nach recht uneleganten lateinisch-griechischen »Wortbastard« (von lat. socius = Gefährte, Geselle, Mitmensch; griech. logos = Wort, Vernunft, Lehre) alles andere als glücklich. Denn eigentlich wollte er sein neu geschaffenes wissenschaftliches System – angeregt von Saint-SimonSaint-Simon, C.H. (1760–1825) und in Anlehnung an die ihn faszinierenden Naturwissenschaften und deren methodisch strenge empirische Ausrichtung – »Physique socialephysique sociale« nennen. Doch sein akademischer Gegenspieler, der belgische Statistiker Adolphe QueteletQuetelet, A. (1796–1874) veröffentlichte kurz zuvor (1835) eine Untersuchung unter eben diesem Titel und »stahl« ihm so, wie Comte bitter bemerkt, seine originäre Begriffsidee und »missbrauchte« sie als »einfache StatistikStatistik«. Die Bezeichnung »SoziologieSoziologie« als die »Lehre vom Sozialen« oder als die »Wissenschaft vom gesellschaftlichen Zusammenleben« setzte sich jedoch in der Folgezeit gegenüber der SozialphysikSozialphysik durch, zumal dann auch Herbert SpencerSpencer, H. 1873 diesen Begriff aufnahm und »Sociology« in die englischsprachige Literatur einführte. Ja selbst in den Ländern des ehemaligen Ostblocks, in denen Gesellschaftslehre als »wissenschaftlicher SozialismusSozialismus« betrieben wurde, gewann die ursprünglich als »bürgerlich« verfemte Bezeichnung SoziologieSoziologie zunehmend an Raum, wenn auch unter der unmissverständlich programmatisch-ideologischen Einengung als »marxistisch-leninistische SoziologieSoziologie-, marxistisch-leninistische«. Dies zeigt allerdings auch, dass Soziologie aufgrund weltanschaulicher, wissenschaftstheoretischer oder methodologischer Orientierung recht unterschiedlich aufgefasst und definiert werden kann.
Als »Lehre vom Sozialen« erforscht Soziologie das menschliche Zusammenleben bzw. das zwischenmenschliche Verhalten, beschäftigt sich mit der GesellschaftGesellschaft(s) und mit den in ihr lebenden Menschen. Diesen Gegenstand teilt sich die Soziologie allerdings auch mit anderen Sozialwissenschaften, wie etwa der SozialpsychologieSozialpsychologie, der KulturanthropologieKulturanthropologie und EthnologieEthnologie, der Demographie, der Ökonomie, der Politologie, der Erziehungswissenschaft, der Jurisprudenz und der Geschichtswissenschaft, neuerdings auch mit der Kommunikationswissenschaft, der Stadt- und Raumplanung oder der Friedens- und Zukunftsforschung. Wenn wir darum die SoziologieSoziologie charakterisieren wollen, genügt es nicht, nur ihr Untersuchungsobjekt zu nennen. Vielmehr müssen wir deutlich machen, in welcher typischen Art und Weise, mit welcher besonderen Fragestellung, mit welcher spezifischen Perspektive und mit welchen Methoden und Regeln sie an ihren Gegenstand als Sozialwissenschaft herangeht.
Der deutsche Soziologe Alfred VierkandtVierkandt, A. (1867–1953) spricht dabei von einer »soziologischen Denkweise, die alle menschlichen Tätigkeiten und Erzeugnisse in Beziehung setzt zu der menschlichen GesellschaftGesellschaft(s), der ihre Träger angehören und sie unter dem Gesichtspunkt ihrer Abhängigkeit von dieser auffasst« (Vierkandt 1928, 14). Das zentrale Bemühen dieser Versuche ist es, analytisch den »sozialen FaktorFaktor, sozialer« zu isolieren und von der Zurückführung »sozialer TatsachenTatsache, soziale« auf irgend etwas Nichtsoziales abzusehen, d. h. – wie der berühmte französische Soziologe Émile DurkheimDurkheim, É. (1858–1917) es ausdrückt – »Soziales nur durch Sozialessozial, Soziales zu erklären«.
Es gibt dabei ziemlich viele konkurrierende Definitionen von »SoziologieSoziologie«. Böse Zungen behaupten, es gehöre zum professionellen Lebenswerk eines jeden echten Soziologen, eine eigene Begriffsbestimmung seines Fachs zu entwickeln. Dass es keine allgemein anerkannte, verbindliche und umfassende Definition von Soziologie gibt, hängt jedoch eng mit der Tatsache zusammen, dass nahezu alle Gegenstände und Erfahrungen unseres täglichen Lebens einen soziologischen Bezug aufweisen und deshalb eine Aufzählung bzw. Abgrenzung der Gegenstandsbereiche der Soziologie praktisch unmöglich ist. Eher lässt sich die »soziologische Denkweise« oder die »soziologische PerspektivePerspektive, soziologische« als professionelles Neugierverhalten charakterisieren, hinter die scheinbaren Selbstverständlichkeiten und Rätsel unseres Alltags zu schauen und die damit verbundenen Erfahrungen aus kritischer DistanzDistanz, kritische zu beschreiben, zu hinterfragen und zu erklären. In diesem Sinne lässt sich Soziologie pragmatisch definieren als »das systematische und kontrollierte Beobachten und Erklären von regelmäßig auftretenden sozialen Beziehungen, von ihren Ursachen, Bedingungen und Folgen« (SegerSeger, I. 1970, 13).
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre
Hermann L. GukenbiehlGukenbiehl, H.L. (2016): Soziologie als Wissenschaft. Warum Begriffe lernen? In Hermann KorteKorte, H. & Bernhard SchäfersSchäfers, B. (Hrsg.), Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie. 9.Aufl. S.11–22. Springer VS: Wiesbaden.
Karl-Heinz HillmannHillmann, K.H. (2007): Wörterbuch der Soziologie, 5.Aufl. (Darin Stichwort »Soziologie« mit weiteren Literaturhinweisen). Kröner: Stuttgart.
1.3.3Soziologie und soziale Probleme
Die Bezeichnungen sozialsozial, Soziales und soziologisch werden oft verwechselt. Etwa wenn ein Politiker von der »soziologischen« Struktur einer Gemeinde spricht oder von einem Journalisten in einem Pressebericht über Arbeitslosigkeit vermutet wird, dass hier »soziologische« Faktoren im Spiel seien. »Soziologisch« bedeutet jedoch im eigentlichen Sinne »gesellschaftswissenschaftlich«, d. h. von den Erkenntnissen, BegriffenBegriffe, Theorien, kurz vom Bezugssystem der SoziologieSoziologie her gesehen. Gemeint ist aber »sozial« im Sinne von »gesellschaftlich«, so dass also in derartigen Fällen sachlich richtig von der sozialen StrukturStruktur und von sozialen FaktorenFaktor, sozialer gesprochen werden muss. Entsprechend ist deshalb ein soziales ProblemProblem, soziales keineswegs auch immer ein soziologisches und umgekehrt betreffen soziologische Fragestellungen entgegen einem weit verbreiteten Missverständnis durchaus nicht immer soziale Probleme.
Ein soziales oder gesellschaftliches Problem liegt meist dann vor, wenn eine Diskrepanz (Widerspruch) zwischen den gesellschaftlichen NormenNorm(en) und Zielvorstellungen und dem tatsächlichen Verhalten der Menschen besteht (z. B. im Falle von DevianzDevianz und Kriminalität) oder wenn eine unvorhergesehene oder unvorhersehbare Situation eintritt, die in der Gesellschaftsordnung (noch) nicht geregelt ist (wie beispielsweise Massenarbeitslosigkeit in Deutschland und gleichzeitige Verlagerung von Arbeitsplätzen durch inländische Unternehmen in Billiglohnländer).
Eine soziologischeFragestellung liegt dagegen erst dann vor, wenn bestimmte gesellschaftliche Problemlagen, Zustände und Prozesse erklärt werden sollen. Wenn also ein Soziologe ein soziales ProblemProblem, soziales bearbeiten soll, muss er es zunächst in eine soziologische Frage »übersetzen«; erst dann kann er mit seinem Handwerkszeug, d. h. mit seinen Begriffen, Theorien und Untersuchungsmethoden, das Problem erfassen, beschreiben und zu erklären suchen. Hierbei wird schon deutlich, dass ein bestimmtes soziales Problem, auch nachdem es soziologisch geklärt ist, durchaus als sozialesProblem weiter bestehen kann. So können beispielsweise Soziologen in Bezug auf das soziale Problem der Chancengerechtigkeit im Bildungswesen schon seit den 1970er-Jahren und nicht erst seit den international vergleichenden Schulleistungsuntersuchungen der OECD (PISA-Studien)PISA-Studie der letzten zwanzig Jahre auf die Wirkung der sozialen Herkunft aufmerksam machen und auch empirisch nachweisen, dass das SchulsystemSchulsystem durch seine typische »Schulkultur« insbesondere im Sprachverhalten Schüler aus mittleren und oberen SchichtenSchicht, soziale begünstigt. Vielmehr konnten Bildungssoziologen auch schon seit Langem darauf aufmerksam machen, wie sehr Lehrerurteile über Eignung und Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schüler von typologischen Vorstellungen und impliziten Persönlichkeitstheorien beeinflusst werden können, in die auch leistungsfremde, kaum objektivierbare Beurteilungsbestandteile eingehen und inwiefern auch solche Schülertypologien wiederum stark schichten- und milieuspezifisch orientiert sind. Den betroffenen Kindern helfen solche theoretischen Erklärungen zunächst wenig, denn das soziale Problem der Benachteiligung bleibt ja zunächst weiter bestehen. Ähnlich verhält es sich bei dem allseits bekannten und nicht nur ökologisch, sondern auch soziologisch vielfach erforschten Problem der Umweltverschmutzung durch CO2- und Feinstaub-Emissionen. Die Analysen sind klar, und Umweltschutz gilt weithin als dringend geboten. Geht es aber an die praktisch zu ziehenden Konsequenzen wie die Einschränkung der gewohnten Lebensführung, ist nach wie vor mit erheblichen Widerständen zu rechnen.
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre
Axel GroenemeyerGroenemeyer, A. (2012): Soziologie sozialer Probleme – Fragestellungen, Konzepte und theoretische Perspektiven. In Günter AlbrechtAlbrecht, G. & Axel Groenemeyer (Hrsg.), Handbuch Soziale Probleme, 2.Aufl., S.17–116. VS: Wiesbaden.
1.4Wozu kann man Soziologie brauchen?
1.4.1Soziologie als Missverständnis
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach dem Nutzen der SoziologieSoziologie für die gesellschaftliche Praxis. Unter dem noch unmittelbaren Eindruck der internationalen Studentenbewegung der späten 1960er-Jahre bemerkte die Soziologin Imogen SegerSeger, I. (1970, 11): »Wer in den letzten Jahren die Berichte im Fernsehen und in den Zeitungen verfolgt hat, der muss zu der Ansicht kommen, die Hauptbeschäftigung der Soziologiestudenten sei es, die Revolution inner- und außerhalb der Universitäten vorzubereiten, und die Hauptbeschäftigung ihrer Professoren sei es, sie dabei zu ermuntern.«
In der Tat hatten manche Politiker und Kommentatoren einen guten Anteil an den landläufig recht gängigen Klischees, Soziologie habe etwas mit RevolutionRevolution und SozialismusSozialismus oder gar KommunismusGesellschaft(s)-, kommunistische zu tun. Sie vermuteten einen Zusammenhang zumindest zwischen einer bestimmten soziologischen Denkweise (gemeint war vor allem die »Kritische Theorie« Theorie(n)-, kritischeder sogenannten »Frankfurter Schule« der Soziologie) und radikalen jungen Leuten, die vorgeben würden, Gesellschaftswissenschaften zu studieren, in Wirklichkeit aber auf Kosten der Steuerzahler in Hörsälen und auf Straßen randalieren oder gar terroristische Gewaltakte planen und durchführen.
Dieses verallgemeinernde Vorurteil entzündete – und entzündet sich immer wieder vor allem an der Beobachtung, dass SoziologieSoziologie offenbar nicht nur für jene Studentinnen und Studenten anziehend und anregend wirkt, die die GesellschaftGesellschaft(s), in der sie leben, verstehen wollen, sondern auch für solche höchst attraktiv erscheint, die die gesellschaftlichen Ordnungen radikal in Frage stellen und auch grundsätzlich verändern möchten, für jene also, die sich in der Soziologie eine Art Revolutionswissenschaft erhoffen und die hierbei Denkmodelle bestimmter Gesellschaftstheoretiker mit politischen Aktionsprogrammen verwechseln.
Oft zählen zur letzten Gruppe vor allem jene, die »ein bisschen Soziologie studiert« haben, bald aber angesichts der Studienanforderungen von StatistikStatistik und Methodenlehre oder der Pflichtkurse über soziologische Grundbegriffe und Theorievergleiche abgeschreckt werden und der »praxisfernen« universitären Soziologie enttäuscht den Rücken kehren. Dies hindert sie jedoch nicht, unter Hinweis auf ihre soziologischen Erkenntnisse (die wohl eher den Charakter von Bekenntnissen haben), zu glauben, die Gesellschaft »in den Griff« zu bekommen und damit die Hoffnung verbinden, sie grundlegend verändern zu können, um sie so von allem Übel zu befreien. Ein bisschen Soziologie ist jedoch ebenso wie ein bisschen Wahrheit eine gefährliche Sache. Bloße Gesellschaftskritik und darauf beruhendes »politisches« Handeln ohne fundierte Information und gründliches Studium gesellschaftlich-politischer Zusammenhänge hat eine unbehagliche Nähe zum VorurteilVorurteil, soziales, zum pauschalisierenden Rundumschlag und zum irrational-eifernden Aktivismus.
Wer sich indessen auf die moderne SoziologieSoziologie ernsthaft einlässt, wird sehr rasch feststellen müssen, dass sie als Ersatzreligion überhaupt nicht taugt. Soziologie »ist kein Ersatz für verlorene Identifikationen, keine begleitende Sinngebung für Handlungen, sondern schlicht Erkenntnis der Zusammenhänge in ihrem Problemfeld« (JonasJonas, F. 2021a, 3). Ihre empirischen und theoretischen Ergebnisse entziehen sich von ihrem Anspruch her explizit allen »schrecklichen Vereinfachungen« und lassen sich auch faktisch – z. B. im Hinblick auf geplante soziale Aktionen – nur äußerst sperrig handhaben.
So beachtlich die methodologischen und analytischen Fortschritte der Soziologie mittlerweile auch sein mögen, so vorsichtig sind seriöse Sozialwissenschaftler dennoch im Umgang mit handlungsleitenden PrognosenPrognose oder gar handlungsanweisenden Rezepten. Statt von Gewissheiten reden Soziologen heute lieber von Wahrscheinlichkeiten, wie überhaupt die meisten soziologischen Aussagen den Charakter von Wahrscheinlichkeitsaussagen haben. Dies vor allem deshalb, weil Soziologen die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Untersuchungsgegenstände höchst dynamisch und unberechenbar sind, ja dass im gesellschaftlichen Bereich fast jede Wirkung eine oft überraschende und unvorhersehbare Gegenwirkung auslösen kann.
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre
Norbert EliasElias, N. (2014): Was ist Soziologie? 12.Aufl. (Darin das Kapitel5/4 »Gesellschaftsideale und Gesellschaftswirklichkeit«, S.182–188). Beltz Juventa: Weinheim, Basel.
1.4.2Strukturen soziologischen Denkens und Forschens
Trotz der vorgenannten Einschränkungen hat die Soziologie für unseren Alltag dennoch wichtige Funktionen zu erfüllen, wie wir im Folgenden sehen können. Die in diesem Zusammenhang immer wieder neu gestellten Fragen
Was ist eigentlich SoziologieSoziologie?
Wozu ist Soziologie nütze?
Was kann die Soziologie leisten?
Was bietet sie uns?
lassen sich dabei allerdings nicht ganz so einfach und bündig beantworten, weil es die Soziologie im strengen Sinne eigentlich nicht gibt, sondern immer nur Soziologen verschiedener Schulen und Denkrichtungen. Abgesehen von differenten wissenschaftstheoretischen und methodologischen Zugängen kommt dann deren Verständnis von Soziologie auch in ihren jeweiligen Lehr- und Forschungsprogrammen zum Ausdruck und lässt sich systematisch etwa so strukturieren:
Soziologie als Wissenschaft vom sozialen Handeln und zwischenmenschlichen Verhalten;
Soziologie als Wissenschaft von den sozialen Institutionen und OrganisationenOrganisation;
Soziologie als Wissenschaft von der Gesamtgesellschaft und deren Stabilität und Wandel;
Soziologie als Wissenschaft von den Ideen über die Gesellschaft und als IdeologiekritikIdeologiekritik.
Mit diesen unterschiedlichen Perspektiven und Ansätzen werden nichts anderes als verschiedene Ebenen der recht komplizierten sozialen Wirklichkeit angesprochen. Ausgehend vom Menschen als soziales WesenWesen, soziales und seinen auf andere gerichteten bzw. an anderen orientierten Handlungen und Verhaltensweisen weisen diese unterschiedlichen Analysedimensionen auf soziologisch unterscheidbare Einflussgrößen und Kontexte hin, was man grafisch vereinfacht so darstellen kann:
Soziologie als SozialwissenschaftSozialwissenschaft
Wenn also Soziologen versuchen, Situationen unseres Alltags zu verstehen und zu analysieren, dann versuchen sie, diese Situationen in einen größeren, überindividuellen Zusammenhang zu stellen. Indem die Soziologen das IndividuumIndividuum, das es – per definitionem – als isoliertes Wesen gar nicht gibt, immer als ein soziales WesenWesen, soziales begreifen, suchen sie nach überindividuellen Einflussgrößen und entpersonalisierten Kontextbedingungen von dessen Lebensweise.
Seriös kann man das nur tun, wenn man einerseits das soziale Individuum mit anderen Individuen in der Gesellschaft vergleicht und andererseits zusätzlich noch weitere Ebenen berücksichtigt, mit denen das soziale Individuum in wechselseitig orientierten (Max Weber) Weber, M.Austauschprozessen verbunden ist, die sein Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen:
die Ebene von Kleingruppen (= Mikro-Ebene)Mikro-Ebene,
die Ebene von OrganisationenOrganisation(= Meso-Ebene)Meso-Ebene,
die Ebene der Gesellschaft (= Makro-Ebene)Makro-Ebene und
die Ebene der einer Gesellschaft allgemein zugrunde liegenden Ideen und Ideologien (= Meta-Ebene)Meta-Ebene.
Die Mikro-EbeneMikro-Ebene wird entsprechend von der MikrosoziologieMikrosoziologie untersucht, die mit der PhänomenologiePhänomenologie und der SozialpsychologieSozialpsychologie eng verwandt ist. Sie befasst sich vor allem mit den Grundbedingungen und -formen sozialen Handelns und Verhaltens im sozialen Nahbereich der sogenannten face-to-face-Beziehungenface-to-face-relations (z. B. FamilieFamilie, Freundeskreis). Darüber hinaus erforscht sie aber auch die Prozesse der Wahrnehmung und Interpretation sowie Aneignung und Auseinandersetzung des Individuums mit der es umgebenden KulturKultur sowie mit gesellschaftlichen RollenRolle(n), soziale und NormenNorm(en) einschließlich der von den sozialen Normierungen abweichenden Verhaltensweisen. Typisch mikrosoziologische Theorien sind beispielsweise der sogenannte »Symbolische InteraktionismusInteraktionismus, symbolischer«, die »Verstehende SoziologieSoziologie-, verstehende« oder die vom Behaviorismus ausgehende verhaltenstheoretische SoziologieSoziologie-, verhaltenstheoretische.
Die Meso-EbeneMeso-Ebene wird vor allem über organisationssoziologische Ansätze erhellt, wobei einzelne Untersuchungen oder vergleichende Darstellungen sowohl den zweckorientierten, d. h. planmäßig gestalteten (Autoritäts-)Strukturen und (Interaktions-)ProzessenInteraktion, soziale in OrganisationenOrganisation (z. B. Industriebetrieben, Verbänden, Parteien, Kirchen, aber auch Bildungsinstitutionen wie Schulen u. a.), wie auch den informellen Prozessdynamiken und -strukturen solcher sozialen Gebilde ihre analytische Aufmerksamkeit schenken.
Der Makro-EbeneMakro-Ebene wendet sich die sog. MakrosoziologieMakrosoziologie zu; sie analysiert sowohl große soziale Einheiten und gesamtgesellschaftliche Prozesse wie auch Austauschprozesse zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Teilsystemen (z. B. Wirtschaft, Politik, Bildung). Besonders thematisiert sie dabei die jeweiligen Sozialstrukturen wie Stände, Kasten, Klassen, Klasse, sozialeSchichtenSchicht, soziale oder MilieusMilieu, soziales. Die damit verbundenen stabilisierenden Bedingungen (»was hält GesellschaftGesellschaft(s) zusammen?«) bzw. evolutionären oder revolutionären Wandlungsprozesse (»wodurch wird Gesellschaft verändert?«) sind im allgemeinen Gegenstand ihrer Forschung. Grundlegende theoretische Ansätze (Paradigmen) der Makrosoziologie sind z. B. der Struktur-FunktionalismusStrukturfunktionalismus, die SystemtheorieSystemtheorie oder die KonflikttheorieKonflikt, sozialer-theorie.
Die Meta-EbeneMeta-Ebene schließlich, die die sozialen Objektivationen gesamtgesellschaftlich übergreifender Norm- und Wertstrukturen, also den ideologischen »Überbau« von Gesellschaften beinhaltet, wird fachlich von der sogenannten WissenssoziologieWissenssoziologie bzw. der soziologischen IdeologiekritikIdeologiekritik bearbeitet.
Wie bei den meisten typologischen Versuchen ist auch diese Aufteilung unserer sozialen Welt in die vier Kernbereiche KleingruppeKleingruppe, OrganisationOrganisation, GesellschaftGesellschaft(s) und Ideenwelt eine in erster Linie analytische Trennung und methodische Unterscheidung bzw. ein Versuch fachsoziologischer Strukturierung. In Wirklichkeit sind alle vier Ebenen voneinander abhängig, durchdringen sich gegenseitig und sind deshalb auch in soziologischen Beschreibungs- und Erklärungsversuchen soweit wie möglich theoretisch und empirisch miteinander zu verbinden. Eine diese verschiedenen Bereiche integrierende allgemeine soziologische Theorie sozialer Systeme wurde zwar in der Wissenschaftsgeschichte der Soziologie von einigen großen Soziologen wie z. B. Talcott ParsonsParsons, T. (1902–1979) oder Niklas LuhmannLuhmann, N. (1927–1998) immer wieder versucht, steht jedoch indessen als schlüssige und auch generell akzeptierte »Allgemeine Theorie« noch aus.
Unter dem Gesichtspunkt der praktischen Verwertung soziologischen Wissens sind überdies die sogenannten materiellen oder »Bindestrich-Soziologien«Bindestrich-Soziologie weit interessanter als die vorgenannten eher theoretischen Differenzierungen und Strukturierungen. Hierbei handelt es sich um problemorientierte Detailforschung in gesellschaftlichen Teilbereichen, die auch inzwischen zu einer ausgeprägten professionellen Spezialisierung innerhalb der Soziologie geführt hat. Solche speziellen und auch weitgehend universitär in einschlägigen Lehrstühlen etablierten SoziologienSoziologie-, spezielle sind zum Beispiel
Bevölkerungssoziologie,
Migrations- und Asylsoziologie,
Politische Soziologie,
Soziologie der Entwicklungsländer,
Ethnosoziologie,
Familiensoziologie,
Soziologie der Ehe und Partnerschaft,
Soziologie der Kindheit und Jugend,
Soziologie des Alters,
Erziehungs- und Bildungssoziologie,
Pädagogische Soziologie,
Geschlechtersoziologie,
Religionssoziologie,
Soziologie des Lebenslaufs,
Soziologie der Behinderten,
Soziologie der Freizeit,
Agrarsoziologie,
Gemeinde-, Stadt- und Regionalsoziologie,
Architektursoziologie,
Mediensoziologie
Kommunikations- und Netzwerk-/Internetsoziologie,
Organisations- und Managementsoziologie,
Industrie- und Betriebssoziologie,
Arbeits- und Berufssoziologie,
Techniksoziologie,
Wirtschafts- und Konsumsoziologie,
Medizinsoziologie,
Rechtssoziologie,
Kriminalsoziologie,
Kultur-, Kunst-, Musik- und Literatursoziologie,
Sportsoziologie,
Konfliktsoziologie,
Militärsoziologie,
Soziologie der Freizeit,
Wissenssoziologie,
und nicht zuletzt auch gewissermaßen als »Meta-Disziplin« die
Soziologie der Soziologie.
Der Wissens- und Forschungsstand in diesen speziellen SoziologienSoziologie-, spezielle, die untereinander auch theoretisch und empirisch mehr oder weniger verknüpft werden, ist recht unterschiedlich. Einige dieser Teildisziplinen, die bereits auch mit eigenen »Sektionen« innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) vertreten sind, verfügen bereits über einen sehr großen Fundus an empirischen Untersuchungen und theoretischen Konstrukten, andere sind noch relativ jung und haben eher den Charakter von »Orchideenfächern«. Neben persönlichen Neigungen ist das unterschiedlich starke Interesse von Soziologen an diesen materiellen Spezialisierungen sicher u. a. auch als Reflex entsprechender gesellschaftlich und politisch aktueller Problemlagen, vielleicht auch sogar manchmal als eine Art lokal und temporär gebundene »Wissenschaftsmode« zu interpretieren.
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre
Günter EndruweitEndruweit, G., Gisela TrommsdorffTrommsdorff, G. & Nicole Burzan (Hrsg.) (2014): Wörterbuch der Soziologie. 3.Aufl. (Mit lexikalischen Informationen zu einzelnen Speziellen Soziologien). UVK: Konstanz.
Hermann KorteKorte, H. & Bernhard SchäfersSchäfers, B. (Hrsg.) (1997): Einführung in Praxisfelder der Soziologie. (Mit Kurzdarstellungen der wichtigsten Speziellen Soziologien.) 2.Aufl. Leske + Budrich: Opladen.
1.4.3Funktionen soziologischer Erkenntnis
Auf unsere Ausgangsfrage nach den Aufgaben und dem Nutzen der Soziologie zurückkehrend, lässt sich zusammenfassend sagen, dass verschiedene Soziologen in Nuancen, Akzentsetzungen, im Grad der Konkretheit sowie in Abhängigkeit von ihrem »strukturellen« ErkenntnisinteresseErkenntnisinteresse wohl unterschiedliche Antworten geben werden. Gemeinsam ist ihnen aber die Überzeugung, dass wir durch soziologisches Denken und Forschen bessere Einsichten in die mannigfaltigen Formen und Prozesse unseres zwischenmenschlichen Zusammenlebens erhalten werden, als uns dies durch bloße AlltagserfahrungAlltag(s)-erfahrung je möglich sein wird.
Bei der Durchsicht der einschlägigen soziologischen Literatur lassen sich hierbei quer zur Pluralität der verschiedenen Erkenntniszugänge verschiedene funktionale WirkungenSoziologie-, funktionale Wirkungen der Soziologie ausmachen:
Indem Soziologie versucht, die vorhandenen gesellschaftlichen Verhältnisse und Lebenslagen in ihrer Entstehung und Entwicklung, in ihrem Zusammenhang und in ihrer ideologischen Begründung sowie mit ihren Macht- und Herrschaftsansprüchen einsichtig und transparent zu machen, verfolgt sie zweifellos zunächst eine aufklärende und informierende Funktion.
Da sie darüber hinaus den Menschen helfen will, die Motive, Bedingungen und Folgen ihres Verhaltens und Handelns zu erkennen und sie über diese Einsichten dazu befähigen möchte, ihren Zielen entsprechend rational zu handeln, erfüllt sie auch eine diagnostische und pädagogische Funktion.
Daneben hat die Soziologie von Anfang an – wenn auch nicht in dem einleitend beschriebenen vulgären Missverständnis – immer auch eine kritischeFunktion und eine prognostischeAbsicht begleitet. Als kritische Wissenschaft ist sie »verpflichtet auf das sapere aude, auf die DistanzDistanz, kritische gegenüber geltenden Werten und Institutionen« (JonasJonas, F. 2021a, 3). In diesem Sinne möchte sie anhand der Analyse der gesellschaftlichen Strukturen und der Bedingungen ihrer Verwirklichung ein kritisches Bewusstsein gegenüber dem Status quo erzeugen, bestimmte Missstände in herrschenden Zuständen aufzeigen und möglichst rationale Alternativen des sozialen Handelns entwerfen. Langfristiges Ziel dabei ist es, durch methodisch gesicherte Erklärungen zu versuchen, hinsichtlich künftig zu erwartender oder auch bewusst angestrebter Veränderungen sozialer Bedingungszusammenhänge PrognosenPrognose über erwünschte oder unerwünschte gesellschaftliche Wirkungen beim Einsatz verschiedener Mittel aufzustellen.
Schließlich soll auch die potenziell gesellschaftlich affirmative Stabilisierungs- und Konservierungsfunktion von Soziologie nicht unterschlagen werden. Insbesondere in stark ideologisierten, fundamentalistischen und rationalen Zielen gegenüber nicht offenen Gesellschaften findet Soziologie – wenn sie überhaupt als wissenschaftliche Disziplin toleriert wird – oft nur insoweit Unterstützung und Entfaltung, als sie sich in der Analyse und Beschreibung auf das gesellschaftlich Bestehende beschränkt und die Interessen und Privilegien von herrschenden Gruppen durch unkritische Anwendung soziologischen Wissens zu unterstützen geneigt ist. In diesem Sinne kann SoziologieSoziologie auch zur Zementierung der jeweils herrschenden Zustände missbraucht werden.
Wenn die Soziologie – wie wahrscheinlich jede andere Denkrichtung auch – letztlich nicht gefeit ist gegen bestimmte ideologische Uminterpretationen und Missverständnisse im Sinne einer revolutionären Heilslehre oder einer letztlich nur noch vorgegebenen administrativen Zielen dienenden Hilfswissenschaft, so kann sie sich dennoch jenseits dieser extremen Positionen für alle, denen Wissenschaft nicht Selbstzweck bedeutet, sondern die von ihr einen praktischen Nutzen zum Wohle der Menschen erwarten, vor allem aus folgenden drei Gründen (BehrendtBehrendt, R.F. 1962, 17 f.) empfehlen:
Sie hilft, einzelne Erlebnisse und Beobachtungen nicht isoliert – und damit ohne Aussicht auf Verständnis ihrer Ursachen und Bedeutung – zu sehen, sondern sie als Teil umfassender gesellschaftlicher Strukturen, u. a. als Auswirkungen von Wertsystemen, SchichtungsordnungenSchicht, soziale und sozial-kulturellen MilieusMilieu, soziales interpretierend zu verstehen.
Sie hilft, die RelativitätRelativismus, kultureller der Werte und Verhaltensweisen der eigenen Umwelt und Zeit zu erkennen und fördert damit die Fähigkeit – und zuweilen auch die Bereitschaft –, die Verhaltensweisen von Angehörigen anderer Sozialgebilde und Kulturkreise zu verstehen und sich einfühlend in ihre Lage zu versetzen.
Sie hilft, den dynamischen Charakter von Verhaltensweisen und Gesellschaftsstrukturen insbesondere in unserer Zeit verständlich zu machen und hiermit die Panik zu bekämpfen, die aus mangelndem Verständnis komplizierter und sich rasch wandelnder gesellschaftlicher Strukturen entspringt. So kann Soziologie die Wurzeln aufdecken, aus denen die Tagesereignisse entspringen und aus deren Kenntnis diese dann besser verstanden und gelassener bewältigt werden können.
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre
Norbert EliasElias, N. (2014): Was ist Soziologie? 12.Aufl. (Darin die »Einführung«, S.11–35). Beltz Juventa: Weinheim, Basel.
Anthony GiddensGiddens, A. (2009): Soziologie. 3.Aufl. (Darin Kapitel 1 »Was ist Soziologie?«). Nausner: Graz, Wien.
1.5Einige Vorväter und Begründer: Soziologie als Krisenwissenschaft
1.5.1Die lange Vorgeschichte: Von der Antike über das Mittelalter und die Aufklärung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
Gelegentlich mag der Eindruck entstehen, Soziologie sei eine hochmoderne, eher geschichtslose Wissenschaft, die sich weder um ihre eigene Geschichte noch um historische Prozesse viel kümmere. Tatsächlich lässt sich aber die SoziologieSoziologie – zumindest in ihrer Vorgeschichte – zurückführen bis in die AntikeAntike und das MittelalterMittelalter. Schon PlatonPlaton, AristotelesAristoteles, die Sophisten oder Thomas von AquinThomas von Aquin haben sich mit elementaren Problemen des menschlichen Zusammenlebens kritisch auseinandergesetzt.
Der österreichisch-britische Philosoph, Soziologe und Wissenschaftstheoretiker Karl Raimund PopperPopper, K.R. (1902–1994) etwa sieht (in seinem Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«) »Platons Größe als Soziologe in der Fülle und der Detailliertheit seiner Beobachtungen sowie in der erstaunenswerten Schärfe seiner soziologischen Intuition. Er sah Dinge, die man vor ihm nicht gesehen hatte und die erst in unserer Zeit wieder entdeckt worden sind.« (PopperPopper, K.R. 1975, I, 68). Wie »modern« PlatonPlaton (427–347 v. Chr.) in seiner Staats- und Gesellschaftslehre in gewissem Sinne ist, lässt sich beispielsweise an der Wahl seiner Themen erkennen: »Dazu gehören die Prinzipien und Auswirkungen der ArbeitsteilungArbeitsteilung, die Gefahren des PrivateigentumsEigentum, der Zusammenhang zwischen Luxuskonsum und Expansion des Wirtschaftsraumes, die entfremdenden Folgen der Geldwirtschaft, die Entstehung von Ständen, die Geschichte der Gesellschaft als Geschichte von Standeskämpfen, die Spaltung von ElitenElite als Voraussetzung von Revolutionen« sowie die Einbindung dieser mehr theoretischen Überlegungen »in einen historischen Zusammenhang, der von der patriarchalischen Viehzüchterfamilie zur Sippenorganisation, [bis hin] zur Dorf- und Städtebildung mit monarchischer Verfassung und gesetztem Recht nach dem Muster eines GesellschaftsvertragesGesellschaftsvertrag reicht« (RüeggRüegg, W. 1969, 25). Ähnliche soziologische Perspektiven finden sich auch bereits bei den SophistenSophisten, die die Gesellschaft ihres religiösen Nimbus und metaphysischen Schleiers zu entkleiden suchten und sie als Ergebnis menschlichen Handelns und sozialer Übereinkunft betrachteten.
Auch PlatonsPlaton Schüler AristotelesAristoteles (384–322 v. Chr.), dessen Schrift »Politik«Politik nach der Einschätzung des amerikanischen Soziologen Franklin H. GiddingsGiddings, F.H. (1855–1931) das bedeutendste Werk ist, das jemals die menschliche Gesellschaft behandelt hat, ist in dem Sinne bereits »modern«, als Aristoteles zur Grundlegung seiner sozialen und politischen Erkenntnisse zunächst auf die sozialphilosophisch üblichen, wertgeladenen Spekulationen verzichtete. Dafür sammelte er erst einmal umfangreiches empirisches Material und versuchte so in seinen Arbeiten bereits jenem Anspruch einer möglichst werturteilsfreien ErfahrungswissenschaftErfahrung(s)-wissenschaft gerecht zu werden, der heute als fundamentale Voraussetzung für soziologisches Denken eingefordert wird. Denn »wer irgendeinen Zweig des Wissens wirklich wissenschaftlich behandeln und nicht bloß auf das Praktische sein Augenmerk richten will, dem kommt es zu, nichts zu übersehen oder unberührt zu lassen, sondern die Wahrheit über ein jedes zu Tage zu fördern« (Aristoteles, Politik, III, 5).
Von AristotelesAristoteles stammt übrigens auch jene berühmte Aussage, die später u. a. auch von Thomas von AquinThomas von Aquin (1225–1274) wieder aufgegriffen wurde: nämlich dass der Mensch ein soziales WesenWesen, soziales sei (»ánthropos zóon politikón«, Politik, I, 2) – eine Kurzformel, in der im Grunde genommen bereits das spätere Forschungsprogramm der Soziologie enthalten ist, wenn auch ein noch sehr weiter Weg zur Soziologie als einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin blieb. Denn »trotz der überragenden Leistungen des Aristoteles vermochten die Griechen nicht zur Soziologie als einer spezifischen Wissensdisziplin vorzudringen, da ihnen das Vermögen fehlte, zwischen Staat und Gesellschaft deutlich zu unterscheiden, so dass sie die sozialen Beziehungen niemals völlig unabhängig von ihren politischen Aspekten betrachteten, ja im Zweifelsfall dem politischen Aspekt stets Priorität vor dem sozialen einräumten« (EisermannEisermann, G. 1973, 4).
Das MittelalterMittelalter führte auf diesem Weg nicht weiter. Die starke Bindung an Autoritäten sowie das vorherrschende Interesse am »Wesen der Dinge«, d. h. an der »richtigen Ordnung« der zwischenmenschlichen Beziehungen in einer »vollkommenen Gesellschaft« (»societas perfecta«, Thomas von AquinThomas von Aquin) standen einer strikt erfahrungswissenschaftlichen und undogmatischen Auffassung von Gesellschaft im Wege.
Relativ isoliert und ohne unmittelbaren Einfluss auf die Soziologie blieb auch der Berber Ibn ChaldunChaldun, Ibn (1333–1406), der – in heute erstaunlicher Aktualität – in seinen Auseinandersetzungen mit der arabisch-islamischen Orthodoxie und ihrem Fundamentalismus die mittelalterlichen Fesseln der unbedingten Autoritätsgläubigkeit zerbrach und methodisch über die Beobachtung und rationale Analyse des menschlichen Zusammenlebens vielleicht als Erster die menschliche Gesellschaft zum Gegenstand einer eigenen Wissenschaft zu machen versuchte. Nicht umsonst knüpfen an ihn einige spätere soziologische Denker des 19. Jahrhunderts wie Frédéric Le PlayLe Play, F., Karl MarxMarx, K., Ludwig GumplowiczGumplowicz, L. und Franz OppenheimerOppenheimer, F. wieder an.
Als weiterer Vorvater der Soziologie kann sicher auch der Florentiner Niccolò MachiavelliMachiavelli, N. (1469–1527) gelten, der sich zu Beginn der italienischen Renaissance gegen jeglichen scholastisch-theologischen Dogmatismus wandte und die sozialen Gleichförmigkeiten in Geschichte, Gesellschaft und PolitikPolitik einer rein auf ErfahrungErfahrung(s) und BeobachtungBeobachtung beruhenden empirischen Analyse zu unterziehen suchte. Insbesondere in seiner 1532 erschienenen Schrift »Über den Fürsten« (Il Principe) stellt er nachdrücklich fest, dass die Menschen betrachtet werden müssten, wie sie sind und nicht, wie sie nach bestimmten Glaubenssätzen zu sein hätten. In seinem konsequenten Realismus verfocht er die These, dass das soziale Handeln des Menschen aus seinen Antrieben heraus verstanden werden müsse. Hierzu lieferte er im Principe bereits eine klassische sozialpsychologische StudieSozialpsychologie über die Ursachen und Effekte verschiedener Motivstrukturen auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Außerdem begründete er mit dieser Schrift eine Klassifikation politischer HerrschaftHerrschaft und legte eine bis heute häufig zitierte Liste bestimmter moralischer Eigenschaften des Regierenden und seiner MachtMacht- und Herrschaftstechniken im Hinblick auf eine möglichst effiziente Ordnung und Zielerreichung vor. Seitdem sind allerdings auch der Begriff des MachiavellismusMachiavellismus und die damit verbundene Vorstellung einer skrupellosen PolitikPolitik immer wieder Gegenstand macht- und herrschaftstheoretischer Diskussionen.
Die eigentliche zusammenhängende Vorgeschichte der Soziologie beginnt jedoch wohl erst mit der Krise des absolutistischen Staates, jener »crise de la conscience européenne« (HazardHazard, P. 1935), die die Gesellschaftslehre der AufklärungAufklärung hervorbrachte und zur Trennung von Staat und Gesellschaft führte. Neben vielen, in erster Linie philosophisch orientierten Beiträgen zur Gesellschaft und Politik ihrer Zeit (vgl. hierzu JonasJonas, F. 2021a, 7) werden jetzt für die erwachende Soziologie insbesondere jene Arbeiten begründend, die die GesellschaftGesellschaft(s) aus dem globalen philosophischen und theologischen Problembezug lösen und die bislang selbstverständliche Geltung von tradierten Werten und Institutionen in Frage stellen.
Hierzu zählen z. B. in England die staatspolitischen Schriften von Thomas HobbesHobbes, Th. (1588–1679), insbesondere dessen Abhandlung »Leviathan« von 1651, sodann die Vertreter eines empirischen Skeptizismus wie John LockeLocke, J. (1632–1704) und David HumeHume, D. (1711–1776) sowie die Theoretiker der sogenannten Schottischen Schule Adam SmithSmith, A. (1723–1790), Adam FergusonFerguson, A. (1723–1816) und John MillarMillar, J. (1735–1801).
In Frankreich wird diese Entwicklung vor allem von MontesquieuMontesquieu, Ch. (1689–1755) vorangetrieben, der seine zeitgenössische Gesellschaft einer beißend-ironischen Kritik unterzog und im Anschluss daran eine historisch-analytische Theorie des sozialen WandelsWandel, sozialer entwarf. In ähnlicher Weise profilieren sich nicht nur Jean-Jacques RousseauRousseau, J.J. (1712–1778) und der Marquis de CondorcetCondorcet, M.J.A.M. (1743–1794) als engagierte Kritiker einer moralisch verrotteten, feudalen Rokoko-Gesellschaft, sondern auch der zu den Frühsozialisten zählende Comte de Saint-SimonSaint-Simon, C.H. (1760–1825).
Wichtige vorsoziologische Quellen sind beispielsweise nicht nur RousseausRousseau, J.J. berühmt gewordene Abhandlung über den »Gesellschaftsvertrag«Gesellschaftsvertrag (Du contrat social, 1762), sondern auch seine Antwort auf die Preisfrage der Akademie von Dijon (»ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste zur Läuterung der SittenSitte beitrage«, 1750), in der der Autor nachhaltig und kompromisslos die von der Akademie gestellte Frage verneint und seine Auffassung insbesondere mit den Folgen der sozialen UngleichheitUngleichheit, soziale begründet. Diesen Gedanken führt er dann in der Abhandlung »Über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen« (1755) systematisch weiter, wobei er den folgenschweren Gedanken entwickelt, dass die Entstehung des EigentumsEigentum den eigentlichen Sündenfall des Menschengeschlechts bilde.
Grundlegende Beiträge für eine spätere Theorie des menschlichen Handelns sowie eine differenzierte Theorie der bürgerlichen GesellschaftGesellschaft(s)-, bürgerliche und des Staates lieferten im damals allerdings »revolutionsabstinenten« Deutschland vor allem die großen Philosophen der Romantik bzw. des deutschen Idealismus wie Immanuel KantKant, I. (1724–1804), Johann Gottlieb FichteFichte, J.G. (1762–1814), Friedrich SchleiermacherSchleiermacher, F. (1768–1835), Georg Wilhelm Friedrich HegelHegel, G.W.F. (1770–1831) und Friedrich Wilhelm SchellingSchelling, F.W. (1775–1854). Auch ist in diesem Zusammenhang der Staatsrechtler Lorenz von SteinStein, L.v. (1815–1890) zu nennen, der im deutschen Vormärz die ideologischen und politischen Positionen des in Bewegung geratenen BürgertumsBürgertum zu klären versuchte.
Sie und viele andere bedeutende Denker dieser Epoche wurden aufgrund bereits spürbarer tief greifender Veränderungen dazu angeregt, die GesellschaftGesellschaft(s) ihrer Zeit mit neuen Augen zu sehen:
An Stelle der traditionellen AgrarwirtschaftAgrargesellschaft, die vor allem auf Selbstversorgung ihrer Angehörigen angelegt war (marktunabhängige Subsistenzwirtschaft), trat in immer stärkerem Maße die Produktion von Waren, die man auf dem Markt gewinnbringend verkaufen konnte. Naturwissenschaftliche Entdeckungen und entsprechende technische Erfindungen und Entwicklungen verstärkten diesen Prozess.
Für Autoren, die den Beginn der IndustrialisierungIndustrialisierung aus eigener Anschauung und Erfahrung miterlebten, wird die fortschreitende ArbeitsteilungArbeitsteilung und ArbeitszerlegungArbeitszerlegung




























