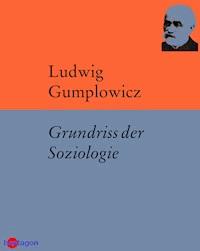
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gumplowicz sieht die Soziologie zur Zeit der Abfassung des Werkes (1884/5) als eine große Wissenschaft der Zukunft an und verfolgt das Ziel, 'einen einheitlichen Gesamtplan dieser Wissenschaft zu entwerfen'.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum.
Veröffentlicht im heptagon Verlag Berlin 2013 ISBN: 978-3-934616-52-3 www.heptagon.deVorwort.
Als »schüchterne Anfangslaute einer großen Wissenschaft der Zukunft – der Soziologie« bezeichnete ich vor zwei Jahren meine unter dem Titel »Der Rassenkampf« herausgegebenen »soziologischen Untersuchungen«. Die günstige Aufnahme, welche jenem Buche im In- und Auslande von kompetentester Seite zu teil ward, war mir eine Ermunterung, den »Anfangslauten« die hier vorliegenden Grundlinien einer Soziologie folgen zu lassen. Daß wir es bei der Soziologie nicht mit einer ephemeren Idee, sondern tatsächlich mit einer neu entstehenden Wissenschaft zu tun haben, dafür zeugt die Beharrlichkeit, mit der seit Comte denkende Köpfe der verschiedensten europäischen Nationen und auch Amerikas immer wieder auf dieses Problem zurückkommen. Wenn es mir gelungen ist, im »Rassenkampf« ein und das andere Prinzip für den Aufbau dieser Wissenschaft hinzustellen: so war ich im vorliegenden Grundriß redlich bemüht, auf diesen Prinzipien weiterbauend, einen einheitlichen Gesamtplan dieser Wissenschaft zu entwerfen, ihre Grenzen gegen benachbarte wissenschaftliche Gebiete abzustecken und innerhalb ersterer die wichtigsten Fragen, welche den Gegenstand ihrer weiteren Forschung bilden sollen, zu erörtern. Möge auch diese Arbeit dieselbe wohlwollende und nachsichtige Beurteilung finden, wie die vorhergehende!
Graz, im April 1885.
Ludwig Gumplowicz.
Erstes Buch. Grundlagen und Grundbegriffe.
I. Die drei Klassen von Erscheinungen.
§ 1. Nutzen der Klassifikation.
Es ist eine alte Regel, daß Einteilungen und Klassifikationen ein gutes Mittel der Erkenntnis sind; je sachgemäßer und zweckentsprechender dieselben, desto mehr Förderung hat die Erkenntnis von ihnen zu erwarten. So mußte sich denn auch die Gesamtheit der uns umgebenden Erscheinungen – das, was man auch als »Welt der Erscheinungen« bezeichnet – von jeher eine Einteilung gefallen lassen zu Nutz und Frommen unserer Erkenntnis. Aber mit fortschreitender Erkenntnis ändern sich auch diese Einteilungen, da man immer tiefere, das Wesen der Erscheinungen betreffende Einteilungsgründe kennen lernt.
So hat eine oberflächliche Betrachtung der leblosen Natur das Gebiet der belebten entgegengestellt. Eine andere Zweiteilung pflegte man auf die Unterscheidung zu gründen, je nachdem die einen Erscheinungen mit den Sinnen, die andern mit dem Verstande, mit unsern geistigen Kräften wahrnehmbar sind; die ersteren waren dann sinnliche, die letzteren geistige.
Eine fortgeschrittene Erkenntnis hat die leblose Natur in eine anorganische und organische gespalten. Indem man sodann neben die Erscheinungen der organischen Welt noch eine besondere Klasse von Erscheinungen hinstellte, welche man aus der Seele des Menschen als ihrer Quelle und ihrem Ursprung herleitete und dieselben als psychisch bezeichnete, erhielt man die Dreiteilung der uns umgebenden Erscheinungen in anorganische, organische und psychische.1 Welche Gruppe oder Art von Erscheinungen man unter jeder dieser drei Abteilungen verstanden wissen wollte, das liegt schon in der Bezeichnung selbst. Aber ebenso klar ist es, daß diese Einteilung mit einem gegebenen Stadium menschlicher Erkenntnis innig zusammenhängt. Sie hängt zusammen mit der Erkenntnis des Unterschiedes zwischen dem Anorganischen und Organischen, welches letztere man nicht mehr kurzweg als »leblos« bezeichnen wollte und von dem leblosen Anorganischen zu trennen bereits sich veranlaßt sah; sie hängt aber ferner auch zusammen, mit der wissenschaftlichen Überzeugung, daß alle Handlungen der Menschen, all ihr Tun und Lassen und somit alle Erscheinungen, die durch dieselben hervorgerufen werden, in einer denselben eigentümlichen, in ihnen befindlichen Seele (Psyche) ihren Grund haben. Ändert sich in diesem Punkte die wissenschaftliche Überzeugung, gelangt man zur Erkenntnis, daß die Annahme einer solchen Psyche falsch ist, daß die Gedanken und das ganze sogenannte Seelenleben des Menschen nichts anderes sind als eine Äußerung der physiologischen Funktion seines Organismus: so folgt daraus das Fallenlassen jenes Einteilungsgrundes »Psyche«, das Aufgeben jener Abteilung der psychischen Erscheinungen und das Unterordnen, derselben unter die organischen.
Auf diese Weise sind Einteilungen provisorische Förderungsmittel der Erkenntnisse: erworbene Erkenntnisse wieder die Grundlagen richtiggestellter neuer Einteilungen.
§ 2. Soziale Erscheinungen.
Es kann aber auch geschehen, daß sich uns Erscheinungen aufdrängen, von denen es uns nicht gleich klar ist, zu welcher der bisher bekannten Arten von Erscheinungen dieselben gehören – wir daher nicht gewiß sind, in welche von uns statuierte Abteilung wir dieselben unterbringen sollen.
Unser Verfahren in einem solchen Falle kann verschieden sein; entweder versuchen wir, diese uns neu sich aufdrängenden Erscheinungen so gut es geht, in eine der bestehenden Abteilungen hineinzuzwängen oder wir fassen dieselben als eine besondere Unterart zusammen, oder endlich, nachdem wir ein besonderes gemeinschaftliches Merkmal für dieselben ausfindig gemacht haben, welches ihnen ausschließlich zukommt, gehen wir daran, aus ihnen eine ganz selbständige Art, ein ganz besonderes Gebiet zu bilden.
Ein solcher Fall des Auftauchens einer neuen Art von Erscheinungen vor unserm erkennenden Geiste ereignete sich in neuerer Zeit: man stieß nämlich auf »soziale« Erscheinungen, die man aus vielen Gründen als eine besondere Klasse anerkennen mußte und mit denen man nicht recht wußte, was eigentlich anzufangen.
Die Gründe, welche für Zusammenfassung dieser Erscheinungen in eine besondere Klasse sprachen, waren folgende: sie konnten weder zu den anorganischen noch zu den organischen gezählt werden; sie boten weder die Merkmale der leblosen noch der lebenden; rein psychisch erschienen sie nicht, weil sie nicht aus der individuellen Psyche emanierten, – erschienen sie doch, ganze Massen von Menschen wider Willen und Bewußtsein mit sich fortreißend – so stellten sie den Systematikern ein Problem dar, das man auf eine der oben angegebenen Arten zu lösen versuchte.
Man hatte als soziale Erscheinungen vornehmlich diejenigen wahrgenommen, die an dem Staate zu Tage treten – also Staatsumwälzungen, Parteikämpfe, politische Bestrebungen usw. Die einen nun versuchten es, alle diese Erscheinungen einfach unter die alte Klasse der »organischen« unterzubringen. Es ist doch in alten Wohnungen, wo man sich schon häuslich eingerichtet hat, so bequem, und man zieht es immer vor, bei einem Zuwachs sich ein bißchen zu zwängen und zu drängen, um nur das lästige Übersiedeln in eine neue Wohnung zu vermeiden. So entstand die sogenannte »organische« Staatslehre, und Schäffle hat es in seinem dreibändigen Werke klar und deutlich bewiesen, wie alles das, was man soziale Erscheinungen nennt, im Grunde nichts anderes ist als »organische Funktion eines sozialen Körpers«, der ebenso Zellen, Gewebe, Nerven, Muskeln, Fleisch, Knochen und Blut hat wie jeder tierische Organismus. Nun, es gibt noch heutzutage Leute, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, die ihm das aufs Wort glauben; wir gehören nicht zu diesen.
Andere aber, die etwas weniger Phantasie und mehr Reflexion hatten, dabei aber die Umwerfung alter, liebgewordener Ordnungen nicht minder perhorreszierten, halfen sich auf folgende Weise. Alles das, was im Staate und am Staate vorgeht, das macht offenbar der Mensch – denn wer sollt's denn sonst machen? Alles aber, was der Mensch macht, entspringt der Psyche, die in ihm sitzt – daher gehören die sozialen Erscheinungen ebenfalls zu den psychischen. Allerdings unterscheidet sich so ein soziales Ereignis von einem individuellen Gedanken oder Gefühl – nun! diesem Unterschied läßt sich ja durch eine »Unterabteilung« Rechnung tragen – aber »psychisch« bleibt »psychisch«. So behandelt denn, um wieder statt unzähliger Beispiele den einen Rümelin zu zitieren, dieser hochachtbare Gelehrte die sozialen Erscheinungen als psychische und infolgedessen »soziale Gesetze als eine besondere Art der psychischen«.2
Aber ebensowenig, wie mit der Subsumierung der sozialen Erscheinungen unter die organischen, können wir uns mit Unterordnung derselben unter die psychischen einverstanden erklären. Vielmehr scheint es uns am richtigsten, die Erscheinungen der uns umgebenden Welt, die den Gegenstand unserer Wahrnehmung und Beobachtung bilden, in dreierlei Arten zu teilen: in physische, geistige und soziale.
Wir stellen aber diese letzteren aus dem Grunde als eine besondere Art von Erscheinungen hin, weil dieselben eine besondere, durch mehrere prinzipielle charakteristische Merkmale abgesonderte Gruppe bilden und es daher in Bezug auf wissenschaftliche Untersuchungen zweckdienlich erscheint, dieselben zu einer besonderen Gruppe zusammenzufassen.
Welches sind nun diese unterscheidenden Merkmale? Allerdings können wir auch die sozialen Erscheinungen nicht mit den »Sinnen« wahrnehmen, und insoferne hätte man guten Grund, dieselben zu den geistigen zu zählen. Andrerseits kommen die sozialen Erscheinungen immer nur durch ein Zusammenwirken einer Vielheit von Menschen zustande, während die von uns schlechtweg geistig genannten Erscheinungen tatsächlich nur an dem Geiste des einzelnen haften, in ihm den Ausgangspunkt und sozusagen ihr einziges Terrain haben.
So sind zum Beispiel alle Zustände der Seele, alle wissenschaftliche Tätigkeit und Kunstäußerung des menschlichen Geistes, alle Werke desselben in Kunst und Wissenschaft, insoferne sie mit dem Geiste perzipiert werden können – alle Gedanken und Ideen, die, vom menschlichen Geiste ausgehend, den Gegenstand geistiger Wahrnehmung bilden, geistige Erscheinungen.
Dagegen sind soziale Erscheinungen alle Verhältnisse der Menschen zueinander, also alle staatlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Die notwendige Voraussetzung einer Mehrheit von Menschen, die bei den im eigentlichen Sinne geistigen Erscheinungen nicht vorhanden zu sein braucht, ohne die aber eine soziale Erscheinung nicht denkbar ist, diese notwendige Voraussetzung bildet das unterscheidende Merkmal dieser letzteren. (Vgl. unten Kap. III, § 2.)
Seither hat Emil Durkheim in wahrhaft bahnbrechender Weise den Begriff einer sozialen Erscheinung klargestellt. Schon in seinem Werke »La division du travail social« (1893) weist er darauf hin, daß »alle diejenigen Erscheinungen, die man nicht aus der Beschaffenheit der organischen Gewebe erklären kann« (also weder physiologisch noch psychologisch), »offenbar aus dem sozialen Milieu abgeleitet werden müssen« (l.c., p. 389). Diesen Gedanken führt Durkheim sodann in seiner Abhandlung »Les regles de la Méthode historique« (zuerst »Revue philos.«, 1894) weiter aus. Was ist eine soziale Erscheinung? fragt er da. Der Umstand allein, daß an gewissen Tatsachen und Handlungen die Gesellschaft ein Interesse nimmt, konstituiert noch nicht ihren sozialen Charakter. Wenn ein Mensch ißt, trinkt, schläft, so sind das keine sozialen Handlungen, trotzdem die Gesellschaft daran ein Interesse hat, daß dieselben ordnungsmäßig vor sich gehen. Wenn wir aber Pflichten erfüllen, die uns durch Recht und Sitte vorgeschrieben sind, so sind das soziale Handlungen. »Nicht nur, daß solche Handlungen und die sie begleitenden Gesinnungen nicht aus unserem Innern stammen: sie sind obendrin mit einer zwingenden Gewalt ausgestattet, der wir uns fügen müssen, ob wir wollen oder nicht.« Vorgänge also, Denkungsarten, Gefühle, die außerhalb des Individuums gebildet wurden und sich demselben zwingend aufdrängen, sind soziale Erscheinungen.
Ein charakteristisches Merkmal der sozialen Erscheinung bildet es also, daß sich dasselbe sozusagen über die Köpfe der einzelnen hinweg abspielt, dieselben mit sich fortreißt und von ihrem Einzelwillen ganz unabhängig ist. Die Beobachtung dieser Tatsache gab Veranlassung, von einer Massenpsyche zu sprechen und eine Massenpsychologie zu schaffen, da man eben solche soziale Erscheinungen weder aus dem Einzelwillen noch aus den Einzelpsychen erklären konnte.
§ 3. Soziale Gesetze.
Wie es nun im Grunde genommen nur eine einheitliche Welt ist, die uns umgibt und alle Einteilung ihrer Erscheinungen nur ein Hilfsmittel für unsere Erkenntnis ist, so gibt es dem Begriffe nach auch nur eine Wissenschaft, welche sich die Erforschung der Gesetze dieser Erscheinungen zur Aufgabe stellt. Denn, wie wir das schon an andrer Stelle begründeten,3 geht das Bestreben aller Wissenschaft dahin, die Gesetze zu erforschen, welche die Aufeinanderfolge und die Entwicklung der Erscheinungen beherrschen.
Entsprechend jedoch der Einteilung der Erscheinungen in mehrere Arten und dem Bedürfnisse nach einer Teilung der Arbeit auf dem Gebiete der Wissenschaft: wurde auch von jeher eine Einteilung der Wissenschaften in mehrere Klassen, die sich besondere Arten von Erscheinungen zum Gegenstande nahmen, für zweckmäßig erkannt und vorgenommen.
Die bekannteste und gebräuchlichste dieser Einteilungen ist die, der Zweiteilung der Erscheinungen in physische und geistige entsprechende, in »Natur- und Geisteswissenschaften« (letztere auch moralische und moralisch-politische genannt).
Die Naturwissenschaften hatten es also mit den Erscheinungen auf dem Gebiete der anorganischen und organischen Natur und mit den dieselben beherrschenden Gesetzen (den physischen) zu tun; die Geisteswissenschaften forschten nach den Gesetzen, die den menschlichen Geist und dessen Entwicklung beherrschen. Als nun Comte und nach ihm Quételet für die Wissenschaft ein neues Gebiet von Erscheinungen, das der sozialen, und zugleich die Behauptung aufstellten, daß auch diese Erscheinungen gleich allen andern von festen Gesetzen beherrscht werden, da mußte die Frage nach dem Wesen und Begriff eines sozialen Gesetzes in den Vordergrund des Interesses treten.
Denn allerdings war es nicht so leicht, sich darüber Rechenschaft zu geben, was denn ein soziales Gesetz sei? Und doch steht und fällt mit einer klaren, positiven Begriffsbestimmung eines sozialen Gesetzes die Frage nach einer Wissenschaft der sozialen Erscheinungen, die Existenzfrage der Soziologie.
Wollen wir nun diese Frage beantworten, so müssen wir zuerst an den Begriff eines Naturgesetzes überhaupt erinnern; indem wir diesen Begriff sodann auf das Gebiet der sozialen Erscheinungen übertragen, wird sich uns der aus demselben abgeleitete Begriff eines sozialen Naturgesetzes oder schlechtweg eines sozialen Gesetzes ergeben, und zwar erst nur in der Abstraktion ohne Rücksicht darauf, ob ein solches in der Wirklichkeit existiere oder nicht; endlich werden wir die allseitig erhobenen Einwendungen gegen die Existenz solcher sozialen Gesetze prüfen, von deren Widerlegung es abhängt, ob wir das Terrain einer Soziologie betreten können. Denn daran müssen wir festhalten: ohne soziale Gesetze keine Soziologie. –
Wo immer uns Erscheinungen in derselben Form der Aufeinanderfolge oder der Koexistenz entgegentreten, da sprechen wir von einem dieser Gleichförmigkeit zu Grunde liegenden Gesetze. Es ist das offenbar nur eine Analogie oder Metapher. Das Urbild derselben ist dem politischen Leben entnommen. Wenn ein Gesetz für bestimmte Fälle die Beobachtung eines bestimmten Vorganges anbefiehlt, so geschieht dieses in allen bezüglichen Fällen in derselben durch das Gesetz vorgeschriebenen Form. Wo wir also in der Natur eine Erscheinung in derselben Form sich wiederholen sehen, da stellen wir uns die Sache der größeren Verständlichkeit wegen so vor, als ob diese Gleichförmigkeit die Folge irgend eines höheren, in einem Gesetz sich verkörpernden Willens wäre, und sprechen kurzweg von einem Gesetz dieser Erscheinungen. Wir erlangen durch diese Metapher für eine Reihenfolge von Erscheinungen einen leicht verständlichen Ausdruck, eine einfache Formel.4
Nun fragt es sich: können auch für soziale Erscheinungen solche Gesetze aufgestellt werden, oder, mit andern Worten: gibt es auch soziale Gesetze? Wir werden diese Frage bejahen müssen, wenn wir auf dem sozialen Gebiet Gleichförmigkeiten in der Aufeinanderfolge und Koexistenz der Erscheinungen antreffen, von denen uns Erfahrung und Geschichte lehren, daß sie sich immer wiederholen, so daß wir diese immer wiederkehrenden Gleichförmigkeiten ganz so wie die auf physischem Gebiete einem supponierten, fiktiven, höheren Willen, einem »Gesetze« zuschreiben können. Das ist nun entschieden der Fall. Das Verhalten sozialer Gruppen zueinander, die Bildung sozialer Gemeinschaften, die Entwicklung und der Untergang derselben zeigen uns unwidersprechlich eine Reihe solcher Gleichförmigkeiten, und wir können daher sehr wohl die Forschung auf sozialem Gebiete darauf richten, für diese Gleichförmigkeiten die einfachsten Formeln, soziale Gesetze, aufzustellen.
An und für sich ist diese Sache nun so klar und einfach, daß, wäre sie allerseits anerkannt, man darüber gar nicht viel Worte zu verlieren brauchte. Leider aber ist dies nicht der Fall, und es wird gegen die Aufstellung sozialer Gesetze, d.h. der Naturgesetze der sozialen Entwicklung, mit großer Heftigkeit gekämpft. Ursache dieses Widerspruches ist die Sorge um Aufrechterhaltung der menschlichen »Willensfreiheit« – denn man befürchtet, daß die Annahme von Naturgesetzen sozialer Entwicklung dieser Willensfreiheit den Todesstoß versetzen würde.
§ 4. Rümelin.
Den inneren Kampf dieser beiden Prinzipien, das zweifelvolle Schwanken zwischen Naturgesetz und Willensfreiheit bezüglich sozialer Erscheinungen, veranschaulichen uns vortrefflich die mit anerkennenswerter Aufrichtigkeit geschriebenen Selbstbekenntnisse Rümelins. In jüngeren Jahren neigte er zur Annahme, daß es auf sozialem Gebiete (welches er, wie wir wissen, als eine Unterabteilung des psychischen auffaßt) Naturgesetze gebe. Er gab dieser Anschauung Ausdruck in einer akademischen Rede: »Über den Begriff eines sozialen Gesetzes«. Das war im Jahre 1868. Nachdem er da nun von einem Naturgesetze überhaupt die Definition gibt, daß es »der Ausdruck für die elementare, konstante, in allen einzelnen Fällen erkennbare Wirkungsweise der Kräfte« sei: stellt er sich die Frage, »ob dieser zunächst den Vorgängen der leblosen Natur entnommene Begriff von Gesetzen auch auf die der belebten anwendbar ist«? Und diese Frage bejahte Rümelin damals, wenn auch nicht mit großer Zuversicht. Er sagte: »Es ergaben sich uns drei Arten von Kräften: physische, organische und psychische; und es ist keine vierte Art von koordinierter Stellung denkbar. Die sozialen Erscheinungen sind eine Unterart der psychischen. Es gibt zwei Arten von psychischen Erscheinungen: die psychologischen und die sozialen.«
Diese letzteren scheint Rümelin auf dem Gebiete der Nationalökonomie ziemlich rückhaltlos anzuerkennen. Da diese Wissenschaft »ausdrücklich oder stillschweigend von der Voraussetzung ausgeht, daß die Menschen von Natur eine ausgesprochene Neigung haben, sich die zur Befriedigung ihres Trieblebens dienlichen äußerlichen Mittel möglichst reichlich und mit der möglichst kleinen Gegenleistung zu verschaffen«, so »scheint« es ihm, daß »die Nationalökonomie in ihrem vollen Rechte ist, wenn sie ihre Fundamentalsätze von den Bewegungen der Preise und Arbeitslöhne, von der Konkurrenz, dem Geldumlauf, geradezu Gesetze nennt; denn sie entsprechen genau der obigen Forderung, indem sie uns die konstanten Grundformen für die Massenwirkung psychischer Kräfte aufzeigen.«
Viel bedenklicher steht Rümelin schon den sogenannten statistischen Gesetzen gegenüber – er ist sich nicht ganz klar, ob er dieselben als soziale Gesetze anerkennen soll. Folgende Reflexionen sollen ihm offenbar die Entscheidung erleichtern: »Die Psychologie betrachtet die Seelenkräfte an typischen Individuen als Merkmale der Gattung; die sozialen Wissenschaften betrachten dieselben Kräfte in ihrer Massenwirkung, und zwar gerade mit den Effekten, Veränderungen und Modifikationen, welche sich aus dem Moment der Massenwirkung selbst ergeben. Ein soziales Gesetz müßte hienach der Ausdruck sein für die elementare Grundform der Massenwirkung psychischer Kräfte«.
Die statistischen Gesetze scheinen ihm nun nicht ganz diesen Merkmalen eines sozialen Gesetzes zu entsprechen. Er hat da seine gewichtigen Einwände. Er kann nicht alles, was die Statistiker als Gesetz proklamieren, als »soziales Gesetz« anerkennen, und darin hat er Recht. In den bezüglichen Gedankenreihen der Statistiker (vornehmlich Quételets) sieht er »bedeutende Wahrheiten mit leichteren und gröberen Mißverständnissen in einen dichten Knäuel verschlungen« – und auch darin wollen wir ihm beistimmen.
Unbefriedigt schließt er seine »Rundschau nach sozialen Gesetzen«. »Die Ausbeute war nicht groß«, meint er; das brauche aber »dem Zweig der sozialen Fächer« nicht zum Vorwurfe zu gereichen. »Die jüngsten Wissenschaften«, so tröstet Rümelin die Soziologen, »sind immer die schwersten; denn sie behandeln Probleme, welche man früher ganz übersah oder gar nicht die Mittel hatte, in Angriff zu nehmen.« Doch versichert er, daß er »von der Zukunft der Statistik, von dem wissenschaftlichen Wert, den eine fortgeführte und immer weiter ausgebildete methodische Beobachtung der Tatsachen haben wird, die höchste Meinung« habe. Kurzum, er gibt die Hoffnung nicht auf, daß es vielleicht gelingen werde, die echten sozialen Gesetze ans Tageslicht zu schaffen – doch verhehlt er keineswegs die Bedenken, die er in dieser Hinsicht hegt. Das war im Jahre 1868.
Zehn Jahre später, im Jahre 1878, hielt Rümelin wieder eine Rede über »Gesetze der Geschichte«. Da gibt er uns nun Rechenschaft über seine seither gepflogenen Beobachtungen über dasselbe Problem, und berichtet uns, ob seine hinsichtlich der »sozialen Gesetze« vor zehn Jahren gehegten Hoffnungen sich erfüllt haben.
Letzteres war nicht der Fall. Der zehn Jahre älter gewordene Gelehrte gibt seiner Enttäuschung unverhohlenen Ausdruck: er hatte vor zehn Jahren Hoffnungen, dabei aber auch gewichtige Bedenken ausgesprochen. Die ersteren sind zerronnen – die letzteren dagegen haben sich, wie er nun tief überzeugt ist, vollkommen bewährt.
»Ich war der Meinung«, erzählt uns diesmal Rümelin fast wehmütig, »es müsse solche Gesetze (soziale) geben, und die Statistik sei vielleicht besonders fruchtbar an Mitteln, dieselben aufzufinden. Ich habe nun durch eine Reihe von Jahren die Aufgabe, Gesetze solcher Art zu finden, nie aus den Augen verloren und habe sie nicht bloß in der Statistik und Gesellschaftslehre, sondern auch bei den Historikern und Philosophen gesucht. Ich stieß dabei auf zahlreiche Gleichförmigkeiten, auf Erfahrungssätze von umfassender Tragweite, auf sichere Kausalzusammenhänge, aber niemals auf einen Satz, der jener Formel für ein Gesetz entsprochen, der die konstante und unausbleibliche Grundform für die Massenwirkung psychischer Kräfte zum Ausdruck gebracht hätte.« Und nun geht Rümelin daran, die Ursache dieses vergeblichen Suchens eines sozialen Gesetzes klar zu machen, und er »neigt« zur Ansicht, »daß keine richtig gestellte Aufgabe vorlag und daß sich das überhaupt nicht finden läßt, was er gesucht habe«. Den tieferen Grund aber dieser Unmöglichkeit, soziale Gesetze zu finden, sieht er darin, daß »die physikalischen und psychischen Erscheinungen bis zur Unvergleichbarkeit voneinander abweichen«, daß »zwischen materiellem Sein und räumlicher Bewegung auf der einen, Empfindung, Denken und Wollen auf der andern Seite, eine unausfüllbare und bis jetzt noch unüberbrückbare Kluft besteht«, infolgedessen es sogar »befremdlich wäre, wenn eine und dieselbe Formulierung des Gesetzbegriffes auf beide Gebiete anwendbar wäre«. Wir sehen, Rümelin ist in höherem Alter wieder mit vollen Segeln auf das Meer des Dualismus gelangt, somit darf es auch nicht Wunder nehmen, daß er in der weiteren Ausführung des prinzipiellen Gegensatzes zwischen Materie und Geist auf dem Gebiete des letzteren jede Möglichkeit eines Gesetzes abstreitet, einfach darum, weil auf diesem Gebiete die »menschliche Willensfreiheit« herrscht. Und nun kommen über dies alte Thema die alten Argumente. »Wer die Willensfreiheit leugnet, ist verbunden, Naturgesetze nachzuweisen, die das Wollen bestimmen und die Freiheit ausschließen. Der Determinismus versucht dies ja auch, wenn uns zum Beispiel gesagt wird, das menschliche Wollen werde mit Naturnotwendigkeit durch das stärkste Motiv bestimmt. Wenn dies nur mehr wäre als eine wertlose Tautologie (?!), wenn uns nur verständlich gemacht würde, was denn sonst ein Motiv zum stärksten machen könne, als eben das Wollen!«
Sonderbar! Warum sollen denn nicht äußere Umstände ein Motiv zum stärksten machen können, und wie kommt denn ein deus ex machina, Wille genannt, dazu, ein Motiv, also ein äußeres Moment, zu verstärken? Jenes äußere Moment wirkt mit der ihm der Sachlage nach innewohnenden Kraft – wie der Dampf auf die Lokomotive – braucht's etwa bei der Lokomotive noch der Vermittlung des Willens, um die Kraft des Dampfes über die Kraft der Trägheit siegen zu lassen? Ebensowenig braucht's beim Menschen dieser vermeintlichen Vermittlung und Nachhilfe des »Willens«, um ein an und für sich stärkeres Motiv erst noch zu einem stärkeren zu machen. Der Unterschied zwischen der Lokomotive und dem Menschen liegt nur im Bewußtsein, d.i. in jenem inneren Sinn, welcher gleichsam wie ein inneres Auge diese intimen Vorgänge sieht, sich deren bewußt wird, also den Kampf der Motive und das Siegen des stärkeren beobachtet. Nur verwechselt die vulgäre Meinung diese Wahrnehmung mit einem freien Willen; das Bewußtwerden des Übergewichtes des stärkeren Motives hält sie für die Entscheidung des freien Willens. Doch das alles sind längst bekannte Dinge, welche aber die Anhänger des Dualismus und der Willensfreiheit noch lange nicht bekehren werden, weil eben die Kraft geistiger Trägheit und geistigen Konservatismus nicht so leicht überwunden werden kann! –
Verharrt man aber unerschütterlich auf dem Standpunkte des Dualismus von Geist und Materie, dann ist allerdings die Annahme eines sozialen Gesetzes im Sinne eines Naturgesetzes der sozialen Entwicklung eine Unmöglichkeit. Rümelin hat daher von seinem dualistischen Standpunkte aus vollkommen Recht, d.h. er bleibt sich völlig konsequent, wenn er jedes solche soziale Gesetz und daher auch jedes »Gesetz der Geschichte« verwirft. Folgender Satz seiner Rede ist vollkommen logisch: »Ich muß es als eine widerspruchsvolle und im einzelnen nicht begreiflich zu machende Theorie bezeichnen, wenn man der einzelnen Menschenseele die Willensfreiheit im Sinne einer vernünftigen oder unvernünftigen Selbstbestimmung innerhalb des weiten Spielraumes gegebener Anlagen beilegt (?), aber in den Zuständen und Geschichten der Menschheit oder der einzelnen Völker und Zeitalter eine feste Determination und Notwendigkeit erkennen will. Der psychologische und der historische Indeterminismus stehen und fallen miteinander ... Wenn der gesamte Komplex der gesellschaftlichen Verhältnisse, in die ich hereingestellt bin, all mein Denken und Tun bestimmt, oder mir das winzigste Feld individueller Selbständigkeit übrig läßt, so kann von Freiheit und Zurechnung nicht weiter die Rede sein. Wenn ich aber, von mir selbst heraus eine neue Reihe von Wirkungen hervorzubringen, mich im Widerspruch mit den Meinungen und Gewohnheiten der andern ausbilden und behaupten kann (?), dann ist auch von dem Ganzen der Gemeinschaft ein freies Geschehen, ein unableitbares Vorschreiten in neue Bahnen nicht auszuschließen und die Notwendigkeiten beschränken sich auf die Geltung der allgemeinen Schranken menschlichen Wirkens und den unvermeidlichen Einfluß der Gemeinschaft auf den einzelnen.«
Viel trägt dabei zum Beharren in der hergebrachten dualistischen Ansicht der Irrtum bei, als ob »naturgesetzliche Bestimmtheit und Notwendigkeit« alle Vernunfttätigkeit und jedes »Gewissen« ausschließen würde.
So sagt zum Beispiel Rümelin: »Oder es wird uns die Lösung geboten, das Wollen sei mit Notwendigkeit bestimmt als das Produkt aus dem individuellen Charakter, wie er durch ererbte Eigenschaften, Erziehung und Lebensgang geworden sei, und aus den konkreten Umständen des gegebenen Falles. Wenn dabei zugestanden wird, daß unter den ererbten Anlagen auch Vernunftanlage und Gewissen mit enthalten und beim Wollen in ihrer Weise mitzuwirken imstande sind, so kann man sich die Antwort gefallen lassen, nur ist es dann ein bloßer Wortstreit noch von naturgesetzlicher Bestimmtheit, von Notwendigkeit des Wollens zu sprechen.« Als ob Vernunft und Streben nicht das Produkt naturgesetzlicher Vorgänge sein könnte und tatsächlich wäre! Als ob man nicht ganz wohl von naturgesetzlicher Entwicklung der Vernunft und des Strebens und Wollens (d.h. des durch Motive beeinflußten und erzeugten Strebens) sprechen könnte!
Und durch solche Irrtümer hindurch gelangt nun Rümelin (immer als treuer Repräsentant der ganzen dualistischen Weltanschauung) zu dem Satze, den er »gezeigt zu haben« glaubt, »daß das psychologische Gesetz durchaus anderer Natur und Gestalt ist als das physikalische und daher mit demselben auch nicht wohl unter eine Formel fallen kann«.
Wie gesagt, das alles ist vollkommen logisch – nur die Prämisse von der Willensfreiheit und Selbstbestimmung ist falsch. Nun mag Rümelin – und das dient zu seiner Entschuldigung – allerdings Recht haben, wenn er sagt, man habe ihm die Gebundenheit des Einzelwesens durch die Gesellschaft noch nicht zur Evidenz bewiesen; das geben wir allerdings zu. »Ich vermag mich nicht zu überzeugen, daß alle Forschung über das Verhältnis zwischen dem einzelnen und der Gesellschaft auch nur einen Schritt weiter geführt hat als zu dem Begriff einer innigen und allseitigen Wechselwirkung, in welcher sich, wenn auch in der mannigfachsten Abstufung, alle zugleich gebend und empfangend, aktiv und passiv verhalten.« Aber dieser bisherige Mangel eines genügenden Beweises ändert nichts an der Tatsache der Willensunfreiheit und es wäre wohl Sache eines philosophischen Denkers gewesen, nicht auf den durch andere zu liefernden Beweis sich zu steifen, sondern die Frage selbst ins Auge zu fassen, selbst dazu zu schauen, wie sich die Sache in Wirklichkeit verhält.
Hätte Rümelin das vorurteilsfrei getan (woran ihn sein Dualismus allerdings hinderte), so würde er vielleicht seine falsche Prämisse von der Willensfreiheit aufgegeben, mithin alle falschen Folgerungen aus derselben fallen gelassen haben – und hätte nicht eine lange Rede darüber gehalten, wie die genialen Männer die Weltgeschichte machen – eine Rede, wie sie gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts an einer deutschen Universität von einem weltlichen Professor nicht gehalten werden sollte! Wir sagen »von einem weltlichen«, denn der von Rümelin eingenommene Standpunkt ist einfach ein theologischer und ein solcher, wie er all und jeder Theologie der Natur der Sache nach einzig und allein entspricht.
Der Dualismus von Geist und Materie ist eben eine Grundlage aller Religion – diese aber ein Bedürfnis des Gemütes der Massen; – Freiheit und Selbstbestimmung als notwendige Konsequenz des Dualismus ein integrierender Bestandteil jedes religiösen Systems. Daher fällt es uns auch gar nicht bei, hier den Dualismus zu bekämpfen, auch abgesehen davon, daß die moderne Philosophie und Naturwissenschaft uns der Mühe überhebt, den Monismus zu begründen. Letzterer ist ebenso richtig und wahr, wie ersterer für das Gemüt der meisten Menschen notwendig ist. Für diese »meisten« schreiben wir nicht; sie mögen unser Buch ungelesen lassen. Wir wenden uns an die Anhänger des Monismus und es handelt sich uns darum, die Konsequenzen desselben auf sozialem Gebiete zu entwickeln – was eben die einzige und alleinige Aufgabe der Soziologie sein muß.
Seither hat es Gustav Ratzenhofer in seiner »Positiven Ethik« (1901) zur Genüge bewiesen, daß sich eine »naturgesetzliche Bestimmtheit« und »Notwendigkeit« mit Moral und Sittlichkeit sehr gut verträgt und ein »Gewissen« durchaus nicht ausschließt, wie das Rümelin befürchtete. Die einschlägigen Ausführungen Ratzenhofers (a.a.O., S. 121 ff.), müssen als endgültige Beseitigung der »moralischen« und »ethischen« Skrupel der Dualisten gegen den Monismus und gegen soziale Gesetze, betrachtet werden.
II. Allgemeine Gesetze.
§ 1. Monismus und soziale Erscheinungen.
Der siegreiche Nachweis der modernen Naturwissenschaft, daß auch der »Geist des Menschen« physischen Gesetzen unterliegt, daß die am Einzelgeiste haftenden geistigen Erscheinungen nur ein Ausfluß der Materie, und als solcher nur Nachwirkungen der physischen Gesetze sind: auch dieser Nachweis war in neuester Zeit noch nicht im stande, die Herrschaft unabänderlicher Naturgesetze auf dem Gebiete der sozialen Erscheinungen zu beweisen. Denn immer noch trat störend und verwirrend zwischen den von den Gesetzen der Materie beherrschten geistigen Erscheinungen und der sozialen Welt das Phantom der menschlichen Freiheit, welche anscheinend die sozialen Verhältnisse nach eigener Wahl ordnen und beherrschen sollte. Denn der Monismus beschränkte sich mit seinen Nachweisungen und Beweisen auf das Gebiet der geistigen Erscheinungen im engeren Sinne des Wortes. Hier hat die monistische Naturwissenschaft teils die unbedingte Herrschaft physischer Gesetze, teils die Unmöglichkeit des Vorhandenseins anderer Faktoren nachgewiesen; auf dem Gebiete der sozialen Erscheinungen hat der Monismus den Sieg noch erst zu erringen. Der auf dem Gebiete der rein geistigen Erscheinungen geschlagene Dualismus hat sich auf das Feld der sozialen Erscheinungen zurückgezogen und hält sich da noch in seinen mächtigen Verschanzungen. So lange aber der Feind nicht aus diesen letzteren verdrängt wird, ist der Triumph des Monismus kein vollständiger. Diese noch zu lösende Aufgabe ist es auch, welche unsere Einteilung und Unterscheidung der geistigen und sozialen Erscheinungen notwendig machte. Denn es ist eine alte taktische Regel, das feindliche Heer zu zersplittern und die zersplitterten Scharen einzeln zu fassen. Die Kernfrage des Monismus nun auf sozialem Gebiete, von deren günstiger Entscheidung seine Berechtigung abhängt, ist die nach der Existenz allgemeiner Gesetze, welche nicht nur auf dem Gebiete der physischen und geistigen, sondern auch auf dem der sozialen Erscheinungen Geltung haben. Gibt es solche Gesetze, dann ist die monistische Lehre begründet; sind solche Gesetze unauffindbar, dann ist der Monismus ebenso eine unbewiesene Hypothese wie der Dualismus.
§ 2. Falsche Verallgemeinerungen.
Die Frage nach dem Vorhandensein solcher allgemeinen Gesetze, welche gleicherweise auf physischem und geistigem wie auch auf sozialem Gebiete sich manifestieren – diese Frage, deren Lösung zu wiederholten Malen in Angriff genommen wurde, begegnet noch, wie wir gesehen haben, einer entschiedenen Abweisung.
Das haben nun allerdings die ersten Verteidiger des Monismus auf dem Gebiete der sozialen Erscheinungen selbst verschuldet.
Denn mit großem Eifer und minderer Überlegung glaubten sie einfach, die auf dem Gebiete der physischen Erscheinungen gefundenen Gesetze der Anziehung und Abstoßung, der Schwere und dergleichen auch auf das Gebiet der sozialen Erscheinungen übertragen zu sollen. Andere wieder glaubten in den sozialen Gestaltungen den tierischen Organismen ähnliche Gebilde zu sehen und alle die für jene geltenden Gesetze als auch auf sozialem Gebiete geltend und herrschend annehmen zu dürfen. Wir haben bereits an andrer Stelle auf das Unpassende und Nichtzutreffende dieser Annahmen hingewiesen und führen das nähere hierüber noch in folgendem aus.
Diese Irrtümer im Detail erschüttern aber keineswegs den richtigen Hauptgedanken, daß es in der Tat allgemeine Gesetze gebe, welche gleicherweise das physische, geistige und soziale Gebiet beherrschen. Von ihrer Erkenntnis hängt die wissenschaftliche Berechtigung der Soziologie ab; nur der Nachweis ihrer Existenz und Geltung kann die Soziologie als Wissenschaft begründen.
Auf einige derselben wollen wir hier direkt hinweisen.
Bevor wir dies jedoch tun, müssen wir zuerst noch die Frage beantworten, inwiefern man überhaupt für so heterogene Erscheinungen wie physische, geistige und soziale die Existenz gemeinsamer allgemeiner Gesetze annehmen kann.
Offenbar darf man dabei nicht zu tief ins Spezielle und Artangehörige hinuntersteigen: denn da, wo die Eigenart eines dieser Gebiete anfängt, da hört das Gemeinsame auf. Wo also die physische Natur anfängt, da hört die Gemeinsamkeit der für das Geistige und Soziale geltenden Gesetze auf.
Allerdings müssen wir auf den Einwurf gefaßt sein, daß wir diese allgemeinen Gesetze einer so hohen Sphäre der Abstraktion entnehmen, wo alles Besondere im Begriff der bloßen Existenz aufgeht. Dieser Einwurf ist nicht stichhältig, denn wir werden diese allgemeinen Gesetze nicht in jener höchsten Sphäre des Existenzbegriffes suchen, wo sie allerdings leicht zu finden, doch ohne Bedeutung wären. Vielmehr werden wir dieselben in der nahe an die Besonderheiten dieser drei Gebiete angrenzenden Sphäre der Existenzmodalitäten zu finden trachten und damit unsere Aufgabe als erledigt ansehen. Denn diese Gesetze in der untersten Sphäre eines dieser Gebiete, namentlich in derjenigen der physischen Naturerscheinungen, gesucht zu haben, war der Hauptirrtum unserer Vorgänger, in den wir nicht wieder verfallen dürfen. Wir dürfen also nicht, wie es unsere Vorgänger machten, organische Lebensgesetze, die dem besonderen Gebiete der organischen Natur angehören, zu verallgemeinern und auf die besonderen Gebiete der psychischen und sozialen Erscheinungen auszudehnen suchen. Wohl aber können und müssen wir unsere allgemeinen Gesetze in der Sphäre der Existenzmodalitäten alles Seienden suchen und uns damit begnügen, in den hier gefundenen Gesetzen jene Schlüssel zu besitzen, die nach Bastians Ausdruck »nach allen Seiten hin aufschließen«. –
Wir übergehen nun zur beispielsweisen Aufzählung dieser allgemeinen Gesetze.
§ 3. Das Gesetz der Kausalität.
Gleichwie auf dem Gebiete der physischen und geistigen Erscheinungen, gilt auch auf unserem Gebiete das Gesetz der Kausalität. Jede soziale Erscheinung ist eine notwendige Wirkung vorhergegangener sozialer Ursachen. Keine soziale Erscheinung entspringt voraussetzungslos aus dem Nichts individueller Launen. Der Satz vom zureichenden Grunde gilt auch auf sozialem Gebiete. Jede soziale Erscheinung, sei es eine staatliche, rechtliche oder wirtschaftliche, muß in einer oder mehreren sozialen Verursachungen ihren zureichenden Grund haben. Dabei muß ebenso wie auf physischem und geistigem Gebiete zwischen Ursache und Wirkung ein Verhältnis der Gleichheit oder doch der Proportionalität der Kraft obwalten. Eine individuelle Tatsache wird nie eine soziale erzeugen, so sehr auch der Schein uns trügen mag. Die Tat eines einzelnen wird nie einen solchen Zustand schaffen oder ändern; nur eine soziale Einwirkung erzeugt einen sozialen Zustand. Im gegebenen Falle diesen richtigen Zusammenhang nachzuweisen, ist die Aufgabe wissenschaftlicher Geschichtsschreibung.
§ 4. Das Gesetz der Entwicklung.
Parallel mit dem Gesetze der Kausalität, vielleicht ein Ausfluß desselben, ist das Gesetz der Entwicklung. Jede soziale Erscheinung ist nur ein Moment, eine augenblickliche Phase einer Entwicklung, die von einem Anfang zu einem Ende fortläuft, wenn auch letzteres oft noch nicht absehbar ist. Jede soziale Organisation, jeder Staat, jede Gesellschaft, jedes Recht, jeder Wirtschaftszweig macht eine Entwicklung durch. Wir können deren Anfänge, deren Ausbildung, oft auch schon deren Niedergang und Verfall deutlich unterscheiden.
Allerdings darf man die Äußerungen dieses Gesetzes auf sozialem Gebiete nicht mit den Äußerungen desselben auf physischem verwechseln, und in den sozialen Gestaltungen nicht Zellen, Keimblätter, Stengel, Früchte oder gar Eier, Embryonen, Bildung von Atmungs- und Verdauungsorganen usw. sehen wollen; solche Analogien führen von der Wahrheit weit weg, umwölken den wissenschaftlichen Blick und geben kein richtiges Resultat. Die Äußerung des Gesetzes der Entwicklung auf sozialem Gebiete ist eine soziale und bei jeder speziellen Erscheinung auf diesem Gebiete eine der besonderen Natur desselben entsprechende.
Will man zu ernsten wissenschaftlichen Resultaten gelangen, so muß man streng bei der Sache, das heißt bei der sozialen Natur dieser Erscheinungen bleiben und nicht auf Äußerungen dieses Gesetzes auf andern Gebieten abschweifen.
§ 5. Das Gesetz der Regelmäßigkeit der Entwicklung.
An und für sich involviert der Begriff der Entwicklung noch nicht den Begriff der regelmäßigen, das heißt durch eine Reihe gleicher oder ähnlicher Phasen verlaufenden Entwicklung. Tatsächlich aber ist die Entwicklung des Seienden auf allen drei Erscheinungsgebieten eine regel-, oder wenn man will gesetzmäßige. Dieses Gesetz der Regelmäßigkeit auf sozialem Gebiete erkannt zu haben, ist das große Verdienst der historischen Schulen in den einzelnen sozialen Wissenschaften, wie der Rechtswissenschaft, der Nationalökonomie, ja sogar der Sprachwissenschaft, die wir nach unserer obigen Begriffsbestimmung ebenfalls zu den sozialen Wissenschaften zählen, da wir die Sprache nach den oben angegebenen Kriterien als soziale Erscheinung auffassen müssen. Diese Regelmäßigkeit der Entwicklung, die wir im Bereiche der ganzen physischen Natur bewundern und die auch auf geistigem Gebiete herrschend ist: sie ist auf dem Gebiete der sozialen Erscheinungen, wie zum Beispiel des Staates, des Rechtes, der Volkswirtschaft und der Sprache, allgemein geltend.
§ 6. Das Gesetz der Periodizität.
Die Regelmäßigkeit der Entwicklung geht auf allen Erscheinungsgebieten in eine Periodizität über, welche sich überall da, wo wir einen Entwicklungsgang in seinem ganzen Verlauf überblicken können, als ein Daseinskreis, von der Entstehung, durch die Phasen der Erstarkung und Vervollkommnung, bis zu denen des Niederganges und Verfalles, darstellt. Allerdings äußern sich diese Entwicklungsphasen auf jedem besonderen Erscheinungsgebiete anders – da kreisen Säfte, erstarkt der Körper, wachsen Organe usw., dort (auf geistigem Gebiete) entsteht ein Gedanke, gewinnt an Begründung, erreicht eine Verbreitung und Ansehen – verliert dann wieder beides und wird in seiner Nichtigkeit erkannt – hier endlich (auf sozialem Gebiete) entsteht ein soziales Verhältnis in kleinem Maßstabe, erweitert sich auf eine große Vielheit, schafft sich immer mehr Anerkennung, übt auf große Massen entscheidenden Einfluß, wird dann durch andere Verhältnisse auf- und abgelöst und verschwindet – kurz auf jedem der drei Gebiete äußert sich das Gesetz der Periodizität auf andere Weise, aber überall gilt es als allgemeines Gesetz.
§ 7. Das Gesetz der Kompliziertheit.
Ebenso wie wir in der physischen Natur keine einfachen Stoffe finden, sondern nur Komplikationen derselben, und ebenso wie uns auf geistigem Gebiete nur Komplikationen entgegentreten (unsere Vorstellungen und Gedanken sind solche, ebenso unsere geistigen Kräfte!), so sind auch die sozialen Erscheinungen, die uns umgeben, durchwegs Komplikationen, das heißt Gebilde, die aus Bestandteilen zusammengesetzt und aus einfacheren Elementen entstanden sind. Jeder Staat, jedes Volk, jeder Stamm stellt eine Kompliziertheit dar, und zwar in den mannigfachsten Beziehungen. Jedes Recht, jeder Rechtssatz ist eine Kompliziertheit einfacherer Elemente, ein Zusammengesetztes aus Anschauungen, Vorstellungen, Ideen und Grundsätzen; jede Gemeinwirtschaft ist eine Kompliziertheit von Zuständen, Tätigkeiten, Verhältnissen; jede Sprache ist eine Kompliziertheit unendlich mannigfaltiger Sprachelemente.
Aus dieser allgemein herrschenden Kompliziertheit folgt die Möglichkeit der Analyse, welche auf dem Gebiete der physischen Erscheinungen zu den Grundstoffen führt, auf dem Gebiete geistiger Erscheinungen zu den elementaren Begriffen und den einfachsten geistigen Funktionen, auf sozialem Gebiete zu den denkbar einfachsten sozialen Gebilden, also von Staat und Volk zur primitiven Horde, vom ausgebildeten Rechtsinstitut zum beginnenden tatsächlichen Verhältnis, von der kompliziertesten Gemeinwirtschaft zur einfachsten materiellen Bedürfnisbefriedigung, von der auf höchster Stufe der Blüte befindlichen Literatur zum einfachsten Gedankenausdruck mittels Laut und Geberde.
§ 8. Wechselwirkung des Heterogenen.
Als Folge der Kompliziertheit stellt sich in allen Erscheinungen der physischen, geistigen und sozialen Welt die Wechselwirkung der heterogenen, aufeinander reagierenden Elemente ein. In der bestimmten Äußerung auf den einzelnen Gebieten unendlich mannigfaltig, erscheint sie doch überall als das erste und wichtigste Motiv aller Entwicklung. Wohl wurde von jeher die Wichtigkeit dieser Kraft für den sozialen Prozeß geahnt, doch suchte man dieselbe irrtümlich in den zwischen Mensch und Mensch bestehenden Reaktionen (Individualismus und Atomismus) und bezeichnete sie bald als Liebe und Haß, bald als Geselligkeitstrieb oder Feindseligkeit, die zu gegenseitiger Bekämpfung führte (bellum omnium contra omnes). Der Irrtum dieser Auffassung wird bei unserer Betrachtung klar. Zwischen Mensch und Mensch läßt sich keine durchgehends und allgemein gültige Wechselwirkung statuieren, denn was zwischen Mensch und Mensch der einen Gruppe gilt, gilt nicht auch zwischen Mensch und Mensch der andern Gruppe. Hier mag es Liebe und Geselligkeitstrieb sein, dort Haß und Kampfbegier. Daher kommt es, daß je nachdem die einzelnen Philosophen ihren Blick auf das Innere einer Gruppe oder auf das Verhältnis der Gruppen zueinander richten, bald die eine, bald die andere Beziehung als die normale und geltende aufgestellt wurde. Aber keine dieser Behauptungen war richtig, weil keine allgemein. Will man für die den sozialen Erscheinungen innewohnenden Kräfte der Wechselwirkung ein allgemeines, immer und überall geltendes Gesetz aufstellen, so darf man nicht die einzelnen Individuen, sondern die einzelnen sozialen Gruppen ins Auge fassen, und dann läßt sich allerdings für die Wechselwirkung dieser heterogenen Elemente eine allgemein gültige Formel finden. Denn diese heterogenen Elemente, die einzelnen Gruppen, zeigen gegeneinander eine Wechselwirkung, die im innersten Grunde immer und überall dieselbe ist, aus derselben Regung entspringt, demselben Gesetze entspricht, wenn sie auch nach näherer Beschaffenheit der einzelnen Gruppen, nach Zeit und Umständen in formverschiedenen Äußerungen sich manifestiert.
Will man für diese Wechselwirkung des Heterogenen eine präzise allgemeine Formel, einen bestimmteren Ausdruck finden, so läuft man schon Gefahr, sich in leere Analogien zu verstricken und eine, nur für spezielle Gebiete der Erscheinungen gültige Formel fälschlich zu generalisieren.
Wollte man zum Beispiel von einem Aufsaugungssystem der heterogenen Elemente sprechen, so würde man eine auf manchem physischen Gebiete vielleicht gültige Äußerung des allgemeinen Gesetzes der Wechselwirkung fälschlich von einer Äußerung desselben Gesetzes auf sozialem Gebiete behaupten, wo es nur als leere Analogie gelten könnte. Andrerseits hat man oft die Äußerungen dieser Wechselwirkung auf physischem, namentlich auf unorganischem und vegetabilischem Gebiete als einen Kampf ums Dasein bezeichnet, was offenbar wieder ein aus der Betrachtung des animalischen und sozialen Gebietes entlehntes, auf das physische nicht passendes Bild ist.
Wollen wir also bei dem für alle Erscheinungsgebiete geltenden allgemeinen Gesetze bleiben, so müssen wir uns bescheiden, nur von einer Wechselwirkung des Heterogenen zu sprechen und die nähere Präzisierung der Äußerung dieses allgemeinen Gesetzes auf jedem besonderen Erscheinungsgebiete, einer demselben entsprechenden besonderen Formel überlassen.
§ 9. Allgemeine Zweckmäßigkeit.
Nur eines könnte man noch von dieser allgemeinen Wechselwirkung des Heterogenen aussagen, das ist die Zweckmäßigkeit – allerdings aber nur in einem ganz bestimmten, speziellen Sinne.
Denn die allgemeine Wechselwirkung des Heterogenen bringt überall Zustände hervor, welche die weitere Entwicklung der betreffenden Erscheinungen begünstigen; im Hinblick also auf diese natürliche Weiterentwicklung gilt auf allen Erscheinungsgebieten ein Gesetz der zweckmäßigen Wechselwirkung.
Auf physischem Gebiete hat die Naturwissenschaft diese Zweckmäßigkeit der natürlichen Wechselwirkung allerwärts nachgewiesen; der Botaniker weiß, »wozu« der Pflanze die Blätter dienen; der Zoologe weiß, »wozu« die besondere Beschaffenheit der Atmungswerkzeuge der Vögel und überhaupt jedes einzelnen tierischen Organs vorhanden ist; auch auf geistigem Gebiete ist die Zweckmäßigkeit der natürlichen Entwicklung vielfach erkannt; auf sozialem Gebiete ist sie allerdings viel bestritten; je wärmer die einen sie verteidigen (Konservative, Manchestermänner, Optimisten), desto heftiger wird sie von andern angegriffen (Revolutionäre, Sozialisten, Pessimisten usw.). Trotz allen Widerspruches dürfte aber über einen Punkt keine Meinungsverschiedenheit herrschen: daß jede soziale Gestaltung, jedes sozial Gewordene, einem bestimmten Zwecke diene. Man kann über den Wert und die Sittlichkeit dieser Zweckmäßigkeit streiten, aber das Gesetz der allgemeinen Zweckmäßigkeit hat eben nur die Bedeutung, daß auf keinem Erscheinungsgebiete zweckloses Wirken und Werden vor sich geht. Und insofern auch auf sozialem Gebiete nichts zwecklos ins Dasein tritt, muß auch hier von einer immanenten Vernünftigkeit alles sozialen Werdens gesprochen werden.
§ 10. Wesensgleichheit der Kräfte.
Die Wechselwirkung der heterogenen Elemente aller Komplikationen geht offenbar infolge gewisser, diesen Elementen innewohnender oder aus dem Kontakte derselben entstehender Kräfte vor sich. Diese Kräfte bleiben sich auf jedem der verschiedenen Erscheinungsgebiete durch alle Zeiten hindurch gleich. Das wollen wir die Wesensgleichheit der Kräfte nennen. Sowie die auf physischem Gebiete wirkenden Kräfte von jeher dieselben waren wie die gegenwärtig auf demselben wirkenden – ebenso ist es auch auf geistigem und sozialem Gebiete. Denken, Fühlen und Wollen haben von jeher auf gleiche Weise den Menschen bewegt und sein Handeln beherrscht – und ebenso sind die auf sozialem Gebiete wirkenden Kräfte, das heißt diejenigen wirkenden Ursachen, auf die wir aus den vor sich gehenden Wirkungen schließen müssen, von jeher dieselben gewesen. So bildet die Wesensgleichheit der Kräfte ein allgemeines Gesetz, das uns auf allen Erscheinungsgebieten entgegentritt.
§ 11. Wesensgleichheit der Vorgänge.5
Eine notwendige Konsequenz des vorigen Gesetzes ist die ewige Wesensgleichheit der Vorgänge auf allen Erscheinungsgebieten. Auf physischem Gebiete ist dasselbe längst erkannt. Es zweifelt niemand daran, daß die den Sonnenstrahlen innewohnende Erwärmungskraft, vor Äonen Jahren auf feuchten Erdboden wirkend, immer dieselben Vegetationsvorgänge erzeugte wie heute und immerdar erzeugen wird, oder daß die Wogen des Meeres, die sich an der felsigen Küste brechen, von jeher dieselbe Wirkung übten wie heute. Auch auf rein geistigem Gebiete zweifelt niemand daran, daß die geistigen Kräfte des Menschen zu allen Zeiten und in allen Zonen dieselben geistigen Vorgänge zur Folge hatten. Immer und überall denken und fühlen und dichten die Menschen; ja, sogar die wahrnehmbaren Produkte dieser geistigen Vorgänge sind immer und überall dieselben, nur formverschieden nach Zeit und Umständen. Es singt sein Lied der Kamtschadale ganz ebenso wie der Franzose; es philosophierte vor Jahrtausenden der chinesische Denker ganz ebenso wie der Weise von Königsberg; es entwarf seine künstlerischen Pläne vor Jahrtausenden der Pyramidenarchitekt ganz ebenso wie die heutigen Künstler Europas. Die ewige Wesensgleichheit der Vorgänge auf geistigem Gebiete also ist offenbar. Viel weniger ist man sich der Wesensgleichheit der Vorgänge auf sozialem Gebiete bewußt, die aber ganz dieselbe ist. Die mangelhafte Erkenntnis dieses Gesetzes ist eine Folge davon, daß man die wahrhaft konstitutiven Elemente der sozialen Erscheinungen verkannte; daß man dieselben in den Individuen statt in den natürlichen sozialen Gruppen suchte und daher die Wesensgleichheit der auf sozialem Gebiete wirkenden Kräfte nicht finden konnte. Hat man dagegen diese letzteren einmal erkannt, dann kann man sich schwerlich der weiteren Erkenntnis verschließen, daß auch die sozialen Vorgänge eine ewige Wesensgleichheit aufweisen. Immer und überall ist alles Recht auf wesensgleiche Weise entstanden; ebenso Staaten, Sprachen, Religionen usw., und ebenso sind die wirtschaftlichen Vorgänge, von denselben Kräften beherrscht, von jeher überall wesensgleich, nur nach Zeit und Umständen formverschieden.
§ 12. Das Gesetz des Parallelismus.
Auf allen Erscheinungsgebieten finden wir zerstreut durch alle Entfernungen ähnliche Erscheinungen, ohne die erste Ursache dieser Ähnlichkeit zu kennen. Auf physischem Gebiete schreibt man dieselbe einfach der Identität der wirkenden Kräfte zu; dagegen ist man auf geistigem Gebiete schon geneigter, dieselbe als Ausfluß gewisser Zusammenhänge aufzufassen und gar auf sozialem Gebiete schreibt man dieselbe meistens Verwandtschaftsverhältnissen und geschichtlichen Beziehungen zu. Tatsächlich liegt diesen Parallelismen auf allen Erscheinungsgebieten etwas Primäres zu Grunde, das wir, da wir es in seiner wirklichen Bestimmtheit nicht kennen, vorläufig auf ein Gesetz des Parallelismus zurückführen müssen. Die Annahme dieser Formel bewahrt uns vor offenbar falschen und irrtümlichen Erklärungen.6
Die Ursache, warum man auf physischem Gebiete die uns überall in Hülle und Fülle entgegentretenden Parallelismen ohneweiters auf Gleichartigkeit der wirkenden Kräfte und natürliche Vorgänge zurückführt: auf geistigem und sozialem Gebiete dagegen vor einer solchen Erklärung so lange als möglich zurückscheut, liegt teilweise in der verbreiteten Annahme des Monogenismus, welcher in der einheitlichen Abstammung von Adam und Eva eine sehr plausible Erklärung solcher Parallelismen leicht zur Hand hatte. Wen aber diese Erklärung als zu albern, nicht befriedigt, dem bleibt eben nichts anders übrig, als die auf geistigem und sozialem Gebiete nicht minder wie auf physischem zahlreichen Parallelismen vorderhand auf ein allgemeines, alle Erscheinungsgebiete beherrschendes Gesetz des Parallelismus zurückzuführen. –
Die Existenz dieser allgemeinen, alle Erscheinungsgebiete beherrschenden, auf allen gültigen Gesetze ist einer der mächtigsten und schlagendsten Beweise eines einzigen einheitlichen Prinzipes, auf dem die Welt der Erscheinungen überhaupt ruht, die wichtigste Stütze des Monismus, die gründlichste Widerlegung des Dualismus. Aus der Betrachtung dieser Gesetze ergibt sich die Unhaltbarkeit der Zurückführung der Erscheinungswelt auf zwei Prinzipien: Materie und Geist. Denn diese Gesetze zeigen klar, daß die Existenzmodalitäten aller Erscheinungsgruppen dieselben sind und nur auf ein einziges, einheitliches Prinzip zurückweisen. Möge man dasselbe Natur oder Gott nennen – oder das große unbekannte, die Welt bewegende Prinzip – es bleibt sich gleich. Jedenfalls ist es ein einheitliches Prinzip, auf das uns die allgemeinen, gleichen Gesetze der Erscheinungswelt hinweisen, das wir allerdings als das Allmächtige, Allgegenwärtige, wenn man will Allwissende ahnen, dessen Wesen wir aber zu erkennen nicht im stande sind. Nur eines müssen wir aus der Erkenntnis dieser allgemeinen Gesetze und noch mehr aus den Nachweisen ihrer Gültigkeit und Herrschaft auf allen Erscheinungsgebieten schließen: daß dieses eine Prinzip sozusagen eine konsequente, immer und überall sich gleichbleibende Politik treibt, daß es sich immer und überall auf allen Erscheinungsgebieten in derselben Weise, in demselben Grundton offenbart. Dieser notwendige Schluß aber ist für die Wissenschaft von unendlicher Bedeutung. [Ratzenhofer nennt dieses letzte Prinzip die Urkraft.]
III. Begriff, Aufgaben, Umfang und Wichtigkeit der Soziologie.
§ 1. Anwendung der allgemeinen Gesetze in der Soziologie.
Wir brauchen es wohl nicht erst zu sagen, daß die von uns oben aufgezählten allgemeinen Gesetze keine Erkenntnisse a priori sind. Ganz im Gegenteil sind es Ausdrücke für Verhältnisse, welche uns eine eingehende Betrachtung der Erscheinungen aller drei Gebiete erschließt. Diese induktiven Erkenntnisse, zu denen wir am Schlusse einer langen Geistesarbeit gelangen, setzen wir aus didaktischen Rücksichten an die Spitze unserer Darstellung. Allerdings kehren wir damit die natürliche Ordnung der Erkenntnis um, jedoch nur zu dem Zwecke, damit wir an den nun folgenden Ausführungen desto leichter das Zutreffen jener allgemeinen Gesetze nachweisen können. Diese provisorische Vorwegnahme der Resultate der Untersuchungen ist nichts mehr als eine didaktische Taktik.
Diese allgemeinen Gesetze nun beherrschen allerdings alle drei Erscheinungsgebiete, doch nehmen sie auf jedem derselben eine der Natur dieser besonderen Erscheinungen entsprechende und adäquate Form an. Man könnte von einer »spezifischen Energie« dieser allgemeinen Gesetze sprechen, vermöge deren sie auf jedem besonderen Erscheinungsgebiete sich in die Sprache dieses Gebietes übersetzen. Ein Beispiel soll unseren Gedanken verdeutlichen. Zweckmäßigkeit der Entwicklung ist ein allgemeines Gesetz. Aber auf dem Gebiete des Pflanzenlebens äußert sich dasselbe in der Art und Weise der Veranlagung und des Wachstums der einzelnen Organe und gestattet dem Botaniker, eine ganze Reihe spezieller Wachstumsgesetze der Pflanzen aufzustellen, welche alle aus dem allgemeinen Gesetz der Zweckmäßigkeit der Entwicklung entspringen.





























