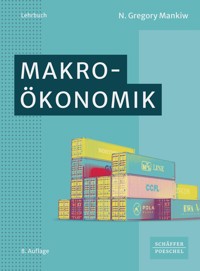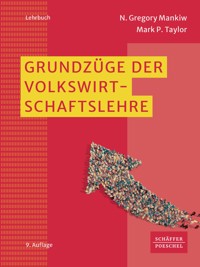
49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Hilft die Mietpreisbremse, erschwingliche Wohnungen zu finden? Welche Auswirkungen hat der Mindestlohn? Sind die Handelsbilanzdefizite der USA ein Problem? Was bedeuten negative Zinsen für Europa? Diese griffigen Beispiele machen klar: Volkswirtschaft findet mitten im Leben statt. Das ebenso fundierte wie wirklichkeitsnahe Lehrbuch avancierte weltweit zum Bestseller – auch wegen seiner klaren Sprache und seines ausgereiften didaktischen Konzepts. Anschaulicher kann Volkswirtschaft nicht vermittelt werden! Die Neuauflage wurde umfassend aktualisiert und um neue Themen ergänzt. Darunter: nachhaltiges Wachstum und Klimaziele, wirtschaftspolitische Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Mit aktualisierten Fallstudien und Praxisbeispielen unter anderem zu den Themen Stagflation in Deutschland, Industrie 4.0, 4-Tage-Woche, Handelskrieg und Klimawandel. Mit Wiederholungsfragen und zahlreichen Aufgaben im Buch sowie ausführlichen Lösungen im begleitenden Arbeitsbuch von Marco Herrmann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2211
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumDie VerfasserDie Bearbeiter der deutschen AuflageVorwort der deutschsprachigen Bearbeiter zur 9. AuflageInhaltsübersichtAbkürzungsverzeichnis1 Was ist Volkswirtschaftslehre?1.1 Die Wirtschaft und die Wirtschaftsordnung1.2 Wie Menschen Entscheidungen treffen1.3 Wie Menschen zusammenwirken1.4 Wie die Volkswirtschaft insgesamt funktioniert1.5 Fazit2 Denken wie ein Volkswirt2.1 Ökonomische Methodologie2.2 Theorieschulen2.3 Der Volkswirt als politischer Berater2.4 Warum Volkswirte einander widersprechenAnhang Kapitel 2: Grafische Darstellungen und die Instrumente der Volkswirtschaftslehre: Ein kurzer Überblick3 Die Marktkräfte von Angebot und Nachfrage3.1 Die Annahmen des Marktmodells3.2 Nachfrage3.3 Angebot3.4 Angebot und Nachfrage zusammen3.5 Die Preiselastizität der Nachfrage3.6 Andere Nachfrageelastizitäten3.7 Die Preiselastizität des Angebots3.8 Anwendungsfälle für Elastizität von Angebot und Nachfrage3.9 Fazit: Wie Preise Ressourcen zuteilen4 Hintergründe zur Nachfrage: Die klassische Theorie der Konsumentscheidung4.1 Das mikroökonomische Standardmodell4.2 Budgetbeschränkung: Was der Konsument sich leisten kann4.3 Präferenzen: Was der Konsument will4.4 Optimierung: Was der Konsument wählt4.5 Der verhaltensökonomische Blick auf das Konsumentenverhalten5 Hintergründe zum Angebot: Die Produktionskosten von Unternehmen5.1 Kosten und Opportunitätskosten5.2 Produktion und Kosten5.3 Verschiedene Kostenarten5.4 Kurzfristige und langfristige Kosten5.5 Skalenerträge6 Hintergründe zum Angebot: Unternehmen in Wettbewerbsmärkten6.1 Was ist ein Wettbewerbsmarkt?6.2 Gewinnmaximierung und die Angebotskurve des Unternehmens bei vollständiger Konkurrenz6.3 Die Marktangebotskurve bei vollständiger Konkurrenz6.4 Die Produktionsentscheidung des Unternehmens: Isoquanten und Isokostenlinien6.5 Die Produktionsentscheidung des Unternehmens: Die Minimalkostenkombination6.6 Fazit7 Konsumenten, Produzenten und die Effizienz von Märkten7.1 Konsumentenrente7.2 Produzentenrente7.3 Markteffizienz7.4 Fazit8 Angebot, Nachfrage und die Politik der Regierung8.1 Preiskontrollen8.2 Steuern8.3 Subventionen8.4 Steuern und Effizienz8.5 Der Nettowohlfahrtsverlust der Besteuerung8.6 Administrative Kosten der Steuererhebung8.7 Die Ausgestaltung des Steuersystems8.8 Steuern und Gerechtigkeit8.9 Fazit9 Öffentliche Güter, Allmendegüter und meritorische Güter9.1 Die verschiedenen Arten von Gütern9.2 Öffentliche Güter9.3 Allmendegüter9.4 Meritorische Güter9.5 Fazit10 Externalitäten und Marktversagen10.1 Externalitäten10.2 Externe Effekte und Ineffizienz der Märkte10.3 Private Lösungen bei externen Effekten10.4 Politische Maßnahmen gegen Externalitäten10.5 Öffentlich-private Maßnahmen gegen Externalitäten10.6 Staatsversagen10.7 Fazit11 Marktstrukturen I: Monopol11.1 Unvollständige Konkurrenz11.2 Warum Monopole entstehen11.3 Wie Monopole Produktions- und Preisentscheidungen treffen11.4 Wohlfahrtseinbußen durch Monopole11.5 Preisdifferenzierung11.6 Wirtschaftspolitische Maßnahmen gegen Monopole11.7 Fazit12 Markstrukturen II: Monopolistische Konkurrenz12.1 Wettbewerb mit unterschiedlichen Produkten12.2 Werbung und Markenbildung12.3 Fazit13 Marktstrukturen III: Oligopol13.1 Märkte mit nur wenigen Anbietern13.2 Die Spieltheorie und die Ökonomik der Kooperation13.3 Eintrittsbarrieren auf Oligopolmärkten13.4 Wirtschaftspolitische Maßnahmen gegen Oligopole13.5 Fazit14 Marktstrukturen IV: Bestreitbare Märkte14.1 Die Eigenschaften bestreitbarer Märkte14.2 Die Grenzen der Bestreitbarkeit14.3 Fazit15 Die Märkte für Produktionsfaktoren15.1 Die Arbeitsnachfrage15.2 Das Arbeitsangebot15.3 Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt15.4 Einkommensunterschiede15.5 Die ökonomischen Aspekte der Diskriminierung15.6 Sonstige Produktionsfaktoren: Boden und Kapital15.7 Fazit16 Einkommensungleichheit und Armut16.1 Die Messung der Ungleichheit16.2 Die politische Philosophie der Einkommensumverteilung16.3 Politische Maßnahmen zur Armutsbekämpfung16.4 Fazit17 Interdependenz und Handelsvorteile17.1 Die Produktionsmöglichkeitenkurve17.2 Produktionsmöglichkeiten und Handel17.3 Das Prinzip des komparativen Vorteils17.4 Die Bestimmungsfaktoren des Außenhandels17.5 Gewinner und Verlierer des Außenhandels17.6 Handelsbeschränkungen17.7 Weitere Außenhandelstheorien17.8 Fazit18 Informations- und Verhaltensökonomik18.1 Abweichung von der Annahme vollkommener Information: Informationsökonomik18.2 Abweichungen von der Annahme rationalen Verhaltens: Verhaltensökonomik18.3 Fazit19 Heterodoxe Theorien in der Volkswirtschaftslehre19.1 Einleitung19.2 Institutionenökonomik19.3 Feministische Ökonomik19.4 Komplexitätsökonomik19.5 Fazit20 Die Messung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt und das Preisniveau20.1 Makroökonomische Denkschulen20.2 Das Wesen der Makroökonomik20.3 Einkommen und Ausgaben einer Volkswirtschaft20.4 Die Messung des Bruttoinlandsprodukts20.5 Die Bestandteile des BIP20.6 Reales versus nominales BIP20.7 Die Grenzen des BIP als Wohlstandsmaß20.8 Die Messung der Lebenshaltungskosten20.9 Der Verbraucherpreisindex20.10 Inflationsbereinigung von ökonomischen Größen20.11 Fazit21 Produktion und Wachstum21.1 Das Wirtschaftswachstum rund um die Welt21.2 Die Bestimmungsgrößen der Produktivität und die Rolle der Produktivität für das Wachstum21.3 Wachstumstheorien21.4 Wirtschaftswachstum und staatliche Politik21.5 Nachhaltiges Wachstum und Klimawandel21.6 Fazit22 Arbeitslosigkeit22.1 Die Erfassung von Arbeitslosigkeit22.2 Arbeitsplatzsuche22.3 Strukturelle Arbeitslosigkeit22.4 Die Kosten der Arbeitslosigkeit22.5 Fazit23 Sparen, Investieren und das Finanzsystem23.1 Finanzinstitutionen23.2 Ersparnis und Investitionen in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung23.3 Der Kreditmarkt23.4 Fazit24 Grundlagen der Finanzierung24.1 Der Barwert: Ein Maß für den Zeitwert des Geldes24.2 Der Umgang mit Risiko24.3 Vermögensbewertung24.4 Neue Produkte in der Finanzwelt24.5 Die Effizienzmarkthypothese in der (Finanz-)Krise24.6 Fazit25 Das monetäre System25.1 Die Bedeutung des Geldes25.2 Zentralbanken25.3 Banken und das Geldangebot25.4 Die geldpolitischen Instrumente der Zentralbank25.5 Fazit26 Geldmengenwachstum und Inflation26.1 Die klassische Inflationstheorie26.2 Die Kosten der Inflation26.3 Das Inflationsziel der Zentralbank26.4 Fazit27 Grundsätzliches über die offene Volkswirtschaft27.1 Die internationalen Güter- und Kapitalströme27.2 Die Preise für internationale Transaktionen: Nominale und reale Wechselkurse27.3 Die Kaufkraftparitätentheorie27.4 Globalisierung27.5 Fazit28 Eine makroökonomische Theorie der offenen Volkswirtschaft28.1 Das Angebot an und die Nachfrage nach Kreditmitteln und Devisen28.2 Das Gleichgewicht in der offenen Volkswirtschaft28.3 Wie wirtschaftspolitische Maßnahmen und andere Ereignisse eine offene Volkswirtschaft beeinflussen28.4 Fazit29 Konjunkturzyklen29.1 Trendwachstum29.2 Ursachen für Konjunkturzyklen29.3 Konjunkturmodelle29.4 Fazit30 Keynes, Keynesianer und die IS-LM-Analyse30.1 Das Keynesianische Kreuz30.2 Der Multiplikatoreffekt30.3 Die IS- und die LM-Kurve30.4 Das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht im IS-LM-Modell30.5 Vom IS-LM-Modell zur aggregierten Nachfragekurve30.6 Fazit31 Gesamtwirtschaftliche Nachfrage und gesamtwirtschaftliches Angebot31.1 Drei wichtige Befunde zu den konjunkturellen Schwankungen31.2 Zur Erklärung von kurzfristigen gesamtwirtschaftlichen Schwankungen31.3 Die aggregierte Nachfragekurve31.4 Die aggregierte Angebotskurve31.5 Zwei Ursachen von kurzfristigen Wirtschaftsschwankungen31.6 Fazit32 Der Einfluss von Geldpolitik und Fiskalpolitik auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage32.1 Wie die Geldpolitik auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wirkt32.2 Der Einfluss der Fiskalpolitik auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage32.3 Der Einsatz der Geld- und Fiskalpolitik zur Stabilisierung der Volkswirtschaft32.4 Fazit33 Inflation und Arbeitslosigkeit als kurzfristige Alternativen33.1 Die Phillips-Kurve33.2 Verschiebungen der Phillips-Kurve: Die Rolle von Erwartungen33.3 Verschiebungen der Phillips-Kurve: Zur Rolle von Angebotsschocks33.4 Die Kosten einer Senkung der Inflationsrate33.5 Empirische Befunde zur Phillips-Kurve33.6 Fazit34 Angebotspolitik34.1 Verschiebungen der aggregierten Angebotskurve34.2 Angebotspolitische Maßnahmen34.3 Fazit35 Gebiete mit einheitlicher Währung und die Europäische Währungsunion35.1 Der Euro35.2 Der europäische Binnenmarkt35.3 Vorteile und Kosten einer Gemeinschaftswährung35.4 Die Theorie optimaler Währungsräume35.5 Ist Europa ein optimaler Währungsraum?35.6 Fiskalpolitik und Währungsunion35.7 Fazit36 Die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007 bis 2009 und die Staatsverschuldung in Europa36.1 Die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007 bis 200936.2 Die Schuldenkrise in Europa36.3 Die eingeleitete Sparpolitik36.4 FazitGlossarFachbegriffe Deutsch-EnglischStichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6261-7
Bestell-Nr. 20729-0005
ePub:
ISBN 978-3-7910-6262-4
Bestell-Nr. 20729-0101
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6263-1
Bestell-Nr. 20729-0152
N. Gregory Mankiw/Mark P. Taylor
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
9. überarbeitete Auflage, Oktober 2024
© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © mattjeacock, iStock
Produktmanagement: Nora Valussi
Lektorat: Bernd Marquard, Stuttgart
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Die Verfasser
Autoren
N. Gregory Mankiw ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Harvard University. Er studierte an der Princeton University und am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Als Hochschullehrer hielt und hält er Vorlesungen zu Makroökonomik, Mikroökonomik, Statistik und Grundlagen der Volkswirtschaftslehre. Professor Mankiw ist ein überaus produktiver Autor und nimmt regelmäßig an wissenschaftlichen und politischen Debatten teil. Zusätzlich zu seiner Lehr-, Forschungs- und Autorentätigkeit forschte er im National Bureau of Economic Research, war Berater der Federal Reserve Bank in Boston und des Congressional Budget Office. Von 2003 bis 2005 war Mankiw Vorsitzender des Council of Economic Advisers, er war auch Berater des Kandidaten Mitt Romney während des US-Präsidentschaftswahlkampfes 2012.
Mark P. Taylor ist Donald Danforth, Jr. Distinguished Professor of Finance der Olin Business School an der Washington Universität in St. Louis, USA. Zuvor war er Dekan der John M. Olin Business School und Dekan der Warwick Business School an der Universität Warwick und Professor für Internationale Finanzen. Seinen ersten Abschluss erwarb er in Philosophie, Politik und Volkswirtschaftslehre an der Universität Oxford. An der Universität London schloss er das Studium der Volkswirtschaftslehre mit dem Master ab und promovierte anschließend in Ökonomie und Internationalen Finanzen. Professor Taylor lehrte und lehrt Volkswirtschaftslehre und Finanzen an verschiedenen Universitäten (u. a. Oxford, New York, Bordeaux und Aix-Marseille) und in verschiedenen Veranstaltungen (Grundlagen-, Fortgeschrittenen- und Doktorandenveranstaltungen). Er arbeitete als leitender Wirtschaftswissenschaftler beim Internationalen Währungsfonds und bei der Bank of England. Bevor er Dekan der Warwick Business School wurde, war er leitender Direktor bei Black Rock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, wo er an internationalen Anlagestrategien arbeitete, die auf makroökonomischen Analysen basierten. Seine Forschungsarbeiten wurden in vielen Journals und wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht. Professor Taylor ist weltweit einer der am häufigsten zitierten Ökonomen.
Mitwirkender Autor
Andrew Ashwin ist Associate Lecturer im Department of Management der Lincoln International Business School an der University of Lincoln in Großbritannien. Ashwin unterrichtet und unterstützt Studierende im Bachelorstudium und Masterstudierende in Führung und Management in verschiedenen Studienfächern. Er unterrichtet auch Commercial and Operational Management im Masterstudium am Lincoln Institute for Agricultural Technology. Andrew Ashwin hat einen Abschluss als Master of Business Administration (MBA) und hat an der Universität Leicester über die Idee und die Bewertung von Schwellenkonzepten in der Wirtschaftswissenschaft promoviert. Ashwin ist ein erfahrener Autor, der mehrere Studientexte unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades und Publikationen für Fachzeitschriften verfasst hat, die sich auf seine Forschung bezogen auf sein Promotionsvorhaben richten. Er hat auch an der Entwicklung von Online-Lehrunterlagen am Institute of Learning and Research Technologies an der Universität Bristol mitgearbeitet. Andrew Ashwin war vorsitzender Prüfer einer großen Qualifikationsvergabestelle für Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissenschaften in England und arbeitet als Berater für das Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual). Ashwin hat ein großes Interesse an Beurteilung und Lernen in den Wirtschaftswissenschaften und ist akkreditierter Gutachter am Chartered Institute of Educational Assessors. Er ist Herausgeber des Journals der Economics, Business and Enterprise Association (EBEA).
Die Bearbeiter der deutschen Auflage
Karolin Frerich (M. A.) studierte Ökonomik und Pädagogik an der Universität Münster. Seit 2022 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ökonomische Bildung tätig, wo sie ebenfalls promoviert. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit dem deutschen Gesundheitssystem.
Dr. Marco Herrmann hat an der Freien Universität Berlin Volkswirtschaftslehre studiert und am Institut für Empirische Wirtschaftsforschung der Universität Leipzig promoviert. Er ist heute bei der ECC – European Commodity Clearing AG im Bereich Clearing Strategy tätig.
Univ.-Prof. Dr. Christian Müller ist seit 2008 Professor für Wirtschaftswissenschaften und Ökonomische Bildung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Er promovierte 1999 und habilitierte 2004 in Volkswirtschaftslehre an der Universität Duisburg-Essen. Im Schäffer-Poeschel Verlag erschien von ihm zuletzt das Lehrbuch »Grundzüge der Wirtschafts- und Unternehmensethik« (2022).
Sebastian Panreck (M. Sc.) studierte an der Universität Münster. Seit 2022 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ökonomische Bildung tätig und promoviert hier zum Dr. rer. pol. Seine kumulative Dissertation befasst sich mit wirtschaftspolitischen und ethischen Fragestellungen.
Dr. Diana Püplichhuysen studierte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sowie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und ist seit 2023 am Schmalenbach Institut für Wirtschaftswissenschaften der TH Köln tätig. Ihr Lehr- und Forschungsschwerpunkt ist die Ökonomische Bildung, insbesondere die Entrepreneurship Education.
Vorwort der deutschsprachigen Bearbeiter zur 9. Auflage
Seit dem Erscheinen der letzten deutschsprachigen Auflage vor drei Jahren hat sich das gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld weiter rasant verändert. Die Auswirkungen der Coronapandemie sind inzwischen gut sichtbar und vielfach wissenschaftlich dokumentiert, wie empirische Analysen der Funktionsfähigkeit globaler Lieferketten, aber auch verhaltensökonomische Erkenntnisse zum Horten wichtiger Produkte des täglichen Bedarfs zeigen. Besonders prägend für die wirtschaftspolitische Debatte sind aktuell die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Stagflation ist mittlerweile weit mehr als eine Randnotiz in VWL-Lehrbüchern.
Auch in dieser Auflage versuchen wir, in der deutschen Bearbeitung des »Mankiw«, des international führenden Lehrbuches für Volkswirtschaftslehre, die großen Entwicklungen volkswirtschaftlich adäquat einzuordnen. Dabei sollen Theorien und Modelle möglichst intuitiv dargestellt werden. Auf Mathematisierungen wird auch in der deutschsprachigen Ausgabe – wo immer möglich – verzichtet.
Die neue Kapitelaufteilung bei den Hintergründen zum Angebot (nun Kapitel 5 und Kapitel 6) verbessert die Lesbarkeit in Teil 2 (Die Theorie der Wettbewerbsmärkte) erheblich. Ebenso dürfte es ein großer Gewinn für das Lehrbuch sein, dass viele wichtige Themen noch stärker akzentuiert werden: Dazu zählen etwa die Finanztechnologien (Kapitel 14), die Auswirkungen gesetzlicher Mindestlöhne auf den Arbeitsmarkt (Kapitel 15), Wachstum, Nachhaltigkeit und Klimawandel (Kapitel 21) sowie die erneut aufgeflammten Diskussionen um die Chancen und Risiken der Globalisierung (Kapitel 27).
Es hat sich bewährt, keine reine Übersetzung der englischsprachen europäischen Version – diesmal der 6th European Edition – von »Economics« vorzulegen. Stattdessen hat sich das Team der deutschen Bearbeiter – neuerdings verstärkt durch Karolin Frerich und Sebastian Panreck – wiederum darum bemüht, durch eine lebendige Übertragung auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse im deutschsprachigen Raum eine möglichst nahe Verbindung zur Lebenswelt unserer Leserinnen und Leser zu schaffen. So berücksichtigen wir Fragen der Wirtschaftspolitik, die vor allem in Deutschland diskutiert werden, wie den Vorschlag einer Vier-Tage-Woche auf dem Arbeitsmarkt, die Kontroversen zur Reform der Schuldenbremse und die mögliche Einführung eines Grunderbes für jeden. Zahlreiche Praxisbeispiele wie die effiziente Herstellung von grünem Wasserstoff im Münsterland runden die 9. deutschsprachige Auflage ebenso ab wie neue Fallstudien, beispielsweise zur Ansiedlung der Tesla-Gigafactory in Berlin-Brandenburg.
Das begleitende Arbeitsbuch von Dr. Marco Herrmann erscheint auch zu dieser Auflage in überarbeiteter Form. Wer nach der Lektüre des Lehrbuches das Wissen über die behandelten Theorien und Modelle mit praxisnahen Aufgaben und Anwendungen festigen und vertiefen möchte, dem ist dieses Arbeitsbuch sehr zu empfehlen.
Schließlich möchten wir uns beim Verlag, vor allem bei Frau Nora Valussi, für die äußerst angenehme Zusammenarbeit bedanken. Unser besonderer Dank gilt jedoch wiederum unserem Lektor, Herrn Dipl.-Volksw. Bernd Marquard, für seine verlässliche, professionelle und überaus kompetente Unterstützung bei der Realisierung der 9. Auflage.
April 2024
Karolin Frerich, Marco Herrmann, Christian Müller, Sebastian Panreck und Diana Püplichhuysen
Inhaltsübersicht
Teil 1 Einführung in die Volkswirtschaftslehre
1. Was ist Volkswirtschaftslehre?
Denken wie ein Volkswirt
Einige der wichtigen Grundbegriffe der Volkswirtschaftslehre sind Opportunitätskosten, Entscheidungen nach dem Marginalprinzip, Anreize, Vorteile des Handels und die Effizienz von Märkten. Die Volkswirtschaftslehre ist durch verschiedene Methoden und Schulen gekennzeichnet. Volkswirte können sowohl Wissenschaftler als auch Politikberater sein.
Teil 2 Die Theorie der Wettbewerbsmärkte
2. Die Marktkräfte von Angebot und Nachfrage
Auf einem Wettbewerbsmarkt bestimmen die Nachfrage der Konsumenten und das Angebot der Unternehmen Preis und Menge. Änderungen des Marktgleichgewichts werden in drei Schritten analysiert. Mithilfe des Konzepts der Elastizität lassen sich Reaktionen von Nachfrage und Angebot sowie von Märkten auf Veränderungen genauer untersuchen.
2. Hintergründe zur Nachfrage: Die klassische Theorie der Konsumentscheidung
Hintergründe zum Angebot: Die Produktionsentscheidung von Unternehmen
Hintergründe zum Angebot: Unternehmen in Wettbewerbsmärkten
Individuelle Entscheidungen unter Budgetbeschränkungen bilden die Grundlage der Nachfragekurve. Die auf kurze und lange Sicht unterschiedlichen Produktionskosten bilden die Grundlage der Angebotskurve. Aus dem Verhalten einzelner Unternehmen lässt sich die zugehörige Marktangebotskurve ableiten. Unternehmen setzen Arbeit und Kapital so ein, dass sie ihre Produktionskosten minimieren.
4. Konsumenten, Produzenten und die Effizienz von Märkten
Die Effizienz von Märkten wird mithilfe der Konzepte Konsumentenrente und Produzentenrente beurteilt. Ein Wettbewerbsmarkt maximiert die Summe aus Produzenten- und Konsumentenrente und damit die Wohlfahrt.
Teil 3 Eingriffe in Märkte
4. Angebot, Nachfrage und die Politik der Regierung
Wirtschaftspolitische Maßnahmen wie Preiskontrollen, Steuern und Subventionen verändern das Marktgleichgewicht. Der durch Steuern erzeugte Nettowohlfahrtsverlust misst die gesellschaftlichen Kosten der Steuer. Ein Steuersystem kann nach verschiedenen Gerechtigkeitsvorstellungen konstruiert werden.
4. Öffentliche Güter, Allmendegüter und meritorische Güter
Externalitäten und Marktversagen
Märkte teilen öffentliche Güter, Allmendegüter und meritorische Güter ineffizient zu. Das Gleiche gilt bei Vorliegen von Externalitäten bzw. externen Effekten. Der Staat kann unter diesen Umständen Marktergebnisse verbessern, andererseits können private Lösungen Staatsversagen vermeiden.
Teil 4 Unternehmensverhalten und Marktstrukturen
5. Marktstrukturen I: Monopol
Markstrukturen II: Monopolistische Konkurrenz
Marktstrukturen III: Oligopol
Marktstrukturen IV: Bestreitbare Märkte
Ein Monopolist ist auf seinem Markt der Alleinanbieter. Aus der Monopolstellung resultieren Ineffizienz und Versuche, den Markt zu spalten.
Unternehmen auf Märkten mit ähnlichen, aber unterschiedlichen Produkten stehen in monopolistischer Konkurrenz.
Ein Oligopol ist ein Markt, der nur von einigen wenigen Anbietern beherrscht wird. Mithilfe der Spieltheorie wird das Verhalten von Oligopolen untersucht.
In einem vollständig bestreitbaren Markt (Markt mit freiem Markteintritt und -austritt) gibt es keine Ineffizienz, unabhängig von der Zahl der Anbieter.
Teil 5 Faktormärkte
8. Die Märkte für Produktionsfaktoren
Am Arbeitsmarkt ist die Verbindung zwischen Faktorpreis und Grenzproduktivität zentral. Einkommensungleichheiten können damit erklärt werden. Wettbewerb wirkt der ungleichen Behandlung vergleichbarer Individuen, der Diskriminierung, entgegen. Weitere Produktionsfaktoren sind Boden und Kapital.
Teil 6 Ungleichheit
8. Einkommensungleichheit und Armut
Die Messung der Einkommensungleichheit stößt auf erhebliche Schwierigkeiten. Aus verschiedenen politischen Philosophien und ihrer Position zur Ungleichheit resultieren unterschiedliche politische Maßnahmen zur Einkommensumverteilung.
Teil 7 Handel
8. Interdependenz und Handelsvorteile
Spezialisierung und Handel erhöhen die Wohlfahrt der Beteiligten. Das gilt auch für den Außenhandel eines Landes. Dabei gibt es Gewinner und Verlierer, die Zölle, Quoten und nichttarifäre Maßnahmen gegenüber dem Ausland fordern können.
Teil 8 Heterodoxe Ökonomik
8. Informations- und Verhaltensökonomik
Die Konzepte von Prinzipal und Agent, asymmetrischer Information, mangelnder Rationalität und zeitinkonsistentem Verhalten erlauben ein genaueres Verständnis der Unzulänglichkeiten menschlicher Entscheidungsfindung.
8. Heterodoxe Theorien in der Volkswirtschaftslehre
Heterodoxe Ökonomik umfasst die Institutionenökonomik, die feministische Ökonomik und die Komplexitätsökonomik.
Teil 9 Makroökonomische Daten
8. Die Messung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt und das Preisniveau
Verschiedene ökonomische Denkschulen setzen unterschiedliche Schwerpunkte in ihrem Verständnis von Wirtschaft.
Das Bruttoinlandsprodukt misst das gesamte Einkommen eines Landes und kann nominal und real ermittelt werden.
Mithilfe eines Verbraucherpreisindex lässt sich eine Inflationsrate berechnen, die zur Inflationsbereinigung nominaler Größen verwendet wird.
Teil 10 Die realökonomische Entwicklung auf lange Sicht
8. Produktion und Wachstum
Arbeitslosigkeit
Der Lebensstandard eines Landes (BIP pro Kopf) hängt ab von der Produktivität, die durch staatliche Maßnahmen beeinflussbar ist. Langfristige Ursachen von Arbeitslosigkeit sind in Mindestlöhnen, Gewerkschaftsmacht oder Effizienzlöhnen zu suchen. Arbeitslosigkeit verursacht hohe Kosten für den Einzelnen und die Gesellschaft.
Teil 11 Zinssätze, Geld und Preise auf lange Sicht
9. Sparen, Investieren und das Finanzsystem
Grundlagen der Finanzierung
Die Finanzmärkte einer Volkswirtschaft koordinieren Kreditvergabe (Ersparnis) und Kreditaufnahme (Investitionen). Das Barwertkonzept, die Theorie der Risikomischung und die Effizienzmarkthypothese sind grundlegende Instrumente der Vermögensbewertung. Die Entwicklung der Finanzmärkte seit 2000 wird dargestellt, Schwerpunkt ist die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007 bis 2009.
10. Das monetäre System
Geldmengenwachstum und Inflation
Geld erfüllt wesentliche Funktionen in der Wirtschaft. Zentralbank und Geschäftsbanken bestimmen zusammen die Geldmenge. Übermäßiges Geldmengenwachstum führt regelmäßig zu Inflation.
Teil 12 Die Makroökonomik der offenen Volkswirtschaft
11. Grundsätzliches über die offene Volkswirtschaft
Eine makroökonomische Theorie der offenen Volkswirtschaft
In der offenen Volkswirtschaft sind Ersparnis und Investitionen mit Kapitalexporten verknüpft. Die Kaufkraftparitätentheorie kann die Höhe des nominalen und realen Wechselkurses erklären. In einem klassischen Modell der internationalen Güter- und Kapitalströme werden die Auswirkungen unterschiedlicher wirtschaftspolitischer Maßnahmen untersucht.
Teil 13 Kurzfristige gesamtwirtschaftliche Schwankungen
12. Konjunkturzyklen
Keynes, Keynesianer und die IS-LM-Analyse
Gesamtwirtschaftliche Nachfrage und gesamtwirtschaftliches Angebot
Der Einfluss von Geldpolitik und Fiskalpolitik auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage
Inflation und Arbeitslosigkeit als kurzfristige Alternativen
Angebotspolitik
Zeitreihendaten zeigen Schwankungen der wirtschaftlichen Aktivität. Diese werden durch moderne Konjunkturmodelle oder traditionell im Rahmen des IS-LM-Modells bzw. des AD-AS-Modells erklärt. Geld- und Fiskalpolitik wirken auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und können damit Wirtschaftsschwankungen entgegenwirken. Kurzfristig ist die Wirtschaftspolitik dem Zielkonflikt zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit ausgesetzt, langfristig dagegen nicht. Angebotspolitische Maßnahmen zur Beeinflussung des gesamtwirtschaftlichen Angebots wirken eher langfristig.
Teil 14 Internationale Makroökonomik
17. Gebiete mit einheitlicher Währung und die Europäische Währungsunion
Die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007 bis 2009 und die Staatsverschuldung in Europa
Die einheitliche Währung Euro ist mit Vorteilen und mit Kosten verbunden. Ob Europa ein optimaler Währungsraum ist, lässt sich nicht abschließend beurteilen. Der weltweiten Finanzkrise folgte eine Schuldenkrise in Europa. Staatliche Sparpolitik als Antwort auf diese Schuldenkrise wird umfassend debattiert.
Abkürzungsverzeichnis
Abkürzung
englischer Begriff
deutscher Begriff
Kapitel
AFC
average fixed cost
durchschnittliche fixe Kosten
5
AR
average revenue
Durchschnittserlös
5
ATC
average total cost
durchschnittliche Gesamtkosten
5
AVC
average variable cost
durchschnittliche variable Kosten
5
BC
budget constraint
Budgetgerade
4
C
consumption
Konsum, privater Verbrauch
20
D
demand
Nachfrage
2
e
exchange rate
nominaler Wechselkurs (in Mengennotierung)
27
E
expenditures
geplante Ausgaben
30
FC
fixed cost
fixe Kosten
5
G
government purchases
Staatsausgaben
20
I
indifference curve
Indifferenzkurve (des Konsumenten)
4
I
investment
Investitionen (im makroökonomischen Kontext)
20
K
capital
Kapital (Realkapital)
5
L
labour
Arbeit
5
M
quantity of money
Geldmenge
25
MC
marginal cost
Grenzkosten
5
MD
demand for money
Geldnachfrage
30
MPC
marginal propensity to consume
marginale Konsumquote
30
MPK
marginal product of capital
Grenzprodukt des Kapitals
6
MPL
marginal product of labour
Grenzprodukt der Arbeit
5
MPS
marginal propensity to save
marginale Sparquote
30
MR
marginal revenue
Grenzerlös
5
MRS
marginal rate of substitution
Grenzrate der Substitution
4
MS
money supply
Geldangebot
26
NCO
net capital outflow
Nettokapitalabfluss
27
NX
net exports
Nettoexporte
20
OC
opportunity cost
Opportunitätskosten
17
P
price
Preis (im Angebots-Nachfrage-Diagramm)
3
P
(domestic) price level
Preisniveau (Index, im makroökonomischen Kontext)
27
P*
foreign price level
Preisniveau des Auslands (Index, im makroökonomischen Kontext)
27
Q
quantity
Menge
2
QD
quantity demanded
Nachfragemenge
3
QS
quantity supplied
Angebotsmenge
3
r
interest rate
Zinssatz
24
R
reserve ratio
Reservesatz der Banken
25
S
supply
Angebot (im Angebots-Nachfrage-Diagramm)
3
S
saving
Ersparnis (im makroökonomischen Kontext)
23
T
taxes (minus transfer payments)
Steuern (abzüglich Transferleistungen des Staates)
23
TC
total cost
Gesamtkosten
5
TR
total revenue
Gesamterlös
3
V
velocity of money
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes
26
VC
variable cost
variable Kosten
5
VMPL
value of the marginal product of labour
Wertgrenzprodukt der Arbeit
15
W
wage
(Nominal-)Lohn
15
Y
quantity of output (real GDP)
(gesamtwirtschaftliches) Produktionsniveau, Einkommen (real)
26
1 Was ist Volkswirtschaftslehre?
1.1 Die Wirtschaft und die Wirtschaftsordnung
Jeden Tag treffen Milliarden von Menschen überall auf der Welt Entscheidungen. Sie entscheiden über die grundlegenden Dinge in ihrem Leben wie ihr Essen, ihre Kleidung oder ihre Unterkunft und wie sie ihre Nichtarbeitszeit auf Freizeit- und Hausarbeitsaktivitäten aufteilen wollen. Das Treffen dieser Entscheidungen verlangt eine Interaktion mit anderen Menschen, mit dem Staat und mit Unternehmen. Diese Individuen könnten Mütter, Väter, Söhne, Töchter, Pfleger, Arbeitgeber, Beschäftigte, Hausangestellte, Produzenten, Konsumenten, Sparer, Steuerzahler oder Unterstützungsempfänger sein. Viele, wenn auch nicht alle dieser Interaktionen sind in irgendeiner Weise mit einem Tausch verbunden, normalerweise einem Tausch gegen ein Medium wie Geld, manchmal aber auch einem direkten Tausch von Leistungen. Individuen kaufen Waren und Dienstleistungen für den Endverbrauch und stellen zudem Inputs für die Produktion bereit – Arbeit, Kapital und Boden. Wir bezeichnen diese Individuen allgemein als Haushalte. Die Organisationen, welche diese Faktoren kaufen und nutzen, um damit Waren und Dienstleistungen zu produzieren, werden allgemein als Unternehmen bezeichnet.
WirtschaftstätigkeitDer Umfang der Interaktion zwischen Haushalten und Unternehmen – der Umfang des Kaufens und Verkaufens.
WirtschaftHaushalte und Unternehmen in einer bestimmten geografischen Region zusammengenommen.
Der Umfang der Interaktion zwischen Haushalten und Unternehmen – der Umfang des Kaufens und Verkaufens – repräsentiert das Ausmaß der WirtschaftstätigkeitWirtschaftstätigkeit. Je mehr gekauft und verkauft wird, desto größer ist die ökonomische Aktivität. Haushalte und Unternehmen in einer bestimmten geografischen Region zusammengenommen werden als WirtschaftWirtschaft bezeichnet.
Die Volkswirtschaftslehre untersucht die Interaktionen zwischen Haushalten und Unternehmen durch Tausch. Sie beschäftigt sich auch mit Situationen, in denen ein Output produziert wird, ohne dass zugleich Einkommen entsteht, wie mit der Arbeit von unbezahlten Pflegekräften oder von Hausfrauen und Hausmännern. Sie untersucht, wie Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen; wie Ressourcen auf die vielen unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten aufgeteilt werden; und die Art, wie unsere Aktivitäten nicht nur unser eigenes Wohlergehen beeinflussen, sondern auch das anderer Menschen und das der Umwelt.
Das ökonomische Problem
ökonomisches ProblemEs gibt drei Grundfragen, die sich jede Gesellschaft stellen muss:
Welche Waren und Dienstleistungen sollen produziert werden?
Wie viel soll von diesen Waren und Dienstleistungen produziert werden?
Wer soll die produzierten Waren und Dienstleistungen erhalten?
Um diesen Fragen gerecht zu werden, stehen den Volkswirtschaften Ressourcen zur Verfügung, die als Boden (Land), Arbeit und Kapital bezeichnet werden.
BodenAlle natürlichen Ressourcen der Welt.
BodenBoden umfasst alle natürlichen Ressourcen der Welt. Das schließt Mineralvorkommen wie Eisenerz, Gold und Kupfer mit ein, aber auch die Fischvorräte in den Ozeanen, Kohle und alle Nahrungsmittel, die das Land hervorbringt.
ArbeitDie – geistige und körperliche – menschliche Leistung, die in die Produktion einfließt.
Arbeit ist die menschliche Leistung – körperliche und geistige –, welche in die Produktion eingeht. Eine Arbeiterin in einer Fabrik für feinmechanische Geräte, ein Investmentbanker, eine unbezahlte Pflegekraft, ein Straßenreiniger, eine Lehrerin – sie alle repräsentieren unterschiedliche Formen von Arbeit.
Kapital (Realkapital)Ausrüstung und Anlagen, die genutzt werden, um Waren und Dienstleistungen zu produzieren.
GutOberbegriff für Ware (materielles Gut) und Dienstleistung (immaterielles Gut).
KapitalKapital (Realkapital) umfasst Ausrüstung und Anlagen, die genutzt werden, um ein GutGut zu produzieren, das heißt eine Ware oder eine Dienstleistung. Kapitalgüter sind Maschinen in Fabriken, Gebäude, Traktoren, Computer, Öfen und alle weiteren Güter, die nicht genutzt werden, sondern in die Produktion eines anderen Gutes eingehen.
Knappheit und Wahl
KnappheitDie Gesellschaft hat weniger anzubieten, als die Menschen haben wollen.
Es wird oft angenommen, dass die RessourcenRessourcen letztlich in Bezug zur Nachfrage nach ihnen knapp sind. Als Mitglieder von Haushalten haben wir oft nicht die Fähigkeit, alle unsere Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere Bedürfnisse umfassen die notwendigen Dinge des Lebens, die es uns ermöglichen zu überleben – wie Nahrung und Wasser, Kleidung, Unterkunft und geeignete Gesundheitsversorgung. Unsere Wünsche dagegen richten sich auf diejenigen Dinge, von denen wir glauben, dass sie unser Leben komfortabler und erfreulicher machen würden – Urlaube, verschiedene Kleidungsstile, Smartphones, Freizeitaktivitäten, Möbel und sonstige Gegenstände, die wir in unseren Häusern haben usw. Unsere Wünsche und Bedürfnisse sind im Allgemeinen größer als unsere Fähigkeiten, sie zu erfüllen. KnappheitKnappheit impliziert, dass die Gesellschaft weniger anzubieten hat, als die Menschen haben wollen. So wie ein Haushalt nicht jedem Mitglied alles geben kann, was es wünscht, kann auch eine Gesellschaft nicht jedem Individuum den höchsten von ihm angestrebten Lebensstandard ermöglichen.
Aufgrund der Spannung zwischen unseren Wünschen und Bedürfnissen einerseits und der Knappheit andererseits müssen von Haushalten und Unternehmen Entscheidungen getroffen werden, wie wir unser Einkommen und unsere Ressourcen verwenden wollen, um unsere Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen.
VolkswirtschaftslehreSie befasst sich mit den Entscheidungen einer Gesellschaft, wie mit den knappen Ressourcen umzugehen ist.
Die Volkswirtschaftslehre untersucht nun die Probleme, die aus diesen Entscheidungen resultieren. Eine typische Lehrbuchdefinition von VolkswirtschaftslehreVolkswirtschaftslehre besteht darin, dass sich diese Disziplin mit den Entscheidungen einer Gesellschaft befasst, wie mit den knappen Ressourcen umzugehen ist, sowie mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen. Diese Definition kann jedoch die Komplexität und das Ausmaß der Volkswirtschaftslehre verschleiern. Wir können Haushalte dadurch charakterisieren, dass sie unbeschränkte Wünsche haben, aber nicht jeder Haushalt ist materialistisch, wie es die Idee der unbeschränkten Wünsche implizieren könnte. Einige Menschen sind bereits mit wenigen Dingen im Leben zufrieden und sie treffen ihre Entscheidungen im Hinblick darauf, was ihnen wichtig erscheint. Diese Entscheidungen sind nicht weniger wertvoll oder wichtig, sondern reflektieren die Komplexität des Themas. Einige Menschen ziehen es vor, ihren Lebensunterhalt durch Verbrechen zu verdienen. Eine Entscheidung, Verbrechen zu verüben, hat Gründe und Konsequenzen, und diese können für einen Volkswirt ebenso von Interesse sein wie die Gründe, aus denen Unternehmen entscheiden, ihre Produkte zu bewerben, oder aus denen Zentralbanken sich für eine bestimmte Geldpolitik entscheiden.
Man mag betonen, dass die Idee der KnappheitKnappheit selbst in einigen Bereichen in Zweifel zu ziehen ist. In Griechenland, in Spanien und in anderen europäischen Ländern gibt es Millionen von Menschen, die gern arbeiten wollen, aber keinen Job finden. Man könnte dagegen einwenden, dass in dieser Situation zwar nicht die Arbeit knapp ist, aber doch die offenen Stellen. Und Ökonomen werden sehr daran interessiert sein, wie eine solche Situation entsteht und was man dagegen tun kann, dass hohe Arbeitslosenquoten entstehen.
Obwohl das Studium der Volkswirtschaftslehre also viele Facetten hat, wird das Arbeitsfeld durch mehrere Leitvorstellungen verbunden, und zwar auch dann, wenn auf verwandte Disziplinen wie Psychologie, Soziologie, Jura, Anthropologie, Geografie, Statistik oder Mathematik Bezug genommen wird. Diese Leitideen sind die Themen, um die dieses Buch kreist, und die die Grundlage vieler Erstsemesterkurse bilden.
1.2 Wie Menschen Entscheidungen treffen
VolkswirtschaftDie Gesamtheit aller täglichen Produktions- und Handelsaktivitäten.
Gesamtwirtschaftliche Aktivität Alle Käufe und Verkäufe in einer Volkswirtschaft innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
Eine Volkswirtschaft ist kein Mysterium. Ob wir über die Volkswirtschaft eines einzelnen Landes wie Deutschland, einer Gruppe von Ländern wie der Europäischen Union (EU) oder über die Volkswirtschaft der gesamten Welt reden – stets ist eine Volkswirtschaft nichts weiter als eine Gruppe von Menschen, die in ihrem täglichen Leben zusammenwirken. Die VolkswirtschaftVolkswirtschaft umfasst alle Produktions- und Handelsaktivitäten, alle Käufe und Verkäufe, die jeden Tag stattfinden. Das Niveau der gesamtwirtschaftlichen AktivitätAktivität, gesamtwirtschaftliche zeigt an, wie viele Käufe und Verkäufe in einer Volkswirtschaft über einen bestimmten Zeitraum stattfinden.
Das Verhalten einer Volkswirtschaft spiegelt das Verhalten der Individuen wider, die die Wirtschaft bilden. Wir werden nun einige der Kernfragen umreißen, die die Volkswirtschaftslehre in Bezug auf die Entscheidungsfindung von Individuen untersuchen.
Alle Menschen stehen vor abzuwägenden Alternativen
Trade-offDer Verzicht auf die Vorteile aus einer entgangenen oder aufgegebenen Option im Vergleich zu den Vorteilen aus der getroffenen Wahl.
Haushalte und Unternehmen müssen Entscheidungen treffen. Das Treffen von Entscheidungen erfordert Kompromisse. Ein Trade-offTrade-off ist der Verlust der Vorteile aus einer Entscheidung, auf die man verzichtet hat, gegen die Vorteile aus einer getroffenen Wahl. Bei der Wahl zwischen Alternativen müssen wir die Vorteile berücksichtigen, die sich aus der Wahl einer Handlungsoption ergeben, aber auch berücksichtigen, dass wir auf die Vorteile verzichten müssen, die sich aus den Alternativen ergeben könnten. Um eine Sache zu bekommen, die uns gefällt, müssen wir normalerweise auf eine andere Sache verzichten, die uns auch gefallen könnte. Entscheidungen zu treffen erfordert daher einen Trade-off der Vorteile einer Handlung gegen die Vorteile anderer Handlungen. Um dieses wichtige Konzept zu illustrieren, betrachten wir nachfolgend einige Beispiele.
Beispiel 1: Denken wir an eine Studierende, die ihre wertvollste Ressource verteilen muss – ihre Zeit. Sie kann all ihre Zeit darauf verwenden, Volkswirtschaftslehre zu studieren, was ihr den Vorteil eines besseren Abschlusses bietet. Sie kann all ihre Zeit für Freizeitaktivitäten verwenden, was ihr verschiedene Vorteile bringt. Oder sie kann ihre Zeit zwischen beiden Möglichkeiten aufteilen. Für jede Stunde, in der sie studiert, gibt sie eine Stunde auf, in der sie hätte Sport treiben, fernsehen, schlafen oder Geld in ihrem Nebenjob verdienen können.
Beispiel 2: Ein Unternehmen könnte die Entscheidung zu treffen haben, in ein neues Produkt oder ein neues Kostenrechnungssystem zu investieren. Beides hat Vorteile. Das neue Produkt kann zu verbesserten Erträgen und Gewinnen in der Zukunft führen, und das Kostenrechnungssystem kann es effektiver machen, die Kosten zu kontrollieren, und hierdurch ebenfalls zu höheren Gewinnen führen. Wenn die knappen Investitionsmittel in das Kostenrechnungssystem gesteckt werden, muss das Unternehmen dagegen die Vorteile abwägen, die das neue Produkt stattdessen hätte einbringen können.
Beispiel 3: Wenn wir Gesellschaften betrachten, dann stehen diese verschiedenen Alternativen oder Zielkonflikten gegenüber. Ein Beispiel ist der Trade-off zwischen sauberer Umwelt und hohem Einkommensniveau. Gesetzliche Vorschriften, die Unternehmen zur Verringerung der Luftverschmutzung verpflichten, erhöhen die Produktionskosten für Waren und Dienstleistungen. Die höheren Kosten führen bei den Unternehmen zu niedrigeren Gewinnen, niedrigeren Löhnen, höheren Preisen oder zu Kombinationen dieser drei Komponenten. Während also Vorschriften gegen Luftverschmutzung uns den Nutzen einer sauberen Umwelt und besserer Gesundheit bieten, »kosten« sie eine Reduzierung des Einkommens der Unternehmenseigentümer, Arbeitnehmer und Kunden.
VerteilungsgerechtigkeitDie Fähigkeit einer Gesellschaft, die wirtschaftliche Wohlfahrt fair auf ihre Mitglieder aufzuteilen.
Ein weiterer Zielkonflikt der Gesellschaft besteht zwischen Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit. EffizienzEffizienzbedeutet, dass die Gesellschaft aus ihren knappen Ressourcen herausholt, so viel sie kann. Ein Ergebnis, das effizient ist, muss allerdings nicht unbedingt wünschenswert sein. VerteilungsgerechtigkeitVerteilungsgerechtigkeit bedeutet, dass der jeweilige Nutzen dieser Ressourcen fair unter den Bürgern verteilt wird. In der Politik stehen diese beiden Ziele häufig im Widerspruch zueinander. Da es bei der Verteilungsgerechtigkeit um »Fairness« geht, sind unausweichlich Werturteile involviert. Unterschiedliche Werturteile führen daher nicht selten zu Uneinigkeit zwischen Politikern und Volkswirten.
Einige Volkswirte glauben, dass Verteilungsgerechtigkeit und Effizienz nicht immer in einem Zielkonflikt zueinander stehen müssen. Auch hier ist es daher wichtig, auf den historischen Zusammenhang und die Ursprünge der Idee zu schauen. Die Behauptung eines Trade-offs zwischen Verteilungsgerechtigkeit und Effizienz geht auf Arthur Okun in den 1970er-Jahren zurück. Einige Volkswirte argumentieren jedoch, dass eine Verbesserung der Gerechtigkeit durchaus auch zu Effizienzverbesserungen führen kann, sodass es letztendlich möglich wäre, durch mehr Verteilungsgerechtigkeit den Kuchen sogar noch zu vergrößern.
Eine Politik, die auf eine gleichmäßigere Verteilung der volkswirtschaftlichen Wohlfahrt zielt, erfordert eine Abwägung zwischen den Leistungen des Wohlfahrtssystems auf der einen Seite und der Effizienz des Steuersystems, das für sie aufkommen muss, auf der anderen. Beschließt die Regierung etwa, den Spitzensatz der Einkommensteuer für die »Superreichen« anzuheben und die Einkommensteuer für die Bezieher des Mindestlohns auszusetzen, dann ist das im Ergebnis eine Einkommensumverteilung von den Reichen zu den Armen. Diese mag für einige den Anreiz bieten, Arbeit zu suchen, aber sie kann auch den Lohn für harte Arbeit schmälern, sodass manche in der Gesellschaft sich dafür entscheiden werden, weniger zu arbeiten oder sogar in ein anderes Land mit einem weniger belastenden Steuersystem umzuziehen. Ob die getroffene Abwägung als gelungen zu betrachten ist, dürfte letztlich von der Philosophie, von Glaubensüberzeugungen und den Meinungen der Entscheidungsträger abhängen und nicht zuletzt von der Macht, die sie in der Gesellschaft haben. Die Erkenntnis, dass Menschen Abwägungen zu treffen haben, bedeutet natürlich nicht zu wissen, welche Entscheidungen sie tatsächlich treffen werden oder treffen sollten. Es ist jedoch wichtig, Trade-offs zu erkennen und ihre Konsequenzen zu verstehen, weil Menschen wahrscheinlich informiertere Entscheidungen treffen, wenn sie die Optionen verstehen, die sie zur Auswahl haben.
Kurztest
Sie haben sicher schon den Satz gehört »There is no such thing as a free lunch.« Bezieht sich diese Aussage nur darauf, dass man für sein Essen bezahlen muss, oder entstehen dem Empfänger eines »free lunch« ebenfalls Kosten?
Opportunitätskosten
Weil die Menschen Zielkonflikten ausgesetzt sind, erfordern Entscheidungen einen Vergleich von Kosten und Nutzen alternativer Aktivitäten. In vielen Fällen sind die KostenKostenKosten, siehe Opportunitätskosten einer Aktivität jedoch nicht so offensichtlich, wie es zunächst scheint.
Betrachten wir zum Beispiel die Entscheidung für oder gegen das Studium. Der Nutzen besteht in der intellektuellen Bereicherung und in lebenslang besseren Karrierechancen. Aber worin bestehen die Kosten? Um diese Frage zu beantworten, könnte man versucht sein, alle finanziellen Kosten des Studiums zu addieren. Aber diese Summe zeigt nicht wirklich, worauf man für ein Studienjahr verzichtet.
Die erste Schwierigkeit besteht darin, dass diese Summe Dinge umfasst, die keine wirklichen Studienkosten sind. Auch wenn Sie nicht studieren, brauchen Sie ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen. Zu veranschlagen sind also nur die durch das Studium bedingten zusätzlichen Kosten.
Ein zweites Problem bei dieser Berechnung der Kosten besteht darin, dass sie den größten Kostenfaktor des Studiums gar nicht enthält – die Zeit. Wenn Sie ein Jahr damit verbringen, Vorlesungen zu besuchen, Lehrbücher zu lesen und Hausarbeiten zu schreiben, können Sie in dieser Zeit nicht arbeiten, zumindest nicht voll. Für die meisten Studierenden ist der Lohn- beziehungsweise Gehaltsverzicht der größte Einzelposten der Kosten ihrer Hochschulbildung.
OpportunitätskostenWas aufgegeben werden muss, um etwas anderes zu erlangen.
Wenn man Entscheidungen trifft, kann es manchmal besser sein, ihre Kosten danach zu bemessen, welche anderen Optionen man dafür aufgibt, als die Kosten der Entscheidungen in Geldeinheiten zu bemessen. Die OpportunitätskostenOpportunitätskosten sind ein Maß für die Optionen, die man durch die Entscheidung aufgibt. Die Opportunitätskosten, zur Universität zu gehen, bestehen beispielsweise im Lohn eines Vollzeitjobs, den Sie gleichzeitig nicht ausüben können.
Opportunitätskosten sind die Kosten einer aufgegebenen nächstbesten Alternative – also das, auf was man verzichten muss, um etwas zu erlangen. Allgemein können wir die Opportunitätskosten als Beziehung des Verzichts auf ein Gut in Einheiten eines erlangten anderen Gutes ausdrücken:
Drückt man dagegen die Opportunitätskosten in Einheiten des Gutes x aus, so erhält man:
Opportunitätskosten können in Einheiten des einen wie des anderen Gutes ausgedrückt werden.
Kurztest
Nehmen Sie an, einer Studierenden entstehen im Lauf ihres dreijährigen Studiums folgende Kosten:
für das Bachelorstudium insgesamt
Opportunitätskosten (Durchschnittsverdienst):
Wieso sollte sie zu solch hohen Kosten studieren wollen?
In Grenzbegriffen denken
Marginale VeränderungenKleine schrittweise Änderungen einer geplanten Aktivität.
WirtschaftssubjektEin Individuum, ein Unternehmen oder eine Organisation, das oder die in irgendeiner Weise Einfluss auf die Wirtschaft hat
Entscheidungen im Leben zu treffen, ist selten ganz einfach; vielmehr fordern sie in der Regel eine Abwägung von Kosten und Nutzen. Wenn wir den Nutzen maximieren oder die Kosten minimieren wollen, kann es hilfreich sein, über ein Konzept zu verfügen, auf das man seine Entscheidung gründen kann. Das Denken in Grenzbegriffen ist ein solches Konzept, das Volkswirte auf das Treffen von Entscheidungen anwenden. Marginale VeränderungenVeränderung, marginale beschreiben kleine, schrittweise Anpassungen an einen bestehenden Handlungsplan. Die Marginalanalyse unterstellt, dass WirtschaftssubjekteWirtschaftssubjektWirtschaftssubjekt (eine Einzelperson, ein Unternehmen oder eine Organisation, welche die Wirtschaft in irgendeiner Weise beeinflusst) versuchen, ihre Ergebnisse zu maximieren oder zu minimieren, wenn sie Entscheidungen treffen. Man kann davon ausgehen, dass Konsumenten versuchen, die Zufriedenheit zu maximieren, die sie aus ihren Einkommen ziehen, während Unternehmen ihre Gewinne maximieren und ihre Kosten minimieren. Dieses Maximierungs- und Minimierungsverhalten basiert dabei auf der zusätzlichen Annahme, dass sich Wirtschaftssubjekte rational verhalten.
Es ist wichtig, kurz innezuhalten und zu überlegen, was wir in diesem Zusammenhang unter dem Begriff »rational« verstehen. Wenn einige Volkswirte den Begriff »rational«rationalrational im Zusammenhang mit einer Entscheidung verwenden, dann steht er einfach für die Annahme, dass Entscheidungsträger konsistent zwischen bestehenden Alternativen wählen. Wir werden dies in diesem Buch später noch genauer ansehen, aber an dieser Stelle bezeichnen wir Rationalität als die Fähigkeit eines Entscheidungsträgers, seine Präferenzen zu ordnen und das Bestmögliche aus seinen Ressourcen zu machen. In Grenzbegriffen zu denken, bedeutet dabei, dass die Entscheidungsträger ihre Entscheidungen so planen, dass ihre Grenzkosten ihrem Grenznutzen gleich sind. Solange eine Entscheidung zu einem höheren Grenznutzen als Grenzkosten führt, dann lohnt es, diese Entscheidung zu treffen und so lange damit fortzufahren, bis die Grenzkosten dieser Entscheidung den Grenznutzen gleich sind.
RationalDie Annahme, dass Entscheidungsträger konsistent zwischen Alternativen wählen.
Die Rationalverhaltensannahme bietet einen Bezugsrahmen, um Entscheidungen zu analysieren. Seit den 1870er-Jahren ist sie ein Grundprinzip der Volkswirtschaftslehre – bei Denkern wie William Stanley Jevons und Carl Menger, die ihrerseits auf den Arbeiten von David Ricardo und Jeremy Bentham aufbauten und die sogenannte Grenznutzenschule bildeten. Die Annahmen eines ökonomischen Rationalverhaltens haben allerdings auch Implikationen, die Gegenstand von Kritik waren. Bei der Untersuchung ökonomischer Modelle auf der Basis der Rationalverhaltensannahme ist es daher wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass sich erheblich andere Ergebnisse einstellen können, wenn diese Annahme aufgehoben wird. Wir werden eine Reihe von ökonomischen Modellen behandeln, die auf dieser Annahme basieren, weil das einen Einblick in die Art und Weise gibt, wie sich die volkswirtschaftliche Analyse historisch entwickelt und im Lauf der Zeit beständig verändert hat. Sie stellt zudem eine spezifische Art dar, über Probleme nachzudenken, die mit anderen Denkweisen unter anderen Annahmen verglichen werden kann.
Menschen reagieren auf Anreize
Wenn wir mit dem Grundsatz des RationalverhaltensRationalverhalten annehmen, dass Menschen Entscheidungen treffen, indem sie ihre Kosten und Nutzen miteinander vergleichen, ist es logisch zu unterstellen, dass sich ihr Verhalten verändern kann, wenn die Kosten und Nutzen sich verändern. Das bedeutet: Menschen reagieren auf Anreize. Die Drohung mit einem Bußgeld und dem Entzug des Führerscheins soll regulieren, wie Menschen ihr Auto fahren oder parken; ein Preis für Plastiktüten im Supermarkt zielt darauf ab, Menschen zu bewegen, die Taschen wiederzuverwenden und ihre Gesamtzahl zu reduzieren.
In den letzten Jahren ist zunehmend über Anreize geforscht worden, weil Absichten von Politikern nicht immer zu den erwarteten oder gewünschten Ergebnissen führen. So würde man erwarten, dass ein Bußgeld für Eltern, die ihre Kinder zu spät aus der Tageseinrichtung abholen, dazu führen müsste, die Anzahl der Spätabholungen zu verringern. Eine Studie in Israel zeigte jedoch, dass ganz im Gegenteil Eltern bereit waren, die Gebühr zu bezahlen, sodass sich die Anzahl der zu spät kommenden Eltern sogar noch erhöhte. Solche Folgen etwa zählen zu den »unbeabsichtigten Konsequenzen«.
Kurztest
Die Regierung eines Landes führt einen gesetzlichen Kündigungsschutz für Arbeitnehmer ein. Was bezweckt diese politische Maßnahme? Welche unbeabsichtigten Konsequenzen kann diese Maßnahme haben?
1.3 Wie Menschen zusammenwirken
Entscheidungen betreffen nicht nur uns allein, sondern auch andere Wirtschaftssubjekte. Wir werden nun einige Probleme betrachten, die entstehen, wenn Wirtschaftssubjekte mit anderen interagieren.
Durch Handel kann es jedem besser gehen
Die Vereinigten Staaten und China sind in der Weltwirtschaft Europas Konkurrenten, weil US-amerikanische und chinesische Unternehmen vielfach die gleichen Güter produzieren wie europäische Unternehmen. Man könnte meinen, wenn China auf Kosten Europas seinen Anteil am Welthandel erhöhte, dies schlecht für die Menschen in Europa wäre. Doch das muss nicht der Fall sein. Denn der Handel zwischen Europa und den Vereinigten Staaten und China ist nicht wie ein Sportwettbewerb, bei dem die eine Seite gewinnt und die andere Seite verliert (ein Nullsummenspiel). Unter bestimmten Umständen kann der Handel zwischen Volkswirtschaften alle besser stellen. Haushalte, Unternehmen und Länder verfügen über unterschiedliche Ressourcenausstattungen; Individuen haben Talente und Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, einige Dinge effizienter zu produzieren als andere; einige Unternehmen haben besondere Erfahrungen und Fachwissen in der Produktion von Waren und Dienstleistungen; und bestimmte Länder wie Spanien sind mit viel Sonnenschein gesegnet, der es ihren Landwirten ermöglicht, qualitativ hochwertiges Obst anzubauen. Handel ermöglicht Individuen, Unternehmen und Ländern dabei, sich auf diejenigen Aktivitäten zu spezialisieren, die sie am besten beherrschen. Mit dem Einkommen, das sie aus ihrer Spezialisierung erzielen, können sie dann mit anderen, die sich ebenfalls spezialisiert haben, Handel treiben und so im Ergebnis den Lebensstandard insgesamt erhöhen.
Doch während der Handel Vorteile und Gewinner haben kann, wird es wahrscheinlich auch Nachteile und Verlierer geben. Die wirtschaftliche Entwicklung einiger Länder in den letzten 50 Jahren hat dazu geführt, dass viele Menschen Zugang zu preiswerten, qualitativ hochwertigen Waren und Dienstleistungen haben, weil diese exportiert werden. Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber dieser Branchen in den entwickelten Volkswirtschaften kann die Konkurrenz aus den Entwicklungsländern daher bedeuten, dass sie ihre Arbeit verlieren oder ihre Unternehmen schließen müssen. Manchmal ist es für diese Menschen schwierig, eine andere Arbeit zu finden. Die Gesellschaftsschichten, die stark von solchen Veränderungen berührt sind, werden dann womöglich nicht zustimmen, dass »Handel allen zugutekommen kann«.
Die kapitalistische Wirtschaftsordnung
WirtschaftsordnungEin Rahmen, in dem Ressourcen organisiert und aufgeteilt werden, um die Bedürfnisse der Wirtschaftsbürgerinnen und -bürger zu erfüllen.
Kapitalistische WirtschaftsordnungSie beinhaltet das Prinzip des Privateigentums an Produktionsfaktoren, um Waren und Dienstleistungen zu produzieren, die mittels eines Preismechanismus ausgetauscht werden; die Produktion wird dabei vor allem zu Gewinnzwecken ausgeführt.
Das Grundproblem des Wirtschaftens besteht in drei Fragen, die jede Gesellschaft zu beantworten hat: Welche Waren und Dienstleistungen produziert werden sollen, wie sie produziert werden sollen und wer bekommen soll, was produziert wurde, muss die Wirtschaftsordnung regeln. Eine WirtschaftsordnungWirtschaftsordnungist ein Rahmen, in dem Ressourcen organisiert und aufgeteilt werden, um die Bedürfnisse der Wirtschaftsbürgerinnen und -bürger zu erfüllen. In vielen Ländern der Welt antworten die Gesellschaften auf die drei aufgeworfenen Fragen mit einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die auf Märkten basiert. Eine kapitalistische WirtschaftsordnungWirtschaftsordnung, kapitalistischebeinhaltet das Prinzip des Privateigentums an Produktionsfaktoren, um Waren und Dienstleistungen zu produzieren, die mittels eines Preismechanismus ausgetauscht werden; die Produktion wird dabei vor allem zu Gewinnzwecken ausgeführt. Kapitalistische Wirtschaftsordnungen haben sich als fähig erwiesen, den Lebensstandard von Millionen von Menschen während der letzten zweihundert Jahre anzuheben. Wir können den Lebensstandard anhand des Einkommens messen, das Menschen verdienen und das es ihnen erlaubt, Waren und Dienstleistungen zu erwerben, die sie für ihr Überleben benötigen oder dazu, ihr Leben zu genießen. Obwohl kapitalistische Wirtschaftsordnungen den Lebensstandard für viele angehoben haben, bedeutet das nicht, dass jeder und jede in der Gesellschaft gleichermaßen profitiert. Kapitalismus bedeutet auch, dass einige Menschen und Länder sehr reich wurden, während andere arm blieben. Die Existenz des Profitmotivs bietet für Unternehmer einen Anreiz, Risiken bei der Organisation von Produktionsfaktoren zu übernehmen. Diese Dynamik in kapitalistischen Wirtschaftsordnungen führt zu Entwicklungen in der Technologie und der Kapitaleffizienz, die zu Gewinnen der betroffenen Individuen und Unternehmen führen, aber auch das Wissen und den Informationsstand in der Gesellschaft insgesamt vergrößern, was wiederum zu weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen führt.
Kritiker kapitalistischer Wirtschaftsordnungen argumentieren, dass diese inhärent instabil seien. Zudem bevorteilen kapitalistische Systeme diejenigen, die Privateigentum an den Einsatzfaktoren erlangt haben und so in der Lage sind, Arbeiter auszubeuten und beträchtliche ökonomische und politische Macht auszuüben, welche die Ressourcenallokation stört. Karl Marx verwendete einen wesentlichen Teil seines Lebens darauf, die kapitalistische Wirtschaftsordnung zu verstehen und zu analysieren und Theorien zu entwickeln, um zu erklären, warum es zur Ausbeutung von Arbeitern und zu Instabilitäten kam.
Märkte sind gewöhnlich gut geeignet, um die Wirtschaftstätigkeit zu organisieren
MarktwirtschaftDie drei Grundfragen des ökonomischen Problems werden durch dezentralisierte Entscheidungen vieler Unternehmen und Haushalte beantwortet, die auf Märkten in Bezug auf Waren und Dienstleistungen miteinander interagieren.
Die Rolle von Märkten ist in einem kapitalistischen System zentral. In einer MarktwirtschaftWirtschaftsordnung, MarktwirtschaftMarktwirtschaftwerden die drei Grundfragen des ökonomischen Problems durch dezentralisierte Entscheidungen vieler Unternehmen und Haushalte beantwortet, die auf Märkten in Bezug auf Waren und Dienstleistungen miteinander interagieren. Unternehmen entscheiden selbst, wen sie einstellen und was sie tun wollen. Haushalte entscheiden selbst, bei welchen Unternehmen sie arbeiten und was sie von ihrem Einkommen kaufen wollen. Diese Unternehmen und Haushalte interagieren im Markt, auf dem Preise und, wie angenommen, Eigennutz ihre Entscheidungen lenken.
In einer reinen Marktwirtschaft (ohne Staatseingriffe) betrachtet niemand das ökonomische Wohlergehen der Gesellschaft als Ganzes. Freie Märkte umfassen viele Käufer und Verkäufer zahlreicher Waren und Dienstleistungen, von denen alle primär an ihrem eigenen Wohlergehen interessiert sind. Trotz der dezentralen Entscheidungsfindung und der selbstinteressierten Entscheidungsträger haben sich Marktwirtschaften bemerkenswert erfolgreich darin erwiesen, die Wirtschaftstätigkeit in einer Weise zu organisieren, die das ökonomische Wohlergehen von Millionen von Menschen befördert, wenn auch anzuerkennen ist, dass dabei Ungleichheiten entstehen können.
Zentralverwaltungswirtschaften Kommunistische Systeme oder Befehlswirtschaften.
Die ungleiche Verteilung von Wohlstand in kapitalistischen Gesellschaften, die in den Ländern der Industriellen Revolution des 18. und 19. Jahrhunderts festzustellen war, führte zur Entwicklung anderer Wirtschaftsordnungen, von denen die ZentralverwaltungswirtschaftenWirtschaftsordnung, ZentralverwaltungswirtschaftenZentralverwaltungswirtschaften manchmal als kommunistische Systeme oder Befehlswirtschaften bezeichnet werden. Kommunistische Länder arbeiteten mit der Annahme, dass Zentralplaner die Wirtschaftstätigkeit leiten und die drei zentralen Fragen des ökonomischen Problems beantworten konnten. Die Theorie hinter der Zentralplanung war, dass der Staat die wirtschaftliche Tätigkeit in einer Weise organisieren könne, die den ökonomischen Wohlstand für das Land insgesamt befördern und zu gleicheren Ergebnissen führen könne. Heute haben die meisten Länder wie Russland, Polen, Angola, Mosambik und die Demokratische Republik Kongo, die früher Zentralverwaltungswirtschaften waren, dieses System aufgegeben und entwickeln nun stärker marktbasierte Wirtschaften.
In China hat sich in den letzten 40 Jahren eine Mischung aus kapitalistischer Wirtschaft und zentraler Planung herausgebildet. Während dieser Zeit hat sich China dem Kapitalismus geöffnet, indem viele ehemals staatseigene Unternehmen privatisiert, das Unternehmertum gefördert und Strukturreformen durchgeführt wurden, um die Handelsströme und die Vernetzung der Regionen in ganz China zu verbessern. Dennoch spielt der Staat nach wie vor eine zentrale Rolle bei der Gesamtplanung der Volkswirtschaft – einer Wirtschaftsordnung, die manche als staatlich gelenkten autoritären Kapitalismus bezeichnen.
Regierungen können manchmal die Marktergebnisse verbessern
In einer Volkswirtschaft können Waren und Dienstleistungen über den Preismechanismus zugeteilt werden. Doch führen Märkte nicht immer zu effizienten oder gerechten Ergebnissen. In einigen Fällen würden Waren und Dienstleistungen durch das Marktsystem nicht bereitgestellt, da dies nicht praktikabel ist oder man die Bereitstellung durch den Markt als unerwünscht betrachtet, weil entweder zu wenige oder zu viele Waren und Dienstleistungen verbraucht werden. Die kapitalistische Wirtschaftsordnung und Märkte stützen sich auf Gesetze und Vorschriften, um zu gewährleisten, dass Eigentumsrechte durchgesetzt werden.
Regierungen stellen Waren und Dienstleistungen bereit, die in einer Marktwirtschaft möglicherweise nicht in ausreichender Menge bereitgestellt würden, und sie legen einen Rechts- und Regelrahmen fest, innerhalb dessen Unternehmen und Haushalte operieren können. Staatliche Eingriffe in Märkte können bestrebt sein, Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit zu fördern. Das bedeutet, dass die meisten Maßnahmen entweder darauf gerichtet sind, den wirtschaftlichen Kuchen zu vergrößern oder die Art und Weise zu ändern, in welcher der Kuchen aufgeteilt wird, oder sie werden sogar versuchen, beides gleichzeitig zu erreichen. Marktordnungen sind keine Garantie dafür, dass alle über genug zu essen, ordentliche Kleidung und angemessene Gesundheitsversorgung verfügen. Viele politische Maßnahmen wie die Einkommensteuer oder das Sozialversicherungssystem sind darauf ausgerichtet, eine gerechtere Verteilung des wirtschaftlichen Wohlstands zu erreichen.
MarktversagenEine Situation, in der es einem sich selbst überlassenen Markt nicht gelingt, die Ressourcen effizient zuzuteilen.
Externalität, externer EffektKosten oder Nutzen der Entscheidung einer Person, die von dieser nicht berücksichtigt wurden und die das ökonomische Wohlergehen eines unbeteiligten Dritten beeinflussen.
MarktmachtDie Fähigkeit eines Einzelnen oder einer kleinen Gruppe, den Marktpreis maßgeblich zu beeinflussen.
Wenn Märkte Ressourcen zuteilen, können ihre Ergebnisse immer noch ineffizient sein. Volkswirte verwenden hierfür den Begriff Marktversagen, um Situationen zu bezeichnen, in denen der Markt allein nicht in der Lage ist, eine effiziente Ressourcenallokation hervorzubringen. Ein möglicher Grund von MarktversagenMarktversagenMarktversagen sind externe Effekte oder sogenannte Externalitäten. Eine Externalität oder ein externer Effekt ist die Auswirkung des Handelns einer Person in Form von Kosten oder Nutzen auf die Wohlfahrt eines unbeteiligten Dritten, die von der Person bei der Entscheidung aber nicht berücksichtigt werden. Ein klassisches Beispiel ist die Luftverschmutzung. Eine andere mögliche Ursache für Marktversagen kann in der Marktmacht liegen. MarktmachtMarktmacht ist die Fähigkeit eines Einzelnen oder einer kleinen Gruppe, die Marktpreise übermäßig zu beeinflussen. Im Fall des Marktversagens kann eine gut gestaltete Politik die ökonomische Effizienz steigern.
Zu sagen, dass die Regierung die Marktergebnisse bisweilen verbessern kann, heißt nicht, dass dies tatsächlich immer geschehen wird. Die Politik wird nicht von Engeln gemacht, sondern in einem bei Weitem nicht perfekten politischen Prozess bestimmt. Manchmal werden Maßnahmen einfach deshalb entwickelt, um mächtige Gruppen zu belohnen. Manchmal werden sie von Politikern entworfen, die es zwar gut meinen, die aber nicht hinreichend informiert sind. Das Studium der Volkswirtschaftslehre hat auch dieses Ziel: Es soll Ihnen helfen, zu beurteilen, ob politische Maßnahmen geeignet sind, Effizienz oder Gerechtigkeit zu fördern oder nicht.
Information
Die unsichtbare Hand des Markts
unsichtbare HandAdam SmithsSmith, Adam bedeutendes Werk »The Wealth of Nations« wurde 1776 veröffentlicht und war ein Meilenstein der Volkswirtschaftslehre. Mit seiner Darstellung der unsichtbaren Hand des Markts repräsentierte das Werk eine Geisteshaltung, die typisch war für Aufklärer wie Smith: Die Menschen sollten selbstständig über ihr Dasein bestimmen, ohne dass sich die Regierung einmischt und eine Zentrale alles steuert. Diese politische Philosophie schuf die Basis der freien Marktwirtschaft. Warum funktionieren dezentrale Marktwirtschaften so gut? Weil man sich darauf verlassen kann, dass sich Menschen gegenseitig mit Liebe und Gutmütigkeit begegnen? Nicht im Geringsten. Wie Menschen in der Marktwirtschaft zusammenwirken, beschreibt Adam Smith wie folgt:
»(D)er Mensch dagegen braucht fortwährend die Hülfe seiner Mitmenschen, und er würde diese vergeblich von ihrem Wohlwollen allein erwarten. Er wird viel eher zum Ziele kommen, wenn er ihre Eigenliebe zu seinen Gunsten interessieren und ihnen zeigen kann, daß sie ihren eigenen Nutzen davon haben, wenn sie für ihn thun, was er von ihnen haben will. (…) Nicht von dem Wohlwollen des Fleischers, Brauers oder Bäckers erwarten wir unsere Mahlzeit, sondern von ihrer Bedachtnahme auf ihr eigenes Interesse« (Smith, A. (1776): Untersuchungen über das Wesen und die Ursachen des Nationalreichthums, Bd. 1, Deutsch mit Anmerkungen von Max Stirner, in: Stirner, M.: Die National-Oekonomen der Franzosen und Engländer, Bd. 5 und 6, Leipzig 1846, S. 25 f.).
»Allerdings ist es in der Regel weder sein Streben, das allgemeine Wohl zu fördern, noch weiß er auch, wie sehr er dasselbe befördert. (…) (Er) beabsichtigt (…) lediglich seinen eigenen Gewinn, und wird in diesen wie in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, daß er einen Zweck befördern muß, den er sich in keiner Weise vorgesetzt hatte. Auch ist es nicht eben ein Unglück für die Gesellschaft, daß er diesen Zweck nicht hatte. Verfolgt er sein eigenes Interesse, so befördert er das der Gesellschaft weit wirksamer, als wenn er dieses wirklich zu befördern die Absicht hätte« (Smith, A. (1776): Untersuchungen über das Wesen und die Ursachen des Nationalreichthums, Bd. 3, Deutsch mit Anmerkungen von Max Stirner, in: Stirner, M.: Die National-Oekonomen der Franzosen und Engländer, Bd. 7 und 8, Leipzig 1847. S. 41).
Smith unterstellte, dass die an der Wirtschaft Beteiligten durch ihr Eigeninteresse motiviert sind und dass die »unsichtbare Hand des Markts« dieses Eigeninteresse zu einer Förderung des allgemeinen wirtschaftlichen Wohlergehens hinlenkt. Smith’ Gebrauch des Begriffs »Eigeninteresse« sollte jedoch nicht im Sinne von »Egoismus« interpretiert werden. Denn Smith interessierte sich dafür, wie die Menschen ihr Eigeninteresse auf ihre eigene Weise verfolgen. Oder wie es der Wirtschaftsnobelpreisträger von 2002, Vernon L. Smith, in der Rede zu seiner Preisverleihung ausdrückte: »Gutes für andere zu tun, erfordert keine bewusste Handlung, um das wahrgenommene Interesse der anderen zu fördern.«
Der Begriff »unsichtbare Hand« wird in der Volkswirtschaftslehre häufig dazu verwendet, zu beschreiben, wie Marktwirtschaften knappe Ressourcen zuteilen. Doch verwendete Adam Smith diese Bezeichnung in seinem Wealth of Nations nur ein einziges Mal. Der Ausdruck kam auch in seinem früheren Buch A Theory of Moral Sentiments vor. In beiden Fällen beschrieb Smith damit die Idee, dass die Handlungen eigeninteressierter Individuen gesellschaftlich wünschenswerte Ergebnisse hervorbringen können.
In seiner »Theorie der ethischen Gefühle« verwendet er den Ausdruck, um zu zeigen, wie der Wunsch des Menschen nach Luxus dazu führen kann, Beschäftigung für andere zu schaffen, und in The Wealth of Nations findet sich der Ausdruck im Zusammenhang mit Investitionsentscheidungen. Beides mag ähnlich klingen, aber im ersten Fall ging es Smith, wie es scheint, um die politische Philosophie der Wirtschaftsordnung, über die er schrieb – ein System, das in vieler Hinsicht sehr verschieden ist von dem, was wir heute erleben.
1.4 Wie die Volkswirtschaft insgesamt funktioniert
Zuerst haben wir erörtert, wie Menschen sich individuell entscheiden, und danach, wie sie zusammenwirken. Alle Entscheidungen und Interaktionen zusammen machen »die Volkswirtschaft« aus.
Mikroökonomik und Makroökonomik
MikroökonomikDie Analyse, wie Haushalte und Unternehmen Entscheidungen treffen und auf den Märkten interagieren.
MakroökonomikDie Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Phänomene einschließlich Inflation, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftswachstum.
Seit etwa den 1930er-Jahren wird das Arbeitsgebiet der Volkswirtschaftslehre in zwei große Teilbereiche untergliedert. Die MikroökonomikMikroökonomik untersucht, wie Haushalte und Unternehmen Entscheidungen treffen und wie die Wirtschaftseinheiten auf den einzelnen Märkten zusammenwirken. Die MakroökonomikMakroökonomik befasst sich mit gesamtwirtschaftlichen Phänomenen. Dem Wirtschaftsnobelpreisträger Ragnar Frisch wird zugeschrieben, der erste gewesen zu sein, der diese beiden Ausdrücke verwendete (übrigens gemeinsam mit dem Ausdruck »Ökonometrie«), und es war die Cambridger Volkswirtin Joan Robinson, eine Verbündete von Keynes, die als erste die Makroökonomik als »die Theorie der gesamtwirtschaftlichen Produktion« definierte. Ein Mikroökonom beschäftigt sich vielleicht mit den Auswirkungen einer Mietpreisbindung auf den Wohnungsmarkt in München, der japanischen Konkurrenz auf den deutschen Automobilmarkt oder der Schulpflicht auf das Lohnniveau. Ein Makroökonom untersucht dagegen die Auswirkungen der Staatsverschuldung, die Veränderungen der Arbeitslosenquote oder Effekte unterschiedlicher wachstumspolitischer Maßnahmen auf den nationalen Lebensstandard.
Mikroökonomik und Makroökonomik sind eng miteinander verbunden. Da gesamtwirtschaftliche Entwicklungen durch Millionen individueller Entscheidungen entstehen, kann man makroökonomische Analysen nicht ohne die zugehörigen Mikroentscheidungen begreifen. Ein Makroökonom untersucht zum Beispiel die Auswirkung einer Einkommensteuersenkung auf das gesamtwirtschaftliche Produktionsniveau, d. h. die Menge an Waren und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft erzeugt wird. Um dieses Problem zu klären, muss er oder sie danach fragen, wie die Steuersenkung den einzelnen Haushalt bei seiner Nachfrageentscheidung beeinflusst.
Trotz der inneren Verbindung zwischen Mikroökonomik und Makroökonomik sind die beiden Teilgebiete voneinander verschieden. In der Volkswirtschaftslehre scheint es sich anzubieten, mit den kleinsten Einheiten zu beginnen und darauf aufzubauen. Doch dieses Vorgehen ist weder notwendig noch stets der beste Weg. Mikroökonomik und Makroökonomik behandeln verschiedene Fragestellungen mit recht unterschiedlichen Ansätzen. Beide Gebiete werden daher auch häufig getrennt gelehrt.
Der Lebensstandard einer Volkswirtschaft hängt von ihrer Fähigkeit ab, Waren und Dienstleistungen herzustellen
WirtschaftswachstumDie prozentuale Veränderung der Menge an Waren und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft innerhalb eines bestimmten Zeitraums produziert wurden.
Ein Schlüsselbegriff der Makroökonomik ist das WirtschaftswachstumWirtschaftswachstum – die prozentuale Veränderung der Menge aller Waren und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum produziert wurden, in der Regel innerhalb eines Quartals oder eines Jahres.
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro KopfDas Durchschnittseinkommen pro Kopf einer Population.
Eine Maßgröße des ökonomischen Wohlstands einer Nation ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro KopfBruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf, das als Durchschnittseinkommen pro Kopf einer Population interpretiert werden kann. Nach Statistiken des BIP pro Kopf haben viele entwickelte Wirtschaften ein relativ hohes Pro-Kopf-Einkommen, während in den Ländern südlich der Sahara in Afrika die Durchschnittseinkommen niedriger und in einigen Fällen sogar signifikant niedriger sind. Beispielsweise betrug das BIP im Jahr 2023 pro Kopf in Benin in Westafrika nach Statistiken der Weltbank 1.449 Dollar. Das BIP pro Kopf in Deutschland dagegen betrug 51.384 Dollar. Mit anderen Worten betrugen die Einkommen in Benin rund 2,82 Prozent der Einkommen in Deutschland.
Lebensstandard Bezieht sich auf die Menge an Waren und Dienstleistungen, die von der Bevölkerung eines Landes gekauft werden kann.
Selbstverständlich schlägt sich diese große Streuung des Pro-Kopf-Einkommens in den verschiedenen Maßen der Lebensqualität und im LebensstandardLebensstandard nieder. Bürger von Ländern mit hohen Pro-Kopf-Einkommen haben mehr Fernsehgeräte, mehr Autos, bessere Ernährung, bessere Gesundheitsfürsorge und eine längere Lebenserwartung als Bürger von Ländern mit niedrigen Einkommen.
Auch die Veränderungen des Lebensstandards im Zeitablauf sind groß. Zwischen 2010 und 2019 (vor der Covid-Pandemie) betrug das Wirtschaftswachstum, also die prozentuale Wachstumsrate des BIP, in Bangladesch durchschnittlich etwa 6,8 Prozent pro Jahr und in China etwa 7,6 Prozent pro Jahr, aber in Brasilien wuchs während des gleichen Zeitraums die Wirtschaft nur um etwa 1,9 Prozent. Und im Zeitraum von 2014 bis 2016 schrumpfte die brasilianische Wirtschaft sogar um 2,1 Prozent (Quelle: Weltbank).
ProduktivitätDie Menge der pro Arbeitsstunde produzierten Güter.
Die Unterschiede der Lebensstandards sind fast gänzlich den nationalen Unterschieden der ProduktivitätProduktivität zuzurechnen, das heißt der Menge der pro Arbeitsstunde produzierten Güter. In Staaten, in denen die Beschäftigten eine große Gütermenge pro Zeiteinheit herstellen können, erfreuen sich die meisten Menschen eines hohen Lebensstandards. In Staaten mit weniger produktiven Arbeitskräften (und oft erheblich niedrigerer Kapitalausstattung) müssen die Menschen bescheidenere Lebensbedingungen ertragen. Ähnlich bestimmt die Wachstumsrate der Produktivität die des Pro-Kopf-Einkommens.
Die Beziehung zwischen der Produktivität und dem Lebensstandard hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Politik. Wenn man über die Auswirkung einer politischen Maßnahme auf den Lebensstandard nachdenkt, ist die zentrale Frage, in welcher Weise die Maßnahme die gesellschaftliche Fähigkeit zur Produktion von Gütern beeinflusst. Um den Lebensstandard zu erhöhen, müssen die Politiker die Produktivität erhöhen, indem sie für hohen Ausbildungsstand, gute Realkapitalausstattung und Zugang zu den bestmöglichen Technologien sorgen.
Die Preise steigen, wenn die Regierung zu viel Geld in Umlauf bringt
InflationEin Anstieg sämtlicher Preise der Volkswirtschaft.
In Deutschland kostete eine Tageszeitung im Jahr 1921 30 Pfennig. Weniger als zwei Jahre später, im November 1922, kostete dieselbe Ausgabe einer Tageszeitung 70 Millionen Mark. Alle anderen Preise in der deutschen Volkswirtschaft stiegen um ähnliche Zuwachsraten. Es handelt sich um eines der spektakulärsten historischen Beispiele für InflationInflation, einen Anstieg sämtlicher Preise der Volkswirtschaft. Weil hohe Inflationsraten einer Gesellschaft Kosten aufbürden, ist es ein weltweites Ziel aller Staaten, die Inflationsrate niedrig zu halten. Was verursacht eine Inflation? In den meisten Fällen hoher und anhaltender Inflation lässt sich ein und derselbe Schuldige finden: das Geldmengenwachstum. Wenn ein Staat oder eine Zentralbank die Geldmenge stark ausweitet, ohne dass die Produktion in gleicher Weise ansteigt, sinkt der Geldwert. Als sich in den frühen 1920er-Jahren in Deutschland sämtliche Preise im Durchschnitt monatlich verdreifachten, verdreifachte sich auch die Geldmenge. Es gilt gemeinhin als anerkannt, dass der Anstieg der Geldmenge und der Anstieg der Preise zusammenhängen.
Kurztest
Was ist der Unterschied zwischen Makroökonomik und Mikroökonomik? Nennen Sie drei Fragen, mit denen sich das Studium der Mikroökonomik befassen könnte, und drei Fragen, mit denen sich das Studium der Makroökonomik befassen könnte.
Information
Wie Sie dieses Buch lesen sollten