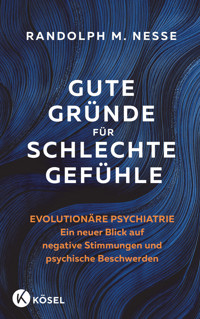
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ein neuer Zugang: Nesse zeigt, dass Angststörungen oder Depression klar einen evolutionären Ursprung haben ... Dieses fesselnde Buch stellt Menschheitsfragen vom Kopf auf die Füße.« The Observer
Dieses psychologische Sachbuch bietet eine faszinierende neue Perspektive auf negative Emotionen. Fundiert und anhand zahlreicher Fallbeispiele aus seiner mehr als vierzigjährigen Praxis zeigt Randolph M. Nesse, dass die eigentlichen Gründe für Angststörungen, Depressionen, Suchterkrankungen etc. keine Abweichungen von der Normalität darstellen, sondern in den evolutionär geprägten Eigenschaften unseres Gehirns liegen. Gerade die jahrtausendealten Entwicklungen, die uns zu sozialem Handeln und kognitiven Leistungen befähigen, sind auch dafür verantwortlich, dass wir unter schlechten Gefühlen wie Angst, Scham, Wut und Niedergeschlagenheit leiden. Nesse macht Zusammenhänge und Hintergründe verständlich, entlastet Betroffene davon, sich schuldig zu fühlen, und zeigt neue Wege im Umgang mit psychischen Beschwerden auf.
»Lebensziele aufgeben kann der Schlüssel zum Überwinden einer Depression sein, sagt Randolph Nesse. Die Evolutionstheorie hat ihn zu einem besseren Therapeuten gemacht.« Zeit online / Jakob Simmank
»Ein Muss: Randolph Nesse lehrt uns, warum die Evolution uns mit ›schlechten Gefühlen‹ ausgestattet hat. Dies kann uns dabei helfen, manche psychische Krankheiten nicht nur besser zu verstehen, sondern auch besser zu behandeln.« Prof. Dr. med. Martin Brüne, Leiter der Forschungsabteilung Soziale Neuropsychiatrie und Evolutionäre Medizin Bochum
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Warum sind wir so anfällig für negative Stimmungen, für Angststörungen und Depressionen? Wieso hat die Evolution nicht längst dafür gesorgt, dass sie verschwinden? Randolph M. Nesse gibt darauf fundiert und anhand zahlreicher Beispiele aus seiner mehr als vierzigjährigen Praxis Antwort: Gerade die evolutionären Entwicklungen, die uns zu sozialem Handeln und kognitiven Leistungen befähigen, sind auch dafür verantwortlich, dass wir mental leiden. Nesse macht Zusammenhänge und Hintergründe verständlich, entlastet Betroffene von Schuldgefühlen und zeigt vielversprechende neue Wege im Umgang mit psychischen Beschwerden auf.
Randolph M. Nesse, MD, zählt zu den renommiertesten Evolutionswissenschaftlern und ist einer der Begründer der Evolutionsmedizin. Der zertifizierte Psychiater und Fellow der American Psychiatric Association hat in mehr als vierzig Jahren als Professor für Psychiatrie und Psychologie unzählige Menschen behandelt und auch ausgebildet. Als Forschungsprofessor an der University of Michigan baute er eine der ersten auf Angststörungen spezialisierten Kliniken der Welt auf. 2014 wurde er der Gründungsdirektor des Center for Evolution and Medicine der Arizona State University, wo er außerdem einen Lehrstuhl an der School of Life Sciences hat. Nesse verbrachte ein Jahr am Wissenschaftskolleg zu Berlin, um die Evolution der Depression zu ergründen. Seine wissenschaftlichen Artikel und sein Buch Warum wir krank werden haben unseren Blick auf Krankheiten grundlegend verändert.
RANDOLPH M. NESSE
GUTEGRÜNDE
FÜR
SCHLECHTEGEFÜHLE
EVOLUTIONÄREPSYCHIATRIE
Ein neuer Blick auf
negative Stimmungen und
psychische Beschwerden
Aus dem Amerikanischen von Ursula Bischoff
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Alle Methoden, Hinweise, Ratschläge und Vorschläge in diesem Buch sind vom Autor sorgfältig geprüft worden. Sie ersetzen jedoch keine ärztliche Abklärung. Für eine korrekte Diagnose und entsprechende Behandlung muss stets ein Arzt aufgesucht werden. Eine Haftung vonseiten des Autors oder des Verlags wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Copyright © 2023 Kösel-Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2019 by Randolph M. Nesse, MD. Alle Rechte vorbehalten
Titel der Originalausgabe: Good Reasons for Bad Feelings. Insights from the Frontier of Evolutionary Psychiatry, erschienen bei Dutton, einem Imprint von Penguin Random House LLC
Redaktion: Diane Zilliges
Umschlaggestaltung: Favoritbuero, München
Umschlagmotiv: Twins Design Studio / Shutterstock.com
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN978-3-641-31387-6V001
www.koesel.de
Inhalt
Vorwort
1. TEILDASMEINUNGSCHAOSIMBEREICHDERPSYCHISCHENSTÖRUNGEN
1. Kapitel: Eine neue Frage
Als Therapeut in den Klinikbetrieb eingebettet
Was verursacht psychische Störungen?
Die Zukunft in der evolutionären Vergangenheit finden
Die neue Frage
2. Kapitel: Sind psychische Störungen Krankheiten?
Ein neuer diagnostischer Leitfaden als Rettungsanker
Das Aufflammen neuer Kontroversen
Die Realität der organischen Vielschichtigkeit akzeptieren
Auf dem Weg zu einem unverfälschten medizinischen Modell
3. Kapitel: Warum ist der menschliche Verstand so verletzlich?
Sechs Gründe, warum uns die natürliche Selektion krankheitsanfällig gemacht hat
Krankheit und Evolution
2. TEILEMOTIONENUNDIHRERÄTSELHAFTENFUNKTIONEN
4. Kapitel: Schlechte Gefühle haben gute Gründe
Schmerzen und Leiden sind nützlich
Emotionen sind auf unsere genetische Fitness ausgerichtet
Aufklärungsansätze
Was sind Emotionen?
Emotionen und Kultur
Sind Emotionen würdelos?
Gefühle aktivieren
Die Regulierung der Gefühle
Emotionale Störungen
5. Kapitel: Angst und Rauchmelder
Von Spinnen und Schlangen zur ersten Spezialklinik für Angststörungen
Warum gibt es überhaupt Angst?
Phobien
Panikstörungen
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Generalisierte Angststörung (GAS)
Was sollten wir anders machen?
6. Kapitel: Niedergeschlagenheit und die Kunst des Aufgebens
Eine Frage, die fehlt
Eine kleine Auswahl möglicher Definitionen
Wie kann ein Stimmungstief nützlich sein?
Stimmungen als Treiber der situationsspezifischen Verhaltensanpassung
Drei Entscheidungen, die das Leben beeinflussen
Beerenpflücken und Stimmungslagen
Wann Sie sich fürs Nichtstun entscheiden sollten
Tiermodelle
Andere Situationen, in denen ein Stimmungstief nützlich ist
Was ist gut an einer Hochstimmung?
Ein Stimmungsmodell
Was in der Psychologie schon seit Langem bekannt ist
Aussichtslose Situationen, geringe Motivation und schlechte Gefühle
Problem gelöst?
Psychisches Leid lindern
7. Kapitel: Schlechte Gefühle ohne guten Grund: Wenn der Stimmungsregler defekt ist
Die Depression eines Gelehrten des 18. Jahrhunderts
Ein grundlegender Fehler
Warum hat die Psychiatrie die Entwicklung verschlafen?
Weshalb Stimmungsregulationssysteme fragil sind
Die Tücken moderner Lebenswelten
Was die natürliche Selektion nicht vermag
Kybernetik
Bipolare Störungen
Schlechte Gene?
Die Realität der organischen Komplexität begrüßen
Wozu soll das gut sein?
Was ist mit der Persönlichkeitsstruktur?
3. TEILDIEVOR- UNDNACHTEILEDESSOZIALLEBENS
8. Kapitel: Wie man Einblicke in den individuellen Wesenskern des Menschen gewinnt
Die Lösung des Rektors
Das Lebensstress-Modell
Evolution und die Sicht auf das Individuum
Die Überprüfung der sozialen Systeme (ROSS)
Erkenne deine Patientinnen und Patienten – aber wozu?
9. Kapitel: Schuld und Trauer: Der Preis von Güte und Liebe
Gruppenselektion: Neuauflage
Kooperatives Verhalten (weitgehend) geklärt
Was fehlt?
Selbstbindung
Soziale Selektion
Sozialangst und Selbstwertgefühl
Trauer
10. Kapitel: Erkenne dich selbst – oder besser nicht?
Verdrängung ist real
Psychologische Erforschung des adaptiven Unbewussten
Warum haben wir keinen Zugang zu unseren Motiven und Emotionen?
Zwanghafte Fokussierung auf das, was passieren könnte
Die kognitive Hemmung selbstsüchtiger Motive
Das Zeitalter der Aufklärung
4. TEILAUSDEMRUDERLAUFENDEAKTIVITÄTENUNDSCHWERWIEGENDESTÖRUNGEN
11. Kapitel: Schlechter Sex kann gut sein – für unsere Gene
Begehrenswert sein: Gleich und Gleich gesellt sich gern
Unkoordinierte Bedürfnisse
Sexuelles Interesse und Erregungsstörung
Asynchrone Orgasmen
Bindungsprobleme
Der neue Sex
12. Kapitel: Extreme Ernährungsgewohnheiten
Anorexie und Bulimie
Evolutionspsychologie und Essstörungen
Neuzeitliche Probleme
Leichtgewichtige Babys, schwergewichtige Erwachsene
Im Süßwarenladen: Tantalos schaut Pornos und setzt Tweets auf seinem Smartphone ab
13. Kapitel: Gute Gefühle aus schlechten Gründen
Alte Fragen, neue Fragen
Gekapert
Warum Pflanzen Drogen produzieren
Ein altes Problem
Drogenentzug, Verlangen und Vorlieben
Warum sind manche Menschen besonders anfällig?
Die Seuche eindämmen
14. Kapitel: Der Verstand an den Klippen der Fitness
Enttäuschte Hoffnungen
Die evolutionäre Genetik der schweren psychischen Störungen
Aus dem Gleichgewicht
Spezifische Funktionsfehler in Informationssystemen
EPILOGEVOLUTIONÄREPSYCHIATRIE – EINEBRÜCKE, KEINEINSEL
Was kann die Evolutionäre Psychiatrie bewirken?
Die aktuelle Situation in den Kliniken
Warum ist Leben so leiderfüllt?
Danksagung
Anhang
Literaturempfehlungen
Literaturempfehlungen auf Deutsch
Anmerkungen
Stichwortverzeichnis
Der Autor
Für meine Klientinnen und Klienten, von denen ich so viel gelernt habe.
VORWORT
Als mir zum ersten Mal bewusst wurde, dass die Evolutionsbiologie einen ganz neuen Erklärungsansatz für psychische Störungen bot, verspürte ich unverzüglich das Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben. Es war jedoch bald klar, dass ich zuerst der Frage auf den Grund gehen musste, warum der menschliche Körper generell anfällig für Erkrankungen ist. Dieses Thema stand im Fokus meiner Zusammenarbeit mit dem großartigen Evolutionsbiologen George C. Williams. Wir verfassten gemeinsam eine Reihe wissenschaftlicher Abhandlungen und das Buch Warum wir krank werden, das zahlreiche neue Forschungsarbeiten im Feld der Evolutionsmedizin anregte, welches inzwischen ein gedeihliches Wachstum verzeichnet. Seither habe ich meine berufliche Laufbahn dem Bemühen gewidmet, einerseits die Evolutionsbiologie mit der Medizin zusammenzuspannen und andererseits meinen Patientinnen und Patienten mit psychischen Störungen zu helfen. Diese beiden Aufgaben treiben mich an und sind auf einer tiefgreifenden Ebene miteinander verknüpft.
Im Fachbereich Psychiatrie zu praktizieren, empfinde ich als ungeheuer befriedigend. Die Patientinnen und Patienten sind dankbar für eine effektive Behandlung. Außerdem ist es nicht nur intellektuell interessant, sondern auch emotional erfüllend. Jeder einzelne Fall gleicht einem Puzzle mit zahlreichen Teilchen, das viele Fragen aufwirft. Warum hat diese Person genau diese Symptome zu genau diesem Zeitpunkt entwickelt? Welche Therapie könnte am besten geeignet sein? Doch manchmal, wenn ich aus dem Fenster meines Sprechzimmers blicke, habe ich das Gefühl, mich in einem sicheren Kokon zu befinden und zusehen zu müssen, wie draußen ein Tsunami an psychischen Störungen Millionen von Menschen erfasst und der Vergessenheit anheimgibt, ohne dass sie Hilfe oder einen Zufluchtsort finden könnten. Solche düsteren Bilder rufen Fragen wach, die mich umtreiben: Warum gibt es überhaupt psychische Störungen? Warum so viele unterschiedliche? Warum sind sie so weit verbreitet? Die natürliche Selektion hätte Ängste, Depressionen, Suchtverhalten, Anorexie und die Gene, die Autismus, Schizophrenie und manisch-depressive Erkrankungen verursachen, doch längst aus dem Genpool entfernen können. Doch das tat sie nicht. Warum nicht? In diesem Buch möchte ich zeigen, dass die Frage, warum uns die natürliche Selektion so verletzlich gemacht hat, zu einem besseren Verständnis psychischer Erkrankungen und zu wirksameren Behandlungsmöglichkeiten beitragen kann.
Die möglichen Antworten in diesem Buch sind Beispiele, keine Schlussfolgerungen, und es können sich zwangsläufig einige von ihnen als falsch erweisen. Das sollte uns in diesem frühen Stadium der Forschungsarbeit in einem neuen Wissenschaftsfeld nicht entmutigen, solange die Prämissen auf den Prüfstand gestellt werden. Wie Darwin sagte: »Fehlerhafte Sichtweisen richten, sofern sie von einigen Belegen gestützt werden, geringen Schaden an, denn jede einzelne Sichtweise trägt mit einer heilsamen Freude zum Nachweis ihrer Fehlerhaftigkeit bei. Wenn das geschieht, ist ein Weg zum Irrtum geschlossen, und der Weg zur Wahrheit öffnet sich oftmals zur gleichen Zeit.«1
Die anhaltenden Kontroversen und langsamen Fortschritte in der Psychiatrie haben den Ruf nach neuen Herangehensweisen an psychische Störungen verstärkt. Die Evolutionsbiologie ist nicht neu; sie ist schon seit Langem eine fest verankerte Grundlage für das Verständnis des Normalverhaltens, deren Relevanz für Verhaltensanomalien endlich erkannt wurde. Die Evolutionsmedizin bietet neue Erklärungsansätze, warum der menschliche Körper krankheitsanfällig ist, die inzwischen auch bei psychischen Störungen systematisch zur Anwendung kommen. Die Zeit ist reif, um das Neuland der Evolutionären Psychiatrie zu erforschen.
Ich wünschte, dieses Forschungsfeld hätte einen anderen Namen. Die Evolutionäre Psychiatrie zielt nicht auf eine spezielle Behandlungsmethode ab, und die Expertinnen und Koryphäen in anderen Bereichen der mentalen Gesundheit wissen eine evolutionäre Perspektive inzwischen ebenfalls zu schätzen. Eine zutreffendere Beschreibung wäre: »die Nutzung der evolutionsbiologischen Schlüsselprinzipien zur Verbesserung des Verständnisses und der Therapie psychischer Störungen in der Psychiatrie, in der klinischen Psychologie, in der Sozialarbeit, in der Pflege und in anderen Berufsfeldern«. Doch das wäre zu sperrig, und deshalb beschränkt sich dieses Buch auf einen breit gefächerten Bericht von der vordersten Forschungsfront der Evolutionären Psychiatrie.
Psychische Störungen sind eine so große Plage unserer Spezies, dass wir uns alle unverzüglich Lösungen wünschen. Die Evolutionäre Psychiatrie bietet schon heute einige praktische Vorteile, doch bahnbrechende Ergebnisse sind erst dann zu erwarten, wenn auf Forschungs-, Klinik- und Patientenebene neue Fragen und Antworten auftauchen, die mit einer grundlegend neuen Sichtweise einhergehen. In der Zwischenzeit kann die Evolutionäre Psychiatrie jedoch hilfreiche philosophische Erkenntnisse bieten. Wir alle haben uns vermutlich schon einmal gefragt, warum das Leben des Menschen von so viel Leid geprägt ist. Ein Teil der Antwort lautet, dass die natürliche Selektion Emotionen wie Angst, Niedergeschlagenheit und Trauer begünstigt hat, weil sie einen bestimmten Nutzen haben. Weitere Antworten leiten sich aus der Erkenntnis her, dass Leiden häufig unseren Genen zugutekommt. Manchmal sind schmerzliche Gefühle normal, auch wenn wir gern darauf verzichten würden, doch ein Leben ohne sie kann mit erheblichen Kosten, sprich Nachteilen verbunden sein. Es gibt darüber hinaus gute evolutionäre Gründe, warum unstillbare Bedürfnisse, unkontrollierbare Impulse und konfliktreiche zwischenmenschliche Beziehungen weit verbreitet sind. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Evolution nicht nur die Ursprünge unserer erstaunlichen Fähigkeit zu Liebe und Güte, sondern auch die Gründe für den Preis erklärt, den sie uns abverlangt, zum Beispiel in Form von Trauer, Schuldgefühlen und – infolge unserer emotionalen Zuwendung – einem übermäßigen Interesse daran, was andere über uns denken.
1. TEIL
DAS MEINUNGSCHAOS IM BEREICH DER PSYCHISCHEN STÖRUNGEN
1. Kapitel
EINE NEUE FRAGE
»Wenn ich eine Stunde hätte, um ein Problem zu lösen, und mein Leben hinge davon ab, dann würde ich die ersten fünfundfünfzig Minuten darauf verwenden, zu überlegen, wie die eigentliche Frage lautet, denn wenn ich die eigentliche Frage kenne, kann ich das Problem in weniger als fünf Minuten lösen.«
Albert Einstein zugeschrieben
Ich wusste, dass irgendwas im Busch war, als einer der Assistenzärzte fünf Minuten vor meinem Termin mit ihm und seiner neuen Patientin an meine Bürotür in der Psychiatrieabteilung klopfte.
»Ich wollte Sie nur vorwarnen«, sagte er. »Diese Frau verlangt Antworten.«
»Auf welche Fragen?«, entgegnete ich.
»Sie will wissen, warum ihr alle, bei denen sie bisher Hilfe gesucht hat, unterschiedliche Erklärungen und Ratschläge geben. Sie ist ohnehin skeptisch, was die ›Seelenklempnerei‹ betrifft, wie sie es ausdrückt. Sie ist um fünf Uhr morgens aufgestanden, um aus irgendeiner entlegenen Gegend hierherzufahren und Antworten von den großen Zampanos an der großen Uni zu erhalten.« Er bezog sich, mit einem süffisanten Lächeln, auf unsere prestigeträchtige Universitätsklinik und mich. Ich bat ihn um eine Zusammenfassung des Falls.
»Sie ist fünfunddreißig Jahre alt, Mutter von drei Grundschulkindern, ihre Hauptbeschwerde seit dem vergangenen Jahr ist die wachsende Sorge um nahezu alles in ihrem Leben – ihre Gesundheit, ihre Sprösslinge, die Wirtschaft, Autofahren, was auch immer. Sie hat oft ein flaues Gefühl im Magen und leidet ein- oder zweimal im Monat unter Übelkeit, das ist jedoch nicht mit einem Gewichtsverlust verbunden. Sie ist nach eigenen Angaben gereizt und erschöpft, leidet unter Einschlafstörungen. Sie hat das Interesse an Aktivitäten, die ihr vorher Spaß machten, verloren, ist aber nicht suizidgefährdet und weist auch keine anderen Symptome auf, die auf eine schwere Depression hindeuten könnten. Angst scheint bei ihr in der Familie zu liegen, aber nichts Dramatisches. Ihr Hausarzt konnte keine medizinischen Ursachen feststellen. Ich denke, es handelt sich um eine generalisierte Angststörung, aber es könnte sich auch um eine Dysthymie, eine chronisch depressive Verstimmung, oder aufgrund der Beschwerden, die sich äußern, aber einer gründlichen Diagnose entziehen, um eine Somatisierungsstörung handeln.«
Als wir uns zu Frau A. ins Untersuchungszimmer begaben, begrüßte sie uns freundlich. Als ich mich erkundigte, was wir für sie tun könnten, nahm ihre Stimme einen scharfen Tonfall an.
»Ich gehe davon aus, dass der junge Mann Sie bereits von meinen Problemen in Kenntnis gesetzt hat. Ich bin fünf Stunden mit dem Auto hierhergefahren, um einige Antworten zu erhalten.«
»Soweit ich informiert bin, hatten Sie Probleme, Hilfe zu finden«, erwiderte ich in dem Bemühen, einfühlsam zu sein. Ihre Reaktion kam so prompt, als hätte ich auf die Abspieltaste eines Gerätes gedrückt.
»So ist es, und nicht nur das: Ich habe von allen, die ich aufgesucht habe, eine andere Erklärung erhalten, angefangen bei unserem Pastor. Er ist ein netter Mann und war durchaus mitfühlend, aber er schlug mir unterm Strich vor, zu beten und Gottes Plan für mich zu akzeptieren. Ich habe es versucht, aber ich schätze, mein Glaube ist nicht stark genug. Dann habe ich mit meinem Hausarzt geredet. Er hat mich nicht einmal untersucht, sondern nur gesagt, es wären die Nerven, ich würde mir zu viele Sorgen machen. Pillen, um runterzukommen, würden nur süchtig machen, deshalb hat er mir ein Medikament gegen meine Magenbeschwerden verordnet, aber geholfen hat es nicht. Er hat mich zu einem Therapeuten geschickt, zu dem ich zweimal in der Woche kommen sollte, aber das konnte ich mir finanziell nicht leisten. Er hat kaum geredet, und wenn doch, hat er mir endlos Fragen über meine Kindheit gestellt und Andeutungen gemacht, da wäre irgendeine sexuelle Sache mit meinem Vater gelaufen, was definitiv nicht stimmt! Als ich ihm berichtete, dass sich mein Zustand verschlimmerte, behauptete er, ich würde es vermeiden, mich mit meinen Erinnerungen auseinanderzusetzen. Das war’s dann für mich, aber er schickt mir immer noch Rechnungen für die Therapiestunden, die ich sausen ließ. Ich fühlte mich immer noch elend und fand im Telefonbuch einen Psychiater, weit genug von meinem Wohnort entfernt, sodass niemand etwas davon mitbekam. Er meinte, mein Problem sei auf eine erbliche Gehirnanomalie zurückzuführen, eine Art chemisches Ungleichgewicht, und ich müsse Medikamente dagegen einnehmen. Aber er hat nicht mal Blutuntersuchungen vorgenommen, und als ich mir den Beipackzettel genauer ansah, hieß es dort, dass die Einnahme Suizidgedanken auslösen kann. Deshalb habe ich beschlossen, hierher an die Uniklinik zu kommen. Vielleicht wissen Sie ja, was mit mir los ist. Ich mache mir ständig Sorgen, kann kaum schlafen oder essen, und mein Mann hat auch schon die Nase voll, weil ich ihn dauernd wegen der Kinder anrufe. Deshalb hoffe ich, dass Sie mir weiterhelfen können.«
»Kein Wunder, dass Sie frustriert sind«, erwiderte ich. »Vier unterschiedliche Erklärungen und Empfehlungen von vier unterschiedlichen Fachleuten! Und wir haben möglicherweise eine weitere Vermutung, was die Ursache betrifft. Ist es in Ordnung, wenn wir Ihnen noch ein paar Fragen stellen, um herauszufinden, wie wir jetzt am besten vorgehen?«
Sie war bereit, weitere Informationen zu liefern. Sie erzählte uns, dass sie sich schon immer Sorgen gemacht hatte und ihre Mutter oft nervös gewesen war. Es hatte keine Missbrauchs- oder Gewalterfahrungen im Elternhaus gegeben, aber ihr Vater hatte oft harsche Kritik geübt. In ihrer Kindheit war die Familie alle paar Jahre umgezogen, sodass sie sich in der Schule immer als Außenseiterin gefühlt hatte. Ihre Ehe war stabil, aber sie hatte oft Streit mit ihrem Mann, vor allem wegen seiner häufigen Geschäftsreisen und der Sorge um ihren ältesten Sohn, der an einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADHS) litt. Sie trank oft »ein paar« Gläser Wein, um einschlafen zu können. Die Angstzustände waren in den beiden vorhergehenden Jahren schlimmer geworden, ungefähr in der Zeit, als ihr jüngster Sohn in den Kindergarten gekommen war und sie versucht hatte abzunehmen. Ohne innezuhalten fügte sie hinzu: »Aber das alles hat nichts mit meinem Problem zu tun. Ich bin hergekommen, um herauszufinden, ob es sich um eine Neurose, eine Gehirnerkrankung, Stress oder was auch immer handelt.«
Ich erklärte ihr, dass ihre Symptome auf eine Kombination aus erblichen Einflussfaktoren, Kindheitserfahrungen, ihren gegenwärtigen Lebensumständen und Alkohol zurückzuführen waren. Sie runzelte die Stirn. Als ich ihr erklärte, dass Angst durchaus nützlich sein kann, die meisten Menschen aber davon mehr als nötig haben, weil zu wenig Angst zu einer Katastrophe führen kann, hellte sich ihre Miene auf. »Das leuchtet mir ein«, erwiderte sie. Als ich sie darauf hinwies, dass es mehrere effektive Behandlungsmethoden ohne schädliche Nebenwirkungen und einen ausgezeichneten kognitiven Verhaltenstherapeuten in ihrer näheren Umgebung gab, der diese anbot, entspannte sie sich und meinte: »Na ja, es wäre zumindest einen Versuch wert.« Als sie sich verabschiedete, sah sie mich an und machte eine Bemerkung, die ich heute noch im Ohr habe: »In Ihrem Arbeitsbereich herrscht das reinste Meinungschaos. Das wissen Sie, oder?«
Ich hatte es mir nie in dieser Deutlichkeit eingestanden, aber sie hatte recht. Die Aufgabe der Psychiatrie besteht darin, Menschen dabei zu helfen, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, die sie zu vermeiden versuchen. Doch Frau A. drehte den Spieß um. Ich habe bei allen Fallberichten in diesem Buch die persönlichen Einzelheiten geändert, damit die Betroffenen anonym bleiben und sich teilweise selbst nicht auf Anhieb darin wiedererkennen. Falls Frau A. die Zeilen liest und sich an ihren Besuch vor dreißig Jahren erinnert, wird sie sich hoffentlich freuen, zu erfahren, dass ihre auf den Punkt gebrachte Beobachtung meine eigenen Vermeidungsstrategien durchkreuzte. Sie löste bei mir die Suche nach einer Möglichkeit aus, über dieses Meinungschaos hinauszuwachsen.
ALS THERAPEUT IN DEN KLINIKBETRIEB EINGEBETTET
Während meiner ersten Jahre als Assistenzprofessor für Psychiatrie war ich, wie ein Berichterstatter in einem Kriegsgebiet, in eine medizinische Klinik eingebettet, zu deren Personal Medizinprofessoren, Fach- und Assistenzärzte sowie Pflegekräfte gehörten. Viele Patienten in medizinischen Kliniken haben psychische Probleme, deshalb wurde meine Hilfe wertgeschätzt. Außerdem bestand die Hoffnung, dass meine Anwesenheit Medizinstudierenden, die sich noch in der Ausbildung befanden, ermutigen würde, dem Gefühlsleben der Patienten mehr Beachtung zu schenken. Diese Hoffnung erfüllte sich auch bis zu einem gewissen Grad, aber die größere Auswirkung hatte diese Zeit auf mich selbst. Als ich die emotionalen Belastungen miterlebte, die mit der Behandlung eines endlosen Zustroms kranker Menschen verbunden sind, lernte ich, dass es die Psyche enorm schützen kann, wenn man sich ein »dickes Fell« zulegt.
Ich wurde von den Internisten oft gebeten, mit Menschen zu sprechen, die aufgrund ihrer Probleme einen Psychiater aufgesucht und sich geschworen hatten: »Nie wieder!« Einige beklagten sich darüber, dass sie ihre Zeit monatelang bei einem Therapeuten vergeudet hatten, der kaum redete. Andere erklärten, dass sie nur wenige Minuten lang einen Arzt zu Gesicht bekommen hatten, bevor sie mit einem Rezept für ein Medikament nach Hause geschickt wurden, das etliche Nebenwirkungen hatte. Immerhin berichteten einige, dass sich ihr Leben dank geduldiger, fürsorglicher Therapeutinnen oder Therapeuten grundlegend verändert hatte, und ein paar andere hatten lange eng mit medizinischem Fachpersonal zusammengearbeitet, bis endlich ein wirksames Medikament gefunden wurde. Die Leute, die gute Ergebnisse erzielt hatten, verschwiegen meistens, dass sie eine Therapie gemacht hatten, und ich wurde selten aufgefordert, mit Leuten zu sprechen, denen es wieder gut ging. Die Anzahl der Skeptischen überwog damit. Ich hörte ihnen jahrelang etliche Stunden in der Woche zu, doch da ich sie unbedingt davon überzeugen wollte, professionelle Hilfe anzunehmen, wurde mir ihre Frustration nie wirklich bewusst, die sich in ihrem Klagen Luft machte – bis Frau A. das Problem auf den Punkt brachte: Im Psychiatriebereich herrschte in der Tat das reinste Meinungschaos.
Das bedeutet nicht, dass psychiatrische Therapieansätze unwirksam sind. Als ich meinen Kommilitonen im Medizinstudium von meiner Berufswahl erzählte, machten einige ein mitleidiges Gesicht und sagten: »Na ja, irgendwer muss sich ja um die Leute kümmern, denen nicht zu helfen ist.« Diese irrige Vorstellung ist genauso unbegründet wie weit verbreitet. Für fast alle psychiatrischen Probleme gibt es eine Lösung, und die Therapie kann bemerkenswert oft eine dauerhafte Heilung bewirken. Menschen mit Panikstörungen und Phobien erleben so verlässlich eine Besserung, dass die Behandlung eintönig würde, wenn es nicht die Zufriedenheit gäbe, mitzuerleben, wie sie in ein rundum erfüllendes Leben zurückkehren.
Eine Frau, die an einer Agoraphobie litt und aus Angst vor öffentlichen Plätzen und Menschenmengen ein ganzes Jahr lang ihren Wohnwagen nicht verließ, fuhr einige Monate später zu ihrer Schwester, die eine Stunde von ihrem Standplatz entfernt wohnte. Ein Schreiner, dessen Sozialphobie so ausgeprägt war, dass er nicht einmal mit seinen Kollegen zu Mittag essen konnte, erzählte uns ein Jahr später, wie viel Spaß ihm sein neuer Job machte: Er hielt überall in seiner Heimat öffentliche Präsentationen seiner Handwerkskunst ab. Selbst Menschen mit schweren Störungen kommen oft in den Genuss spektakulärer Besserungen. Letzte Woche erhielt ich unverhofft ein E-Mail von einer Patientin, die vor fünfundzwanzig Jahren bei mir war; sie bedankte sich spontan und von ganzem Herzen, weil die erfolgreiche Behandlung ihrer Zwangsneurose ihr Leben dramatisch verändert und sie möglicherweise sogar gerettet hatte.
Es gibt viele Bücher, die das Feld der Psychiatrie unter Beschuss nehmen. Dieses Buch gehört nicht dazu. Und ja, die riesigen Umsätze der Pharmagiganten haben in der Psychiatrie mehr Korruption zur Folge als in einigen anderen medizinischen Spezialgebieten. Die von der Industrie finanzierten Werbekampagnen und professionellen »Aufklärungsmaßnahmen« fördern eine auf maximale Gewinnsteigerung ausgerichtete vereinfachte Sichtweise, die davon ausgeht, dass alle emotionalen Störungen auf Hirnerkrankungen zurückzuführen sind und eine medikamentöse Therapie erfordern. Doch die Mehrzahl der Psychiaterinnen und Psychiater, die ich kenne, sind nicht vom finanziellen Gewinn, sondern von Fürsorglichkeit und dem Gedanken getrieben, wie sie ihren Patientinnen und Patienten helfen können, mit welchen Erfolg versprechenden Mitteln auch immer. Ich erinnere mich an einen Assistenzpsychiater, der jeden Morgen um sechs Uhr morgens seinen Dienst antrat, damit seine Patienten, von denen die meisten mit Alkoholabhängigkeit zu kämpfen hatten, rechtzeitig zur Arbeit kamen; um sieben Uhr abends war er immer noch da. Ein anderer mit mir befreundeter Psychiater übernahm die ausgeprägtesten Borderline-Persönlichkeiten, obwohl er wusste, dass er immer wieder nächtliche Anrufe erhalten würde, in denen ein Suizid angedroht würde. Und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die Menschen mit schweren depressiven oder psychotischen Episoden behandeln, obwohl ihnen klar ist, dass einige sich das Leben nehmen werden und man sie dafür verantwortlich machen wird. Die meisten von uns finden in manchen Nächten keinen Schlaf, weil sie sich um Patienten sorgen und sich den Kopf darüber zerbrechen, wie sie ihnen helfen können. Den meisten Betroffenen geht es jedoch irgendwann besser, und die Möglichkeit, unser Scherflein beizutragen, macht die psychiatrische Arbeit trotz aller Herausforderungen zutiefst befriedigend.
Die Herausforderung, psychische Störungen besser zu verstehen, ist im Gegensatz dazu zutiefst unbefriedigend. Nachdem ich einige Jahre lang einen Lehrstuhl für Psychiatrie bekleidet hatte, war ich nicht nur frustriert, sondern auch verwirrt. Dieser Bereich schien sich zu verengen und auf den Leitsatz zu fokussieren: »Psychische Störungen sind Gehirnerkrankungen.« Er eignet sich hervorragend als Motto für das Marketing von Medikamenten, für die Bemühungen, das Stigma abzubauen, das mit einem Tabuthema verbunden ist, und für Spendensammlungen, aber er führt zu einem Kurzschluss im klaren Denken. Manchmal kann dieser Leitsatz zutreffend sein, aber er schließt wertvolle Erkenntnisse aus dem Behaviorismus, der Psychoanalyse, der kognitiven Therapie, der Familiendynamik, dem öffentlichen Gesundheitswesen und der Sozialpsychologie aus. Eine Psychiatrie zu praktizieren, die auf einer eindimensionalen Sichtweise beruht, ist genauso, als würde man innerhalb der geschlossenen Mauern einer mittelalterlichen Siedlung leben. Der Versuch, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen, wäre mit dem Besuch einer Reihe anderer von Mauern umgebener Siedlungen zu vergleichen. Um die ganze Landschaft der psychischen Erkrankungen zu sehen, ist ein Überblick mit einem speziellen Vergrößerungsglas erforderlich, das den Lauf der Veränderungen sowohl auf der evolutionären als auch auf der geschichtlichen Zeitachse zeigt.
WAS VERURSACHT PSYCHISCHE STÖRUNGEN?
Wie die sechs blinden Männer, von denen jeder einen anderen Teil eines Elefanten berührt, um zu begreifen, worum es sich bei diesem Tier handelt, betont jede Herangehensweise an psychische Störungen eine bestimmte Ursache und einen entsprechenden Behandlungsansatz. Ärzte, die nach ererbten Einflussfaktoren und Gehirnstörungen Ausschau halten, empfehlen Medikamente. Therapeuten, die Kindheitserfahrungen und mentale Konflikte für die Symptome verantwortlich machen, raten zu einer Psychotherapie, während diejenigen, die auf falsche und belastende Überzeugungen fokussiert sind, eine kognitive Therapie vorschlagen. Bei einer religiösen Orientierung legt man den Hilfesuchenden Meditation und Gebet nahe. Und diejenigen, die glauben, dass die meisten Probleme in der Familiendynamik verankert sind, sprechen sich, was sonst, für eine Familientherapie aus.
Der Psychiater George Engel erkannte das Problem 1977 und entwickelte ein integratives »Biopsychosoziales Modell« von Gesundheit und Krankheit.2 Seither wurden jedes Jahr erneut Rufe nach einer Sichtweise laut, die biologische, psychische und soziale Einflussfaktoren als Teile eines miteinander verwobenen Ganzen versteht, womit bedauerlicherweise die Fragmentierung der Psychiatrie noch verstärkt wurde. Die chaotischen Realitäten psychischer Störungen werden ignoriert, damit sie in das Prokrustesbett des einen oder anderen Schemas eingepasst werden können. Fachausschüsse plädieren für einen integrierenden Ansatz, aber die Ausschüsse, die über die Zuteilung von Fördergeldern und Festanstellungen entscheiden, unterstützen ausschließlich Projekte, die sich in eine der eng gefassten Disziplinen einfügen.
Pläne für eine unlängst angekündigte Revision des diagnostischen Systems weckten die Hoffnung, endlich den Zusammenhang in den Blick zu nehmen, doch ergaben sich daraufhin zunehmend Konflikte und Verwirrung. Der renommierte Psychiater Allen Frances übernahm den Vorsitz über einen Ausschuss, der die vorletzte Ausgabe des statistischen und diagnostischen Leitfadens psychischer Störungen verfasste, des Diagnostic und Statistic Manual of Mental Disorders (DSM).3 Der Titel eines seiner Bücher spiegelt die Enttäuschung angesichts der mittlerweile überarbeiteten Ausgabe des DSM wider: Saving Normal. An Insider’s Revolt Against Out-of-Control Psychiatric Diagnosis, DSM-V, Big Pharma, and the Medicalization of Ordinary Life.4 Debatten über die Diagnostik werden seither so erbittert geführt, dass sie es bis in die Editorials von Zeitschriften schaffen. Den krönenden Abschluss lieferte das National Institute of Mental Health (NIMH), die wichtigste Behörde für biomedizinische Forschung in den USA, als man dort die offiziellen Diagnosekriterien für psychische Störungen ausmusterte.5 So viel zur Fähigkeit eines verbindlichen Diagnosesystems, das einen Konsens schaffen sollte!
Die Suche nach Gehirnanomalien als Ursache psychischer Störungen bot eine weitere Hoffnung, der Verwirrung ein Ende zu setzen. In einem Bewerbungsgespräch für das Medizinstudium hatte ich 1969 vielleicht unklugerweise verlauten lassen, dass ich Psychiater werden wollte. »Warum denn das?«, hieß es. »Man wird in Kürze feststellen, wie psychische Störungen im Gehirn entstehen, und dann ist die Neurologie am Zug.« Wenn sich diese Vorhersage doch nur bewahrheitet hätte! Doch nach vier Jahrzehnten milliardenschwerer Forschung von zahllosen Koryphäen wurde keine auf das Gehirn zurückzuführende Ursache für psychische Störungen, gleich welcher Art, entdeckt, mit Ausnahme der Alzheimer- und Huntington-Krankheit, bei denen das schon vorher bekannt war. Für andere psychische Störungen gibt es bis heute keine Laboruntersuchungen oder Scans, die eine Grundlage für eine endgültige Diagnose liefern könnten.
Das ist sowohl erstaunlich als auch enttäuschend. Das Gehirn von Menschen mit bipolarer Störung oder Autismus müsste sich doch in irgendeiner Form von dem Gehirn nicht betroffener Personen unterscheiden. Doch Studien haben nur geringfügige Abweichungen entdeckt. Sie sind real, aber nicht konsistent. Es ist schwer, zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden. Keine Untersuchungsmethode kommt an eine definitive Diagnose heran, die vergleichbar wäre mit der einer Lungenentzündung oder Krebserkrankung.
Auch die Hoffnungen, die sich auf die Genetik stützten, haben sich zerschlagen. Ob jemand Schizophrenie, eine bipolare Störung oder Autismus entwickelt, ist fast ausschließlich eine Vererbungssache, sodass die meisten, die um die Jahrtausendwende mit Forschungsprojekten im psychiatrischen Bereich befasst waren, zu der Überzeugung gelangten, dass die spezifischen genetischen »Übeltäter« bald gefunden wären. Doch nachfolgende Studien haben gezeigt, dass es keine weit verbreiteten genetischen Variationen mit größeren Auswirkungen auf diese Erkrankungen gibt. Fast alle spezifischen Variationen erhöhen das Anfälligkeitsrisiko nur um ein Prozent oder weniger.6 Das ist die wichtigste – und eine besonders entmutigende – Entdeckung in der Geschichte der Psychiatrie. Was sie bedeutet und was wir als Nächstes tun sollten, steht in den Sternen.
Die Pioniere in der psychiatrischen Forschung verdienen Lob, weil sie das Scheitern ihrer Bemühungen und die Notwendigkeit neuer Erklärungsansätze erkannten. In einem Artikel, der im Wissenschaftsmagazin Science erschien, erklärten einige von ihnen: »Bei der Behandlung der Schizophrenie gab es in den letzten fünfzig Jahren und bei der Behandlung von Depressionen in den letzten zwanzig Jahren keine wichtigen Durchbrüche […] Dieser frustrierende Mangel an Fortschritt verlangt, dass wir uns mit der Komplexität des Gehirns auseinandersetzen […] Das erfordert eine neue Sichtweise.«7 Eine Tagung der Society of Biological Psychiatry wünschte sich dringend Präsentationen zum Thema »Paradigmenwechsel in der Behandlung psychiatrischer Störungen«. Und 2011 erklärte Thomas Insel, Leiter des NIMH: »Was immer wir seit fünf Jahrzehnten auch gemacht haben, es funktioniert nicht […] Wenn ich mir die Zahlen ansehe – die Anzahl der Suizide, die Anzahl der Beeinträchtigungen, die Sterblichkeitsraten –, kann ich nur sagen, sie sind katastrophal und werden nicht besser. Vielleicht müssen wir einfach nur die gesamte Herangehensweise überdenken.«8
Psychiater betrachten die Lebenskrisen ihrer Patienten als Chance, nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Könnte das für die Psychiatrie selbst auch gelten?9
DIE ZUKUNFT IN DER EVOLUTIONÄREN VERGANGENHEIT FINDEN
Das Museum of Natural History war nur einen Straßenblock südlich von unserem medizinischen Zentrum entfernt. Öffnete man die schwere eiserne Eingangstür zwischen den beiden großen Löwenskulpturen, gelangte man in die Ausstellungshallen. Dieser Ort war mir von den Besuchen mit meinen Kindern vertraut, die Dinosaurierfossilien anschauen wollten. Doch dieses Mal war ich eingeladen, den Personaleingang zu benutzen, um mich einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anzuschließen, die sich hier wöchentlich zu einer Diskussion über das Verhalten von Tieren trafen. Schon in der ersten Stunde wurde mir klar, dass sich ihr Erklärungsansatz grundlegend von allem unterschied, was ich kannte.
Anstatt sich ausschließlich mit den Gehirnmechanismen zu befassen, stellten sie sich die Frage, wie die natürliche Selektion das Gehirn geformt und wie das Verhalten die Fitness im Sinne Darwins beeinflusst hat, sprich das Überleben derjenigen Individuen, die am besten an ihre Umwelt angepasst sind. Die Biologie spricht oft von »reproduktiver Fitness«; der Ausdruck bezieht sich auf die Anzahl der Nachkommen eines Individuums, die fortpflanzungsfähig sind. Einige Individuen mit einer höheren Fitness haben mehr Nachkommen als andere, sodass ihre genetischen Variationen bei künftigen Generationen häufiger auftreten. Andere haben weniger Nachkommen als der Durchschnitt, sodass ihre genetischen Variationen seltener auftreten. Dieser Prozess der natürlichen Selektion hat prägenden Einfluss auf Körper und Gehirn, was zu einer Maximierung der Darwin’schen Fitnessmerkmale in einer natürlichen Umgebung beigetragen hat.
Normalerweise sind Merkmale mit einem Mittelwert die besten. Kaninchen sind nicht alle gleich wagemutig. Extrem wagemutige Kaninchen fallen Füchsen als Nahrung zum Opfer. Furchtsame Kaninchen fliehen bei jedem Anzeichen einer drohenden Gefahr so schnell, dass sie selbst kaum Nahrung finden. Kaninchen mit einem Angstniveau zwischen den beiden Grenzwerten haben mehr Nachwuchs, sodass ihre Gene häufiger zum Ausdruck kommen. Einige Menschen erhalten den sogenannten Darwin Award, verliehen an die »Verlierer im Roulette des Lebens«, sprich an Menschen, die sich durch selbst verschuldete Idiotie getötet oder unfruchtbar gemacht haben. So erreichte der abenteuerlustige junge Mann, der den Startbeschleuniger einer Rakete an seinem Auto befestigte, eine Geschwindigkeit von 480 Kilometern pro Stunde, bevor er sich an einer Felswand platt walzte. Auf der anderen Seite der Scala haben manche Angst, das Haus zu verlassen. Sie sterben seltener in jungen Jahren, aber sie haben seltener Kinder. Menschen mit einem gemäßigten Angstniveau haben mehr Nachkommen, und deshalb sind die meisten von uns irgendwo in der Mitte des Spektrums verortet.
Bei meinen neuen Kolleginnen und Kollegen im Museum stützte sich die Erklärung, warum Tiere das tun, was sie tun, auf ein einfaches Prinzip: Die natürliche Selektion begünstigt Organismen mit Verhaltensweisen, die ihren Reproduktionserfolg maximieren. Das ist keine hypothetische Theorie, sondern ein Prinzip, das zutreffend sein muss. Es bot mir genau das, wonach ich gesucht hatte: einen neuen biologischen Erklärungsansatz, nicht nur für das Verhalten generell, sondern als Antwort auf die Frage, warum Organismen so sind, wie sie sind.
Nachdem ich einige Wochen lang aufmerksam zugehört hatte, nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und teilte eine Theorie, die ich im Rahmen meines Grundstudiums entwickelt hatte: Altwerden ist nützlich, um zu gewährleisten, dass jedes Jahr einige Individuen einer Population sterben und sich die Spezies schneller an veränderte Umweltbedingungen anpassen kann. Die Gruppe wurde plötzlich still, aber Bobbi Low, eine Biologin, brach in schallendes Gelächter aus. »Sie wissen wohl nicht viel über die Evolution, oder?«, fragte sie. Es war ein gutmütiges Lachen, wie wenn man einen Hundewelpen beobachtet, der versucht, eine Treppe hochzuklettern. Bobbi und andere erklärten, dass Gene, die für eine Spezies von Vorteil sind, dennoch aus dem Pool aussortiert werden, wenn die Individuen mit diesen Genen weniger Nachkommen haben als die durchschnittliche Anzahl.
Bobbi schlug mir vor, eine 1957 erschienene wissenschaftliche Abhandlung des Evolutionsbiologen George Williams zu lesen. Ich hielt auf dem Heimweg an der Bibliothek und machte eine Kopie. Wie bei so vielen Dingen, die mir noch bevorstanden, hatte diese Lektüre eine grundlegende Änderung meiner Lebenssicht zur Folge. Williams wies darauf hin, dass ein Gen, das für den Alterungsprozess zuständig ist, universell werden kann, wenn es Vorteile in einer frühen Lebensphase bietet, in der die Selektion härter ist, weil zu diesem Zeitpunkt mehr Individuen einer Population am Leben sind.10 Ein Beispiel: Eine genetische Variation, die eine Arteriosklerose der Herzgefäße verursacht und viele Menschen das Leben kostet, bevor sie neunzig werden, kann sich trotzdem universell durchsetzen, wenn sie in der Kindheit auch eine schnellere Heilung von Knochenbrüchen bewirkt. Williams’ Abhandlung war so einflussreich, dass anlässlich seines sechzigsten Geburtstags eine Retrospektive veröffentlicht wurde.11 Er bot eine Erklärung völlig anderer Art, nicht nur für das Altern, sondern für Krankheiten generell. Was die Frage aufwirft: Wenn es für den Alterungsprozess eine evolutionäre Erklärung gibt, was ist dann mit Schizophrenie, Depressionen und Essstörungen?
Im Verlauf der nachfolgenden Wochen halfen mir meine neuen Kollegen aus der Evolutionsbiologie bei der Erkenntnis, dass alle Phänomene in der Natur zwei Erklärungsansätze benötigen. Die gewöhnliche Herangehensweise beschreibt die Mechanismen des Körpers und ihre Funktionsweise, von Biologen als proximate Erklärungen bezeichnet. Die andere Herangehensweise beschreibt, wie diese Mechanismen zu dem wurden, was sie heute sind; das ordnen Biologen den evolutionären oder ultimaten Erklärungen zu.12 Während meiner medizinischen Ausbildung stand ausschließlich der proximate Teil der Biologie im Mittelpunkt, der sich mit den Mechanismen befasst. Von der anderen Hälfte, die erklärt, warum der Körper zu dem wurde, was er heute ist, war nie die Rede.
Die mangelnde Erkenntnis, dass evolutionäre Erklärungen eine wesentliche Ergänzung für proximate Erklärungsmodelle sind, hat zu einigem Wirrwarr beigetragen. Wer wissen möchte, wie sich Augenbrauen entwickeln, erhält vermutlich die Auskunft, dass es Gene gibt, die eine Synthese bestimmter Proteine in bestimmten Körperregionen in Gang setzen. Andere weisen vielleicht darauf hin, dass auch der Prozess beschrieben werden sollte, der zur Entstehung von Augenbrauen geführt hat. Und wieder andere halten es für erforderlich, sich über die Augenbrauen bei anderen Primaten zu informieren. Wahrscheinlich führt jemand an, dass sie die Augen vor herablaufendem Schweiß schützen. Oder jemand zieht die Augenbrauen hoch, um auf ihre Nützlichkeit als Signalinstrument aufmerksam zu machen. Die ersten beiden Erklärungen beschreiben proximate Mechanismen; bei den anderen steht der evolutionäre Zweck im Vordergrund.
Der Ethologe und Nobelpreisträger Nikolaas Tinbergen erweiterte dieses Konzept in einem 1963 erschienenen Artikel, der seine »Vier Warum-Fragen« beschrieb, die später als »Die vier Grundfragen der biologischen Forschung« bezeichnet wurden: Wie funktioniert der Mechanismus? Wie entwickelt er sich im Verlauf des individuellen Lebens? Welchen Wert hat er für die Anpassung innerhalb einer Art? Und unter welchen Voraussetzungen hat er sich stammesgeschichtlich entwickelt?13 Nachdem ich mich jahrelang darauf verlassen hatte, erkannte ich schließlich, dass ich zwei proximate und zwei ultimate Zusammenhänge vor mir hatte, wobei zwei einen bestimmten Zeitausschnitt abbilden, während es bei den beiden anderen um Veränderungen im Lauf der Zeit geht. Sie lassen sich nahtlos in eine Tabelle einfügen. Wenn ich diese Tabelle meinen Vorträgen hinzufügte, war das Publikum mehr an ihr als an meinem Referat interessiert. Und als ich sie als PDF auf meiner Website einfügte, verbreitete sie sich rasant.
Tinbergens vier Fragen, zugeordnet14
Proximat
Evolutionär
Zeitausschnitt
Wie funktioniert der Mechanismus?
Welchen Wert hat er für die Anpassung innerhalb einer Art?
Sequenz im Zeitverlauf
Wie entwickelt er sich im Verlauf des individuellen Lebens?
Unter welchen Voraussetzungen hat er sich stammesgeschichtlich entwickelt?
Tinbergens Fragen machten mir bewusst, dass einige der spätabendlichen Debatten mit anderen Medizinstudenten der Fehlannahme geschuldet waren, dass die Fragen Alternativen darstellten. Das ist nicht der Fall. Antworten auf alle vier Fragen sind für eine vollumfängliche Erklärung unerlässlich. Sie machten mir auch klar, dass viele Dinge, die ich für Anomalien gehalten hatte, in Wirklichkeit von Nutzen waren. Während meines Medizinstudiums wurden uns zwar zum Beispiel Kenntnisse über die Einzelheiten der Mechanismen, die Säure in den Magenzellen produzieren, und ihre Rolle bei der Entstehung von Magengeschwüren vermittelt, aber dass die Magensäure auch ihr Gutes hat, dass sie nämlich Bakterien zersetzt, einen erheblichen Beitrag zur Verdauung der Nahrung leistet oder zu wenig Magensäure ein ebenso großes Problem darstellt wie zu viel, wurde nie erwähnt. Wir lernten alles nur Erdenkliche über die Ursachen von Durchfallerkrankungen, aber wenig über ihre Rolle bei der Ausleitung von Toxinen und Infektionen im Magen-Darm-Trakt. Husten beseitigt Fremdkörper in den Atemwegen. Fieber ist eine akribisch gesteuerte Reaktion des Körpers, um Infektionen zu bekämpfen. Sogar Schmerzen sollten nicht nur als Mechanismus, sondern auch im Hinblick auf ihre Funktion, ihren Zweck, betrachtet werden: Menschen, die ohne jedes Schmerzempfinden geboren werden, sterben gewöhnlich in einer frühen Phase ihres Erwachsenenlebens.15 Ich begann, über die Möglichkeit nachzudenken, dass Angst und depressive Verstimmung auch einen Nutzen haben könnten.
Viele Mechanismen, die auf den ersten Blick nutzlos erscheinen, haben in Wirklichkeit eine wichtige Funktion, wie sich herausgestellt hat; andere muten dagegen wie eine absolute Fehlkonstruktion an. Das Auge wäre ohne blinden Fleck besser für seine Aufgaben gerüstet. Der Geburtskanal ist zu eng. Die Tumorschutzmechanismen sind unzureichend, genau wie diejenigen, die uns vor Infektionen schützen sollen. Die Regulierung der Nahrungsaufnahme lässt zu wünschen übrig. Angst und Schmerzen sind oft übermächtig. Ich begann, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, warum wir von der natürlichen Selektion mit einem Körper ausgestattet wurden, der mit so vielen Unvollkommenheiten belastet ist.
Als George Williams zu einer Fachtagung erschien, war er leicht zu erkennen. Seine Ähnlichkeit mit Abraham Lincoln war unverkennbar. Ich wusste, dass seine 1957 erschienene wissenschaftliche Abhandlung von allen bewundert wurde, aber niemand, Williams selbst verständlicherweise eingeschlossen, hatte mir gesagt, dass er zu den führenden Biologen des 20. Jahrhunderts gehörte. Er war wortkarg, aber wenn er redete, hörten alle aufmerksam zu. In geselliger Runde erzählte er, wie er auf die Idee gekommen war, dass die natürliche Selektion aus gutem Grund für den Fortbestand der Gene gesorgt haben könnte, die den Alterungsprozess verursachen. Ich sah eine Möglichkeit, seine Theorie zu überprüfen. Sie geht davon aus, dass die Sterblichkeitsraten bei wild lebenden Tieren mit zunehmendem Alter steigen. Die alternative Theorie, dass die für den Alterungsprozess zuständigen Gene dem Einflussbereich der Selektion entzogen sind, basiert auf der Annahme, dass die Sterblichkeitsraten bei erwachsenen Tieren während der gesamten Lebensspanne gleich bleiben.
Mir war klar, dass einige Monate Arbeit in der Bibliothek erforderlich sein würden, um Daten zu den Sterblichkeitsraten wild lebender Tiere zu sammeln. Ich erzählte John Greden, dem Leiter des Fachbereichs Psychiatrie, von meiner Idee. Er war neu im Amt und erpicht darauf, Kreativität zu ermutigen, deshalb erhielt ich seine Zustimmung, im Sommer die Hälfte meiner Zeit dem geplanten Projekt zu widmen. Im Herbst hatte ich die Daten und eine Möglichkeit gefunden, zu berechnen, in welchem Ausmaß sich die Selektion auf den Alterungsprozess wild lebender Tiere ausgewirkt hatte: tatsächlich sehr stark.16 George Williams’ Theorie war richtig: Gene, die den Alterungsprozess vorantreiben, sind keine unheilvollen Mutationen, deren Auswirkungen sich zu spät im Leben bemerkbar machen, um durch die natürliche Selektion aus dem Genpool entfernt zu werden. Einige bieten Vorteile, die den Reproduktionserfolg in früheren Lebensjahren steigern. Diese Annahme wurde in zahlreichen Studien bestätigt, in denen Käfer und Fruchtfliegen für kürzere oder längere Lebensspannen gezüchtet wurden.17 Die Selektion zugunsten einer früheren Reproduktion führt zu einer kürzeren Lebensspanne. Die Selektion zugunsten einer längeren Lebensspanne führt zu weniger Nachkommen, vor allem bei wild lebenden Populationen. Der Alterungsprozess hat daher eine evolutionäre Erklärung.18
Bei Georges nächstem Besuch wusste ich genug über die Evolutionsbiologie, um ein kohärentes Gespräch führen zu können, und meine Forschung zum Alterungsprozess war veröffentlicht worden. Ich erzählte George, dass die Evolution meiner Ansicht nach neue Erklärungsansätze bieten könne, nicht nur für das Altern, sondern auch im Hinblick auf Krankheiten. Er war der gleichen Meinung. Wir beschlossen, gemeinsam eine Abhandlung über den Nutzen der Evolution für die Medizin zu schreiben.
Während der ersten Monate unserer Arbeit unterlief uns ein grundlegender Fehler: Wir versuchten, evolutionäre Erklärungen für Erkrankungen zu finden. Wir fragten uns: Warum hat die natürliche Selektion Koronargefäßerkrankungen herausgebildet? Oder Schizophrenie? Doch am Ende erkannten wir: Wir hatten Krankheiten als Adaptionen betrachtet (Viewing Diseases As Adaptions, VDAA), ein schwerwiegender Irrtum, der in der Evolutionsmedizin häufig vorkommt. Aber Krankheiten sind keine Anpassungen. Sie haben keine evolutionäre Erklärung. Sie sind nicht durch natürliche Selektion entstanden. Doch für bestimmte körperliche Aspekte, die uns anfällig für Erkrankungen machen, gibt es sehr wohl eine evolutionäre Erklärung. Die Verlagerung der Aufmerksamkeit von den Krankheiten auf Merkmale, die den Körper krankheitsanfällig machen, war eine bahnbrechende Erkenntnis, die zu einem Eckpfeiler der Evolutionsmedizin wurde.
Wir diskutierten tagelang über Blinddarm, Weisheitszähne, Entzündung der Koronararterien, Krebs und natürlich den Rücken, der vielen Menschen »zu schaffen« macht. George sah die Implikationen klarer als ich und bestand darauf, unseren Artikel mit der spektakulären Überschrift »The Dawn of Darwinian Medicine«. (in etwa: »Die Morgendämmerung der Darwinistischen Medizin«) zu versehen. Unser gemeinsames Buch Warum wir krank werden. Die Antworten der Evolutionsmedizin erreichte ein breites Publikum und förderte das Wachstum der Darwinistischen oder Evolutionsmedizin, wie sie heute meistens genannt wird. Es gibt inzwischen zahllose Bücher, eine Wissenschaftsgesellschaft, eine Fachzeitschrift, internationale Tagungen und an den meisten Universitäten evolutionsmedizinische Studiengänge, die sich mit diesem Thema befassen.
Die Evolutionsmedizin ist ein medizinischer Forschungszweig, der Gesundheit und Krankheit aus einer evolutionären Perspektive betrachtet, sich aber nicht als Alternative zur Standardmedizin versteht. Sie wendet die Schlüsselprinzipien der Evolutionsbiologie an, um Gesundheitsprobleme zu lösen, genauso, wie Schlüsselprinzipien der Genetik und Physiologie in das Gesamtbild einfließen. Die Evolutionäre Psychiatrie ist ein Teil der Evolutionsmedizin, der der Frage nachgeht, warum uns die natürliche Selektion so anfällig für psychische Störungen gemacht hat.
DIE NEUE FRAGE
Die üblichen Fragen in der Medizin gleichen denen, die ein Mechaniker stellen würde: Wie funktioniert das System »Körper«? Was ist defekt? Warum ist es defekt? Wie lässt es sich reparieren? Das sind proximate Fragen, die zu klären versuchen, wie körpereigene Mechanismen funktionieren und wie sie sich bei Gesunden und Kranken unterscheiden. Welche Mechanismen im Immunsystem verursachen Multiple Sklerose? Welche Gehirnanomalien sind für die Schizophrenie verantwortlich? Die Antworten auf diese Fragen bringen uns dem wichtigsten Ziel näher: Ursachen zu finden und Probleme zu beheben. Sie haben einen großen Beitrag zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit geleistet. Würde die Medizin nur eine Hälfte der Biologie nutzen, wäre das die Hälfte mit den größten praktischen Vorteilen.
Die andere, die evolutionäre Hälfte der Biologie geht Fragen aus der Perspektive von Ingenieurinnen oder Designern nach: Wie wurde der Körper zu dem, was er heute ist? Welche Selektionskräfte haben dieses Merkmal begünstigt? Wie beeinflussen Variationen den Fortpflanzungserfolg? Welche Trade-offs, sprich Kosten-Nutzen-Abwägungen bzw. Kompromisse, begrenzen ihre Verlässlichkeit? In ihrer allgemeinen Form lautet die Frage: Warum hat die natürliche Selektion unseren Körper mit Merkmalen ausgestattet, die uns krankheitsanfällig machen?
Die Frage ist neu, kommt aber nahe an eine der ältesten Fragen der Menschheit heran: Warum gibt es so viel Leid im Leben? Sie wird seit Jahrtausenden in religiösen und philosophischen Kontexten diskutiert, da sich die Antworten, die als »Das Problem des Bösen« in das kollektive Gedächtnis eingegangen sind, als schwer fassbar erwiesen haben.19 Der griechische Philosoph Epikur erkannte bereits vor 2400 Jahren, wie trickreich die Frage ist, und der schottische Philosoph David Hume griff seine Gedanken auf und wird damit oft zitiert: »Ist Gott gewillt, das Böse zu verhindern, aber nicht fähig? Dann ist er nicht allmächtig. Ist er fähig, aber nicht gewillt? Dann ist er boshaft. Ist er sowohl gewillt als auch fähig? Woher kommt dann das Böse? Ist er weder fähig noch gewillt? Warum nennen wir ihn dann Gott?«20
Seither haben sich Philosophen und Theologen, vor allem diejenigen, die in der abrahamitischen Tradition verwurzelt sind, an dem Problem abgearbeitet, das Böse und das Leiden in der Welt zu erklären. Mögliche Erklärungsansätze werden unter der Bezeichnung »Theodizee« zusammengefasst. Es gibt viele dieser Art, aber keine ist vollauf zufriedenstellend.21
Das Problem ist auch im Buddhismus von zentraler Bedeutung; hier bilden die Edlen Wahrheiten die Grundlagen der Lehre. Die erste edle Wahrheit lautet: »Das Leben ist geprägt von Leid.«22 Die zweite edle Wahrheit besagt, dass Leid durch menschliches Begehren entsteht, genauer gesagt, durch die Unfähigkeit, dieses endlose Begehren jemals vollständig zu stillen. Die dritte weist auf die Erlösung vom Leid hin, die mit der Erkenntnis einhergeht, dass Begehren eine Illusion ist.
Eine evolutionäre Sichtweise erklärt, warum wir Wünsche und Bedürfnisse haben, warum wir sie niemals vollumfänglich befriedigen können und warum es uns schwerfällt, auf sie zu verzichten: Unser Gehirn wurde von der Evolution darauf ausgerichtet, nicht uns, sondern unseren Genen zu dienen.23
Der Versuch, Menschen mit den unergründlichen Wegen Gottes zu versöhnen, würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Das würde auch für den Versuch gelten, die Verbreitung des Bösen und des Leids in der Welt generell zu erklären. Leiden findet jedoch meistens auf der emotionalen Ebene statt. Angst und Niedergeschlagenheit existieren aus den gleichen Gründen wie Schmerzen und Übelkeit: weil sie in bestimmten Situationen nützlich sind. Sie treten häufig in geballter Form auf, und das aus guten Gründen. Es gibt auch gute Gründe dafür, dass wir anfällig für Suchtverhalten, Schizophrenie und zahlreiche weitere psychische Probleme sind. Gründe im Plural, weil hier mehrere Einflussfaktoren in verschiedenen Kombinationen relevant sind, je nach Störung.
Der Versuch, zu erklären, warum das emotionale Leben oft so schmerzlich ist und warum Denken und Verhalten so oft aus dem Ruder laufen, deckt eine gleichermaßen tiefgründige Frage auf. Wie kann eine Selektion, die ausschließlich darauf ausgerichtet ist, den reproduktiven Erfolg zu maximieren, zur Entwicklung von Gehirnen beigetragen haben, die engagierte, liebevolle Beziehungen und ein sinnvolles, erfülltes Leben ermöglichen? Das Leben der meisten Menschen ist nicht auf den eigennützigen Konkurrenzkampf um Geld und Sex fokussiert, wie es den Vorstellungen naiver Darwinisten entspricht. Wir sind in der Lage, zu meditieren, zu beten, zu kooperieren, zu lieben, uns uneigennützig umeinander zu kümmern, ja sogar Anteil an Fremden zu nehmen. Unsere Spezies ist mit bemerkenswerten positiven Eigenschaften ausgestattet, nicht nur intellektuell, sondern auch auf der sozialen, moralischen und emotionalen Ebene. Die Ursprünge der Liebe und des moralischen oder ethischen Verhaltens zu verstehen, ist eine wichtige Voraussetzung, um Sozialangst, Trauer und die tiefen zwischenmenschlichen Beziehungen zu verstehen, die sie ermöglicht haben.
Jonas Salk, der den Polioimpfstoff entwickelte, soll einmal sinngemäß gesagt haben: Was die Leute als Moment der Entdeckung betrachten, ist in Wirklichkeit der Moment, in dem die Frage entdeckt wurde. Und wir haben eine wichtige neue Frage.





























