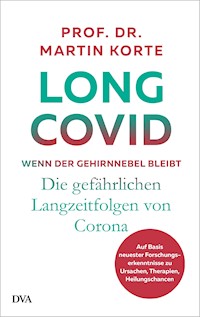12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wie Sie von Ihrer schöpferischen Kraft profitieren und Ihr kreatives Potenzial entfalten – eine Anleitung in sieben Schritten
In ihrem Buch erklären der Hirnforscher Prof. Dr. Martin Korte und die Journalistin Gaby Miketta, wie es gelingt, gewohnte Denkweisen hinter sich zu lassen und zu neuen originellen Lösungen zu kommen – egal, ob am Arbeitsplatz, in Schule oder Ausbildung oder im Privatleben. »Gute Idee!« zeigt,
• was kreatives Denken ausmacht,
• wie und unter welchen Voraussetzungen Ideen im Gehirnentstehen,
• wie sich kreatives Denken mit einfachen techniken und Übungen erlernen lässt und
• wie kreative Menschen mit unterschiedlichsten Berufen und Berufungen zu neuen Einfällen gelangen.
Eine praxisnahe Anleitung für alle, die nicht länger auf gute Ideen warten wollen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
Neue und überraschende Ideen sind überall im Leben gefragt, und zwar immer dann, wenn die automatisierten Abläufe nicht mehr greifen und außergewöhnliche Denkansätze gefragt sind: sei es beim Umbau eines Hauses, beim Halten eines Vortrags oder Referats, bei der Akquise neuer Mitarbeiter oder auch wenn es darum geht, den Familien- und Berufsalltag reibungsloser zu gestalten. Die gute Nachricht dabei ist: Kreatives Denken ist keine angeborene Begabung, sondern lässt sich lernen. Wie, das zeigt dieses Buch aus der Feder eines Hirnforschers und einer seit Jahrzehnten kreativ arbeitenden Journalistin und Blattmacherin. Es stellt dar, wie und unter welchen Voraussetzungen neue Einfälle im Gehirn entstehen und wie man herausfindet, welche Faktoren für einen selbst dabei entscheidend sind. Anhand vieler Übungen leitet es ganz konkret und alltagstauglich dazu an, seinen individuellen Weg zu finden, Probleme erfindungsreich und unkonventionell zu lösen, und wie man diese Art des Denkens zum Generieren neuer Ideen trainieren kann.
Zu den Autoren
Martin Korte ist Professor für Neurobiologie an der TU Braunschweig. Seine Forschungsschwerpunkte sind die zellulären Grundlagen von Lernen und Erinnern ebenso wie die Vorgänge des Vergessens. Martin Korte ist einer der meistzitierten deutschen Neurobiologen, ein gefragter Experte in den Medien und bereits durch eine Reihe von Fernsehauftritten bekannt. Neben seiner Tätigkeit als Wissenschaftler hält er regelmäßig öffentliche Vorträge vor Schuldirektoren, Lehrern, Eltern, Schülern und Politikern. Bei DVA erschien zuletzt von ihm »Frisch im Kopf. Wie wir uns aus der digitalen Reizüberflutung befreien« (2023).
Gaby Miketta studierte Kommunikationswissenschaft und Biologie in München und Münster. Danach arbeitete sie für die Wissenschaftsredaktionen verschiedener Hörfunksender, produzierte TV-Beiträge für Sat 1 und begann 1992 im FOCUS-Gründungsteam bei Helmut Markwort im Ressort Forschung und Technik des Nachrichtenmagazins. Von 2004 bis 2009 war sie Chefredakteurin des von ihr entwickelten Bildungsmagazins FOCUS-SCHULE. Im Oktober 2009 übernahm sie die Chefredaktion von DASHAUS, Europas größte Bau- und Wohnzeitschrift. Nebenbei hat sie immer wieder Seminare zum Thema Kreativität an der Burda-Journalistenschule gegeben. 2023 gründete sie ihr Büro für Wissenschaftskommunikation. Mit Martin Korte hat sie bereits mehrere Bücher verfasst.
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
MARTIN KORTE
GABY MIKETTA
GUTE IDEE!
IN SIEBEN SCHRITTEN KREATIV DENKEN LERNEN
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Grafik: satz-bau Leingärtner, Nabburg
Illustrationen: Maria Herrlich, Berlin
Icon: © AdobeStock/lines of life
Umschlaggestaltung: Favoritbuero, Mü[email protected] (Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30864-3V002
www.dva.de
INHALT
EINLEITUNG Oder: Warum Kreativität für uns so wichtig ist
KAPITEL 1 STAUNEN: Was ist Kreativität
KAPITEL 2 VERSTEHEN: Wie und wann arbeitet ein Gehirn kreativ
KAPITEL 3 TESTEN: Wie kreativ bin ich?
KAPITEL 4 WISSEN: Was stärkt oder schwächt unsere Kreativität?
KAPITEL 5 ÜBEN: Alltagstraining für jedes Gehirn
KAPITEL 6 LERNEN: Kreativitätstechniken, die Ihnen helfen
KAPITEL 7 DENKEN: Strategien für eine kreative Gesellschaft
ANHANG
Übungsblätter
Zum Weiterlesen, Schmökern und Sich-anregen-Lassen zu eigener Kreativität
Fachliteratur zu Kapitel 2 Verstehen
Rechtenachweis
EINLEITUNG Oder: Warum Kreativität für uns so wichtig ist
»Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat.«
Albert Einstein, Physiker (1879 – 1955)
Lassen Sie sich was Neues einfallen! Kannst du mal was anderes kochen! Wir brauchen frische Ideen!
Kommen Ihnen diese Aufforderungen irgendwie bekannt vor? Wenn die Umsetzung nur so einfach wäre …
Dabei durchströmen täglich Tausende von Gedanken unser Bewusstsein, wie Neurowissenschaftler schätzen. Die meisten werden wir allerdings bereits nach wenigen Sekunden nicht mehr erinnern oder rekapitulieren können, falls wir sie überhaupt jemals bewusst registrierten. Sie verschwinden in den Weiten unserer neuronalen Netzwerke. Das ist auch gut so, denn sonst wäre unser Gehirn heillos überfordert. Es arbeitet ökonomisch und nicht mehr als nötig. Deshalb lieben unsere etwa 86 Milliarden Nervenzellen im Kopf Gewohnheiten und routinierte Denkpfade. Was sich bereits mehrfach als gut erwiesen hat – oder mit einer kurzfristigen Belohnung assoziiert war –, das machen wir gerne weiter so. Obwohl wir wissen, dass dies, wie beim abendlichen Snacken oder ständigen Handy-Daddeln, langfristig nicht immer gut für uns sein muss. Wir lieben Denkschubladen und orientieren uns an dem, was uns keinen sofortigen offensichtlichen Schaden, sondern Nutzen oder Genuss gebracht hat.
Der amerikanische Begründer der Biopsychologie, William James, stellte schon vor über hundert Jahren fest, dass 85 Prozent von dem, was wir im Laufe eines Tages entscheiden, unbewusste Gewohnheiten und Routinen sind. Und solange nicht eine Baustelle den Weg zur Arbeit versperrt oder der Netzwerkadministrator am Morgen ein neues Passwort von uns verlangt, kommen wir mit dieser Art von unangestrengten Automatismen gut durch den Tag, oft auch eine ganze Weile durchs Leben.
So weit ist alles gut, und dieses Buch könnte hier enden.
Doch wir wissen, dass unser Leben nicht allein aus Routinen besteht; weder im Beruf noch im privaten emotionalen Miteinander.
Rahmenbedingungen ändern sich, manchmal schnell, manchmal schleichend. Plötzlich müssen Eltern und Kinder ein Leben als Patchwork-Familie organisieren, weit entfernt von dem, was man sich vielleicht jahrelang vorgestellt hat, wünschte oder erhoffte. Im Job müssen neue Märkte erschlossen werden, möglichst digital. Die Traditionsfirma wird an einen ausländischen Konzern verkauft, und Arbeitsabläufe sollen völlig neu strukturiert werden. Und für all diese Prozesse bedarf es eines Umdenkens, Neudenkens, kurz Kreativität. Jetzt ist flexibles Denken gefragt, um für die veränderte Situation neue Lösungen zu finden – jenseits der eingeübten Denkpfade. Wie aber denkt man kreativ und lernt, originelle Ideen zu generieren?
Die gute Nachricht ist: Kreativität kann man lernen.
In und mit diesem Buch können Sie sich selbst beibringen, originell, inspiriert zu denken und dadurch neue Lösungswege zu entwickeln – egal, ob es darum geht, wie wir das digitale Lernen unserer Kinder gestalten, uns selbst nicht im Multitasking zu verirren oder Neuerungen am Arbeitsplatz zu etablieren. Und auch: Wie halten wir im Alter unser Gehirn flexibel, um Veränderungen anzunehmen und angemessen darauf zu reagieren?
Erfolgsfaktor »Weiterdenken«
»Wow, wie sind Sie denn darauf gekommen?« Das ist ein Kompliment, wenn Sie es gesagt bekommen. Neue Denkwege erschließen, mal »querdenken« im positivsten Sinne, drauflos spinnen, vorzugehen wie beim Experiment »grüne Wiese«: Nichts ist vorgegeben, jede Denkrichtung erlaubt, um eine Fragestellung zu beantworten, alles darf hinterfragt werden – das ist heute der Erfolgsfaktor im Privatleben ebenso wie im Beruf. Und auch als Gesellschaft suchen wir nach neuen Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit. Beim Klimawandel, der Energiewende, beim Fachkräftemangel, in Wirtschaftsorganisation und bei gesellschaftsrelevanten Themen wie der Flüchtlingskrise sind neue Denkansätze gefragt. Vielleicht sogar überlebenswichtig.
Wie war das noch mal
Wie sieht für Sie ein kreativer Moment oder Nachmittag aus? Was benötigen Sie dafür? Wenn Sie sich an ein Erlebnis erinnern, bei dem Sie eine gute Idee hatten, was fällt Ihnen spontan ein? Wo geschah es? Wann? Wie haben Sie sich gefühlt? Wer war dabei?
Wie aber funktioniert kreatives Denken? Und was ist das überhaupt? Wie kann man sein Wissen kreativ für Problemlösungen jeder Art nutzen?
Was bedeutet Kreativität?
Kreativ sein – darunter verstehen die meisten Menschen jemanden, der besonders künstlerisch begabt ist: Maler, Musiker, Designer, Romanautoren, Künstler eben. Oder Menschen, die gerne basteln, die ein Auge haben z. B. für harmonische Einrichtungen oder die besondere Architektur eines Hauses. Kreativität kann aber sehr unterschiedlich aussehen:
Erfinder suchen nach neuen Lösungen, prüfen und verwerfen Ansätze, gehen also ganz analytisch und mit viel Fachwissen an Aufgaben heran.
Andere Menschen sind Meister der Improvisation. Sie denken schnell um und orientieren sich an neuen Gegebenheiten. Sie sehen Lösungen, wo andere sich lange plagen, eine veränderte Situation zu akzeptieren, etwa bei einem angedrohten Streik – bei der Bahn, im Nahverkehr – oder wenn Klimakleber den Weg zur Arbeit mit dem Auto unmöglich machen. Oder die Corona-Pandemie, die ungeheure kreative Kräfte freisetzte, weil von einem Tag auf den anderen viele alte Regeln nicht mehr galten. Wie schnell stellte sich die Gastronomie auf Lieferdienste um. Wie radikal orientierten sich Arbeitnehmer neu und arbeiteten, wenn irgend möglich, von zuhause. Diese schreckliche Krise, die Millionen Menschen das Leben kostete und unser gesellschaftliches Leben komplett auf den Kopf stellte, akzelerierte ab 2020 den disruptiven Wandel.
Viele Branchen erleben dies: Banken, Handel, Verkehr, Reisen, Wohnen, medizinische Versorgung, Bildung, Medien – alles ändert sich, und nicht nur gefühlt, auch tatsächlich immer schneller. Zudem übernimmt die Künstliche Intelligenz immer mehr Aufgaben, die noch vor fünf Jahren von wertgeschätzten gut bezahlten Mitarbeitern erledigt wurden.
Schnelles Umdenken, intelligente Alternativen finden – auch das ist eine kreative Qualität. Ebenso wie Fehler machen zu dürfen – eine der Grundvoraussetzungen für Kreativität und neues Denken.
Ihre Meinung ist gefragt:
Was meinen Sie?
Ja
Nein
Kreativ denken, kostet kaum Geld
☐
☐
… ist anstrengend
☐
☐
… kann jeder
☐
☐
… stärkt das Selbstbewusstsein
☐
☐
… schafft Nähe und Vertrauen
☐
☐
… macht glücklich
☐
☐
… macht Eindruck
☐
☐
… ist unnötig
☐
☐
… ist in jedem Beruf hilfreich
☐
☐
Wer einmal gelernt hat, kreativ zu sein, verlernt es nicht wieder – so wie Fahrradfahren
☐
☐
»Kreativ sein« bedeutet, sich von vorhandenem Wissen zu befreien und dadurch Neues zu generieren, ohne in alten Strukturen verhaftet zu bleiben. Der Bruch mit »Altem« (etwas im kulturellen oder persönlichen Gedächtnis Verhaftetes), der Perspektivwechsel ist geradezu programmatisch für kreative Prozesse. Aber es stellt sich auch die Frage nach der richtigen Balance von Stabilität und Kreativität, denn keiner möchte einen Chef, der jeden Tag mit irgendeiner spontanen Idee zur Arbeitsorganisation den eigenen Berufsalltag völlig umkrempelt. Ebenso wenig lieben es Kunden beim Einkaufen, wenn die Produkte plötzlich neu sortiert und in anderen Regalen zu finden sind. Auch als User im Internet empfänden wir es doch befremdlich, wenn unsere bewährte Nachrichten- oder Nahverkehrs-APP jede Woche ihre Webseite kreativ umorganisieren würde.
Was dieses Buch bietet
Wie aber lernt man nun, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen, um die Ecke zu denken, kurz: kreativ an Problemstellungen heranzugehen? Auf dem Buchmarkt finden Sie einige Bücher, die Kreativitätstechniken erklären und ebenso eine ganze Reihe von Übungsbüchern für den Hausgebrauch. Auch Bücher, die das Gehirn und seine Funktionen bei kreativen Prozessen erläutern, sind im Handel. Gute Idee! In sieben Schritten kreativ denken lernen will diese Ebenen zusammenführen und Ihnen zeigen, wie Ideen im Gehirn entstehen und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit Ihr Gehirn bereit ist, diese Leistung zu erbringen. Dieses Buch bietet keine einfachen Lösungen oder simple Anleitungen, um kreativer zu denken. Vielmehr liefert es Hintergrundwissen, wie kreatives Denken funktioniert, erklärt, was dabei im Gehirn geschieht, und leitet Sie ganz konkret dazu an, Ihre Bereitschaft zu kreativem Denken individuell zu trainieren und mit Hilfe von ausgewählten Kreativitätstechniken spezifisch auszubauen. Das ist ein komplexer Prozess: Das Versprechen, dass das per Knopfdruck morgen funktioniert, werden Sie hier nicht finden. Übung und ein wenig Geduld sind gefragt, bis man einen gewissen Leistungsgrad erreicht.
Perspektivwechsel
Diskutieren Sie 5 Minuten mit sich selbst – führen Sie einen inneren Dialog über ein Thema, das Sie bewegt. Nehmen Sie die Perspektiven anderer ein – Ihres Kindes, Ihres Partners, Ihrer Kollegen, Ihres Chefs, Ihrer Eltern, eines Barkeepers …
In Kapitel 1 STAUNEN wollen wir zunächst darüber aufklären, was Kreativität eigentlich bedeutet, und gegen einige Klischees angehen. In Kapitel 2 VERSTEHEN werden wir darstellen, wie Ideen in unseren Gehirnen entstehen. In Kapitel 3 TESTEN wird Ihnen ein Fragebogen dabei helfen, genauer darüber nachzudenken, welche Faktoren für Sie persönlich wichtig sind, um neue Einfälle zu entwickeln, während in Kapitel 4 WISSEN jeder von Ihnen entdecken kann, welche Kontexte für ihn persönlich entscheidend sind, um kreativ zu sein.
In den Kapiteln 5 ÜBEN und 6 LERNEN finden Sie Anleitungen, mit denen Sie sich selbst in den unterschiedlichsten Lebenssituationen ein Übungsprogramm zusammenstellen können, um je nach Fragestellung neues Denken zu etablieren. Frei nach der Erkenntnis der US-amerikanischen Schriftstellerin und Bürgerrechtlerin Maya Angelou: »Du kannst die Kreativität nicht aufbrauchen. Je mehr du sie benutzt, desto mehr hast du.«
Hier finden Sie auch wissenschaftliche Einschätzungen, welche Kreativitätstechniken bei welcher Fragestellung und welcher Gruppenkonstellation sinnvoll sind.
Im letzten Kapitel, 7 DENKEN, schauen wir über den Tellerrand des persönlichen Nutzens von Kreativität hinaus: Hier geht es um Strategien für mehr Kreativität in Schule, Erziehung und der Gesellschaft.
In der Randspalte finden Sie in den meisten Kapiteln kleine »Aufwärmübungen« zum Dehnen der »geistigen Denkmuskeln«. Sie aktivieren assoziatives Denken oder lenken Ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte und sprechen bestimmte Hirnfunktionen gezielt an. Manchmal sollen Sie einfach nur Entspannung bringen oder zum Lachen anregen. Einzeln mögen Ihnen diese kleinen Aufwärmübungen zum Teil trivial erscheinen, aber unbewusst und öfter, als Sie denken, freuen sich Ihre Hirnzellen über die Ablenkungen, verknüpfen sich neu und danken Ihnen dieses kleine Jogging im Kopf.
In einigen Kapiteln finden Sie auch komplexere Übungen, deren Lösungen zum Teil mühsamer erarbeitet sein wollen. Natürlich müssen Sie diese Übungen nicht absolvieren, aber sie sind in der Abfolge gezielt so angeordnet, dass sie den Inhalt des Buches sinnvoll ergänzen, und auch hier gilt: Nichts geht über Probieren! Sie entscheiden. Auf jeden Fall sollen sie Ihnen Freude machen. Das ist sozusagen bereits die erste Lernübung: Kreativität sollte Spaß machen – unter Druck ist der Anfang für die meisten beschwerlich.
Zudem haben uns Menschen mit unterschiedlichsten Berufen erzählt, was es für sie bedeutet, kreativ zu sein und um die Ecke zu denken. Sie berichten in diesem Buch, wann, wo und unter welchen Bedingungen sie neue Out-of-the-box-Ideen produzieren. Sie werden staunen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen sein können. Lesen Sie wie der 3-Sterne-Koch Jan Hartwig neue Rezepte kreiert, wie der Ingenieur Thorsten Werner auf einer Baustelle plötzlich auftretende Probleme löst oder der Verleger und Unternehmer Dr. Dirk Ippen innovativ in die Zukunft denkt.
Neu sortieren
Wie könnte eine Sammlung Ihrer Lieblingsrezepte als Buch aussehen? Wie Bücher eben sind oder in Form einer runden Pizza, oder sollte man es von hinten nach vorne lesen, oder ist es nach Gerichten (mit Fleisch, vegan, glutenfrei) geordnet oder nach Tagen, Monaten, Stimmungen oder nach flachen Gerichten und gehäuften oder nach Kohlenhydraten, Eiweiß, Fett, Zucker? Wonach würden Sie Ihre Rezepte sortieren?
Und noch ein Hinweis: Sie müssen dieses Buch keineswegs in der Reihenfolge der Buchkapitel lesen. Sie können mit jedem beliebigen Themenbereich beginnen, der Sie besonders interessiert. Mit den wissenschaftlichen Erklärungen über die Funktionsweise des Gehirns oder den Techniken und Übungen, die unsere grauen Zellen auf Kreativität programmieren.
Was Kreativität braucht
Eins ist ganz wichtig: Es ist ein Mythos, dass Kreativität nur im abgeschiedenen Kämmerchen entsteht. Dieses Bild bedient das Klischee des mittellosen Künstlers, der sich allein in Malerei oder Musik mitteilt. Vincent van Gogh gilt als ein Beispiel des einsamen verkannten Künstlers. Er verkaufte zu Lebzeiten nur wenige seiner Bilder. Allerdings war er keinesfalls völlig isoliert und pflegte wohl auch in gewissem Rahmen Freundschaften, etwa zu seinem Kollegen Paul Gauguin, mit dem er sich später allerdings bitter zerstritt. Kreativität ist ein sozialer Akt. Der schöpferische Geist benötigt den Diskurs.
Wenn wir lernen wollen, verschiedene Lösungsstrategien und prinzipiell unterschiedliche Denkmethoden anzuwenden – in der Gruppe oder alleine –, dann bedarf es der Interaktion mit der Umwelt, Begegnungen mit anderen Menschen – und vor allem auch mit uns selbst. Nur so erhalten wir die Flexibilität und Plastizität unseres Gehirns, die beide unverzichtbar für kreatives Denken sind.
Für wen dieses Buch ist
Kreativität kann jedem in jeder Lebenslage von Nutzen sein: sei es bei der Akquise neuer Mitarbeiter, dem Entwurf für eine ungewöhnliche Einladung zur Weihnachtsfeier in der Firma, dem Umbau des geerbten alten Häuschens, dem Prospekt des Gartenbaufachbetriebs, dem Plakat des Konditors an der Ecke, dem Forschungsprojekt eines Wissenschaftlers, dem Referat einer Schülerin, der Präsentation des Studenten, der Bewerbung der Kunsthistorikerin auf den ersten Job oder dem Podcast eines Schauspielers. Oder bei der Reorganisation eines Unternehmens, die ein Konzernchef vorzunehmen hat. Selbst Fußballer lernen heute selbstverständlich kreatives Umdenken im Training. Alles wird dynamischer, schneller und eben auch origineller. Profis wie Amateure müssen blitzartig neue Räume und Situationen erkennen und fix wie flexibel neue Lösungswege einschlagen – eben das Gegenteil von »Schema F«.
Unternehmer, Ingenieure, Wissenschaftler, Marketing-Experten, Public-Relations-Spezialisten, Journalisten, Start-up-Gründer, Social-Games-Produzenten, Künstler, Kommunikationsexperten, Werbespezialisten – jeder von uns sucht zeitweilig nach Lösungen, die andere überzeugen, schlicht nach neuen frischen Ideen und außergewöhnlichen Denkansätzen. Und zwar immer dann, wenn nicht nur automatisierte Abläufe zu tätigen, sondern überraschende, außergewöhnliche Denkansätze gefragt sind. Kreative Menschen sind ein Erfolgsfaktor in jeder Firma auf jeder hierarchischen Ebene – vom Chef bis zum Azubi.
Unsere wichtigste Botschaft
Kreativität kann jeder lernen. Es ist keine angeborene Begabung. Oder besser: nicht nur. Wer kreativ denken lernen will, benötigt ein ausgeklügeltes Training ebenso wie viel Übung, wie wir es vom Sport her kennen und auch akzeptieren. Denn nur wer viele Wochen lang motiviert trainiert, wird erfolgreich an einem Halbmarathon teilnehmen können, wenn er zuvor allenfalls einen Spaziergang von drei Kilometern bewältigt hat.
Wie man also lernt, die Denkrichtung zu ändern, gewohnte Denkpfade zu verlassen, neue Ideen zu generieren, weiterzuspinnen und zu bewerten und was unser etwa drei Pfund schweres Gehirn dabei leistet, erfahren Sie hier.
Gedicht zum Nachdenken
Zweifle nichtan demder dir sagt er hat Angst
aber hab Angstvor demder dir sagter kenne keine Zweifel
Erich Fried
»Das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir noch nie so gemacht« – dieses Denken wird die Welt nicht zum Besseren verändern und uns auch persönlich nicht voranbringen. Zu schnell ändern sich die Rahmenbedingungen unserer Welt, und wenn wir diese erhalten wollen, müssen wir kreative, tragfähige und nachhaltig wirkende Ideen entwickeln. Fangen wir also an!
KAPITEL 1 STAUNEN: Was ist Kreativität
»Kreativität kann fast jedes Problem lösen. Der schöpferische Akt, die Überwindung der Gewohnheit durch Originalität, überkommt alles.«
George Lois, Artdirector (1931 – 2022)
Woher hatte der spanische Architekt Antoni Gaudí (1852 – 1926) die Idee, Fenster in seinen Baukunstwerken wie in der Sagrada Familia und der Casa Batlló in Barcelona keineswegs viereckig zu gestalten, sondern sphärische und unfassbar farbenfrohe Formen aller Art zum Einsatz zu bringen? Diese Fenster entsprechen keinesfalls dem, was Kinder zeichnen, wenn wir sie bitten, ein Fenster zu malen. Überhaupt erfüllen Gaudís Werke nicht die standardisierten, uns selbstverständlich erscheinenden Kriterien von Architektur.
Der kanadisch-amerikanische Architekt Frank Gehry (geboren 1929) vermeidet in seinen Bauten gerade Wände. Geschwungene Formen wie beim Guggenheim Museum in Bilbao oder dem Vitra Design Museum in Weil am Rhein sind sein Markenzeichen. Die Walt-Disney-Konzerthalle in Los Angeles ahmt eine Wellenform nach; das Lou Ruvo Center for Brain Health in Las Vegas ähnelt optisch stark der äußeren Form eines Gehirns. Für unsere an bekannte Häuserformen gewöhnte Augen haben die Gehry-Bauten einen ikonischen Charakter. Wer sie sieht, vergisst sie nicht.
Aber auch auf einer etwas kleineren Ebene – nicht minder erstaunlich – entsteht Neues: In Kitas bauen Kinder ein Spielhaus aus Eierkartons, in Panama entstanden Häuser aus rund 10 000 handelsüblichen Plastikflaschen. Das Bottle Village Project ist zeit- und kosteneffektiv, und die luftgefüllten PET-Flaschen isolieren erstaunlich gut. In der französischen Normandie entstehen Recyclinghäuser aus Autoreifen! Eine wirklich verblüffend simple Idee setzten 2023 fünf Studentinnen der Universität Hohenheim um. Sie entwickelten eine nachhaltige essbare Verpackung aus Eierschalen, zum Beispiel für Tütensuppen. Einfach Wasser drauf und die Verpackung löst sich auf, ohne Müll zu hinterlassen. Die zermahlenen Eierschalen wurden zuvor mit Eiweiß, Wasser und Bindemittel vermischt und dann im Ofen getrocknet. Bei 20 Milliarden Eiern, die in Deutschland jährlich verspeist werden, besteht an diesem Rohstoff kein Mangel. Die Idee ist wirklich clever.
Die Liste ließe sich seitenlang fortführen, weil eigentlich überall erstaunliche Ideen entstehen. Meist bleibt die simple Frage: Wie seid ihr nur darauf gekommen?
Wer bin ich?
Wenn Sie Ihren Charakter einem Tier zuschreiben sollten, welches wäre es?
Wie sehen Sie sich? Welche Eigenschaften schreiben Sie dem Tier zu? Was wäre Ihr Lebenspartner oder Ihre Lebenspartnerin? Entscheiden Sie spontan, was Sie gerne sein wollen: Schildkröte, Tiger, Elefant, Spitzmaus, Eisbär, …? Lange zu überlegen, ergibt keinen Sinn.
Kommt Kunst von Können?
Einzigartigkeit und eine spezielle Handschrift zeichnen Künstler per se aus, aber es gibt einige, da steht die Idee, etwas auffällig Neues zu schaffen oder schaffen zu müssen, stärker im Fokus als bei anderen. Stellvertretend für viele Künstler seien hier die Maler Georg Baselitz, Gerhard Richter und Gotthard Graubner genannt; alle drei bekannt für einen augenfälligen charakteristischen Kunststil, der ein wenig aus der Not geboren wurde.
Baselitz (geboren 1938) stellte seine Bilder Ende der 1960er und in den 1970er Jahren im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf. Er malte seine Figuren einfach verkehrt herum, auf dem Kopf stehend, also abstrakt. Richter (geboren 1932) perfektionierte in dieser Zeit seine fotorealistischen Abmalungen. Er verwischte seine Pinselstriche, so wirkte das Bild nicht mehr wie ein Foto, sondern abstrakter. Eine Verfremdungstechnik, die ihn weltberühmt machte. Graubner (1930 – 2013), mit Richter befreundet, spannte die Leinwand für seine Bilder über dicke Lagen von Watte und synthetischen Stoffen – so entstanden in den 1960er Jahren seine charakteristischen dreidimensionalen, objekthaften »Kissenbilder«. Farbe und Form mischen sich zu Bild und Skulptur.
Alle drei – Baselitz, Richter, Graubner – setzten sich mit ihrem Stil, mit ihren neuen Ideen von anderen Künstlern ab. Warum? Weil man auffallen musste, um in jener Zeit in der Kunst seinen Platz zu finden. Natürlich haben die hier genannten Künstler ein viel reicheres Repertoire und viele weitere Entwicklungen durchgemacht als hier skizziert. Was man an den drei Beispielen aber sieht: Großes entsteht, wenn man es anders macht als die anderen oder das Bedürfnis spürt, es anders machen zu müssen.
Die vielen Dimensionen des Begriffs Kreativität
Einfallsreichtum, Originalität, Vorstellungsvermögen, Schaffenskraft, Fantasie, Genialität, Erfindungsgabe, … Allein die vielen Synonyme des Wortes Kreativität zeigen auf, wie unterschiedlich wir sie definieren. Ist etwas kreativ, wenn es etwas Besonderes ist oder einzigartig, originell, ideenreich, innovativ erschaffen wurde? Oder wenn das vermeintlich Unmögliche dadurch möglich wird? Ist sie ein schöpferischer, spiritueller Akt? Braucht es eine Inspiration, was etwa »Einhauchung« bedeutet? Sind Menschen bereits kreativ, wenn sie das Übliche variieren? Oder müssen sie dazu erst etwas Neues kreieren, etwas von Dauer und Wert erschaffen haben? Oder gar eine eigene Kreation erstellt haben, die auch urheberrechtlich geschützt ist?
Dies alles sind wertaufgeladene Schlagworte, die dennoch nur begrenzt den Kern dessen erfassen, was Kreativität ausmacht.
Der Begriff leitet sich aus dem Lateinischen creatio – Schöpfung – ab und bezeichnet eine Fähigkeit, produktiv gegen Regeln zu denken und Neues zu erschaffen, aus dem wir Nutzen ziehen können. Das ist eine Art offizielle Umschreibung, die noch auf Immanuel Kant zurückgeht (Kritik der Urteilskraft).
»Kreativ sein« wird konnotiert mit Fantasie, Witz, Intellektualität oder zumindest mit einer handwerklichen Begabung wie Malen, Kochen oder Schreinern. Es wird gehandelt wie eine Geheimformel. Es entzieht sich der exakten Verortung und einfachen Erklärungen.
Kreativtraining
Was fällt Ihnen spontan ein?
Vervollständigen Sie diese kleine Ideensammlung. Welche Worte umschreiben Kreativität?
Natürlich wird wissenschaftlich intensiv untersucht, was genau Kreativität ist. Aber seit dem Jahr 2000 sind gerade einmal 30 000 Fachartikel zum Thema erschienen. Klingt nach viel? Nicht im Vergleich zu den Publikationen aus anderen Forschungsfeldern: Innerhalb der letzten 15 Jahre wurden mehr als 1,8 Millionen wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht, die das Stichwort »Kaffee« enthielten. Dagegen wird Kreativität, diese so wichtige und neben der Sprache menschlichste aller kognitiven Tätigkeiten, eher stiefmütterlich behandelt. Dieser Umstand ist misslich und wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass Kreativität sich mit den reduktionistischen Werkzeugen einer sezierenden Wissenschaft in Laborsituationen nur schwer untersuchen lässt. Die eine festgelegte Kreativitätsforschung existiert nicht.
Kreativität ist ein gedankliches Monster, manchmal kaum wahrzunehmen, mal drohend vor einem stehend. Es ist ein unglaublich riesiges Geflecht von unterschiedlichen Erklärungsansätzen, Einstellungen, Perspektiven. Die Religion betrachtet Kreativität aus einem völlig anderen Blickwinkel als die Ökonomie, die Pädagogik sieht andere Punkte als die Philosophie, der Psychologe erforscht Kreativität unter anderen Aspekten als der Neurobiologe, der Künstler versteht etwas gänzlich anderes darunter als der Handwerker.
Sind die Aktivistinnen und Aktivisten der »Letzten Generation«, auch »Klima-Kleber« genannt, kreativ, weil sie Anfang 2022 für sich einen Weg entdeckten, Aufmerksamkeit für ihr Anliegen zu generieren? Diese Beurteilung dürfte vom ideologischen, politischen und juristischen Standpunkt abhängen.
Jeder von uns entwickelt eine persönliche spezifische Vorstellung davon, was »kreativ sein« und »kreativ leben« bedeutet. Und das ist auch gut so.
Nur durch diese Vielfalt bleibt Kreativität der Motor für die Zukunft, für gesellschaftliche, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Entwicklung.
Kreativität ist aber auch der Motor der Evolution für die Entstehung der unterschiedlichen Arten und der speziellsten Ausformungen des Lebens: der schnelle Gepard und das gemächliche Faultier, die zwei Gramm schwere Etruskerspitzmaus und der 190 Tonnen schwere Blauwal, der Wanderfalke und der Tiefseeoktopus, die geselligen Delfine und die eher einsamen Schildkröten.
Genmutationen befeuern die Kreativität in der Natur in reinster Form. Die Selektion – nicht jede genetisch neue Variante ist tauglich, manche auch eine Sackgasse – sortiert nach Nützlichkeit und Anpassungsfähigkeit. Hier ähneln allein schon die Begrifflichkeiten den oben genannten Beschreibungen dessen, was Kreativität ausmacht. Der Konsens ist: Die Wissenschaft bezeichnet etwas als kreatives Denken, wenn etwas NEUES und zugleich NÜTZLICHES dabei generiert wird. Diese Definition grenzt ein wenig das ab, was wir als Kunst bezeichnen. Kunst muss nicht nützlich sein, außer dass sie unser Leben bereichert, auf gesellschaftliche Missstände hinweist, uns erfreut, uns zum Nachdenken anregt – sicher eine andere Art von Nutzen für die Gesellschaft und jeden Einzelnen von uns.
Gourmetidee
Sandwich mal anders: Wie könnte diese Zwischenmahlzeit, bestehend aus zwei zusammengeklappten Scheiben Brot und dazwischen üppig belegt, noch schmecken? Inside out? Rund aufgetürmt, püriert …? Überlegen Sie noch fünf weitere Möglichkeiten.
Die Basis ist: Kreativität ist ein ganz natürlicher Teil des Lebens. Sie ist überall auf der Welt vorhanden, in den einsamsten Winkeln pazifischer Inseln ebenso wie in den Millionenmetropolen aller Kontinente.
Wenn man es genau betrachtet, ist alles um uns herum aus kreativen Ideen entstanden. Die Glühbirne ebenso wie neue LED-Leuchten, die Gartenanlagen im alten Ägypten ebenso wie moderne vertikale Gärten als Fassadenbegrünung, die ersten runden Radscheiben der Sumerer 3500 v. Chr. und die Elektro-Fahrräder, die erst seit einigen Jahrzehnten für die Allgemeinheit verfügbar sind. Immerhin wurde bereits 1817 ein Patent darauf angemeldet.
Kreativität ist viel mehr als Kunst
Die Versuche, Kategorien von Kreativität zu unterscheiden, wirken bemüht. Als »Big-C-Kreative« bezeichnet man Menschen, die als Künstler und Künstlerinnen Herausragendes darstellen und die in der Öffentlichkeit berühmt oder bekannt geworden sind, deren Kreativität also anerkannt ist. Sie zeichnen sich wohl durch ein besonderes Talent aus, meist in den Bereichen bildende Kunst und Naturwissenschaften. Als Komponisten und Musiker sind hier zu nennen: Beethoven, Bach, die Beatles. In den Naturwissenschaften sind es – um einige Beispiele zu nennen – vielleicht: der Molekularbiologe Francis Crick, die Physiker Albert Einstein und Richard Feynman, die Chemikerin und Physikerin Marie Curie, die Biochemikerin Christiane Nüsslein-Volhard, der Paläogenetiker Svante Pääbo. Sie alle erhielten für ihre Forschung und Entdeckungen den Nobelpreis. Der italienische Künstler Michelangelo (1475 – 1564) war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, da er in gleich mehreren künstlerischen Gebieten überaus kreativ, produktiv und erfolgreich war: als Bildhauer, Maler, Architekt und Dichter. Der britische Schriftsteller John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) war seit seiner Jugend ein Sprachengenie, sprach selbst Altenglisch, Gotisch, Latein, Griechisch, Finnisch, Spanisch, entwickelte aber auch mehrere eigene Sprachen. Intensiv beschäftigte er sich mit der Mythologie. So erschuf er in seinen Büchern eine ganze eigene Fantasiewelt: 1937 erschien das Kinderbuch Der Hobbit, 1954 wurde Der Herr der Ringe veröffentlicht. Tolkien begründete damit die moderne Fantasy-Literatur.
Als »Little-C-Kreative« bezeichnen wir Menschen, die im Alltag kreativ sein und denken müssen: Unternehmer, Köche, Handwerker, Manager, Journalisten, Texter, Experten für Werbung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing sowie alle Mütter und Väter, insbesondere Alleinerziehende – und viele, viele andere Berufe und Berufungen.
Aber wer entscheidet über Big- oder Little-C? Die Historie, der gesellschaftliche Sinn, der wirtschaftliche Nutzen? Die Unterscheidung bleibt kryptisch ebenso wie die Bemühungen von Firmen, mit Kursen für Kreativtechniken, Bällebädern und stylischen Büros vielleicht doch den Sprung vom kleinen zum großen »C« zu schaffen.
Kreativtraining
Was sehen Sie?
Sie sehen eine Reihe von Buchstaben, lauter K’s, der Anfangsbuchstabe von Kreativität. Lässt sich Ihre Wahrnehmung täuschen?
Sehen Sie auch das E?
Höhere Mächte und kulturelle Einschätzungen
Apollon steht als griechischer Gott in der Mythologie für Kreativität, Kunst, Musik, Poesie und Licht und auch für die Heilkunst. Als Sohn von Göttervater Zeus war er sehr machtvoll. Allerdings nicht nur der Musik – er verzauberte Götter und Menschen mit seiner Lyra – und den Künsten zugetan, sondern auch dem Leid. Er schickte den Griechen die Pest und half bei der Tötung des Achilles, da er den Pfeil von Paris auf die einzig verwundbare Stelle, die Ferse, lenkte.
Saraswati (in Sanskrit »die Fließende«) ist die indische Göttin der Weisheit, Kreativität, Kunst, Schöpferkraft und Musik – sie wird stets mit einem Saiteninstrument abgebildet – und steht in der hinduistischen Mythologie für Reinheit und Gelassenheit. Im Buddhismus gilt sie als Göttin der Gelehrsamkeit und Unterweisung. In Japan ist sie eine der sieben Glücksgötter.
Kreativität entspricht im Ayurveda dem Vata Dosha, dem Luftprinzip. Vata-Menschen, die diesem ayurvedischen Funktionsprinzip zugeordnet werden, gelten als aktiv, rege, neugierig und immer in Bewegung. Vata steht für Leichtigkeit, Kreativität und Flexibilität.
Die Erklärungen für den Ursprung der Kreativität reichen vom träumenden Unterbewusstsein bis zur wachen Aufmerksamkeit, vom schwerfälligen Nachdenken bis zum hellen Blitz der Erkenntnis, von der göttlichen Inspiration bis zur mühsamen Arbeit.
Der griechische Philosoph Platon schrieb vor 2500 Jahren, dass Dichter von den Musen in einem göttlichen Wahn inspiriert werden, während sein berühmtester Schüler Aristoteles ihre Arbeit als rational und ergebnisorientiert betrachtete. Während der deutsche Philosoph Immanuel Kant im 18. Jahrhundert der Meinung war, dass Kreativität sowohl »originell« – da es auch »originellen Unsinn« geben kann – als auch »beispielhaft« sein muss, geboren aus einer angeborenen Vorstellungskraft. Für Friedrich Nietzsche war sie ein Balanceakt zwischen »dionysischer« Ekstase und »apollinischer« Robustheit. Das klingt wie eine spannende und kreative Formulierung, die eine gewisse Ratlosigkeit über die Definition, aber auch über das Zustandekommen kreativer Ideen beinhaltet.