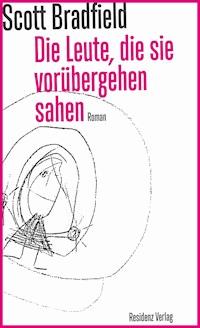11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Lah ist ein 19-jähriger heißer Todeszellenfeger mit sehr langen Beinen und einer ebensolchen Anklageliste. Während Lah in Erwartung der Todesspritze im Frauengefängnis in Texas sitzt, umschwirren sie Wärter, Therapeuten und Polizeibeamte wie Motten das Licht. Bradfield gelingt eine vor schwarzem Humor sprühende Satire über das amerikanische Justizsystem, die Gut und Böse auf erfrischend verstörende Weise zur Farce werden lässt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Ähnliche
Scott Bradfield
Gute Mädchen haben’s schwer
Roman
Aus dem Amerikanischen von Manfred Allié
FISCHER E-Books
Inhalt
»Meine Seele ist von der Welt verdorben …«
Petschorin in Lermontows Ein Held unserer Zeit
Erster Tag
ICH HOFFE, DASS meine Bekenntnisse in dem Geiste aufgenommen werden, in dem sie verfaßt sind, nämlich in bester Absicht und als Buße für all meine Sünden. Ich habe keine katholische Erziehung genossen, auch keine protestantische oder sonst eine religiöse, jedenfalls nicht daß ich wüßte, aber ich glaube an die Überzeugung der Psychologen, daß Menschen ihre tiefsten Ängste und Geheimnisse offenbaren sollten, weil sie sonst nicht gesund werden können. Und ich hoffe auch, daß mein aufrichtiger und reumütiger Bericht ein Trost für die Freunde und Familien all derer sein wird, denen ich mit meinen Greueltaten Leid zugefügt habe.
Hauptsächlich aber will ich zeigen, daß ich im Grunde meines Herzens ein guter Mensch bin, was man ja nach dem, was die Zeitungen über mich schreiben, nicht vermuten würde. Die Zeitungsberichte bauschen alle Lügen über mein Leben auf, meine angebliche Männerfeindlichkeit, meine »sinnlose« Gewalt, meine Unaufrichtigkeit, meine Promiskuität, meinen grundsätzlichen Mangel an Moral. Worüber ich für meinen Teil nur lachen kann.
Ich weiß nicht, wie Sie als Leser darüber denken, aber wenn ich auf Moral aus wäre, dann würde ich sie nicht gerade in amerikanischen Zeitungen oder im amerikanischen Fernsehen suchen, das steht fest.
Für diejenigen, die nicht fernsehen und keine Zeitung lesen, möchte ich mich vorstellen, wie Eva sich einst Adam vorgestellt hat, denn das ist die unschuldigste Art, wie eine Frau sich der Welt präsentieren kann. Ich wünsche mir nur, daß Sie alle Vorurteile über mich beiseite legen, bis Sie mich angehört haben.
Unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Haben Sie das nicht schon mal irgendwo gehört?
Bitte bitte bitte bitte bitte.
Ich heiße Delilah Riordan und bin im Jahr 1981 zur Welt gekommen, dem letzten Jahr, in dem Oakland den Superbowl gewann, woran mein Daddy mich oft und gern erinnerte. Mein verehrter Daddy war der Überzeugung, daß meine Geburt und der Niedergang der Oakland Raiders etwas miteinander zu tun hatten, oder jedenfalls klang es in den vielen gehässigen Bemerkungen, die er im Laufe der Jahre darüber gemacht hat, so.
Die meisten Leute denken bei meinem Daddy an das Gute, das er für die Gemeinde getan hat, etwa daß er Algebra an der Junior High unterrichtet hat oder daß er Trainer der Bowlingmannschaft war. Aber mir ist er vor allem wegen seiner boshaften Sticheleien auf meine Kosten im Gedächtnis geblieben, zum Beispiel eben daß ich der Grund für den Niedergang seiner Lieblings-Fußballmannschaft gewesen sei. Oder daß er es »rumpoussieren« nannte, wenn ich mal mit Jungs ausging, was ja wohl soviel wie »für jeden zu haben« heißen sollte.
Daddy war ein Mann, der immer freundlich war und immer nur lächelte, und in all den Jahren, die ich ihn kannte, habe ich ihn nicht ein einziges Mal wütend gesehen. Aber er war ein weitaus komplizierterer Mensch, als die anderen wußten. Was wohl, nehme ich an, für jeden von uns gilt.
Im Grunde war ich ein fröhliches Mädchen mit einer positiven Lebenseinstellung, und wenn das Wetter in Connecticut nicht gar so gräßlich wäre und ich nicht ganz soviel Zeit im Haus hätte verbringen müssen, dann wäre es eine perfekte Kindheit gewesen.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe gern in unserem Keller in Ashford gespielt, wo ich oft Spinnen aufgespürt und bombardiert habe, damit sie begreifen, was Demokratie heißt. Aber der ideale Spielplatz für ein kleines Mädchen ist es nicht, das muß man sagen.
Kleine Mädchen (kleine Jungs übrigens auch) brauchen Sonnenlicht, sie müssen im Freien spielen können, wenn sie groß werden und nützliche Mitglieder der Gesellschaft werden sollen.
Was die Schreiberin dieser Zeilen ja eben nicht geworden ist.
Das ist vielleicht sogar die Moral von meiner Geschichte, das, was ich der Welt damit sagen will: daß wir alle groß werden und plötzlich Dinge tun, die wir überhaupt nicht wollten, egal ob gut oder schlecht oder sonstwas. Was ja eigentlich auch gar keine schlechte Art ist, die Dinge zu sehen, denn schließlich kann ein Mensch, der einen freien Willen hat, jeder sein, der er sein möchte, sogar Adolf Hitler oder Mutter Teresa.
Du kannst kein gutes Mädchen sein, wenn du nicht die Wahl hast, auch ein böses Mädchen zu sein, hat Daddy immer gesagt. Und umgekehrt.
Aber jetzt ruft die Wache, Zeit zum Schlafengehen. Dann verschiebe ich den Bericht über mein Leben bis morgen.
Zweiter Tag
ALSO, DAS FRÜHSTÜCK war wieder genauso eklig wie jedesmal, bestehend aus einer Pampe, die ich nicht mal meinem Hund geben würde, und schlabbrigem Rührei-Ersatz, was wirklich noch schlimmer ist als schlabbriges Rührei.
Was ist ein Menschenleben doch für eine erstaunliche Sache! Und wie vollgestopft mit Gedanken, Erinnerungen, Meinungen!
Gestern habe ich zum Beispiel geschrieben, daß ich bei meinem Daddy in Ashford aufgewachsen bin. Das wäre ja schon eine ganze Geschichte für sich.
Bevor Daddy seinen Posten bei der Schule bekam, hatte er ein Herrenausstattergeschäft an der Hauptstraße, aber die Bank hat es zugemacht, und dann hatte er alle möglichen anderen Jobs, an einer Softeismaschine oder als Vertreter für Schuluniformen oder als nicht gewerkschaftlich organisierter Lieferwagenfahrer für die Ashford News, unsere Lokalzeitung in Ashford, bevor die Bank die auch zugemacht hat. Am Ende ist Daddy dann zur Abendschule gegangen und hat sein Lehrerdiplom bekommen, und seine neue Karriere an unserer High School war ja gerade erst richtig angelaufen, als seine tragische Erkrankung/angebliche Vergiftung ihn ins Koma beförderte.
Daddy war immer ein guter Vater, der hart arbeitete, damit seine einzige Tochter es mal besser haben sollte, auch wenn er sie wegen der Arbeit zu oft allein lassen mußte, wodurch sie allerlei falsche Vorstellungen vom Leben bekam. Aber sein Hauptproblem war, glaube ich, daß er keine dauerhaften Bindungen mit Frauen aufbauen konnte, deshalb hat er Mam im Mittelwesten sitzenlassen, als ich noch ein Baby war, und zog mit mir nach Connecticut, wo er hoffte, daß sie uns nie wiederfinden würde.
Wo sie uns aber, wie mittlerweile jeder weiß, doch fand.
Malen Sie sich also bitte ein hübsches kleines Mädchen aus, das so viel mit Jungs spielte, daß es sich beinahe selbst für einen Jungen hielt. Schon im zarten Alter fuhr ich Fahrrad, spielte Baseball und hatte immer nur Jeans und T-Shirts an, alte Sachen von meinem Vetter Oscar, der in Willimantic bei Tante Alice lebte. Ich identifizierte mich mit den Jungs in Filmen, mit Indiana Jones und Luke Skywalker, und die Mädchen in den Filmen waren mir peinlich, weil sie immer unbedingt wollten, daß jemand sie heiratete oder daß sie Babys bekamen oder daß man ihnen Komplimente machte. Ich glaube, ich habe nie einen Film gesehen, wo nicht das Mädchen am Ende heiratete, und wenn sie nicht heiratete, dann taten alle, als sei es eine große Tragödie. Das war natürlich bevor Julia Roberts kam und den Zuschauern zeigte, daß es auch anders geht.
Aber ich bin ja nicht als Filmkritikerin hier im West-Texas-Frauengefängnis, und ich glaube auch nicht, daß ich in der nächsten Zeit Filmkritikerin werde.
Im West-Texas-Frauengefängnis bin ich, weil ich angeblich eine Serienmörderin bin. Was auch nur wieder eines von den Vorurteilen ist, mit denen ich schnellstens aufräumen möchte.
Das Etikett der Serienmörderin ist denkbar unpassend für eine junge Frau wie mich, die überhaupt keine Mörderin ist und schon gar nicht in Serie, nicht einmal wenn man glauben würde, was Connecticut, Kalifornien, New York und Idaho mir alles zur Last legen, und ein paar europäische Staaten dazu, wodurch die Sache aber jetzt zu kompliziert würde.
Serienmörder sind Menschen (meist hyperaggressive Alphamännchen) wie Jeffrey Dahlmer und Hannibal Lecter, die andere umbringen und aufessen. Oder wie in Henry: Porträt eines Serienkillers Leute, die so was sexuell aufregend finden. Serienmörder schreiben Briefe an die Presse und prahlen mit ihren gräßlichen Verbrechen, wie Zodiac oder Jack the Ripper, und lassen mit Absicht Fährten zurück, weil es ein Spiel zwischen ihnen und den neunmalklugen Detektiven ist, die ihnen auf die Spur kommen sollen, denn tief im Herzen wollen sie, daß man sie faßt und für ihre Untaten bestraft. Ein Beispiel für dieses Syndrom ist in Der Knochenjäger zu sehen, wo Denzel Washington ein sehr glaubwürdiges Porträt eines echten Serienkillers gibt (d.h. von jemandem, der ganz anders ist als ich).
Denzel Washington wäre, nebenbei bemerkt, ein ausgezeichneter fester Freund/Ehemann für Julia Roberts, gerade wo die beiden in Die Akte so gut zusammengearbeitet haben. Aber ich glaube, er ist schon verheiratet.
Wer sich also auskennt, kann mich unmöglich einen Serienkiller nennen. Auch wenn die Schwachköpfe im Billigfernsehen das Tag für Tag tun.
Daß ich keine Serienmörderin (hauptsächlich von Männern) bin und niemanden mißhandelt habe, liegt auf der Hand. Ich fasse die Fakten hier kurz zusammen:
Zunächst einmal habe ich ja nicht so viele umgebracht, zwei vielleicht; obwohl einer ganzen Reihe von Männern aus meiner Bekanntschaft Unfälle zugestoßen sind, darunter einem, den ich wirklich geliebt habe.
Zum zweiten erregt das Morden mich nicht sexuell, denn ich bin ein normales Mädchen mit einer gesunden Sexualität, vielleicht ein bißchen viel davon, wenn man den sogenannten Experten glauben will. Aber die Experten können mich mal, was geht die das überhaupt an?
Drittens bin ich das genaue Gegenteil von einem Kontrollfreak, und die zwei-, vielleicht dreimal, wo ich jemanden umgebracht habe, war es einfach nur ganz gewöhnliche Wut wegen der schrecklichen Sachen, die sie mir angetan hatten, sogar mißbraucht haben sie mich. Wie Farrah Fawcett (eine von den drei ursprünglichen Engeln für Charlie) es in dem Fernsehfilm Das brennende Bett, den ich als kleines Kind gesehen habe, durchmachen mußte.
Die hat dem Burschen ganz schön was erzählt über Mißbrauch in der Ehe!
Als viertes oder auch fünftes wäre zu sagen, daß ich niemals gefaßt oder bestraft werden wollte, und ich habe mit Sicherheit für niemanden Spuren hinterlassen, nur ein paar blöde Fehler gemacht, die ich zutiefst bedaure. (Aber wenn Denzel Washington kommen und nach mir fahnden will, kann er das gerne tun.)
Und zum letzten esse ich keine Menschen, ich bin so gut wie Vegetarierin, und das ist die reine Wahrheit. Und ich habe auch nicht vor, in absehbarer Zeit welche zu verspeisen.
Lassen Sie mich zum Abschluß noch sagen, daß der Journalismus eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft hat und daß es schön wäre, wenn Journalisten ab und zu auch mal die Wahrheit sagten.
Aber da brauche ich mir wohl keine Hoffnungen zu machen. Nicht solange es Kommerzfernsehen gibt.
Jetzt habe ich den ganzen Tag über geschrieben, und hier kommt schon wieder die Wache und ruft, daß Schlafenszeit ist. Und wenn ich es jetzt noch mal durchlese, sehe ich, daß ich nicht weit mit meiner Lebensgeschichte gekommen bin.
Na ja. Morgen ist auch noch ein Tag.
Das ist doch das Wichtigste im Leben, oder?
Dritter Tag
DIENSTAGE MAG ICH nicht, schon gar nicht im Gefängnis, denn da bleibt kaum Zeit, an seinen Memoiren zu schreiben oder in Ruhe nachzudenken, was man ja tun muß, bevor man etwas aufschreibt.
Zuerst das Frühstück, enttäuschend wie immer. Dann kommt die tägliche »Körperertüchtigung«, was heißt, daß man über den Gefängnishof marschiert und von den bullbeißigen Aufseherinnen drangsaliert wird, die zuviel rauchen und die dir erzählen, was sie gern mit deinen Brustwarzen machen würden. Dann die Leibesvisitationen, jedesmal bevor man in seine Einzelzelle im Todestrakt zurückdarf, wo ich seit zwei Jahren sitze, seit meiner zweiten Verurteilung wegen Mordes.
Manche von den männlichen Aufsehern (und sogar weibliche) nutzen diese Visitationen ziemlich aus.
Dann kommt am Dienstagnachmittag die Sozialtherapie, unsere wöchentliche Gruppensitzung mit Dr. Reginald, dem lieben, aber vertrottelten Psychiater, der uns helfen soll, uns »über unsere Gefühle klarzuwerden«, über das Gefängnisleben, unsere Kindheit in heruntergekommenen Stadtvierteln, die Wirren der Teenagerzeit (alles was mit Sex und der körperlichen Reife zu tun hat), und dann kommt noch eine ganz besondere Spezialität, für die Dr. Reginald die Formel »Uns das Erreichte vergegenwärtigen: Wie wir das Beste aus unserer Zeit im Gefängnis machen« hat.
Jede Sitzung beginnt und endet mit etwas Positivem, das wir unserer gegenwärtigen Lebenssituation abgewinnen können, gerade wenn wir es im Kontext seiner Lieblingsmetapher sehen, nämlich daß wir mit dem Fahrrad einen Berg hinauffahren.
Ipso facto: Man sieht nicht immer, wie hart man arbeitet und wieviel Fortschritte man macht. Aber trotzdem ist der Fortschritt immer da, die ganze Zeit.
Bei der Erläuterung dieses Prinzips setzt Dr. Reginald heute an der Stelle wieder an, wo wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich daß wir Anteil an der Geschichte von Suzy Monaghan nehmen sollen, einem jungen Mädchen, das praktisch überhaupt keine Freunde im Gefängnis hat, weil sie so gräßliche rote Pusteln hat und immer vor sich hin trielt.
»Letzte Woche«, nimmt Dr. Reginald den Faden auf, »hat Suzy uns ein paar hochinteressante Dinge aus ihrem Leben als Kinderprostituierte in Danbury erzählt, über ihre zunehmende Abhängigkeit von Heroin, kodeinhaltigem Hustensaft und veterinärem Tranquilizer. Ich weiß noch, Suzy erzählte, es sei von Tag zu Tag schlimmer und entwürdigender geworden. Die Demütigungen wurden größer, die Verbrechen abscheulicher, und sie stumpfte immer mehr ab gegenüber ihrem eigenen Betragen und dem der anderen. Aber mitten in dieser Abwärtsspirale, diesem Weg in den Abgrund, fand sie zu einem Akt der Lebensbejahung, wie er auf dem Blatt, das ich euch letzte Woche ausgeteilt habe, beschrieben ist. Wo es darum geht, daß man sich selbst ein Versprechen gibt oder einen langfristigen Vertrag mit sich schließt. Und das Mittel, das Suzy wählte, das Mittel, durch das sich ihre Lebensumstände bessern sollen, war, wenn ich mich recht erinnere, das Wörterbuch.«
An diesem Punkt öffnet Dr. Reginald eine Pappschachtel, die er am Boden stehen hat, und darin liegt die jämmerlichste Ansammlung von Taschenbüchern, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Bei den meisten sind die Umschläge abgerissen, und die Seiten sind voller Wasserflecken oder bekritzelt mit Bleistiften und Buntstiften und was weiß ich allem.
Dr. Reginald fischt in der ramponierten Kiste, bis er ein Exemplar findet, an dem wenigstens noch ein Stück Umschlag hängt. Und dann hält er es uns hin, als sei es etwas ganz Besonderes, was seine Frau extra für uns im Ofen gebacken hätte.
Plätzchen oder ein Gugelhupf.
»Ein Wörterbuch. All die Wörter, mit denen wir sagen können, wer wir sind, wie uns zumute ist, was wir mit unserem Leben machen wollen. Nicht wahr, Suzy? Hast du uns nicht letzte Woche erzählt, daß du dir, ganz egal ob du gerade high warst oder ob du Unzucht in einem billigen Hotel triebst, jeden Morgen ein Wort aus dem Wörterbuch beigebracht hast? Das muß dir nicht peinlich sein, Suzy. Das ist nichts, wofür man sich schämen muß. Ich weiß, du hast im Laufe der Jahre allerlei an Verweigerungstechniken gelernt, aber heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Deine Zukunft gehört nur dir selbst.«
Suzy hat natürlich angefangen zu kichern. Das ist Suzys Standardantwort, wenn jemand sie etwas Ernsthaftes fragt, etwa Namen, Alter oder Geburtsort.
Dr. Reginald hat bereits mit dem Verteilen der Wörterbücher begonnen. Sie wandern von Hand zu Hand wie Sushi.
»Habe ich etwas Lustiges gesagt, Suzy?«
Suzy hält kurz im Kichern inne, so lange wie sie braucht, um »Nein, Dr. Reginald« zu sagen.
»Gibt es etwas an dem Vorsatz, sein Leben zu verbessern, das du lustig findest?«
Nun braucht Suzy schon ein wenig länger, bis sie das Kichern einstellt. Sie hat Tränen in den Augen. »Nein, Dr. Reginald.«
»Ist es lustig, wenn man mit verkommenen Männern in billigen Motels Unzucht treibt, Suzy? Oder ist es vielleicht lustiger, wenn man mit aidskranken Junkies in der Gosse die Nadeln teilt?«
Nun hat Suzy aufgehört zu kichern. Vielleicht weil sie sich für all die Dinge, die sie nie getan hat, schämt.
Dr. Reginald gibt sich alle Mühe, auf uns einzugehen, aber offenbar liest er nie unsere Akten und glaubt alles, was wir ihm bei den Gruppensitzungen erzählen. Sogar Suzy glaubt er, einer zwanghaften Lügnerin, die nie im Leben in einem billigen Motel Unzucht getrieben hat (hätte sie wohl gern!). Genaugenommen ist Suzy dreimal wegen Ladendiebstahls verurteilt worden, und nach texanischem Gesetz landet sie nach der dritten Straftat im Hochsicherheitstrakt mit echten Gewalttätern wie mir.
»Ein Wort pro Tag«, sagt Dr. Reginald nach einer Weile. »Das ist doch nicht zuviel verlangt, oder?«
Ich nehme das Taschenbuch und blättere darin. Krümel und getrocknete Popel rieseln heraus. Ich schlage zufällig eine Seite auf und lese das erste Wort.
Pudenda.
Ein Wort wie jedes andere, nehme ich an.
Und Worte sind doch besser als gar nichts.
Vierter Tag
LETZTE NACHT HATTE ich fürchterliche Träume von Manuel und Dr. Pendenning und von dem Mann, dessen Name mir immer nicht einfällt, und meinem ersten Richter, Richter Kenworthy, von dem Tag bei ihm im Büro, wo ich einfach nur fortwollte, und er hielt mich fest; all diese Träume handeln davon, daß ich die Kontrolle verliere, daß ich mich im Haus eines Fremden verirre, ich weiß nicht, wem es gehört, vielleicht ist es das Haus von Richter Kenworthy. Diese Träume fühlen sich überhaupt nicht an wie Schlaf, eher wie Folter, und alle paar Minuten habe ich das Gefühl, jetzt passiert es. Jetzt kommen sie. Ich kann nicht nach draußen, und jetzt passiert es. Jetzt ist es soweit, und ich kann sie nicht aufhalten.
Ich habe ja schon manchen schlechten Traum gehabt, schon seit meiner Kindheit, und solche Träume sind kein Zuckerschlecken, das können Sie mir glauben.
Als ich noch klein war und Mam uns verließ, habe ich oft von der Frau mit dem Pferdegesicht und den knochigen Fingern geträumt, die mich immer entdeckte, selbst in den sichersten Ecken, und jedesmal wenn ich sie umbrachte, kehrte sie zurück. Sie kam durch mein Zimmerfenster oder lauerte im Garderobenschrank des Kindergartens, oder ich lief zu Daddy und fand sie bei ihm im Bett, mit der blauen Plastik-Nachthaube, die sie über den Lockenwicklern trug, wie der große böse Wolf, nur daß es kein Märchen war, sondern eine echte häßliche Frau in der wirklichen Welt. Ich warf sie zum Fenster hinaus, ich stopfte sie in Kamin oder Ofen, ich stach mit Küchenmessern auf sie ein, immer und immer wieder, bis sie aussah wie ein großes menschliches Nadelkissen, und dann blies sie sich auf wie ein Kugelfisch, und all die Messer standen wie Stacheln aus ihr heraus, und sie hob vom Boden ab und ich sagte: Bye-bye, langgesichtige Lady, auf Nimmerwiedersehen. Ich war erleichtert, wenn sie fort war, aber da war auch gleich wieder die Furcht, und ich konnte sie nicht zurückhalten, tot war sie schlimmer als lebendig. Und mein Haus war leer und Daddy war an der Arbeit, und ich hörte Stimmen aus dem Keller.
Ich wußte, daß ich nach unten mußte. Ich wußte, ich mußte nach unten und nach der Frau mit dem Pferdegesicht suchen.
Bevor sie mich fand.
Nachdem Mam uns zum letztenmal verlassen hatte, nahm Daddy alle erdenklichen Arbeiten an, und ich war oft allein, und wahrscheinlich war das der Punkt, an dem ich so tragisch vom Pfad meines Lebens abkam und so weiter.
Anfangs vermißte ich Mam gar nicht, denn sie war ohnehin nie zu Hause gewesen; soweit ich mich überhaupt zurückerinnern konnte, war sie immer anderswo, zur Kur oder dergleichen. Und wenn sie mal zu Hause war, dann lag sie den ganzen Tag über im Bett, die Tür verschlossen, oder sie ging in die Stadt, wo sie gern ein Bier in der Duckpin-Bowlingbahn an der Route 44 trank. Manchmal erzählten meine Freunde mir merkwürdige Geschichten über sie. Ich fand es unfair, daß meine Freunde so viel über Mam wußten und ich fast gar nichts.
»Deine Mami sollte sich lieber nicht mehr bei uns blicken lassen«, sagte Johnny Singer mir eines Tages. Johnny und ich waren bei unserem damaligen Lieblingsspiel, und zwar spielten wir mit Plastiksoldaten draußen hinter der Thomas-Jefferson-Grundschule. Manchmal bombardierten wir die Soldaten mit Steinen, oder wir schlossen sie mit »Feuerwällen« aus Streichhölzern und Feuerzeugbenzin ein, und viele Plastiksoldaten starben unter schrecklichen Qualen und bereuten ihre Sünden. »Meine Mami sagt, sie hackt deiner Mami den Kopf mit dem Küchenmesser ab, wenn sie sich noch mal blicken läßt.«
Oder Sally Grampus: »Mein Onkel Tommy sagt, wenn du deiner Mami sagst, sie soll ihn anrufen, dann bekommen wir jeder ’nen Vierteldollar.« Sally Grampus, das wußten alle, war eine scheinheilige Ziege, schon als Kind, lange bevor ihr unverdienter Ruhm als Homecoming Queen mit einem tragischen Jagdunfall endete. (Ein Schuß traf sie, als sie zu ihrem Wohnzimmerfenster in Wallingford hinausschaute.)
Oder die Jungs in der Schule fragten mich, ob jemand die Dorfpumpe geölt hätte, gestern nacht hätten sie sie quietschen hören. Oder unrasierte Männer hielten mich und Daddy an, wenn wir auf den Markt gingen, und klopften ihm auf die Schulter, als ob sie dicke Freunde wären, oder sie knieten sich vor mich hin und wollten einen Kuß von mir, und Daddy zerrte mich weg, so fest wie er noch nie gezerrt hatte. Ich habe heute noch das Gelächter dieser Männer im Ohr, in ihren neongelben Straßenkehrerwesten, und höre noch den Lärm, wenn sie ihre Motorräder aufdrehten. Das waren keine schlechten Männer, die da zu meinem Daddy und mir kamen, immer gerade wenn wir am wenigsten mit ihnen rechneten, nicht grausam. Aber sie wollten vor aller Welt damit prahlen, daß sie meine Mam besser kannten als ich. Und irgendwie kann man, glaube ich, sagen, das ist das eine, was ich ihnen nie verziehen habe.
Ganz egal wie sehr ich’s versucht habe.
Die Leute erzählten so viel von »meiner Mami«, daß sie mir gar nicht mehr wie meine eigene vorkam, und eigentlich kannte ich sie nur als Abwesende, als jemanden, der nie richtig da war. Ich kannte nur einzelne Sachen von ihr, die sich irgendwie von Mams Körper und Gesicht losgelöst hatten und durchs Haus geisterten, als hätten sie einen eigenen Willen, wie die Psyche von Toten, die noch als Poltergeist im Haus bleibt.
Etwa das Geräusch von fallengelassenen Flaschen in der Küche. Oder der Geruch von Desinfektionsmittel im Schlafzimmerschrank. Mam putzte die Toilette und den Schuhständer dreimal pro Abend, Zwangsneurose nennt man so etwas, soviel ich weiß. Oder wenn ich schlief, spürte ich Mams kühle Hand auf der Stirn, wie Wäsche frisch von der Leine. Mam sprach dabei nie ein Wort. Sie ließ mich nur einfach wissen, daß sie immer noch da war.
Diese paar Fetzen waren jahrelang praktisch alles, was ich von Mam wußte, bevor ich sie dann als erwachsene Frau in Los Angeles besser kennenlernte.
Aber das ist, wie man so sagt, eine andere Geschichte.
Fünfter Tag
ICH GLAUBE, JUNGS interessierten sich schon für mich, bevor ich mich für Jungs interessierte. Und es war mir nicht unwillkommen, denn es half beim Erwachsenwerden. Was soviel hieß wie: Nichts wie weg aus Ashford.
»Mädchen sind zu kompliziert«, sagte Mam einmal zu mir, als ich in L.A. lebte und wir wieder mehr Kontakt miteinander hatten. »Und Jungs sind nicht kompliziert genug. Wenn du Männer verstehen willst, mußt du alles auf die einfachsten Triebe reduzieren. Sex. Essen. Sex. Geld. Geld für Essen. Geld für Sex. Schlafen. Wieder Geld. Sex. Wenn du dafür sorgst, daß ein Mann diese simplen Sachen hat, dann will er nichts anderes, bis er irgendwann aufwacht. Und dann will er das gleiche wieder von vorn.«
Jungs bemerkten mich, Jungs jeden Alters und jeder Größe, Jungs auf der Straße und Jungs im Bus. Ich kann mich noch genau an meinen zwölften Geburtstag erinnern, es war, als ob die ganzen Biorhythmen exakt an diesem Tag losgegangen wären, wie im Horoskop, wenn die Planeten alle in einer Linie stehen.
Es ist eine merkwürdige Sache, wenn man selbst die Welt mit den Augen eines Kindes sieht, und die Welt schaut einen an und sieht eine Frau. Das könnte einen wahrscheinlich schon ziemlich durcheinanderbringen. Wenn man es zuläßt.
Das erste, was dir auffällt, ist, daß der Busfahrer überhaupt nicht mehr drauf achtet, wieviel Geld du ihm hinlegst, und dich trotzdem durchläßt, der hat nur Augen für deine Oberweite. Du könntest genausogut Flaschendeckel in den Geldschlitz stecken oder Reiskörner, für den zählt nur das eine, und du könntest Buntstifte und ein Malbuch unter dem Arm haben, er würde trotzdem so gaffen. Dann gehst du den Mittelgang runter, und alle machen dir Platz, ganz gleich welcher Rasse oder Schicht oder Herkunft. Puertoricaner und Weiße und Ausländer und Schwarze. Jungs und Männer und uralte Männer und sogar schwule Jungs manchmal, und eine ganze Reihe Frauen, da staunt man immer. (Manchmal sogar Großmütter, die mit ihren Enkeln in den Park fahren!) All die Leute sind genau wie der Busfahrer, sie starren jede Rundung deines Körpers an, und dabei ist es ihnen völlig egal, wer du bist; Rundungen, die du am liebsten gar nicht sehen möchtest, die aber schwer zu verbergen sind unter Daddys altem Trainingsanzug.
Wenn du könntest, würdest du dich in einen großen Sack Kartoffeln verwandeln.
Aber die Leute sehen diese Peinlichkeiten mit einem Gesichtsausdruck an, den du noch nie bei ihnen gesehen hast, und plötzlich ist die Peinlichkeit verflogen, du weißt nicht wie, und du kommst dir mit einem Male riesengroß vor, und die Leute blicken zu dir auf. Man kann nicht sagen, daß sie dich bewundern. Lieben tun sie dich nicht. Sie spüren dich, das ist die einzige Erklärung. Sie spüren, wo du bist, wohin du gehst, sogar auf welchen Platz du dich setzt, denn da nimmt schon ein Mann seinen Aktenkoffer von der Stelle, an die du dich setzen wirst. Und alle starren dich an, selbst wenn sie gerade wegsehen, und du begreifst, daß da etwas sehr Gutes geschieht, du kannst nicht recht sagen was, aber es ist sehr, sehr gut und wird dich sehr glücklich machen. Etwas Besseres als du selbst. Etwas Besseres als Fernsehcartoons oder Lehrer, die dir deinen Mangel an Ehrgeiz vorhalten, oder andere Kids, die dich wie einen Idioten behandeln, nur weil du am Mittwochnachmittag noch zum Nachsitzen in Mathe dableiben mußt.
Aber jetzt hast du etwas erreicht. Und du bist draußen. Fast wie in diesen Geschichten, die man in der Zeitung liest, von Leuten, die ihren Körper verlassen.
Es macht mir keinen Spaß, Macht über andere zu haben – auch wenn neunmalkluge Ärzte und Gossenjournalisten das Gegenteil behaupten –, aber es kann schon nützlich sein. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber so ist es nun mal.
Und dann setzt du dich auf deinen Platz, und irgendwie swingt alles, und aus allen Richtungen kommen sie angeflogen, all diese kleinen Blicke und Nicht-Blicke, wie Chemikalien, die man in ein Reagenzglas gießt, und alles erwacht zum Leben, alles brodelt und zischt und schäumt. Dann fährt der Bus los. Und als nächstes sitzt du am Krankenhausbett, wo Dad wieder eine von seinen Operationen überstanden hat, und als er aus der Narkose erwacht, sieht er dich an wie immer. Als wärst du immer noch sein kleines Mädchen.
»Hallo, Prinzessin«, sagt er. Er ist bleich und eingefallen. An Metallständern hängen Flaschen, und er ist mit Schläuchen daran angeschlossen. Er liegt auf einer Station mit anderen Männern, die genauso in ihren Betten liegen, als hätte man die Luft rausgelassen, reglos, wie Schatten auf den Bettüchern. »Nur eine Routineuntersuchung«, sagt Dad zu dir. »Sei ein gutes Mädchen, bis ich wieder hier rauskomme, und tu, was Tante Alice dir sagt. Wenn du willst, kannst du auch bei ihr wohnen. Nicht wahr, Alice? Wenn Lah dich braucht, muß sie nur anrufen.«
Wie üblich bemerkst du Tante Alice erst, als Daddy dich auf sie aufmerksam macht. Sie sitzt auf dem Stuhl neben dem Bett. Sie hält Daddys leblose Hand in ihrem Schoß.
»Selbstverständlich, Charles«, sagt Tante Alice. »Es wartet immer ein Zuhause auf Lah, wenn es ihr nachts graust. Sie braucht nur anzurufen.«
Und natürlich bemerkst du ihn sofort, den Blick, mit dem Tante Alice dich ansieht. Derselbe Blick wie bei den Leuten im Bus. Du könntest lachen.
Tust du aber nicht.
Du behältst das Geheimnis für dich.
Sechster Tag
DIE LIEBE KENNT nur eine einzige Sprache, und das ist die Sprache des Herzens. Das hat Daddy immer gesagt, als ich noch klein war, und da muß es ja stimmen.
Er sagte das natürlich über seine eigene Liebe zu meiner Mam, einer Frau, die anders war als andere und immer ihre eigene Art hatte. Aber es galt auch für Manuel und mich, wo wir ja zwei verschiedene Sprachen sprachen, auch wenn etwas so Unwichtiges bei unserer Liebe nie eine Rolle gespielt hat.
Ich habe oft versucht, das meinem Spanischlehrer zu erklären, dem Direktor meiner High School, Rektor Foster, der sein gesamtes (kurzes und unnötig tragisches) Leben lang nicht einsehen wollte, daß es bei Fremdsprachen um etwas anderes geht als um Grammatik und unregelmäßige Verben. Aber das Herz hat seine eigene Grammatik, und entweder kennt man die oder eben nicht. Das war die Sprache, die Manuel und ich sprachen. Und da ist es mir egal, wie oft ich durch den Anfängerkurs Spanisch gefallen bin, nur weil Rektor Fosters Unterricht so rückständig war.
»Ich glaube, du unterforderst dich«, war eine typische Bemerkung von Rektor Foster, wenn wir in seinem Büro saßen und er wieder mal versuchte, mir die Laune zu vermiesen. »Du gibst im Unterricht nicht acht, und jedesmal wenn ich auf deine schlechten Leistungen zu sprechen komme, erzählst du mir etwas von deinem mexikanischen Freund und der Bowlingbahn, und ich frage mich, ob du auch nur ein einziges Wort von dem hörst, was ich zu dir sage. Ich weiß, ich bin nicht gerade der Mann deiner Träume, Lah. Und ich bin sicher, du siehst mich an und denkst ›was will denn der alte Knacker, mit Frau und Kindern, seit Ewigkeiten verheiratet und schon mit einem Fuß im Grabe‹. Aber ich mache mir Sorgen um dich, Lah, echte Sorgen. Ich will nicht, daß ein kluges, attraktives Mädchen wie du endet als – ja, als was willst du enden? Mathematik magst du nicht. Bücherlesen magst du nicht. Und was das Spanische angeht – die schönste, romantischste Sprache auf der großen weiten Welt, und jede Stunde kommst du ohne Hausaufgaben. Wenn wir uns nicht bald auf den Hosenboden setzen, Lah – und zwar wir beide –, dann wirst du zum drittenmal beim Spanisch-Grundkurs durchfallen; aber anscheinend macht dir das weniger Sorgen als mir. Ich sage dir nämlich eine große Zukunft voraus, Lah. Ich will, daß du etwas machst aus all den guten Anlagen, die du hast.«
Eine Sache, die ich gelernt habe, jetzt wo ich älter geworden bin, das ist, daß Menschen eigentlich ziemlich berechenbar sind, gerade Männer wie Rektor Foster, der ja in der ganzen Zeit, die ich ihn kannte, nur einen einzigen Gedanken im Kopf hatte; na, vielleicht zwei. Der erste war, daß er allein mit mir im Klassenzimmer sein wollte, und der andere, daß er mir die Laune verderben wollte, jedesmal wenn ich irgendwas gemacht habe, was ihm nicht paßte. (Als ob ich das dauernd getan hätte.) Natürlich hat Rektor Foster immer gesagt, ihm ginge alles mögliche durch den Kopf, all die Gedanken, die er sich um andere machte, und daß doch etwas werden müßte aus unseren Anlagen, bla bla. Aber unter uns gesagt, ich denke mir, das war alles nur Geschwätz.
Wie die meisten Menschen wollte er einfach nur tiefsinniger und gefühlvoller tun, als er in Wirklichkeit war.
Eins muß man aber immerhin sagen: Rektor Foster war der erste, der versuchte, mich zu retten.
Ganz schön ironisch, wenn man bedenkt, was dann mit Rektor Foster passiert ist.
Siebter Tag
SAMSTAG. WAHRSCHEINLICH DER gräßlichste Tag der Woche oder vielleicht auch der beste. Der Tag, an dem Dr. Alexander seine Sitzungen mit mir hält, im Büro des Direktors mit zwei Wachen vor der Tür.
Dr. Alexander hat ein Stipendium von seiner Universität und erforscht die Psyche von Massen- respektive Serienmördern. Zwar beruht meine Zuordnung zu beiden Kategorien auf einem Irrtum, aber auf Anraten meines Anwalts Joshua Birnbaum habe ich mich zur Teilnahme bereit erklärt; er sagt, in unseren Verhandlungen mit den Gouverneuren von Iowa und Texas wird es als »Zeichen des guten Willens« gewertet. Im Gegenzug überläßt Dr. Alexander uns regelmäßig Transkriptionen der Tonbandprotokolle dieser Sitzungen, damit wir der Welt vor Augen führen können, daß ich sogar als Opfer eines furchtbaren Justizirrtums immer noch bereit bin, meinen Beitrag zur Erforschung der kriminellen Psyche in unserem Land zu leisten.
Dr. Alexander ist ein häßlicher Mann mit widerlichen Warzen an Gesicht und Händen. Aber ich freue mich auf die Sitzung, weil ich die von ihm erfundene Methode mag, die sogenannte »Konfrontationsanalyse«. Bei diesem Verfahren stellt der Analytiker alles, was der Analysand (das bin ich) sagt, immer wieder in Frage, widerspricht ihm, provoziert ihn sogar, bis jede seiner Äußerungen ein »Konfliktlösungsparadigma« zwischen Arzt und Patient ist.
Nach Dr. Alexanders Theorie (über die er ein Buch schreibt, das ihn berühmt machen soll) ist Wahrheit kein Faktum und auch kein Zustand. Die Wahrheit muß man sich jeden Tag neu erkämpfen.
Ich nehme auf dem Stuhl von Gefängnisdirektor Harrison hinter dessen Schreibtisch Platz, und zunächst behandelt Dr. Alexander mich sehr aufmerksam und zuvorkommend, damit sich ein »trügerisches Machtgefühl« entwickelt.
Gemäß Dr. Alexander sind sämtliche Machtgefühle trügerisch. Je früher man sich daran gewöhnt, desto besser.
Protokoll einer Therapiesitzung
Fall Nr. 34421
Delilah Riordan
Beginn der Therapie: 2. 2. 02
Datum der Sitzung: 11. 5. 02
Anwesend:
Delilah Riordan, Patientin
Dr. Wayne Alexander, Analytiker
W.A. Letztesmal haben wir über Ihre Einstellung zu Ihrer Mutter gesprochen.
D.R. Wenn Sie das sagen, Dr. Alexander.
W.A. Sie sagten, Sie haßten sie.
D.R. Ich habe nie gesagt, daß ich meine Mutter hasse.
W.A. Das haben Sie.
D.R. Ich habe meine Mutter nie gehaßt. Ich habe meine Mutter geliebt. Ich werde meine Mutter immer lieben, auch wenn sie mir nie schreibt oder mal im Gefängnis anruft, und sie kann sich ja wohl vorstellen, wie einsam ich hier bin.
W.A. Sie hassen sie, weil sie nie anruft. Sie hassen sie, weil sie nicht einmal eine Postkarte schreibt. Was würde eine Postkarte Ihre Mutter kosten, Lah? Vierzig Cents?
D.R. Ich liebe meine Mutter. Und ich liebe meinen Daddy. Sie wollen mich nur provozieren, damit ich etwas Wütendes sage.
W.A. 27. August 1998. Amarillo, Texas. Stephen Weaver, Vater von vier Kindern, parkt gegen 15 Uhr 30 seinen Sierra vor World o’ Boots. Stephen will eine Dose Schuhcreme für seine Kalbslederstiefel kaufen. Nicht daß Stephen ein Cowboy wäre. Er stellt keine Stacheldrahtzäune in der Prärie auf. Stephen ist Computerprogrammierer; seine Firma, ein Unternehmen für Marketingberatung, hat ihn vor kurzem aus Florida dorthin versetzt. Stephen ist glücklich verheiratet (d.h. noch nicht geschieden), Stephen liebt seine Kinder (d.h. er geht zu den meisten Elternabenden), Stephen ist ein verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft (d.h. er hat keine Schulden bei der Bank). Er parkt seinen Wagen und geht über den dampfenden Asphalt. Eine junge Frau steht, wie unser Augenzeuge berichtet, an ihrem Wagen mit geöffneter Motorhaube. Diese Frau ist, berichtet unser Augenzeuge, heißer als texanischer Asphalt. So heiß, daß unser Augenzeuge sich nicht mehr erinnern kann, ob sie blond oder brünett war, blau- oder braunäugig, groß oder klein. Sie ist einfach nur heiß. Sie ist absolute Hitze und sonst nichts. Unser Augenzeuge weiß noch genau, wo sich hinten an ihren abgeschnittenen Wranglers die roten Nähte lösten. Er könnte die Form ihrer Brustwarzen, die sich unter dem rosa Baumwolltop abzeichneten, auf Millimeterpapier festhalten. Er könnte die Härchen an der Rückseite ihrer Beine beschreiben, die Schweißperlen auf ihren Schenkeln, die Aura, die sie umgab. Sie war heiß. So hat der Augenzeuge sie den Richtern beschrieben. Stephen Weaver steht mit dieser heißen Lady eine Weile an ihrem Wagen, zuckt auf seine linkische Machoart mit den Schultern. Er prüft den Ölstand. Er prüft den Kühlwasserstand. Er prüft den Reifendruck und die Scheibenwischer und den Keilriemen. Stephen kann einen Kolben nicht von einer Karotte unterscheiden, aber er wird ihren Wagen reparieren, einfach nur damit er in ihrer Nähe bleibt, in ihrer geheimnisvollen Hitze. Etwa zu dieser Zeit geht unser Augenzeuge von World o’ Boots hinüber zu dessen Schwestergeschäft World o’ Guns, und vier Minuten später verläßt er den Laden wieder mit seiner Munition. Dann, der Kassenzettel vermerkt 15 Uhr 47 Minuten 33 Sekunden, ist Stephen Weaver fort. Die heiße Lady ist fort. Ihr Wagen ist fort. Und Stephen Weaver wird nie wieder gesehen. Stephen Weavers Irischer Setter stirbt an Hitzschlag im Wagen, schnappt nach Luft wie ein Barsch auf dem Trockenen. Zwei Tage darauf beginnt die Fahndung nach Stephen Weaver. Vermißtenanzeige wird erstattet, aufgehoben, nochmals erstattet. Und dann hört man nichts mehr von dem armen Stephen Weaver, Ehemann, Vater, treuer Sohn. Der arme Stephen Weaver. Seine arme Frau, seine armen Kinder. Und Sie, Lah? Haben Sie vielleicht eine Ahnung, was aus Stephen Weaver geworden ist?
D.R. Kann ich bitte ein Glas Wasser haben?
W.A. Aber natürlich.
D.R. Ich dachte, Sie wollten über meine Mutter sprechen.
W.A. Jemand hat an dem Tag, an dem Stephen Weaver verschwand, bei World o’ Guns einen 45er Colt gekauft. Bezahlt wurde mit Ihrer Kreditkarte. Der Beleg trägt Ihre Unterschrift. Ihr Gesicht erscheint in den Aufzeichnungen einer Verkehrsüberwachungskamera in Amarillo am Vormittag desselben Tages. Jemand hob am Nachmittag des folgenden Tages an einem Geldautomaten im Stadtzentrum zweihundert Dollar von Ihrem Girokonto ab. Im Motel 8 am Highway 61, gleich hinter der Stadtgrenze, schrieb sich eine Ms . Emily Weaver für zwei Nächte ein und reiste nach der ersten ab. Zwei Sachverständige haben Emily Weavers Unterschrift als die Ihre identifiziert. Alles in Ordnung? Stimmt etwas nicht mit dem Wasser?
D.R. Nein, mir fehlt nichts. Haben Sie Eis?
W.A. Kein Eis, Lah. Tut mir leid.
D.R. Vielleicht bin ich mal durch Amarillo gekommen. Früher bin ich viel unterwegs gewesen.
W.A. Tut mir leid, daß es kein Eis für dich gibt, hier im West-Texas-Frauengefängnis.
D.R. Ich bin immer gern gereist.
W.A. Vielleicht sollte ich die Wachen fragen, ob sie dir einen Becher Häagen-Dazs bringen können. Wäre das eine Abkühlung, Lah? Du siehst ein wenig erhitzt aus.
D.R. Es tut mir leid, wenn Mr. Weaver verschwunden ist, aber in Amerika ist so was ja keine Seltenheit. Gerade wenn man drei Kinder hat. Gerade wenn man Computerprogrammierer ist und die Firma einen nach Texas versetzt.
W.A. Sehr lustig, Lah. Vielleicht hätten Sie lieber Kaffee und Kuchen, bei soviel Sinn für Humor.
D.R. Ich habe keinen Sinn für Humor, Dr. Alexander. Den meisten Leuten fällt das als erstes an mir auf.
W.A. War es schön, Lah?
D.R. War was schön?