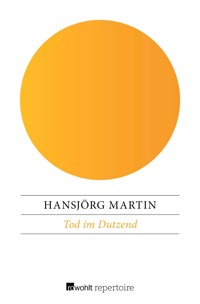9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dr. Andrea Abeling sitzt in ihrer neueröffneten Anwaltspraxis und wartet sehnsüchtig auf Klienten. Doch in den ersten vier Tagen flattern nur dümmliche Werbeprospekte auf ihren Schreibtisch. Niemand scheint ihren juristischen Beistand zu benötigen. Dabei hat sie in einem Anfall von Optimismus eine Sekretärin eingestellt. Woher soll sie bei der miserablen Auftragslage bloß am Ende des Monats deren Gehalt herzaubern? Da betritt, sozusagen als rettender Engel, der erste Mandant das Büro: gut aussehend wie ein Filmstar und mit besten Manieren. Ein Bild von einem Mann und eine leichte Sache für einen Anfänger wie sie – bis Andrea eine böse Überraschung erlebt. Aber das ist nur der Auftakt. Denn was der jungen Anwältin dann an merkwürdigen Fällen über den Weg läuft wie «Der Todträumer», an komischen wie «Keine Angst vor dicken Männern», an rührenden wie «Ein kritischer Kunde», an lebensgefährlichen wie «Blitz und Donner» und an tragischen wie «Ein böser Fall», läßt sie von einer verblüffenden Situation in die nächste stolpern. Der jungen, noch unerfahrenen Anwältin stellt Hansjörg Martin in seinem fünften Kurzgeschichtenband den allen Krimilesern vertrauten Kriminalkommissar Leo Klipp gegenüber. Aber auch ihm, dem alten Profi, blieb wie Andrea ein Reinfall nicht erspart ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Gute Messer bleiben lange scharf
Kriminalstories
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Dr. Andrea Abeling sitzt in ihrer neueröffneten Anwaltspraxis und wartet sehnsüchtig auf Klienten. Doch in den ersten vier Tagen flattern nur dümmliche Werbeprospekte auf ihren Schreibtisch. Niemand scheint ihren juristischen Beistand zu benötigen. Dabei hat sie in einem Anfall von Optimismus eine Sekretärin eingestellt. Woher soll sie bei der miserablen Auftragslage bloß am Ende des Monats deren Gehalt herzaubern? Da betritt, sozusagen als rettender Engel, der erste Mandant das Büro: gut aussehend wie ein Filmstar und mit besten Manieren. Ein Bild von einem Mann und eine leichte Sache für einen Anfänger wie sie – bis Andrea eine böse Überraschung erlebt. Aber das ist nur der Auftakt. Denn was der jungen Anwältin dann an merkwürdigen Fällen über den Weg läuft wie «Der Todträumer», an komischen wie «Keine Angst vor dicken Männern», an rührenden wie «Ein kritischer Kunde» und an lebensgefährlichen wie «Blitz und Donner» und an tragischen wie «Ein böser Fall», läßt sie von einer verblüffenden Situation in die nächste stolpern.
Der jungen, noch unerfahrenen Anwältin stellt Hansjörg Martin in seinem fünften Kurzgeschichtenband den allen Krimilesern vertrauten Kriminalkommissar Leo Klipp gegenüber. Aber auch ihm, dem alten Profi, blieb wie Andrea ein Reinfall nicht erspart ...
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Gute Messer bleiben lange scharf
Der Mord an Georg Tecklenberg geschah in meinem Beisein, ohne daß ich es merkte. Das ist eine Tatsache, die ich leider nicht leugnen kann, obschon sie nicht sonderlich schmeichelhaft für mich ist.
Welcher Kriminalkommissar – und noch dazu welcher erfahrene Mitarbeiter einer Mordkommission – gibt gern zu, daß fünf Meter von ihm entfernt, im gleichen Raum, jemand ermordet worden ist, ohne daß er es verhindert, ja, ohne daß er es überhaupt wahrgenommen hat.
Zu meiner Entschuldigung, richtiger zu meiner Rechtfertigung, noch richtiger: zur Erklärung dieses ungewöhnlichen Umstands kann ich zwar sagen: Der Raum war dunkel, aber das ist kein überzeugendes Argument, denn ein guter Kommissar sollte auch im Dunklen hellwach sein …
Bis auf das hellere, wechselnde Viereck der Leinwand zwischen den dicht verhängten Fenstern, bis auf den flimmernden Lichtstrahl, der vom Bildprojektor über unsere Köpfe quer durch das Clubzimmer schien, bis auf einzelne aufflammende Streichhölzer oder Feuerzeuge und den Glutschimmer von Zigarren oder Zigaretten war wenig zu sehen.
Außerdem saß ich neben Erika Schuhbier, die einen Großteil meiner Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, weil sie bei jedem neuen Dia, das erschien, lauthals «Oh!» oder «Ah!» oder «Guck doch mal, Leo!» oder sonstwas rief, mich am Arm packte und sich zu mir neigte, wobei aus dem tiefen Ausschnitt ihres großgeblümten Organdykleides Duftwolken schweren Parfums aufstiegen, mit dem sie ihren enormen Busen besprengt hatte, diesen Busen, der schon zu unserer Schulzeit überdimensional gewesen war und unsere Gymnasiastenfantasie beflügelt hatte.
Das alles mag mein Versäumnis erklären, aber es entschuldigt es nicht.
Keine Dunkelheit, keine mehr oder minder mollige Damenhand, kein Parfumduft und erst recht kein Busen, ganz gleich wie groß und fantasiebeflügelnd, darf einen Kriminalbeamten – und noch dazu einen Mitarbeiter der Mordkommission – davon abhalten, zu jeder Zeit wachsam zu sein.
Ich könnte natürlich weiter anführen, daß ich ja gar nicht im Dienst war. Doch auch das zieht nicht, denn unsereiner ist immer im Dienst, wenn es gilt, Verbrechen zu verhüten – genauso wie der Arzt, der auch allzeit bereit sein muß, ein blutiges Knie zu verbinden, einen kollabierten Kreislauf wieder in Gang zu setzen oder ein versehentlich verschlucktes Dessertmesser aus einer Kehle zu angeln oder …
Apropos: Das Messer, mit dem Georg Tecklenberg (in meinem Beisein) getötet worden war, ragte schräg aus seinem breiten Rücken und war mit Kraft, Geschick und offensichtlichen anatomischen Kenntnissen geführt worden. Denn es hatte den stattlichen Georg so schnell ins Jenseits befördert, daß auch die links neben ihm sitzende Erna Probiehl nichts – außer einem tiefen Atemzug oder Seufzer – bemerkt hatte.
Erna war übrigens die erste, die schrie, als das Licht wieder angeknipst wurde.
Sie schrie grell und spitz und so anhaltend, daß wir alle nicht gleich erkannten, warum sie schrie und zunächst von dem Geschrei fasziniert waren und dachten, sie habe einen Schreikrampf … aber es war nur der Schock, der sich dann auch bald löste und in ein atemlosstammelndes Stöhnen überging.
Ich übernahm, als ich erkannte, was passiert war, sofort das Kommando. Es ist eine alte Berufsgewohnheit und -erfahrung, daß in solchen ungewöhnlichen Situationen mit Demokratie wenig auszurichten ist.
Man kann nicht anfangen zu diskutieren, was nun geschehen soll, wenn es gilt, schnell Spuren zu sichern, vielleicht ein Motiv zu finden, den Täter zu ermitteln und so weiter …
Das ist wie beim Segeln. Wenn da plötzlich eine Bö kommt oder ein Sturm losbricht, kann die Crew auch nicht darüber reden und abstimmen, welches Segel gerefft, welcher Kurs gesteuert oder ob geankert werden soll oder nicht.
Also sagte ich in die allgemeine Verwirrung mit erhobener Stimme:
«Mal herhören, Herrschaften!» – und fuhr, als zu meinem Erstaunen tatsächlich im Handumdrehen Ruhe eintrat, etwas leiser, aber sehr bestimmt fort:
«Ihr wißt ja alle, daß es mein Job ist, in solchen Fällen die richtigen Maßnahmen zu treffen. Und das werde ich jetzt versuchen zu tun, bis die zuständigen Kollegen von der hiesigen Mordkommission da sind. Also geht bitte alle sofort wieder auf eure Plätze – außer Erna, der ich nicht zumuten will, sich neben den armen, toten Georg zu setzen. Setz dich hier auf meinen Platz, Erna, so. Und keiner verläßt den Raum. Und keiner sagt ein Wort – außer auf meine Fragen. Und keiner verliert die Nerven, wenn ich bitten darf. Und niemand verändert irgendwas hier im Clubzimmer. Niemand faßt den Toten an – aber das ist wohl überflüssig zu sagen … Ist das klar?»
«Ja», sagten einige. Andere nickten verstört. Zwei der Frauen weinten in ihre Taschentücher, leise, aber unaufhaltsam.
Ludwig Mick, der den Projektionsapparat bedient hatte, wollte die Kassette mit den Farbdias herausnehmen.
«Stopp!» rief ich. «Nichts wird verändert, hab ich gesagt, Ludwig!»
Ludwig Mick gehorchte erschrocken.
Ich ging zum Telefon, das auf einem Tischchen an der Seite stand, hob den Hörer ab und wählte. Dabei behielt ich die ganze Gesellschaft, alle elf, im Auge – und zwar tat ich das betont, damit sie nicht anfingen, meine mühsam aufgebaute Autorität in Frage zu stellen.
Das Telefon war mit der Portiersloge des Hotels verbunden.
«Hier Hotel Deutsches Haus, guten Abend», schnarrte der Portier.
«Hier ist der Clubraum», sagte ich, «Kommi – äh – Klipp am Apparat. Bitte sorgen Sie dafür, daß niemand – kein einziger – jetzt hier hereinkommt, klar? – Und geben Sie mir eine Amtsleitung, schnell, bitte!»
«Was … was ist denn …?» fragte der Portier.
Ich antwortete nicht, sondern legte auf.
Gleich darauf klingelte der Apparat. Ich hob ab, hatte das Amtszeichen und wählte die Notrufnummer. Dem Mädchen, das sich da meldete, sagte ich meinen Dienstgrad und Namen und bat, mich mit der Mordkommission zu verbinden. Das klappte sehr schnell. Ich kannte den Kollegen, der am Telefon war, nicht. Seit sieben Jahren war ich nicht hier in Endwarden gewesen – woher sollte ich wissen, wie die hiesige Kripodienststelle besetzt war.
«Mord?» fragte der Kollege.
«Eindeutig», sagte ich.
«Wir kommen», sagte er, «aber die Spezialisten sitzen in der Kreisstadt. In Olders. In etwa dreißig, fünfunddreißig Minuten sind wir da. Daß keiner was anrührt in der Zwischenzeit, bitte!»
«Hab ich mir gedacht, daß Sie das hier auch so machen», sagte ich spöttisch.
«’tschuldigung …», erwiderte er verwirrt.
«Bitte sehr», gab ich zurück und legte auf.
Meine elf Klassenbrüder und -schwestern sahen mich stumm, zum Teil fast ehrfürchtig an. Der zwölfte, Georg Tecklenberg, konnte nicht mehr ehrfürchtig gucken. Er saß schwer in seinem Sessel und sah aus, als schliefe er mit offenen Augen. Ein dünner Speichelfaden zog sich aus seinem linken Mundwinkel auf das Revers seines teuren Nadelstreifenjacketts. Die elf anderen aber blickten wirklich alle zu mir auf und mich an.
Es hat schon sein Gutes mit dem deutschen Obrigkeitsglauben. Wenn einer sich hierzulande Autorität anmaßt und wenn er sie überzeugend, von Titel oder Dienstgrad unterstützt proklamiert, dann hat er sie auch gleich.
Wenn die Autorität gar eine Uniform trägt, beginnt selbst bei den sogenannten Intellektuellen das Denkvermögen ins Wackeln zu geraten.
Dreißig Minuten sind eine lange Zeit, wenn man sie in Gegenwart eines Toten verbringen muß, der eben noch ein lebendiger Zweizentnermann war, gelacht und geredet hat und nun auf schaurige Weise ums Leben gekommen dasitzt …
Ich überlegte krampfhaft, was zu tun sei, um keine Massenhysterie aufkommen zu lassen, gegen die auch die Autorität meines Berufes möglicherweise machtlos sein würde.
Wir konnten ja angesichts des toten Georg Tecklenberg, in Erwartung der Mordkommission nicht unsere harmlos-alberne, flachsige Konversation weiterführen, die wir seit Beginn des Klassentreffens geführt hatten.
Dieses idiotische Klassentreffen. Das vierte in vierzig Jahren, initiiert und organisiert von Grethe Kobernuss, der alten Jungfer, die durch allerlei Erbschaften reich geworden war und noch immer in der kleinen Stadt an der Küste wohnte, in der wir zusammen die harten Bänke des Gymnasiums gedrückt hatten, das damals Schlageter-Schule geheißen hatte und heute, weil der Schlageter nicht mehr als Held geführt wurde, brav Schiller-Gymnasium hieß … was für Schiller eine zweifelhafte Erb-Ehre bedeutete.
Grethe Kobernuss hatte schon die ersten Klassentreffen gemanagt, weil sie mit ihrem verplemperten Leben und vielen Geld nichts anderes zu tun wußte, als die Vergangenheit wieder heraufzubeschwören, die sie liebte …
Warum schimpfte ich eigentlich?
Ich hätte ja nicht herzufahren brauchen!
Aber da saß ich nun, weil ich einfach neugierig gewesen war, saß zwischen den übriggebliebenen zwölf – nein, jetzt nur noch elf von sechsundzwanzig Ehemaligen und hatte zu allem Überfluß einen eben erstochenen Klassenkameraden verantwortlich am Halse … wenigstens so lange, bis die Kollegen aus der Kreisstadt kamen.
Wo blieben die denn, zum Teufel?
Ich sah auf die Uhr. Es waren erst drei Minuten vorbei. Dreißig bis fünfunddreißig würden sie brauchen, um hier zu sein, hatte der Kollege gesagt.
Ich nahm die Samtdecke vom Konzertflügel ab, der in der Ecke des Clubzimmers stand, und deckte sie behutsam über Georg Tecklenbergs Leiche. Ein bißchen Staub wirbelte auf. Für einen Moment hatte ich die absurde Vorstellung, Tecklenberg müsse niesen unter der staubigen Flügeldecke …
«Hat irgendeiner von euch während Ludwigs Lichtbildervortrag irgend jemanden in diesen Raum hereinkommen und – oder hinausgehen sehen?» fragte ich. «Überlegt mal genau!»
«Nein, ich nicht», sagte Ludwig Mick, «aber ich habe auch nicht aufgepaßt …»
«Nein, nein … ich auch nicht!» murmelten einige andere. Der Rest schüttelte die Köpfe. Erna Probiehl weinte wieder.
«Mir ist so schlecht», sagte Käthe Horn.
Sie war wirklich ganz blaß. Es schien ihr tatsächlich nicht gutzugehen. Sogar ihre kunstvolle Frisur war in Unordnung.
«Wenn es länger dauert», meinte Joachim Kress schüchtern, «dann könnten wir uns vielleicht wenigstens irgendwas bestellen. Einen Kaffee oder Cognac … oder? Geht das nicht, Leo?»
Dagegen war nichts einzuwenden.
Ich drückte auf die Bedienungsklingel. Wir warteten schweigend. Nach zwei, drei Minuten kam der alte Kellner hereingeschlurft, der uns auch vorhin bedient hatte. Der graugesichtige, gebückte Mann, dessen Gesicht man die schmerzenden Füße ansah, warf einen Blick auf die zugedeckte, bewegungslose Gestalt vorn im Sessel, runzelte kurz die Stirn, sah mich schräg an, sagte aber nichts.
Vielleicht glaubte er, wir spielten eine Art Gesellschaftsspiel, «Blinde Kuh» oder «Wer hat Angst vorm schwarzen Mann» oder «Ich sehe was, was du nicht siehst»… oder so was.
Wir gaben unsere Bestellungen auf. Sieben bestellten Cognac, zwei Kaffee. Ich einen doppelten Korn. Erna Probiehl wollte nichts.
Der alte Kellner wandte sich zu dem toten Tecklenberg und sprach die bewegungslose Gestalt unter der Samtdecke an:
«Und der Herr …?» fragte er.
«Der Herr trinkt nichts», sagte ich und mußte mir auf die Zunge beißen, um nicht «… mehr» hinzuzufügen.
Der Alte humpelte hinaus. Ich lief ihm nach.
In der Tür, die vom Clubraum zur Hotelhalle führte, holte ich ihn ein.
«Bitte schicken Sie mir Ihren Chef», bat ich.
«Ist was nicht in Ordnung?» fragte er mit ängstlich zwinkernden Augen.
«Nein – alles okay!» sagte ich. «Aber ich muß ihn trotzdem möglichst schnell sprechen!»
Der Kellner nickte und ging.
Ich weiß nicht, was mich auf den Gedanken brachte – jedenfalls sagte ich zu Ludwig Mick, der neben dem Projektor hockte und ein Gesicht machte, als seien seine Dias an Georg Tecklenbergs Tod schuld – ich sagte also:
«Wie viele Bilder waren das, Micky?»
«Achtundzwanzig», gab er zurück.
«Laß sie noch mal durchlaufen, bitte – und zwar, wenn es geht in der gleichen Reihenfolge wie vorhin», ordnete ich an, ohne eigentlich, wie gesagt, einen Grund für diese Anordnung zu haben, außer dem Wunsch, irgendwie die Zeit bis zum Eintreffen der Kollegen zu überbrücken. «Geht das?» fragte ich.
«Ja, das geht», sagte Mick, «ich hab sie ja so wieder im Kasten, wie sie vorhin auch waren. Das läuft automatisch».
«Aha», brummte ich. «Also denn mal los!»
«Mach ich», sagte Mick beflissen.
«Aber das Licht bleibt an!» rief Erna entsetzt.
«Sonst schrei ich!» drohte Erika Schuhbier.
Wir ließen das Licht der Wandlampen, die wie Kerzen geformt waren und paarweise rechts und links an den Wänden hingen, an. Nur das zu helle Deckenlicht schaltete ich aus, sonst hätte man die Dias kaum sehen können.
Ludwig Mick schob die Kassette ein und warf das erste Dia an die Wand.
Er hatte sich in wochenlanger, mühevoller Arbeit Fotos aus unserer Schulzeit besorgt und diese Diapositive daraus machen lassen. Das mußte schwierig gewesen sein, denn er hatte alte Alben zu Dutzenden durchblättern, in Archiven stöbern und alle anschreiben müssen, die vielleicht noch Aufnahmen aus der Zeit vor vierzig und mehr Jahren besaßen. Die Ausbeute war nicht allzu groß geworden.
Micks Lichtbilderfolge sollte ein Höhepunkt des Klassentreffens werden – und war es ja nun auch tatsächlich geworden, auf unvorhergesehene und schreckliche Weise, aber bestimmt ein Höhepunkt, den keiner je vergessen würde.
Die Bilder hatten bei mir sehr wechselnde Gefühle ausgelöst. Einige fand ich komisch, andere tief deprimierend.
Das Foto von Hannchen Meisel und Karl Grobleben, das die beiden auf einem Schulfest als Konzertduo zeigte – er am Klavier, sie mit Geige –, war umwerfend komisch, zumal wenn man die zwei heute sah: seit sechsunddreißig Jahren verheiratet, ganz offenbar glücklich … und immer noch: er am Klavier, sie mit Geige.
Vorhin, vor dem Lichtbildervortrag Mickys, vor Tecklenbergs tristem Tod, hatten die uns noch eine Schubertsonate oder so was vorgespielt – immer noch komisch, aber nun mit einem rührenden Beigeschmack, der einem das Lachen nahe an die Tränen bringen konnte.
Das Klassenfoto von der Abiturfeier 1940. Sechzehn Jungen und zehn Mädchen. Von den sechzehn Jungen waren sieben in dem Scheißkrieg ums Leben gekommen. Auch Wolfgang, mein bester Freund. Und einer war seit zweiundvierzig in einer Irrenanstalt, weil er bei einem Luftangriff verschüttet und erst nach drei Tagen ausgebuddelt worden war – weißhaarig mit 21 und wahnsinnig für immer …
Und das Foto, auf dem Hermann Ulrici und Georg Tecklenberg zu sehen waren – beide in Hitlerjugend-Uniform –, als sie mit anderen begeisterten Jung- oder Altnazis einen Zug verhafteter «Staatsfeinde» zum Bahnhof begleiteten.
Als Micky dieses Bild vorhin im Projektor hatte aufleuchten lassen, war das Gelächter im Clubraum verstummt. Nicht mal Erika Schuhbier hatte gekichert.
Hermann Ulrici war tot. Bauchschuß am Donezbecken, glaub ich, vor fast vierzig Jahren. Georg Tecklenberg war auch tot. Seit einer Viertelstunde.
Die Dias – diesmal nicht mit «Ah!» und «Oh!» und «Weißt du noch?» kommentiert, liefen das zweite Mal ab. Ich sah sie mir an und betrachtete – an der Wand stehend – nebenbei die Gesichter meiner Klassenschwestern und -brüder.
Wer war aufgestanden und hingekrochen und hatte Tecklenberg das Messer in den Rücken gestoßen?
Und warum?
Gerade in dem Augenblick, als Ludwig Mick das schreckliche Bild in den Projektor schob, das die Verhafteten mit den zwei uniformierten Klassenkameraden zeigte, klopfte es an die Clubraumtür.
«Laß das Bild stehen!» befahl ich und ging hin, um zu öffnen. Der Wirt, ein dicker Mittsechziger, mit dem rotblauen Teint, der von viel Bier und noch mehr Schnaps stammt, stand davor.
«Sie wollten mich sprechen?» fragte er.
«Ist irgendwas passiert?»
«Kommen Sie herein!» sagte ich.
Er kam herein. Das böse Bild war immer noch auf der Leinwand.
«Ach du liebe Güte!» sagte er leise. «Wo haben Sie denn das aufgetrieben!»
«Herr Mick hat es ausgegraben», sagte ich.
«Aus dem alten Zeitungsarchiv», erklärte Micky.
«Ich erinnere mich noch ganz genau …» sagte der Wirt.
Die Tür ging auf. Der Kellner kam mit einem Tablett voll Kaffeekännchen, Tassen und Gläsern herein.
Er stand neben dem Wirt und mir.
«Du mußt dich doch auch noch genau an die Szene erinnern, Franz», sagte der Wirt. «Warst du da nicht dabei?»
«Ja …» sagte der alte Kellner mit heiserer Stimme, «in der zweiten Reihe. In der Mitte. Das bin ich.»
Ich sah mir das Bild an. Der Beschriebene war ein junger blonder Bursche in einem gestreiften Kittel – wie Schlachter sie tragen. Er machte ein erstauntes Gesicht, soweit ich das erkennen konnte. In der rechten Hand hatte er einen Pappkarton. «PERSIL» stand darauf.
Ähnlichkeit mit unserem alten Kellner hatte er nicht.
«Der in dem gestreiften Kittel?» fragte ich.
Der alte Kellner nickte.
Die Gläser und Tassen auf seinem Tablett klirrten, so sehr zitterte er.
«Sie haben mich morgens direkt aus dem Betrieb geholt», sagte er leise. «Ich war Schlachter bei Paul Körner, in der Fleischwarenfabrik. Nur meine paar privaten Klamotten durfte ich mitnehmen. Umziehen durfte ich mich nicht …»
«Und weshalb …?» wollte ich wissen. «Warum hat man Sie abgeholt?»
«Wir hatten heimlich Fleischabfälle zu den polnischen Gefangenen geschafft, die draußen an der Schleuse im Lager wohnten und halb krepiert waren vor Hunger. Tecklenberg hat uns beobachtet und angezeigt und dann –»
Er brach ab.
«Das wußte ich ja gar nicht …» sagte der Wirt.
«Meinen Kumpel haben sie schon in der Gestapokaserne totgeschlagen», fuhr der Alte fort. «Ich habe fast vier Jahre gesessen. Zum Schluß war ich in einer Strafkompanie. Wir mußten das Warschauer Ghetto aufräumen … als Schlachter wollte ich danach nicht mehr …»
«Aber Sie haben den Umgang mit Messern nicht verlernt?» fragte ich.
«Nein», sagte er. «Mit guten Messern ist das wie mit tiefem Haß. Sie bleiben lange scharf, Herr Kommissar!»
Er setzte sein Tablett auf dem Flügel ab und sah mich an.
«Es tut mir leid», sagte ich. «Aber ich muß Sie festnehmen!»
Das Bild auf der Leinwand begann plötzlich zu wackeln und sah aus, als würde es flüssig.
Die Konturen verliefen.
«Mein Gott!» sagte Ludwig Mick und schaltete den Projektor aus.
Erna Probiehl fing wieder an zu schreien …
Aus Andrea Abelings Anwaltspraxis
Die ersten fünf Berichte
1 Ein sehr gut aussehender Taschendieb
Aus mehreren Gründen werde ich diese Geschichte mit absoluter Sicherheit nie vergessen:
Erstens war Konrad, genannt Conny, Maibach mein erster Kunde – oder richtiger: Mandant. Zweitens war er ein wirklich unheimlich gut aussehender und ausgesprochen charmanter Bursche. Drittens habe ich mit ihm – besser: für ihn meinen ersten Prozeß gewonnen, und viertens hat er mir eine Überraschung bereitet, die mich beinahe vom Schreibtischsessel gekippt hätte.
Das war allerdings ein recht wackeliger Schreibtischsessel, aus zweiter oder dritter Hand, mit nur drei Streben und kleinen Rollen drunter, denn ich besaß nicht mehr genug Geld für einen der großen, protzigen Chefzimmerschreibtischsessel, und mein Kredit bei der Bank war auch zu sehr strapaziert, als daß ich für solch einen Vollrindlederimponierstuhl noch zweitausend Mark hätte ausgeben können.
Die Einrichtung der Praxis hatte mich ohnehin an den Rand der Schlaflosigkeit gebracht.
Allein für das Messingschild unten neben der Haustür:
DR. ANDREA ABELING
RECHTSANWÄLTIN
SPRECHSTUNDEN MO–FREI 10–12
UND 15–18UHR
ODER NACH VEREINBARUNG
– allein für das Schild war ich fast dreihundert Mark losgeworden, weil der Gauner von Schildermacher mir nur fürs Anbringen 65 Mark berechnet hatte plus Mehrwertsteuer.
Aber ich konnte mich schließlich nicht gut selbst mit Bohrmaschine, Dübeln und Schraubenzieher vor den Eingang stellen und das Ding anmontieren.
Da hätte ich mal die Herren Kollegen sehen wollen, deren vornehme Schilder schon neben dem Eingang prangten. Alles Akademiker aus meiner Branche und ein paar Ärzte dazu. Reputationsbewußte Leute. Sogar zwei von Adel dabei …
Und mit Jochen war ich gerade verquer, weil er meine Idee, eine eigene Praxis aufzumachen statt ihn zu heiraten und seine – besser: unsere – Kinder großzuziehen, äußerst unpassend fand. Ich wolle erst mal mit dem mühsam Gelernten selber was anfangen, hatte ich ihm erklärt, und er hatte mich mit Chauvi-Spöttereien geärgert, die eigentlich auch nicht zu ihm paßten, na ja …
Wenn ich es mir richtig überlege, war mein Entschluß okay. Nicht wegen der «Selbstverwirklichung» oder so was – aber wir hätten zusammen nie … doch halt, es geht jetzt nicht um Jochen und unsere Beziehung und das eindrucksvolle Messingschild vor der Haustür – es geht um Conny Maibach, meinen ersten Mandanten.
Man soll auch bei Erinnerungen – und wenn sie noch so aufregend sind – immer die Reihenfolge beachten und einhalten …