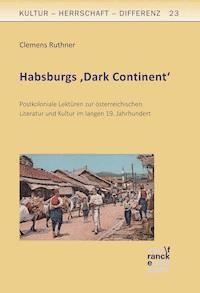
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kultur – Herrschaft – Differenz
- Sprache: Deutsch
Was kann die Germanistik als Literatur- und Kulturwissenschaft von den sogenannten ,Postcolonial Studies' in Bezug auf das imperiale Österreich im langen 19. Jahrhundert von 1815 bis 1914 lernen? Es ist ein meist unhinterfragtes Mantra der Habsburg-Forschung, dass die k.u.k.-Monarchie keine Überseekolonien besaß und in ihrem inneren Identitätsmanagement richtungsweisende Ansätze für den Multikulturalismus der Gegenwart aufwies: Doch ist nicht die Okkupation Bosnien-Herzegowinas 1878 (und die Annexion 1908) - die letzte fatale Expansion des niedergehenden Reiches - in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit der britischen Herrschaft über Indien? Die vorliegende Monografie geht nicht nur dieser Frage nach. Im Anschluss an eine ausführliche theoretische Diskussion existierender germanistischer und anderer Auseinandersetzungen mit dem Kolonialismus (z. B. anhand von Kafkas "Strafkolonie") sowie einer kritischen Neubestimmung der Imagologie als Methodik literatur- und kulturwissenschaftlicher Forschung werden auch andere Fallstudien präsentiert. Sie zeigen koloniales Fantasieren und Begehren anhand zentraler und bisher in dieser Hinsicht unerforschter deutschsprachiger Literatur aus dem alten Österreich auf: Franz Grillparzers Trilogie "Das goldene Vließ" und seine Reisetagebücher sind eine interkulturelle Odyssee durch das später so genannte ,Kakanien'; Peter Altenbergs "Ashantee" entspringt einem Kontakt mit einer afrikanischen 'Völkerschau' im Wiener Prater 1896; Alfred Kubins "Die andere Seite" (1908) erschließt sich als koloniale Allegorie auf die Donaumonarchie in ihrer Spätphase. Im Anschluss an eine kritische Zusammenschau der Befunde soll abschließend auch das Verhältnis von ,postkolonial' und ,postimperial' in Bezug auf das posthabsburgische Zentraleuropa erörtert und die Forschungen des Autors in den letzten 15 Jahren konklusiv zusammengefasst werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clemens Ruthner
Habsburgs ‚Dark Continent‘
Postkoloniale Lektüren zur imperialen Literatur und Kultur Österreichs im langen 19. Jahrhunderts
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2018 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.francke.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-7720-0053-9
Inhalt
0.VorWort & DankSagung
The starting-point of critical elaboration is the consciousness of what one really is […] as a product of the historical processes to date, which has deposited in you an infinity of traces, without leaving an inventory. (Antonio Gramsci)1
Als ich im Februar 1991 meine erste Stelle als österreichischer Auslandslektor an der staatlichen Universität von Budapest (ELTE) antrat, hieß die Straße mit den stalinistischen Wohnblocks, wo ich für ein Semester wohnte, noch ein paar Wochen lang Lumumba utca, bevor sie umbenannt wurde und eine IKEA-Filiale in unmittelbarer Nähe aufmachte. Dies ist in meiner Erinnerung nicht nur ein drastisches Bild für die sog. ‚Wende‘ in Ungarn geworden, sondern auch ein erster Anreiz, mich mit dem Namen2 hinter der Straße und damit der Geschichte des Kolonialismus, seinem Ende bzw. Fortbestehen zu beschäftigen.
Anders als viele Österreicher/innen und andere Zentraleuropäer/innen meiner Generation („X“), die ein halbes Jahrhundert nach dem Ende der Habsburger Monarchie geboren wurden, verbindet mich aber mit meinem Untersuchungsgegenstand „k.u.k. post/kolonial“ sonst kaum eine tiefer gehende biografisch-familiäre Wurzel. Das einzige, was ich anführen könnte, ist, dass mein Großvater Alfons Leopold in der Zwischenkriegszeit eine Wiener Kolonialwarenhandlung (für Kaffee und Tee aus Asien) betrieb: eine merkwürdige Bezeichnung in einem Land ohne Kolonien, die im Verbund mit den obligaten Orientteppichen in der elterlichen Wohnung und der damals obligaten Karl-May-Lektüre meine kindliche Phantasie immer wieder beschäftigte.
Es war jedoch erst meine Zeit als Lektor und Doktorand in Belgien (1993–2003), die meine Wahrnehmung für den Kolonialismus gerade der kleineren Staaten Europas, seine Bilderwelten (wie z.B. das Afrika-Museum Tervuren bei Brüssel) und realen wie globalen Nachwirkungen nachhaltig schärfte – ebenso wie für die innere Kolonisierung, die häufig stattgefunden hat (Beispiel: Flandern). In Belgien kam ich auch zum ersten Mal mit den Gründungsschriften der Postcolonial Studies in Kontakt: jener „Holy Trinity“ (Richard Young) von Said, Bhabha und Spivak, für die sich einige jüngere Kolleg/inn/en an der Anglistik- und Romanistik-Abteilung unserer Universität in Antwerpen zu interessieren begannen und eine Werkgroep Postcoloniale Literaturen einrichteten.3 In diesem Kontext boten sich auch Frederic Jamesons Motto „always historicize“4 und die Arbeiten des Birminghamer Centres for Cultural Studies rund um Stuart Hall zur Moderation einer allgemein um sich greifenden dekonstruktivistischen Textherme(neu)tik an.
Anlässlich einer Lektor/innen-Tagung lernte ich dann im Juni 1998 auf einem Korridor der Wiener Universität Wolfgang Müller-Funk kennen, der kurz darauf als Gastprofessor an eben jene Universität Birmingham berufen werden sollte. Ich kam mit ihm ins Gespräch, dessen Gegenstand die zu jener Zeit in der österreichischen Germanistik nur zögerlich stattfindende kulturwissenschaftliche Weitung des Faches war, die bekanntlich auch zu diversen Abstoßungsreaktionen führte. Es sollte aber mehr werden als ein typischer academic rant, wie er immer häufiger geworden ist nach dem economic (down)turn an den europäischen Universitäten: Wenig später waren wir uns nämlich auch in unserem Interesse für postkoloniale Theoriebildung internationaler Prägung einig – und dass es ein wohl reizvolles Unterfangen wäre, deren zumeist im kolonial-imperialen Kontext Großbritanniens gewonnenen Ansätze und Erkenntnisse, die im Wesentlichen in einer speziellen Lesart von Literatur und anderen kulturellen Texten bestehen, versuchsweise auf die Spätzeit der multiethnischen Habsburger Monarchie anzuwenden.
Die Folgen sind bekannt: Aus unserer Begegnung heraus entstanden zwei internationale Wiener Forschungsprojekte,5 die die Textkulturen Österreich-Ungarns zwischen 1867 und 1918 analysierten, die vorliegende Buchreihe Kultur – Herrschaft – Differenz beim Tübinger Francke-Verlag, und schließlich Kakanien revisited, ein selbst entwickeltes label für das Gesamtvorhaben, das nicht nur den Titel für den ersten Sammelband unsres Teams abgab,6 sondern auch für ein von Peter Plener, Ursula Reber sowie Lajos und János Bekesi mit Geldern des österreichischen Wissenschaftsministerium aus der Taufe gehobenes Internet-Publikationsprojekt7 an der Universität Wien, das sich bis zum Versiegen jener Geldquellen als überaus erfolgreich erweisen sollte. Im Umfeld bildete sich rasch und informell ein zwar zentraleuropäisch geprägtes, aber doch dezentral rhizomatisches Forschungsnetzwerk, das auch mit anderen Teams zusammenarbeitete – wie etwa mit dem SFB Moderne an der Karl-Franzens-Universität Graz8 – und ein kurzlebiges Wiener Doktoratskolleg9 gründete; vor allem aber wurden wissenschaftliche Tagungen und Workshops abgehalten, und als Folge eine Vielzahl von Sammelbänden, Monografien und Aufsätzen veröffentlicht – in Buchform wie auch im Internet.10
Die geografische und sprachliche Streuung meiner eigenen Beiträge zum Thema in den fünfzehn Jahren, die seither vergangen sind, hat mich nun – im Kontext der zunehmenden Aktivitäten einer postkolonialen Germanistik11 in Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem englischsprachigen Raum – dazu gebracht, die alten Fäden wieder aufzugreifen und sie zu einem vorläufigen Abschluss zusammenzuführen. Es war meine Ambition, sie trotz der Irrungen, Wirrungen und Limitationen eines neoliberalen Uni-Betriebs, der selbst nolens volens Züge von Kafkas Strafkolonie angenommen hat, zu überdenken, ggf. zu revidieren und zu einem Buch zu verweben, das hiermit vorliegt.
Mein herzlicher Dank für inhaltliche Anregungen, logistische und sprachliche Hilfeleistungen sowie notwendige Korrekturen gilt in diesem Zusammenhang neben Wolfgang Müller-Funk, dem mein wissenschaftlicher Werdegang wesentliche Impulse schuldet, folgenden Kolleg/inn/en und Freund/inn/en in alphabetischer Reihenfolge:
Balázs Apor (Dublin), Katie Arens (Austin), Ulrich Bach (Connecticut), Karyn Ball (Edmonton), Carl Bethke (Tübingen), Anil Bhatti (Neu-Delhi), Anke Bosse (Namur/Klagenfurt), Emil Brix (Wien), Milka Car (Zagreb), Moritz Csáky (Wien), Stanley Corngold (Princeton), Mary Cosgrove (Dublin), Raymond Detrez (Gent), Jeroen de Wolf (Berkeley), Robert Donia (San Diego), Wolfram Dornik (Graz), Davor Dukić (Zagreb), Anne Dwyer (Pomona), Jozo Džambo (München), Alfred Ebenbauer † (Wien), Katrin Eberbach (Dublin), Daniela Finzi (Wien), Ana Foteva (Skopje), Dariusz Gafijczuk (Newcastle), Karl-Markus Gauß (Salzburg), Andreas Geyer (München), Kathleen Gijssels (Antwerpen), Rüdiger Görner (London), Deniz Göktürk (Berkeley), Martin A. Hainz (Baden), Endre Hárs (Szeged), Jonathan Locke Hart (Edmonton/Shanghai), Róisín Healey (Galway), Waltraud Heindl (Wien), Friederike Heymach (Wien), John Paul Himka (Edmonton), Miranda Jakiša (Berlin), Reinhard Johler (Tübingen), Pieter Judson (Florenz), Tomek Kamusella (St. Andrews), Amália Kerekes (Budapest), Alfrun Kliems (Berlin), Kristin Kopp (Columbia), Albrecht Koschorke (Konstanz), Alan Kramer (Dublin), Wynfrid Kriegleder (Wien), Florian Krobb (Maynooth), Stephan Lehnstaedt (Warschau), Joep Leerssen (Amsterdam), Jacques Le Rider (Paris), Michael Limberger (Gent), Vivian Liska (Antwerpen/Jerusalem), Tomislav Longinović (Madison/Rovinj), Dagmar Lorenz (Chicago), Mike Lützeler (St. Louis), Christian Marchetti (Tübingen), Graeme Murdock (Dublin), Ivana Nevesinjac (Sarajevo), Nina Newell-Osmanović (Sarajevo), Jane Ohlmeyer (Dublin), Christine Okresek & Zlatko ‚Ola‘ Olić (Opatija), Martin Pammer (Sarajevo), Peter Plener (Wien), Brigitte Pfriemer-Sitzwohl (Brüssel), Vasilis Politis (Dublin), Jon Cho-Polizzi (Berkeley), Christian Promitzer (Graz), Ursula Prutsch (München), Sabrina Rahman (Leeds), Usha Reber (Wien), Markus Reisenleitner (Toronto), Stephan Resch (Auckland), Diana Reynolds Cordileone (San Diego), Per Anders Rudling (Karlstad/Singapur), Irena Samide (Ljubljana), Derek Sayer (Calgary), Tamara Scheer (Wien), Klaus Scherpe (Berlin), Wendelin Schmidt-Dengler † (Wien), Naser Šečerović (Sarajevo), Andrea Seidler (Wien), Rob Shields (Edmonton), Stefan Simonek (Wien), Lejla Sirbubalo (Wien/Sarajevo), Džemal Sokolović (Bergen), Malcolm Spencer (Birmingham), Rok Stergar (Ljubljana), Erhard Stölting (Potsdam), Daniela Strigl (Wien), Elaine Tennant (Berkeley), Dirk Uffelmann (Passau), Stijn Vervaet (Oslo), Birgit Wagner (Wien), Hilde Zaloscer † (Wien), Klaus Zeyringer (Angers/Pöllau) und Yvonne Živković (New York/Cambridge).
Bei der Erschließung bosnischer Quellen haben mich meine wissenschaftlichen Hilfskräfte Asja Osmančević und Vikica Matić 2011 vor Ort in Sarajevo tatkräftig wie sprachmächtig unterstützt; große Inspiration kam auch von meinen bosnischen Studierenden in Sarajevo und Dublin über die Jahre hinweg. Ebenso muss ich mich für die kritische Lektüre von Rohfassungen meiner Buchkapitel bei Anna Babka (Wien), Marijan Bobinac und Ivana Brković (Zagreb), Gilbert Carr (Dublin), Hannes Leidinger (Wien), Martin Gabriel (Klagenfurt) und Vahidin Preljević (Sarajevo) ganz besonders bedanken – sowie für das Endlektorat bei Isabel Thomas (Halle/Dublin). Daneben schulde ich auch folgenden Institutionen Dank: der Filozofski Fakultet der staatlichen Universität von Sarajevo, dem German Department der UC Berkeley, der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien, der UB Wien und ihren angeschlossenen Germanistik- und Anglistik-Fachbibliotheken, der bosnisch-herzegowinischen Nationalbibliothek in Sarajevo, sowie dem Long Room Hub Arts & Humanities Research Institute und dem Dept. of German Studies am Trinity College in Dublin.
Auch ohne zeitweiligen Ortswechsel wäre ein derartiges Projekt mental wohl nicht realisierbar gewesen – in diesem Sinne bin ich auch äußerst dankbar für den genius loci, der mich verschiedentlich, so z.B. als Gastprofessor in Bosnien und Kalifornien, umgab. Er ist wichtig für das geistige Überleben der ehemaligen Geisteswissenschaften, denn manchmal braucht auch unsereins Inspiration.
Als größter Anreiz für das Gelingen dieses Projekts erwies sich freilich, dass es im Leben noch wichtigere Anlässe als deadlines für Bücher gibt – wie z.B. eine Geburt. In diesem Sinn geht, last but not least, mein liebevoller Dank an Christina Töpfer und unsere Tochter Juli Ariane: dafür, dass sie da sind und mit mir Geduld haben. Ebenso an meine Mutter Sigrid Ruthner, ohne deren großzügige Unterstützung es wohl auch nicht möglich gewesen wäre, dieses Projekt erfolgreich abzuschließen.
Berkeley – Dublin – Graz – Opatija – Penk – Wien, 2015–2017
„Wir machen aber von dem Länderreichtum des Ich viel zu kleine oder enge Messungen, wenn wir das ungeheure Reich des Unbewußten, dieses wahre Innere Afrika, auslassen.“
(Jean Paul, Selina, 1827)
Teil A:Instrumentarium
A.0.BestandsAufnahmen:
Postkoloniale Zugänge in der (Österreich-) Germanistik – Forschungsstand & Projektskizze
Die Literatur Europas ist die eines Kontinents von Kolonisatoren. Meistens ist der Kolonialismus in der Literatur ‚Hintergrundphänomen‘, d.h. er wird nicht wahrgenommen, gehört zum selbst verständlichen Bestand des europäischen Weltbildes.1
1.Weiße Flecken am dunklen Kontinent: der Kolonialismus & Österreich
Das hier als Motto vorangestellte Zitat des Komparatisten Janós Riesz entstammt einem der ersten deutschsprachigen Sammelbände zum Thema Literatur und Kolonialismus aus dem Jahr 1983 – und es spricht paradigmatisch die selektive Wahrnehmung an, die das Phänomen lange umgab und teilweise immer noch umgibt. Die akademische Auseinandersetzung damit begann zwischen den 1950er und 1970er Jahren in Frankreich, Großbritannien und den USA unter dem Eindruck der weltweiten Dekolonisation – vor allem angesichts der Gräueltaten des Algerien- und Vietnam-Kriegs, aber auch durch die intellektuellen Interventionen eines Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre, einer Hannah Arendt u.a., durch die entstehenden britischen Cultural Studies und die sich später formierenden amerikanischen Postcolonial Studies.1 Die ideengeschichtliche Folie dafür lieferte die Imperialismus-Kritik der westlichen Linken vor allem der 1968er-Generation; aus ihr heraus sollte bald – zusammen mit neuen, postmarxistischen Begrifflichkeiten – eine spezielle Sensibilität für jene Form einer entmündigenden bzw. bevormundenden Übersee-Herrschaft unter dem trügerischen Vorzeichen der europäischen Moderne entstehen. Nicht nur in den ehemaligen Mutterländern, die sich mit zunehmender politischer Bedeutungslosigkeit bei gleichzeitiger Massenimmigration konfrontiert sahen, sondern v.a. auf dem Grundgebiet der neuen Supermacht USA sowie in einigen anderen ehemaligen Kolonien etablierten sich entsprechende Forschungseinrichtungen, wie z.B. in Indien die Subaltern Studies Group oder eine lateinamerikanische Spielart der Kulturtheorie. Schließlich erfasste diese zweite Welle einer internationalen Vergangenheits(selbst)bewältigung nach dem Zweiten Weltkrieg auch kleinere ehemalige Kolonialmächte wie Belgien, Portugal oder Italien, wenn auch zögerlich: werden doch die Verbrechen und das Scheitern des Kolonialismus immer noch gleichsam als Bildstörungen der eigenen nationalen wie kontinentalen Erfolgsgeschichte angesehen.
Auf der Europakarte eines neuen postkolonialen Bewusstseins blieben indes einige weiße Flecken zurück, darunter Österreich: „Forschungsgeschichtlich“, so moniert der Wiener Historiker Walter Sauer selbst erst nach der Jahrtausendwende,
ist die Frage nach dem Verhältnis der [Habsburger] Monarchie zur Kolonialproblematik zwar nur selten gestellt, aber um so häufiger beantwortet worden: Nein, über Kolonien habe Österreich-Ungarn nie verfügt, koloniale Ambitionen habe es nur am Rande gegeben, kolonialpolitisches Desinteresse gerade sei für das Verhalten von Österreichern in außereuropäischen Gebieten charakteristisch gewesen. […] Es entsprach einer in großbürgerlichen Kreisen um die Jahrhundertwende verbreiteten Tendenz, das Scheitern früherer Ambitionen auf ein ‚Kolonialreich‘ zur bewußten Zurückhaltung, zur moralischen Überlegenheit der Monarchie zu stilisieren. […] Gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber einer ‚Dritten Welt‘, die sich vom kolonialen Joch zunehmend emanzipierte, stellte sich [auch] das neue Österreich [= die Zweite Republik ab 1945, C.R.] als unbelastet dar.2
Die Habsburger Reich, d.h. jenes „Kaisertum Österreich“, das nach dem „Ausgleich“ von 1867 international unter dem Etikett von „k.u.k.“ (’kaiserlich-und-königlich’) bzw. als „Österreich-Ungarn“ firmierte, hatte in der Tat keine Übersee-„Schutzgebiete“ wie das benachbarte Deutsche Reich seit 1884: Aber ist nicht seine letzte territoriale Erweiterung nach Südosten hin (Bosnien-Herzegowina 1878/1908) nicht auch als Ersatzhandlung für jenes Zukurz- bzw. Zuspätkommen im internationalen Wettlauf des europäischen Kolonialismus zu verstehen – ebenso, wie vielleicht auch Galizien, die Bukowina und andere habsburgische Peripherien seit dem späten 18. Jahrhundert dafür in Betracht kämen? Und, allgemeiner gesprochen: Welche Spuren bzw. „Parallelaktionen“ hat der zeitgenössische Kolonialismus Europas im „politischen Unbewussten“ bzw. „sozialen“ Imaginären“3 der habsburgischen Kultur/en hinterlassen? Diese Fragen werden uns – unter Anderem – im Laufe dieses Buches beschäftigen.
Mit seiner Metapher vom „dark continent“,4 die unserer Monografie ihren Titel gab, meint Sigmund Freud freilich nicht jene verdrängte innere und äußere k.u.k. Kolonisierung,5 sondern „das Geschlechtsleben des erwachsenen Weibes“6 in seiner eigenen Kartografie der menschlichen Psyche – in die seine Lehre ebenso wie in das „Unbewusste“ generell mit uneingestanden kolonialen Wünschen vordrang.7 Das gendering ist evident: der Wiener Mann gibt sich als Entdeckungsreisender auf dem ‚dunklen Kontinent‘ der Frau. Wollte die Psychoanalyse hier nicht nur ihr Revier im wissenschaftlichen Wettrüsten ihrer Zeit – einer Nebenerscheinung des europäischen Imperialismus im 1900 – abstecken, sondern gleichsam auch ihre mentalen Schutzgebiete errichten (ähnlich wie der westliche Kolonialismus trachtete, nicht nur das materielle und soziale Außen der Menschen, sondern auch ihr psychisches Innen zu besetzen und zu manipulieren)?
Was uns im vorliegenden Buch beschäftigen soll, sind aber nicht die metaphorischen Expeditionen der Psychoanalyse, sondern wie gesagt ein anderer „dunkler Kontinent“ der Habsburger Monarchie. Auf einen blinden Fleck der Historiografie entrückt sind nämlich auch deren koloniale Begehrlichkeiten, bei denen die präsumptiven Kolonialherren und die von ihnen Beherrschten im selben Erdteil, ja sogar in unmittelbarer Nachbarschaft lebten, wie z.B. auf dem westlichen Balkan. Mehr oder weniger unbewusst sind auch jene kolonialen Phantasien, wie sie uns bis heute in literarischen Texten und anderen Zeugnissen der habsburgischen Kultur/en entgegentreten: manchmal implizit und verklausuliert, dann wieder erschreckend explizit, indem sie sich auf das eigene multiethnische Staatsgefüge beziehen oder dieses insgeheim in der überseeischen Projektion auf das Andere meinen.
Um dieses Verdrängte in den kulturellen Ordnungen „Kakaniens“ im langen 19. Jahrhundert wieder sichtbar zu machen, wird sich die vorliegende Monografie stichprobenhaft jenen kolonialen Vorstellungen und Praktiken in der hegemonialen österreichischen Kultur des Kaiserreichs widmen. Zunächst jedoch ist eine Bestandsaufnahme bestehender Zugänge zu unternehmen, anhand deren sich in einem weiteren Schritt unsere Forschungsfragen und methodologischen Herangehensweisen verdichten werden.
2.Kafka und kein Ende: eine Modellinterpretation (in) der Strafkolonie
„Es ist ein eigentümlicher Apparat“, sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohlbekannten Apparat. Der Reisende schien nur aus Höflichkeit der Einladung des Kommandanten gefolgt zu sein, der ihn aufgefordert hatte, der Exekution eines Soldaten beizuwohnen, der wegen Ungehorsam und Beleidigung des Vorgesetzten verurteilt worden war. Das Interesse für diese Exekution war wohl auch in der Strafkolonie nicht sehr groß. Wenigstens war hier in dem tiefen, sandigen, von kahlen Abhängen ringsum abgeschlossenen kleinen Tal außer dem Offizier und dem Reisenden nur der Verurteilte […].1
In der physischen Eindringlichkeit, die sie entwickelt, gehört Kafkas Erzählung In der Strafkolonie (1914) wohl zu seinen drastischsten Texten – geht sie doch buchstäblich „unter die Haut“2 (vgl. IDS38ff.). Sie scheint prädestiniert für postmoderne und dekonstruktive Lektüren, indem sie den Körper und die Schrift thematisiert,3 respektive die grausige – und doch ästhetische4 – Inskription der einen in den anderen durch eine Tätowierungs-„Schreibmaschine“,5 die die Aufsässigkeit eines Soldaten unverhältnismäßig grausam mit einem langsamen Tod bestraft. Mit seiner ‚subkutan‘-ornamentalen6 Niederschrift durch den „Apparat“ wird das reichlich willkürliche Gerichtsurteil – „Ehre deinen Vorgesetzten!“ (IDS35) – direkt in die archaisch anmutende und doch technologisch perfektionierte Schindung des Deliquenten umgesetzt, die nach stundenlanger Folter in dessen Exitus gipfelt (vgl. IDS41). Alexander Honold und andere haben auf „die allen Prinzipien der Gewaltentrennung spottende Kongruenz von Delikt, Gesetz, Urteil und tödlicher Strafe“ hingewiesen;7 Jean-Francois Lyotard spricht in Anlehnung an Artaud von einem „Theater der Grausamkeit“.8
Angesichts der vielfältigen „Einladungen zur Allegorese“ blieb indes im „inventory of traces“9 der früheren Kafka-Forschung das „koloniale Setting“ der Geschichte meist unbeachtet10 – und gerade dieser Bezugsrahmen ist es, der das Werk später in Anschluss an eine Arbeit von Walter Müller-Seidel (1986) zu einem Paradetext postkolonialer Lektüren11 für die Germanistik gemacht hat: Dessen „Traumlogik“ werde, so Paul Peters, zum „skandalösen ‚Rebus‘ des kollektiven, politischen Unbewußten“.12
Kafka fördert mit der Abfassung seines Textes im Oktober 1914, kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs,13 den „versunkene[n] und kollektive[n] Traum des Kolonialismus zutage, die ‚Leiche im Keller‘ der europäischen Metropolen“.14 Dies geschieht in einem Zeitalter, in dem die großen Kriegsverbrechen des westlichen Übersee-Imperialismus – wie die Niederschlagung der indischen Mutiny (1857), die belgischen Gräueltaten im Kongo (1888–1908) und der deutsche Vernichtungsfeldzug gegen die Herero und Nama in Südwestafrika (1904) – bereits geschehen sind und der Übergang zu einer neuen, weniger gewaltsamen Kolonialpolitik merkbar ist, die auf Identitätspolitik und nicht auf Formen der Sklaverei beruht.15
Einer realistischen Lektüre, die die Strafkolonie „kontrapunktisch“16 gleichsam oberhalb ihrer Allegorie-Angebote liest, erschlössen sich im Text also nicht nur ein „Rechtsritual“,17 das Bürokratie,18 Gericht und körperliche Bestrafung in einem allgemeinen – und nachgerade Foucault’schen19 – Sinn vereint, sondern auch die Exzesse kolonialer Gewaltherrschaft: der „Untergang einer vom rigoristischen Strafgesetz dominierten Kulturordnung und deren Ersetzung durch eine neue, ‚moderatere‘“,20 geschildert aus der quasi-ethnologischen Sicht des „Forschungsreisenden“ – einer Figur, die auch „die Deformation des Beobachtungsgegenstandes“21 durch das „Paradox des ‚teilnehmenden Beobachters‘“22 thematisiert. Die einer Dialektik der Aufklärung sich verdankende Disziplinartechnologie jenes ancien régime, mit der ein weißer Offizier im Beisein seines Gastes einen anderssprachigen23 (’eingeborenen’?) Soldaten hinrichten möchte, verkörpert sich in einer Peepshow physischer Grausamkeit, die lange vor Georges Bataille Herrschaft als Sadismus (und Ekstase?) zur Schau stellt.24 In der unangenehmen Verdopplung des Gewalt-Voyeurismus in der „Pornologie“25 des Textes wird neben der Zuschauerfigur auch der/die Leser/in in eine kompromittierte Rolle gedrängt:26 „Through the figure of the Traveler […] the text turns the Western anthropological gaze upon itself to excoriate the barbarism of the supposedly enlightened Occident.“27
In Anlehnung an Hannah Arendts Kolonialismus-Analyse hat Peters darauf hingewiesen, dass „gemäß dem Gesetz des ‚Korrespondenzverhältnisses‘, [von ‚innen‘ und ‚außen‘, C.R.], das Kafkas Welt auszeichnet“, „der Prozeß unendlicher [kolonialer] Expansion hier weniger als ein äußerlicher und territorialer, denn als eine schier endlose Expedition […] ins Innere des Kolonialisierten geschildert“ werde.28 Diese psycho-physische Invasion ähnelt jener Einschreibung, als die David Spurr den Kolonialismus achtzig Jahre später beschrieben hat: „a form of self-inscription onto the lives of a people […]“29. Bei Kafka indes wird das koloniale Eindringen in den Körper nichts zutage fördern, denn das Gemüt des Verurteilten bleibt für die Umstehenden wie den Leser opak und wird nur durch die – möglicherweise unzulänglichen – Interpretationen seiner Reaktionen durch den Forschungsreisenden erschlossen. Ganz im Sinne von Gayatri Spivaks zentralem Text der Postcolonial Studies – Can the Subaltern Speak?30 – gibt es hier im Text keinen Raum, in dem sich der Verurteilte vernehmlich ausdrücken könnte, geschweige denn, dass ihn die Strafe mündig machen würde: Das, was er beispielsweise zum Soldaten sagt, bleibt für die immer weniger vertrauenswürdige Erzählinstanz ungehört, ja unerhört (vgl. IDS51, 55).31
In der prächtigen Uniform des Offiziers, die „für die Tropen zu schwer“ ist (IDS32, vgl. 33), kontrastiert mit der zu beschriftenden Nacktheit seines präsumtiven Opfers (IDS41f.), wird so auch der Gegensatz von „savagery and civilization“ verhandelt.32 Dabei schreckt der Text ebenso wenig vor der verstörend teilnahmslosen Wiedergabe rassi(sti)scher Stereotypen33 zurück, wenn der „Verurteilte“ beschrieben wird:
[…] ein stumpfsinniger, breitmäuliger Mensch mit verwahrlostem Haar und Gesicht […]. Übrigens sah der Verurteilte so hündisch ergeben aus, dass es den Anschein hatte, als könnte man ihn frei auf den Abhängen herumlaufen lassen und müsse bei Beginn der Exekution nur pfeifen, damit er käme. (IDS31)
So treffen gleichermaßen die Raffinesse des Henkers und seiner Maschine auf die stumpfe Indolenz des Delinquenten, dem auch noch eine defiziente Physiognomie und potenziell sogar Kannibalismus34 (vgl. IDS37) nachgesagt werden. Schon diese Beschreibung stellt eine koloniale Hierarchie der Kulturen her, die zwischen ‚Herr‘ und ‚Knecht‘ differenziert, aber auch zwischen ‚Sauberkeit‘ und ‚Schmutz‘35: ein Gefälle, das in weiterer Folge freilich kollabiert – oder doch nicht?
Was nämlich folgt, ist die zunehmende Entropie bzw. Dysfunktion des „Apparats“ – und nicht nur Alexander Honold hat bereits auf die Doppeldeutigkeit dieses Terms hingewiesen, der sich sowohl auf die Maschine als auch auf das dahinter stehende bürokratische Disziplinarsystem beziehen lässt:36 Von Beginn an kämpft der Offizier der alten Schule gegen das reformerische Regime des neuen Kommandanten an, das sich seinen Methoden gegenüber distanziert verhält (vgl. IDS33, 35). Auf der anderen Seite verweigert auch der Verurteilte allem Anschein nach den heiligen Ernst, den sich die Figuren, aber auch die Leser/innen als Reaktion auf seine bevorstehende Hinrichtung erwarten würden. Mehr noch, der Todeskandidat „ahmt[.] den Reisenden nach“ (IDS34), wofür Rolf Goebel den aus der postkolonialen Theorie stammenden Begriff der Mimikry37 bemüht, die einen „unsettling effect on the authority of the colonial scene“ habe.38 Der für das Handgelenk des Verurteilten bestimmte Riemen reißt und schafft damit potenziell bürokratische Probleme mit der Rechnungsstelle (vgl. IDS42). Dann wieder erbricht sich der Deliquent, von den mildtätigen „Damen des Kommandanten“ überfüttert, in die Maschine und verzögert damit den korrekten Ablauf des Hinrichtungsrituals aufs Neue (IDS43).
Dies hat einen Wutausbruch des Offiziers zur Folge, der ob all der Abweichungen vom ursprünglichen Zeremoniell verzweifelt und den Reisenden wortreich ersucht, sich für ihn und seine Methode beim neuen Kommandeur zu verwenden (vgl. IDS43–51). Als sich der Besucher weigert, lässt der Offizier den Verurteilten kurzerhand frei und legt sich – in einer perversen Verkehrung der Mimikry39 – kurzerhand selbst in die Maschine, die – offenkundig defekt – ihn nicht ordnungsgemäß und deshalb scheinbar besonders grausig tötet (IDS57). In Folge verlässt der Reisende die Insel; er lässt den Verurteilten und den anderen Soldaten zurück, nachdem deren Versuch, mit aufs Boot zu kommen, von ihm durch eine wohl kaum human zu nennende Drohgebärde mit einem „schwere[n] geknotete[n] Tau“ (IDS59) verhindert worden ist.
Dieser Ausgang von und aus Kafkas Strafkolonie – den der unzufriedene Autor mehrfach überarbeitete40 – hat nicht nur John Zilcosky dazu gebracht, darin eine „Allegorie der Selbstzerstörung des Kolonialismus“ zu sehen:41 „[…] the story seems to focus on the practice of military justice in general and the dynamics of colonialism in particular,“ schreibt etwa Margret Kohn.42 Sie konzentriert sich dabei auf die Figur des Forschungsreisenden, zumal dessen Sicht die Erzählperspektive dominiert, gerade auch in Hinblick auf das Ende: „The figure of the Explorer seems to suggest the ineffectiveness and indecisiveness of the liberal critique of colonial practice.“43 In diesem möglichen Gegner der Todesstrafe (vgl. IDS46) und Kritiker gewaltsamer Kolonialherrschaft alten Stils verkörpere sich ein liberaler Imperialismus; genauso zeige Kafkas Text aber in dessen überstürzter Abreise (und schlußendlicher Komplizität) lediglich die Ohnmacht und Heuchelei, und damit die Skepsis einer möglichen Revision von Herrschaft gegenüber.44In der Strafkolonie sei „a cautionary tale for social reformers“, getragen vom Bewusstsein, dass letztlich jede Rechtsordnung auf Gewalt beruhe.45 Ergänzend dazu vermerkt Bernd Auerochs, eine „aufgeklärte Moderne“, für die der Reisende „– wie der neue Kommandant und seine Damen – steht“, sei eine Ära „der nur scheinbaren Humanität“,46 die – in einer fundamentalen Unterminierung des Fortschritt-Paradigmas – nichts anderes „als der Kollaps der Tradition“ sei.47
Durch diese und andere postkoloniale Lektüren von Kafkas Textes erschließt sich also eine zusätzliche Bedeutungsdimension dieser „‚schwarze[n]‘ Gesellschaftsgeschichte der Moderne“.48 Bestehende – bürokratie- und rechtskritische, zeitdiagnostische, genderbasierte, metaphysisch-religiöse, existenzialistische und biografisch-metaliterarische – Ansätze49 werden ergänzt, ohne ihnen wirklich zu opponieren, indem in der polyvalenten Unerschöpflichkeit der Kafka’schen Allegorese bisher unterbelichtete Interpretamente der (ver)waltenden Unmenschlichkeit zum Vorschein kommen. In der Strafkolonie werde der Autor, so Bernd Neumann, zum „Ethnologe[n] der eigenen [„zerfallenden“] Kultur“.50
In eben diesem Zusammenhang hat Karen Piper auch auf eine spezifisch ‚kakanische‘ Dimension des Textes aufmerksam gemacht, indem sie das Verständigungsproblem der Figuren auf das multiethnische setup des Habsburger Monarchie zurückprojiziert.51 Ähnlich funktioniert auch die Kontextualisierung von Elizabeth Boa, wonach Kafkas Erzählung einen der „breakdowns“ des „ancient mechanism of social subordination“ zeige:52 „the unwinding of a creaking state bureaucracy, like that of Austria-Hungary, served by a soldier-bureaucrat blind to its imminent collapse“.53 Es sind Interpretationsstränge wie diese, die im Rahmen unseres Buches noch eine wichtige Rolle spielen werden (und dass eine postkoloniale Sicht auf die tropische Strafkolonie nicht völlig überzogen ist, zeigen auch denkwürdige Motiv-Ähnlichkeiten zwischen Kafka und Joseph Conrad an – wiewohl man die Werke des polnisch-britischen Autors in der Bibliothek seines Prager Zeitgenossen vergeblich suchen wird.54)
3.Postkolonialismus & Orientalismus in der (Österreich)-Germanistik
Ähnlich postkolonial gestimmte Re-Lektüren wie die eben präsentierte haben jedenfalls auch andere Kafka-Texte in Anspruch genommen, beispielsweise Beim Bau der chinesischen Mauer (EA1931), Das Schloß (1926), Bericht für eine Akademie (1917), Ein Hungerkünstler (1922) und Der Verschollene (entstanden 1911–1914);1 jüngst wurde etwa auch die kleine Erzählung Schakale und Araber (1917) überzeugend vor diesem Deutungshorizont interpretiert.2 Daneben sind auch ambitionierte Genre-Studien entstanden, so z.B. zum literarischen Orientalismus als k.u.k. Gesellschaftskritik (Robert Lemon, 2011) oder zur Verschränkung von kritischer Utopie und Quasi-Kolonialroman in den Werken von Leopold von Sacher-Masoch, Theodor Herzl, u.a. (Ulrich Bach, 2016). Nicht zu vergessen wären auch – neben dem bereits erwähnten Forschungsnetzwerk Kakanien revisited und den Teamresten des Grazer SFB Moderne3 – die wenig rezipierte Dissertation des kroatischen Komparatisten Nikola Petković (University of Texas, 1996) sowie die unentwegten Versuche der Wiener Germanistin Anna Babka, einen speziellen Mix aus Postkolonialismus, Dekonstruktion sowie Gender und Queer Studies in der österreichischen Wissenschaftslandschaft heimisch zu machen.
Ansonsten haben sich postkoloniale Zugangsweisen – im Anschluss an die Wiederentdeckung und Aufarbeitung der Geschichte4 der wilhelminischen „Schutzgebiete“ Togo, Kamerun, Tansania, Namibia und Papua Neu-Guinea (1884–1919) seit den 1980er Jahren – eher in einer deutschen Literaturwissenschaft im engeren Sinne durchgesetzt. Getragen wurde diese Entwicklung der letzten 25 Jahre nicht zuletzt von international agierenden Germanist/inn/en wie etwa Monika Albrecht (Limerick bzw. Vechta), Nina Berman (Columbus), Russell A. Berman (Stanford), Anil Bhatti (Neu-Delhi), Axel Dunker (Bremen), Gabriele Dürbeck (Vechta), Dirk Göttsche (Nottingham), Alexander Honold (Basel), Florian Krobb (Maynooth), Paul Michael Lützeler (St. Louis), John Noyes (Toronto), Klaus Scherpe (Berlin), Franziska Schößler und Herbert Uerlings (Trier), oder Sabine Wilke (Seattle).5
So hat sich rund um Uwe Timms Roman Morenga (1978) als zentralem Text6 ein veritabler postkolonialer Kernkanon in der Germanistik etablieren können.7 Er enthält Klassiker wie Georg Forsters Reise um die Welt (1780), Alexander von Humboldts Schriften, Kleists Verlobung in St. Domingo (1811), Goethes West-östlichen Divan (1819) und Wilhelm Raabes Stopfkuchen (1868), neben der Abenteuerliteratur von Karl May sowie Kinder- und Jugendbüchern; Kolonialromane im engeren – und problematischen – Sinn wie Peter Moors Fahrt nach Südwest (Gustav Frenssen, 1906) oder Hans Grimms Volk ohne Raum (1926); Reise- und postkoloniale Literatur im engeren Sinn aus der Zwischenkriegszeit wie Alfred Döblins Amazonas-Trilogie (1937/38) ebenso wie Nachkriegsautoren vom Schlage eines Hubert Fichte, Günter Grass (Zunge zeigen, 1988) und Bodo Kirchhoff, aber auch Migrantenliteratur von May Ayim, Emine Sevgi Özdamar, Rafik Schami oder Yoko Tawada.8
Gemäß dem bereits erwähnten Standardargument, dass Österreich(-Ungarn) über keine (Übersee-)Kolonien verfügt habe (das in der vorliegenden Arbeit kritisch hinterfragt werden soll), werden aber Autoren aus diesem post/imperialen Kontext nicht speziell thematisiert oder – wie im Falle Kafkas – stillschweigend eingemeindet, wie besonders anhand des Sammelbands Postkoloniale Germanistik deutlich (2014) wird:9 Ähnliches gilt für Schweizer Autoren wie Urs Widmer oder Christian Kracht, der mit seinem Roman Imperium von 2012 immerhin zu den Meistuntersuchten im Feld gehört; Lukas Bärfuss’ exzellenter Roman Hundert Tage (2008) über den Völkermord in Ruanda indes blieb von Dürbecks und Dunkers „Bestandsaufnahme“ überhaupt unerfasst.10
Ergiebiger ist Österreich bzw. Habsburg als Forschungsgegenstand thematisiert, wenn es in Anschluss an Edward Saids feldbegründendes Werk von 1978 um die Analyse des Orientalismus in deutschsprachigen Ländern11 bzw. in Zentraleuropa12 geht, die sich mit postkolonialen Ansätzen naturgemäß verschränkt und überlappt. Hier ist die austriakische Präsenz deutlicher, zumal ja Österreich durch die gemeinsame Sprache und durch herausragende Forscherpersönlichkeiten wie Josef Hammer-Purgstall (1774–1856) entscheidend am deutschen Orientalismus-Diskurs partizipiert hat und gerade Wien nicht nur bei Hugo von Hofmannsthal als „Porta Orientis“13 firmiert. Bemerkenswert ist auch der literarische Orientalismus in der Habsburger Monarchie um 1900, für den Hofmannsthals Märchen der 672. Nacht (1895), aber auch andere Texte exemplarisch stehen.14
Rüdiger Görner beispielsweise hat gezeigt, wie sich der literarisch gepflogene Jahrhundertwende-Orientalismus mit Positionen des Modernismus verschränkt, d.h. wie er dazu verwendet wird, eine ästhetische Gegenwelt zum herrschenden Positivismus, „Ökonomismus und Reduktionismus“ aufzubauen und damit einen Beitrag zur Krise des Ichs um 1900 sowie deren Repräsentation und Überwindung zu leisten:15 Bei Hofmannsthal stehe
das Orientalische nahezu konsistent für einen bestimmten Vorstellungshorizont, eine imaginatio perpetua, die sich im Zustand permanenter Selbstbefruchtung befindet. Hofmannsthal schätzte das Orientalische als eine ästhetische Ausdrucksform, die keiner Unterscheidung zwischen Innen- und Außenwelt mehr bedarf; sie ist die Einheit von Innen und Außen: das orientalische Ornament, der arabische Schriftzug, die Arabeske, sie galten ihm als sichtbare Zeichen eines unaufhörlichen Traumes, man könnte sagen, als Seismographen träumerischer Bewegungen und Erregungen.
[…] Hofmannsthal ließ keinen Zweifel daran, daß er im ästhetischen Orientalismus nicht in erster Linie ein narratives Verfahren sah, sondern einen genuin poetischen Wert.16
Der Orient biete so den österreichischen Zerrissenen des Fin de siècle ein holistisches Modell einer zumindest imaginären idenitären – oder besser gesagt: identifikatorischen – Einheit. Dem gegenüber hat Robert Lemons Monografie Imperial Messages (2011) – ähnlich wie schon vorher Nina Berman – die „orientalist fiction“ nicht nur Hofmannsthals, sondern auch anderer Autoren der deutschsprachigen Literatur/en Österreich-Ungarns einer kontextualisierenden Lektüre unterzogen: Literarischer Orientalismus made in Austria sei „marked by self-reflection and self-critique“ der Doppelmonarchie in ihrer Spätphase;17 Kafkas Texte über das ‚Reich im Osten‘ beispielsweise evozierten „China in order to allude to the Habsburg Empire“.18 Parallel dazu hat Johannes Feichtinger gezeigt, wie in den populären Bilderwelten einer kollektiven kulturellen Imaginären um 1900 sich die Identitätskonstruktionen und wechselseitigen Abgrenzungen der verschiedenen k.u.k. Ethnien auch durch phantasmatische „Orientalisierungsprozesse“ entlang „asymmetrischer Machtverhältnisse“ vollziehen.19 Zusammen mit Johann Heiss hat Feichtinger weiters auf die Ko-Existenz mehrerer – gegenläufiger – Orientalismen in der k.u.k. Ära hingewiesen.20
Diesen spezifischen Charakter der politischen Symbolisierung bzw. Allegorese im Bereich orientalistischen bzw. post/kolonialen Schreibens in Österreich im 19. und 20. Jahrhundert gälte es stärker zu berücksichtigen – gerade in Hinblick auf Modelle der „inneren Kolonisierung“ Europas, die in Anschluss an Michael Hechters paradgimenbildendes Werk Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536–1966 von 1975 entwickelt und diskutiert worden sind.21 Deshalb ist es auch verwunderlich, dass die Habsburger Monarchie um 1900 als vom Deutschen Reich deutlich abweichender Bezugsrahmen in den tonangebenden Überblickswerken kaum wahrgenommen wird bzw. die vorliegenden Forschungsergebnisse des zentraleuropäischen Netzwerkes Habsburg postcolonial/ Kakanien revisited donauaufwärts kaum rezipiert worden sind.22 Dies hat Robert Lemon dazu gebracht, in seiner Arbeit die postkoloniale „assumption of a German perspective“ als ihrerseits latent kolonial zu kritisieren: „In this way, Dunker maintains the longstanding quasi-colonial claim of German Germanistik over Austrian and Austro-Hungarian literature and culture.“23 Erst jüngst sind gewisse Ansätze zu einer Verbesserung dieses Missverhältnisses bemerkbar.24
Das Bedürfnis nach einer differenzierteren und ausgewogeneren Sichtweise, das mit der Publikation des vorliegenden Buches angesprochen werden soll, entspringt aber keineswegs einem reaktiven Literatur-Nationalismus des kleineren Landes. Vielmehr steht dahinter die Überzeugung, dass die Berücksichtigung des – verdrängten, aber doch sehr spezifischen – Kolonialkomplexes der imperial-historischen Kultur/en der Habsburger Monarchie neue supranationale, komparative – und „kontrapunktische“ Lektüren im Sinne von Edward Said25 – ermöglicht und bisher übersehene Facetten der k.u.k. Kultur/en zutage fördert; ein Unternehmen, das, um den Untertitel des Sammelbands Schweiz postkolonial26 zu paraphrasieren, möglicherweise auch „Formen und Folgen eines Kolonialismus ohne Kolonien“ inkludiert.
4.Zur Anlage der vorliegenden Arbeit
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich folgendes Arbeitsprogramm: Zunächst sollen die Begrifflichkeiten ‚Kolonie‘ bzw. ‚Kolonialismus‘ kritisch auf ihre Übertragbarkeit auf das habsburgische Staatsgebilde im „langen 19. Jahrhundert“ (Eric Hobsbawm) operationalisiert werden – ein Zeitraum, der sinnvollerweise vom Wiener Kongress (als dem letzten Ende der Aufklärung, der französischen Revolution und napoleonischen Kriege) bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs anzusetzen wäre. Nicht intendiert wird eine Gesamtevaluation der Post/Colonial Studies, zumal diese Sinnfrage nach den Meriten und shortcomings dieser akademisch und verlagstechnisch äußerst erfolgreichen Disziplin in den letzten 20 Jahren wiederholt und umfänglich – und sehr kritisch – von Aijaz Ahmad, Graham Huggan, Anne McClintock, Benita Parry, u.v.a.1 gestellt wurde. Diese Diskussion soll nicht wieder aufgegriffen werden, sondern die Frage vielmehr ex positivo gestellt werden: Inwieweit sich eine interkulturell und kulturwissenschaftlich orientierte Österreich-Germanistik von Erkenntnissen und Zugangsweisen der Post/Colonial Studies als „travelling concepts“ (Mieke Bal) inspirieren lassen kann, ohne die besondere Eigenheit ihres habsburgischen Gegenstands aus dem Auge zu verlieren.
Dafür wird eine entsprechend kritisch redigierte literatur- und kulturwissenschaftliche Imagologie – die Erforschung von Selbst- und Fremdbildern, wie sie in der Komparatistik aufgekommen ist – als toolset für die folgenden Fallstudien präsentiert werden, die eine koloniale Diskursanalyse in der Nachfolge von Edward Said, David Spurr und anderen versuchen. Im Brennpunkt stehen drei paradigmatische Autoren und deren Texte aus dem germanistischen Forschungskanon Österreich-Ungarns (Franz Grillparzer, Peter Altenberg und Alfred Kubin), die als symbolische Ausdrucksformen eines „kolonialen Begehrens“ bzw. eines symbolischen Ersatz-Kolonialismus verstanden werden, in Ergänzung zu bereits intensiver erforschten Autoren wie Kafka, Hofmannsthal, Sacher-Masoch, Emil Franzos oder Joseph Roth.2 Der zweite Teil der Fallstudien schließlich widmet sich mit einem erweiterten Literaturbegriff kulturellen Texten3 aus dem Umfeld der habsburgischen Okkupation (1878) und Annexion (1908) Bosnien-Herzegowinas, die als koloniale Ersatzhandlung interpretiert wird; dabei kommt dem hegemonialen Schrifttum die Funktion einer kulturellen Kolonisierung des Territoriums zu, die durchaus mit Formen des britischen und französischen Imperialismus um 1900 vergleichbar ist – soweit die zentrale These.
Die vorliegende Arbeit versteht sich also primär als Analyse eines disparaten – phantasmatischen, aber auch pragmatischen – deutsch-österreichisch imperialen Kolonialdiskurses innerhalb der Habsburger Monarchie. Was indes nur ansatzweise geleistet werden kann, ist die Thematisierung einer literarischen Opposition nicht-deutschsprachiger Autoren und Autorinnen gegen diese kulturelle Hegemonie des Zentrums. Dies schuldet sich freilich nicht einer unreflektierten zweiten Entmündigung etwa der Südslawen, wie voreilige Kritiker moniert haben,4 sondern einfach der wissenschaftlichen Expertise des Verfassers, die freilich durch andere Ansätze innerhalb des Kakanien revisited-Netzwerks ergänzt worden ist.5 Ebenso können Bezüge zu zeitgenössischen k.u.k. Orientalismen lediglich kursorisch hergestellt werden, da auch sie wohl Gegenstand einer eigenständigen Studie sein müssten.
Eine abschließende Zusammenschau der Ergebnisse soll dementsprechend auch in einen Ausblick münden, der künftige Antworten auf die Frage nach dem Fortwirken der kolonialen Blicke und Bildkomplexe in der österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts – bis hin zu Peter Handkes Jugoslawienkrieg-Texten oder Christoph Ransmayrs postmoderner Abenteuerliteratur – vorbereiten soll. Ich hoffe jedenfalls, damit meine in den letzten eineinhalb Jahrzehnten gewachsenen Ansätze und Positionen in einer konklusiven Weise zusammenzuführen und einer künftigen Forschung weitere Anstöße zu geben.6 Generell gilt freilich, was schon Peter Hulme vor 30 Jahren über seine eigene Studie Colonial Encounters schrieb: „The venture, it should be said, is archeological: no smooth history emerges, but rather a series of fragments which, read speculatively, hint at a story that can never be fully recovered.“7
A.1.K.u.k. postcolonial:
Habsburgs ‚Kolonialismus‘ als Befund, Befindlichkeit und Betrachtungsweise
[…] die Worte Kolonie und Übersee hörte man an wie etwas noch gänzlich Unerprobtes und Fernes. (Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften)1
Die Geschichte des Imperialismus und Kolonialismus überschattet und überdauert in ihren Auswirkungen das angebliche Ende des Letzteren, und sie hat lange vor dem langen 19. Jahrhundert begonnen.2 Schon bei Platon findet sich der Gedanke, dass eine polis ihren Bevölkerungsüberschuss durch Gründung neuer „Pflanzstädte“ jenseits des Meeres planvoll und produktiv abführen müsse.3 Mehr als 2000 Jahre später kennt Bartholomew’s Century Atlas of the World (London 1902) lediglich 37 unabhängige „Principal States“; deren „Colonies and Protectorates“ werden nicht mitgezählt.4 Auf diese Weise sind 1914, als Kafka seine Strafkolonie schreibt, zirka 85 % der globalen Landmasse Kolonien.5
Wie jeder auch noch so kurze historische Abriss suggeriert, kann man Auswanderung und – als ihr Komplementärphänomen – Gebietserweiterung nachgerade als anthropologische Konstanten ansehen. In seiner 1995 erstmals formulierten Typologie unterscheidet Jürgen Osterhammel zwischen (1) der „Totalmigration ganzer Völker und Gesellschaften“ wie z.B. in der sog. Völkerwanderung, (2) „massenhafte[r] Individualmigration“ wie z.B. in die Neue Welt oder aus der sog. Dritten Welt nach Europa, (3) „Grenzkolonisation“ (das „Hinausschieben einer Kultivierungsgrenze“ wie z.B. im frontier-Gedanken der USA im 19. Jh.), (4) „überseeische[r] Siedlungskolonisation (in Nordamerika, Australien/Neuseeland, Südafrika, der Karibik etc.), (5) „reichsbildendende[n] Eroberungskriege[n]“ wie etwa bei Dschingis Khan und (6) der „Stützpunktvernetzung“ z.B. der Regionalmächte Genua und Venedig im Mittelmeer oder der Briten und Portugiesen in Singapur, Hongkong und Macau.6
Bevor er noch diese Kategorien entwickelt, moniert der deutsche Fachhistoriker auch, dass Kolonisation „ein Phänomen von kolossaler Uneindeutigkeit“ sei;7 ebenso sehen andere Forscher/innen den Begriff des Kolonialismus zumindest als „umstritten“.8 Und in der Tat stellt sich die Frage, ob die antik-griechische Kolonisierung der Mittelmeerküsten, die militärischen Eroberungen der Römer,9 die sich in Zentral- und Osteuropa festsetzenden deutschen Kolonisten des Mittelalters und der Frühneuzeit, die Entdeckung/Besiedlung Amerikas und die großen europäischen Kolonialreiche der Moderne kommensurable Phänomene sind. Was wäre also (mit Wittgenstein gesprochen) die „Familienähnlichkeit“10 zwischen jenen europäischen Expansionsbewegungen und beispielweise den historischen Großreichen Asiens? Zugespitzt formuliert: Wie eurozentrisch ist eine historiografische Theorie des Kolonialismus? Anderseits: Läuft ein wahrhaft globaler Begriff nicht wiederum Gefahr, sich – ähnlich wie Saids „Orientalismus“11 – dem Vorwurf künstlicher, ahistorischer Universalität auszusetzen?12
Die um die Jahrtausendwende aufgekommene historisch-kulturwissenschaftliche Debatte, inwieweit das Kolonialismus-Paradigma produktiv auf innereuropäische und speziell habsburgische Verhältnisse umgelegt werden könnte, zeitigt indes immer neue Ergebnisse.13 Dies hat auch den Verfasser der vorliegenden Studie – der am Zustandekommen eben jener Diskussion nicht ganz unschuldig war – dazu gebracht, auf seine eigenen Positionen, die erst eher programmatisch als mit dem Anspruch auf Vollständigkeit geäußert wurden, noch einmal zurückzukommen. In Ergänzung zu früheren Texten14 erscheint es angebracht, die verschiedenen Anwendungsfälle noch einmal zu differenzieren, in denen das Paradigma ‚Kolonialismus‘ in Hinblick auf „Kakanien“ operationalisiert wird. Im Wesentlichen dürfte es sich dabei um folgende Szenarien handeln:15
Österreich-Ungarn wird historisch-sozialwissenschaftlich als (Pseudo-)Kolonialmacht angesehen, die sich anderssprachiger Territorien imperialistisch bemächtigt hat, um sie zu beherrschen und ökonomisch auszubeuten; damit wird ein innerkontinentaler Kolonialismus als historischer Befund ausgesprochen.
Wie in Fall 1 wird dem späten Habsburger Reich unterstellt, so etwas wie eine Kolonialmacht gewesen zu sein; dies geschieht jedoch v.a. rhetorisch, d.h. häufig in polemischer Form im Rahmen eines zeitgenössischen bzw. zeitspezifischen Diskurses (als Befindlichkeit).
Es wird eingeräumt, dass die k.u.k. Monarchie zwar keine Kolonialmacht im engeren Sinne war, dass aber ihre symbolischen Formen ethnisch differenzierender Herrschaft – d.h. ihre kulturellen Formatierungen und Bilderwelten – Ähnlichkeiten zu jenen überseeischer Kolonialreiche aufweisen (Imagologie und Identitätspolitik). Vorgeschlagen wird hier also eine heuristische Denkfigur bzw. ein Vergleich als kritische Betrachtungsweise.
Im Folgenden soll versucht werden, diese drei Positionen noch einmal darzustellen und einen Beitrag zu ihrer weiteren Diskussion zu leisten.
1.Kolonialismus als Befund: der sozialwissenschaftliche & historische Diskurs
Als erster Schritt zu einer näheren Bestimmung unseres Fokus sollen nun historiografisch-sozialwissenschaftliche Definitionen von Kolonie, Kolonisierung bzw. Kolonialismus aus gängigen Handbüchern, Fach-Enzyklopädien und Standardwerken herangezogen und diskutiert werden. Gleichwohl empfiehlt sich eine gewisse Vorsicht im Hinblick auf ältere Texte dieses Genres, die häufig auf Grund ihrer zeitlichen und sogar geistigen Nachbarschaft zur Endphase des europäischen Kolonialismus in der Nachkriegszeit wenig brauchbar sind.1 Dennoch liegt bereits mit Rupert Emersons Definition in der International Encyclopedia of the Social Sciences von 1968 eine praktikable Arbeitshypothese vor:
Colonialism is the establishment and maintenance, for an extended time, of rule over an alien people that is separate from and subordinate to the ruling power. It is no longer closely associated with the term ‚colonization‘, which involves the settlement abroad of people from a mother country as in the case of the ancient Greek colonies or the Americas. Colonialism has now come to be identified with rule over peoples of different race inhabiting lands separated by salt water from the imperial center; […].
Some further features of the ‚colonial situation‘2 are: domination of an alien minority, asserting racial and cultural superiority over a materially inferior native majority; contact between a machine-oriented civilization with Christian origins, a powerful economy, and a rapid rhythm of life and a non-Christian civilization that lacks machines and is marked by a backward economy and a slow rhythm of life; and the imposition of the first civilization upon the second.3
Dies entspricht im Wesentlichen auch den Ansätzen, die Jahrzehnte später zur Blütezeit der Post/Colonial Studies vorgetragen werden.4 Wesentlich ist dabei, dass der aus den antiken Kolonien sich herleitende Siedlungsgedanke revidiert worden ist zugunsten der Fokussierung auf eine externe, kulturell fremde Herrschaft, die sich selbst interventionistisch aufoktroyiert: „Modern colonialism was not characterized by settlements but by external control.“5 Oder, mit den Worten von Jürgen Osterhammel: „‚Kolonisation‘ bezeichnet im Kern einen Prozeß der Landnahme, ‚Kolonie‘ eine besondere Art von politisch-gesellschaftlichem Personenverband,6 ‚Kolonialismus‘ ein Herrschaftsverhältnis.“7
Auch die meisten anderen Theoriebeiträge trachten, diese drei Begriffe von einander abzuheben. Wolfgang Reinhard schreibt etwa, ‚Kolonisierung‘ habe zwar prinzipiell mit „Migration“ zu tun; der Begriff verliere jedoch seine relativ neutrale Bedeutung (’Siedlungswesen’) im Lauf des 19. Jahrhunderts, was – so wäre hinzuzufügen – seiner breiten Anwendung und Aufladung im Rahmen eines gesamteuropäischen Kolonialismus Vorschub leistet:
We have no choice but to accept the change of meaning that colonialism has undergone, though we can try to neutralize political emotions. In this sense, colonialism can be defined as the control of one people by another, culturally different one, an unequal relationship which exploits differences of economic, political, and ideological development between the two.8
Reinhard macht drei Hauptmotive für den Kolonialismus namhaft: 1) „sozio-ökonomische Antriebe“9 bzw. der „Wille zur Modernisierung“, 2) „extensive Vorwärtsverteidigung“ (Expansionismus?) sowie 3) „ideologische, religiöse, kulturelle Antriebe“ (also die ‚missionarische‘ Seite der Kolonisation).10 Struktureller geht Osterhammel vor, der zu einer weiteren Ausdifferenzierung des Begriffs drei wesentliche Faktoren formuliert, die im Fall des Kolonialismus verwirklicht sein müssten:
Erstens […] ein Verhältnis […], bei dem eine gesamte Gesellschaft ihrer historischen Eigenentwicklung beraubt, fremdgesteuert und auf die – vornehmlich wirtschaftlichen – Bedürfnisse der Kolonialherrn hin umgepolt wird. […]
Zweitens ist die Art der Fremdheit zwischen Kolonisierern und Kolonisierten von großer Bedeutung. […]
Der dritte Punkt schließlich hängt mit dem zweiten eng zusammen. Moderner Kolonialismus ist nicht nur ein strukturgeschichtlich beschreibbares Herrschaftsverhältnis, sondern zugleich auch eine besondere Interpretation dieses Verhältnisses.11
Gerade die dritte Facette der systemimmanenten Auto-Interpretation und Selbstrechtfertigung des Kolonialismus dürfte im Rahmen eines Theorietransfers auf die Habsburger Monarchie noch von besonderer Bedeutung sein.12 Mit Berücksichtigung des k.u.k. Kontexts hat im Übrigen auch Johannes Feichtinger eine erste Fokussierung der Begrifflichkeit versucht und „drei Spielarten“ des Kolonialismus unterschieden:
Einerseits durch direkte Machtausübung mit gleichzeitiger Implementierung fremder Kultursysteme, anderseits als indirekter Kulturkolonialismus, durch den autochtone kulturelle Strukturen überrollt werden, und schließlich als ein Kolonialismus, der sich auf die Ausbeutung ökonomischer Ressourcen anderer beschränkt.13
Feichtinger sieht das erste Szenario nach der Niederschlagung der Revolution in Ungarn 1849 gegeben.14 Das zweite Szenario, den „Kulturkolonialismus“, versteht er als Prozess, der von einer „Inklusion des Außen“ zu einer „Sinnentleerung“ bzw. „Exklusion des Anderen“ führt und schließlich zur „Entrückung des Anderen in eine Idealsphäre“ und zur „Entmündigung des Anderen“;15 Herfried Münkler spricht hier von einer „Kulturalisierung der Macht“, d.h. einer „Transformation“ von hard in soft power16 (und durchaus kompatibel dazu hat Serge Gruzinski von einer „colonisation de l’imaginaire“ gesprochen17). Damit kommt einem top-down Modell kultureller Manipulation und Knebelung (d.h. Bevormundung bzw. Entmündigung) der ‚Eingeborenen‘ große Bedeutung zu18 (was insbesondere in deren kultureller Repräsentation bzw. deren Widerstand ein zentrales Problem darstellt, wie wir noch sehen werden).19 Über Michael Mann20 hinausgehend ließe sich dann auch behaupten, dass der Kolonialismus nicht nur eine Form struktureller Gewalt, sondern – mit Foucault gesprochen – ein Dispositiv ist, d.h. ein Ineinander von Diskurs und Praxis.
Auf jeden Fall lässt sich Kolonialismus generell im Kern als Herrschaftspraxis jener Fremdbestimmung von Gebieten und Bevölkerungen bestimmen, die kulturelle Differenz (v.a. entlang von Kategorien wie ‚Rasse‘, Menschheitsentwicklung/‚Evolution‘, ‚Fortschritt‘ etc.) zur Rechtfertigung für die externe Machtübernahme im Rahmen einer „mission civilatrice“,21 „rule of law“,22 „white man’s burden“,23 o.ä. operationalisiert; als Konsequenz daraus wird politische Ungleichheit stipuliert und Gewalt rechtfertigt.24 Wie Münkler gezeigt hat, verfügte so ziemlich jedes historische Imperium über Narrative zur Legitimation der Herrschaft, deren Gewaltbereitsschaft und Expansion, d.h. eine selbst erteilte „Mission“ und komplementär zu deren Bestimmung ex negativo auch einen „Barbarendiskurs“.25 In Reinkultur ist dies etwa beim Franzosen Jules Harmand zu finden, einem der großen Stichwortgeber des Kolonialismus um 1900, so wie dies ein halbes Jahrhundert zuvor in Großbritannien Thomas Babington Macaulay war; eine der Schlussfolgerungen in Harmands Buch Domination et Colonisation (1910) lautet:
It is necessary then, to accept as a principle and point of departure the fact that there is a hierarchy of races and civilizations, and that we belong to the superior race and civilization, still recognizing that, while superiority confers rights, it imposes strict obligations in return. The basic legitimation of conquest over native peoples is the conviction of our superiority, not merely our mechanical, economic, and military superiority, but our moral superiority.26
Mehrere Autoren haben indes auf die schwierige Abgrenzung der historisch nicht unbelasteteten27 Begrifflichkeit des Imperialismus und des Kolonialismus hingewiesen. Diese ist aber durchaus zu leisten, indem man Letzteren als konkrete Ausprägung, Anwendungsfall bzw. konkrete Herrschaftspraxis des Ersteren (der dann als Oberbegriff fungiert) begreift, wie dies Hannah Arendt u.a. getan haben28 – ganz egal, wie man Imperialismus selbst im Einzelnen verstehten will.29 Hier ist auch in den letzten zwanzig Jahren eine gewisse post- und neomarxistische Renaissance dieser Terminologie zu bemerken,30 die in Anschluss an Michael Hardts and Antonio Negris Beststeller Empire von 2000 mit zum Boom sog. Imperial Studies als postkolonialer Nachfolgeformation an vielen Universitäten und Forschungseinrichtungen geführt haben mag.
Die Weitung des Fokus mag auch dazu beigetragen haben, dass eine in Anlehnung an die South Asian Subaltern Studies Group um die Jahrtausendwende herum entstandene lateinamerikanische Schule postkolonialer Theorie versucht hat, in der Nachfolge von Hardt und Negri den globalen Zusammenhang von Imperialismus/Kolonialismus und einer westlich geprägten Moderne insgesamt herauszustellen, insofern als sich diese beide notwendigerweise gegenseitig ermöglichen; dies geschieht unter dem Etikett der „Kolonialität der Macht“, das der peruanische Soziologe Aníbal Quijano entwickelt hat.31 Mit den Worten von Pablo Quintero und Sebastian Grabbe sind die „konzeptionellen Schwerpunkte“ in diesem Rahmen:
1) Der Versuch, die Ursprünge der Moderne in der Eroberung Amerikas und in der europäischen Hegemonie über den Atlantik ab Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts zu verorten. Dies im Gegensatz zur herkömmlichen Perspektive über die Moderne als Phänomen der Aufklärung, industriellen Revolution oder Reformation. 2) Ausgehend davon werden die durch den Kolonialismus entstehende Machtstruktur und die Gründungsdynamiken des modernen/kapitalistischen Weltsystems mit seinen spezifischen Akkumulations- und Ausbeutungsregimes auf globaler Ebene betont. 3) Dadurch wird die Moderne als ein weltweites Phänomen betrachtet, das durch asymmetrische Machtverhältnisse begründet wurde statt durch symmetrische Phänomenen innerhalb Europas […]. 4) Diese asymmetrischen Machtbeziehungen zwischen Europa und den anderen Weltregionen und -bevölkerungen stellt eine konstitutive Dimension der Moderne dar und impliziert notwendigerweise die Subalternisierung der Wissens- und Seinsformen der kolonisierten Weltbevölkerungen. 5) Die Subalternisierung des Großteils der Weltbevölkerung geschah durch eine spezielle und bisher nicht bekannte Form von sozialer Klassifikation […] anhand von, heute würde man sagen, phänotypischen Unterschieden zwischen Menschen sowie Geschlechts- und Sexualitätskonstruktionen. 6) Schließlich wird der Eurozentrismus als eine spezifische Wissensform und Produktionsweise innerhalb dieses globalen Machtmusters […] [etabliert].32
In Bezug auf den Kolonialismus als Teilaspekt des Imperialismus sind jedenfalls außer den genannten kulturellen und epistemologischen, (geo)politischen – und vor allem wirtschaftlichen33 – Parametern auch rechtliche Aspekte von Belang,34 wenn etwa das Handwörterbuch der Sozialwissenschaften (1959) „Kolonien“ definiert als
Gebietsteile, denen […] ein bestimmter, vom Regime des Hauptlandes verschiedener rechtlicher Sonderstatus zugewiesen worden ist […] Das rechtliche Sonderregime typischer Kolonialländer besteht in aller Regel darin, dass die Bevölkerung eines Kolonialgebiets nicht, oder jedenfalls nicht gleichberechtigt, am politischen Leben des Mutterlandes teilnimmt und dass sie ihrerseits auch in Bezug auf das Kolonialgebiet keine oder keine volle Selbstregierung besitzt.35
Fast alle konsultierten Werke schlagen nun zusätzlich zu diesen Definitionen einen Katalog von verschiedenen Kolonietypen vor: Das Handwörterbuch der Sozialwissenschaften unterscheidet etwa zwischen Gebieten, die Kolonien „im juristischen Sinne“ sind, von solchen, die „nur in sozialer Hinsicht kolonialen Status haben“.36 Ähnlich machen mehrere Historiker/innen bzw. Sozial- und Politikwissenschaftler/innen einen Unterschied zwischen „direkter“ und „indirekter“ Herrschaft (also etwa durch staatliche Verwaltungsorgane des Kolonisators oder durch einen dazwischen geschalteten körperschaftlichen Akteur wie z.B. die East India Company);37 parallel dazu zwischen einem Kolonialismus, der eher eine Assoziation mit dem Mutterland intendiert, dadurch aber gewisse kulturelle und politische Barrieren aufrechterhält (wie z.B. die Herrschaft der „Raj“ in British-Indien, 1858–1947), und einem solchen, der die Assimilation der Kolonie ans Mutterland, ja sogar deren Inkorporation anstrebt (wie etwa im Falle von Frankreich und seinen „departements outre-mer“ in Algerien).38 Typologisch wird weiters zwischen Siedlungskolonien („die den Bevölkerungsüberschuss des Mutterlandes aufnehmen“ – z.B. USA, Australien, Neuseeland), Ausbeutungskolonien (z.B. die Kolonien in Lateinamerika und der Karibik), Handelskolonien (wie etwa die Besitzungen der venezianischen Republik am Mittelmeer), strategischen Kolonien (z.B. Hongkong, Gibraltar) und Kolonien für besondere Zwecke (z.B. Strafkolonien, Wetterstationen u.Ä.) differenziert.39 Reinhard dagegen – wie auch Osterhammel und Young – folgt Jules Harmand (1910), wenn er lediglich zwischen Herrschafts-, Stützpunkt- und Siedlungskolonien unterscheidet.40
Für unsere Themenstellung außerdem von Belang dürfte die mehrfach versuchte Ausweitung des Koloniebegriffs sein. Reinhard etwa verwendet den Terminus semicolonies für China und das Osmanische Reich um 1900.41 Außerdem verweist Emerson auf belgische Bestrebungen in der Frühzeit der Vereinten Nationen „to broaden the concept of colonialism to include all ethnically distinct minorites discriminated against in their home countries“ – ein Vorstoß, der von der UNO abgelehnt worden ist.42
Hodder-Williams wiederum versucht, einen internal colonialism zu beschreiben als „broadly similar processes at work within a single state. Thus, particular groups, through their dominance of political and economic power, ensured that other groups are kept in long-term subservience“; als Beispiel dafür werden die Ostbengalen in Pakistan angeführt.43 Ausschlaggebend für die Diskussion dieses Terms im europäischen Kontext war Michael Hechters bereits erwähntes Buch Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536–1966 von 1975, das die englische Herrschaft über die „keltischen Randgebiete“ Großbritanniens – Irland, Schottland und Wales – unter diesem Blickwinkel gleichsam als Parallelaktion bzw. Vorwegnahme eines britischen Übersee-Imperialismus beleuchtet; ebenso liegen Versuche eines Theorietransfers auf die russische bzw. sowjetische Expansion in Zentralasien und Osteuropa vor.44 Aber schon der Beitrag im Handwörterbuch der Sozialwissenschaften von 1958 hatte darauf verwiesen, dass es durchaus vorkomme, „dass Gebiete, welche soziologisch Kolonialland sind, ohne rechtliche Sonderregelung als Bestandteil des Hauptlandes regiert werden, so etwa Sibirien als Teil Rußlands oder die Mandschurei als Provinz Chinas“ (und Algerien innerhalb Frankreichs).45 Young sieht ebenso die polnischen Teilungen im späten 18. Jahrhundert unter einem kolonialen Vorzeichen.46
Ansätze in Richtung einer inneren Kolonisierung schlagen auch Edward Said47 und Hannah Arendt48 vor, im letzteren Fall in dezidierter Anlehnung an den Gegensatz von „Landtretern“ und „Meerschäumern“, d.h. Kontinentalreichen und einem maritimen Kolonialismus bei Carl Schmitt.49 In Folge wird der viel diskutierte50 Begriff aber als Konsequenz seiner zunehmenden Polyvalenz immer unschärfer (vor allem, wenn er etwa von Andrea Allerkamp doppeldeutig psychologisiert und ins Individuum selbst verlegt wird51). Auf der anderen Seite würde jedoch auch eine Differenzierung zwischen innerem und kontinentalem Kolonialismus, die auf der Unterscheidung eines Diesseits von einem Jenseits imperialer Staatsgrenzen auf demselben Erdteil beruht, durchaus Sinn machen.52
Aus dieser kurzen Darstellung der sozialwissenschaftlichen Begrifflichkeit von Kolonie bzw. Kolonialismus sollte indes hervorgegangen sein, dass Österreich-Ungarn um 1900 kein Kolonialreich im engeren Sinn gewesen sein bzw. gehabt haben kann:53 Weder das Moment großer (überseeischer) Entfernung noch jenes großer kultureller Differenz kann für seine multiethnischen Herrschaftsverhältnisse geltend gemacht werden – es sei denn, man besteht darauf, dass es sich hier lediglich um quantitative bzw. graduelle Unterschiede handelt. Hiermit liefe man aber möglicherweise Gefahr, durch Nivellierung der Betrachtungsweise die großen Menschheitsverbrechen des zeitgenössischen europäischen Kolonialismus in Afrika und Asien – wie etwa den Genozid im Belgisch-Kongo54 um 1900 – zu verharmlosen.
Dennoch gilt, was Walter Sauer moniert hat, nämlich dass mit dem Mantra der Nicht-Existenz österreichisch-ungarischer Überseekolonien sich für die meisten Forscher/innen jede Diskussion überhaupt erübrige, inwieweit es koloniale Tendenzen im späten Habsburger Reich gegeben habe; dieses Denkklischee gelte es freilich kritisch zu überprüfen:55
The silence regarding Austria in academic debate corresponds with the attitude in national […] discourse. Far from entering a discourse of whether or not imperialist or colonialist tendencies are to be found in the country’s history, and if so, the discussion is largely based on the assumption that Austria was not a colonial power […].56
Sauers eigener Studie K.u.k. kolonial (2002) kommt indes das Verdienst zu, die vergessenen oder verdrängten kolonialen Projekte der Habsburger Monarchie dem Vergessen entrissen zu zu haben: Sokotra 1857/58, die Nikobaren 1858, die Salomonen 1895/96, weiters die Westsahara 1899 und Südostanatolien 1913; 1901–14 schließlich wurden sechs Quadratkilometer Land bei der Hafenstadt Tientsin von k.u.k. Truppen besetzt – als eine Art österreichisch-ungarisches Hongkong in China.57 Zudem gab es koloniale Begehrlichkeiten als Folge des Suezkanal-Baus (und der diesbezüglich günstigen Lage der Hafenstadt Triest) sowie im Rahmen der Sudan-Mission.58 Sauer kommt dann freilich zu dem Schluss: „Die Monarchie war mit Sicherheit kein Kolonialstaat. Sie war jedoch auch keine antikoloniale Kraft“,59 denn „[a]uch als ‚Großmacht ohne Kolonien‘“ habe sich Österreich-Ungarn „dem imperialistischen Grundkonsens der europäischen Mächte verpflichtet“ gefühlt.60
Dies greift vielleicht etwas zu kurz, wie im Folgenden ausgeführt werden wird. In diesem Sinne soll ein erster Schritt gleichsam zu einer Erfassung des einschlägigen kollektiven Unbewussten der ‚kakanischen‘ Kultur/en (nach den Pionierarbeiten von Sauer, Csáky/Feichtinger/Prutsch und diversen eigenen Beiträgen des Kakanien revisited-Teams) unternommen werden; dies ist eines der vordringlichsten Anliegen der vorliegenden Monografie. Darüber hinaus gilt es freilich auch, potenzielle politische und kulturelle Parallelaktionen zum Kolonialismus der anderen europäischen Großmächte namhaft zu machen; diese Frageperspektive ist schon von Valentina Glajar 2001 unter Bezugnahme auf prominente Forschungsmeinungen kompakt zusammengefasst worden:
While historians such as Oscar Jászi and Ferenc Eckhart argued that the eastern and southeastern regions of the Habsburg Empire functioned as internal colonies for Austro-Germans and, in part, for Hungarians, postcolonial critics have rarely considered Austria-Hungary as a case of colonialism. Katherine Arens criticizes postcolonial theorists such as Edward Said and Homi Bhabha, who base their theories on the British or French Empires yet ignore the case of Austria-Hungary. While the paradigms developed for the French and British Empires might not be entirely applicable to the Habsburg Empire, they are defined in terms of the East-versus-West distinction that was also at the core of the Habsburg expansion to the East. Just like the British and the French colonizers, the Habsburgs had a mission civilisatrice in the ‚barbaric‘ East. The Habsburgs’ belief in a ‚superior‘ German culture and civilization was employed to justify their political, cultural, and economic mission in eastern Europe. Unlike the British and French rule in Africa, Asia, and Latin America, however, the Habsburgs’ rule was not characterized by terror or massacre, nor was the conflict colonizer-versus-colonized always spelled out in racial terms.61
Die überzeugendste Fallstudie für eine Kolonialismusdebatte in diesem Sinne dürfte wohl Bosnien-Herzegowina darstellen, dessen militärische Okkupation (1878), Verwaltung und Annexion (1908) durch die Habsburger Monarchie gewisse (quasi)koloniale Züge eignen, wie dies z.B. schon die Historiker Robert Donia und Raymond Detrez behauptet haben:62 So etwa die Tatsache, dass die Bosnier/innen vorderhand über kein politisches Mitbestimmungsrecht innerhalb der Parlamente der Monarchie verfügten wie deren anderen „Völker“ und damit so etwas zu k.u.k. Bürger/innen 2. Klasse wurden.63 (Für eine genaue Bestimmung dieses komplexen Kolonialismus-Szenarios ist freilich eine nähere Untersuchung vonnöten, die im Folgenden Gegenstand eines eigenen Kapitels [C.0] sein wird, das den Bosnien-Abschnitt der vorliegenden Studie einleitet.)
2.(Innerer) Kolonialismus als Befindlichkeit: die Rhetorik der Zeitzeug/inn/en
Kolonialismus ist eine Herrschaftsbeziehung zwischen Kollektiven, bei welcher die fundamentalen Entscheidungen über die Lebensführung der Kolonisierten durch eine kulturell andersartige und kaum anpassungswillige Minderheit von Kolonialherren unter vorrangiger Berücksichtigung externer Interessen getroffen und tatsächlich durchgesetzt werden. Damit verbinden sich in der Neuzeit in der Regel sendungsideologische Rechtfertigungsstrategien, die auf der Überzeugung der Kolonialherren von ihrer kulturellen Höherwertigkeit beruhen.1
Die hier zur Rekapitulation wiedergegebene Definition Jürgen Osterhammels – ziemlich kulturalistisch argumentierend und häufig zitiert – gibt das Moment ‚überseeischer Distanz‘ auf und öffnet gleichsam wieder die innerkontinentalen Räume für eine Kolonialismus-Debatte. Erhellend ist auch die bereits erwähnte Zusatzklausel des Autors, Kolonialismus sei nicht nur ein „strukturgeschichtlich beschreibbares Herrschaftsverhältnis, sondern zugleich auch eine besondere Interpretation dieses Verhältnisses“;2 diese beruhe im Wesentlichen auf drei diskursiven Faktoren: „die Konstruktion von inferiorer ‚Andersartigkeit‘“, „Sendungsglaube und Vormundschaftspflicht“ (der Kolonisatoren) sowie die „Utopie der Nicht-Politik“ (d.h. eines „politikfreien Verwaltens“).3
Osterhammel muss freilich einräumen, dass es derartige Herrschaftsverhältnisse ebenso zwischen Zentren und Peripherien „innerhalb von Nationalstaaten oder territorial zusammenhängenden Landimperien“ gebe4 (und die Dichotomie von Zentrum vs. Peripherie/n





























