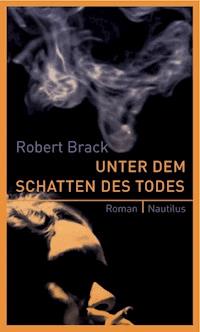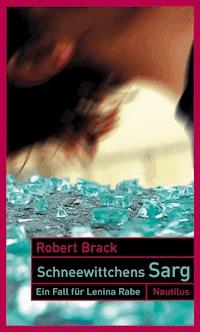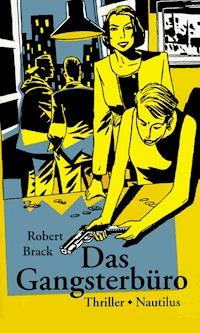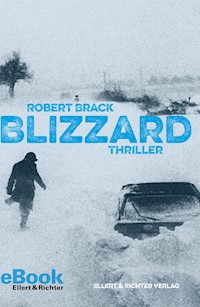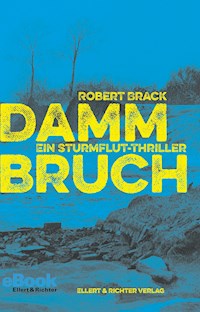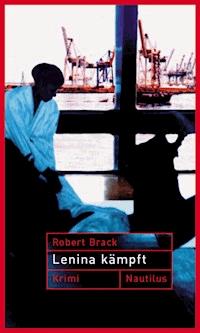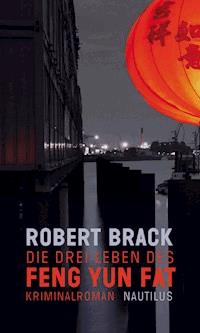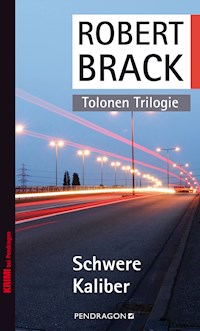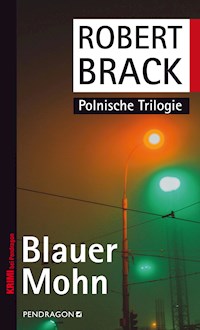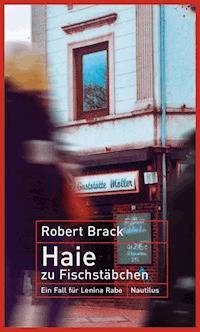
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Lenina Rabe
- Sprache: Deutsch
Die rätselhafte Herumtreiberin Mary wurde auf dem Gelände der alten Seifenfabrik tot aufgefunden. Die Polizei hat den angeblichen Mörder schnell gefasst: Tom, gelegentlicher Mitarbeiter des Detektivbüros Lenina Rabe und hauptberuflich bei dem Sicherheitsdienst tätig, der das Gelände vor der Besetzung durch Bauwagen-Leute schützen soll. Denn der Tatort ist ein begehrtes Spekulationsobjekt, um den verschiedene Investoren und ein türkischer Kulturverein kämpfen. Gleichzeitig regt sich der Widerstand im Viertel gegen die Baupläne. Hartnäckig sucht Lenina Rabe Beweise für Toms Unschuld. Doch niemand scheint sich für den Tod der "Obdachlosen" zu interessieren. Auch bei ihren Freunden stößt Lenina Rabe nur auf eine verstörende Teilnahmslosigkeit. Da geschieht ein zweiter Mord...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Brack, Jahrgang 1959, lebt in Hamburg. Er wurde mit dem »Marlowe« der Raymond-Chandler-Gesellschaft und dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Zuletzt erschienen in der Edition Nautilus drei Romane über die politischen Verhältnisse in der Weimarer Republik: Und #das Meer gab seine Toten wieder beschreibt einen Polizeiskandal aus dem Jahr 1931, Blutsonntag befasst sich mit den Ereignissen im Juli 1932 in Altona, Unter dem Schatten des Todes beschreibt die Hintergründe des Reichstagsbrands 1933 in Berlin. Mit Die drei Leben des Feng Yun-Fat kehrt der Autor in die Gegenwart zurück und knüpft an seine drei Lenina-Rabe-Kriminalromane Lenina kämpft, Haie zu Fischstäbchen und Schneewittchens Sarg an. Weitere Abenteuer von Rabe & Adler sollen folgen.
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg
Schützenstraße 49 a · D-22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Lutz Schulenburg 2005
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
Autorenfoto Seite 2: Charlotte Gutberlet
Originalveröffentlichung
Erstausgabe August 2005
Print ISBN 978-3-89401-466-0
E-Book ePub ISBN 978-3-86438-175-1
Inhalt
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
EINS
Das erste Mal bemerkte ich Mary, als sie aus der Gaststätte Möller heraustaumelte und dicht an mir vorbeilief. Sie lächelte geistesabwesend und wäre beinahe vor ein Auto gelaufen, wenn ich sie nicht am Arm gepackt und zurückgezogen hätte.
Sie sagte nicht mal Danke, sondern nahm Kurs auf eine Bank und legte sich drauf. Sie war etwa Mitte vierzig, trug zerschlissene schwarze Jeans und eine löchrige Lederjacke mit Fransen, dazu Cowboystiefel. Wenn man genau hinsah, erkannte man, dass sie einmal eine umwerfende Schönheit gewesen sein musste: geschwungener Mund, große dunkle Augen, üppiges schwarzes Haar, klassische Nase, hohe Wangenknochen. Sie rappelte sich kurz auf und lächelte mich an. Es war ein Lächeln, in das man sich verlieben konnte. Melancholisch, einladend. Ich lächelte zurück, ging weiter und spürte, wie mir ein Schauer über den Rücken lief.
Die Kneipe, aus der sie gekommen war, war ein Refugium für alle Altonaer, deren Hoffnungen ergraut und verblichen waren. Dort gab es Bier und Kaffee zu Tiefstpreisen, dorthin kamen die Stammgäste zum Frühschoppen, wenn sie Geld hatten. Danach setzten sich manche von ihnen vor eine Bankfiliale oder einen Modeladen und sammelten Almosen, bis es wieder für die nächste Flasche reichte. Ich war nie drin gewesen. Wie die meisten Passanten ging ich lieber nicht zu nah am Eingang des Ecklokals am Spritzenplatz vorbei. Der rauchgeschwängerte Bierdunst, der herausdrang, war nichts für sensible Nasen.
Nach ein paar Metern drehte ich mich noch einmal um. Mary hatte die gefalteten Hände unter den Kopf gelegt und die Augen geschlossen. Ein Windstoß wehte durch die Bäume und ein paar gelbe Blätter trudelten über sie hinweg. Ein seltsamer Anfall von Traurigkeit überkam mich, und ich flüchtete auf die andere Straßenseite.
Im Schlüsselladen neben der Sparkasse holte ich das neue Büroschild ab. Als ich wieder herauskam, guckte ich nicht zu ihr rüber. Ich war sowieso spät dran. Philipp erwartete mich im Knuth und ich wusste, dass er pünktlich sein würde. Eine heftige Bö schob mich an der Eckkneipe vorbei in die Große Rainstraße.
Philipp saß draußen und ließ sich die Haare vom Westwind verstrubbeln.
Er stand auf, als er mich sah, und kam mir drei Schritte entgegen. Küsschen, Küsschen. Heute gelang es mir nicht, seine Wange diesen Moment länger zu berühren, der die Sache interessant machte. Es war eine Art sportlicher Ehrgeiz von mir. Gelegentlich, nur ganz selten, hatte ich ein schlechtes Gewissen deshalb. Wegen Nadine. Aber Philipp behauptete ja, sie seien nicht mehr »so richtig« zusammen.
»Komm, setz dich«, forderte er mich auf.
»Draußen ist es mir zu kalt.« Es war mir ein Rätsel, wie er an so einem Tag nur mit T-Shirt und Jeansjacke herumlaufen konnte. Ich hatte heute morgen die Winterjacke mit dem Pelzkragen aus dem Schrank geholt. »Lass uns reingehen, Philipp.«
»Wenn du meinst.«
Wir setzten uns ans Fenster und bestellten Latte macchiato und Frühstück mit Marmelade. Die Gäste waren alle älter als wir. Im Knuth frühstückten die Vierzigjährigen, mittags speisten hier die Dreißigjährigen. Wer knapp über Zwanzig war, so wie wir, kam in der Regel erst abends und ging um Mitternacht, wenn die Teenies einfielen. Momentan war niemand da, den wir kannten, was eher selten vorkam in diesem Viertel, in dem jeder schon mal mit jedem zu tun hatte.
»Wie geht’s Nadine?«, fragte ich.
»Weiß nicht, hab sie länger nicht gesprochen.«
»Das hast du das letzte Mal auch schon gesagt.«
»Du wolltest sie doch besuchen.«
»Ja, stimmt.«
»Und?«
Ich zuckte mit den Schultern. Was sollte ich sagen? Dass ich mich nicht traute, ihr unter die Augen zu treten, weil ich gern ihren Platz in seinem Leben eingenommen hätte, den sie aber schon gar nicht mehr hatte, was ich wusste, sie aber nicht wahrhaben wollte?
»Was ist denn los?«, fragte Philipp.
»Hm?«
»Du antwortest nicht.«
»Wieso?«
Er winkte ab. »Ach, vergiss es. Du siehst blass aus.«
»Herbstanfang«, sagte ich.
Er kniff die Augen zusammen und musterte mich. Es kam selten vor, dass er mich richtig ansah. In so einem Moment hätte ich gern irgendwas getan, um mich zu offenbaren. Aber mir fiel nichts ein. Oder ich zögerte zu lang. Oder ich hatte so verrückte Ideen wie zum Beispiel: Pack ihn an den Ohren und zieh ihn über den Tisch zu dir und küsse ihn so lang, bis er keine Luft mehr bekommt.
Ich lachte vor mich hin. Seine Ohren luden wirklich dazu ein.
»Was ist denn los?«, wollte er wissen.
Ich zog die Papiertüte aus der Jackentasche und holte das Messingschild heraus.
»Was ist das?«
»Der Typ im Laden fand’s witzig. Hat mir nicht geglaubt, dass es wirklich mein Beruf ist.«
»Na ja, Beruf …«, sagte Philipp.
Er nahm das Schild und schaute es an. »Lenina Rabe, Detektivin« stand darauf. »Bist du echt immer noch auf dem Trip?«
»Es ernährt seine Frau«, entgegnete ich schnippisch.
Philipp verzog das Gesicht. »Wolltest du nicht mit Studieren anfangen?«
»Kann mich nicht dazu durchringen. Sport ist auf Dauer wahrscheinlich zu öde.«
»Jura.«
»Was?«
»Rechtswissenschaften, das würde zu deinem Detektivkram passen.«
»Ist mir zu trocken. Ich dachte eher an so was wie Germanistik, vielleicht.«
Philipp verzog den Mund. »Deutsch und Sport, Frau Studienrätin«, sagte er abfällig.
Ich war sauer, wollte es aber nicht zeigen. »Mein Vater sagte immer, wer nichts wird, wird Wirt oder Lehrer.«
»Und dann ist er Detektiv geworden.«
»Na und?«, fuhr ich ihn an. Auf meinen toten Vater ließ ich nichts kommen, auch wenn er mir einen schrägen Vornamen verpasst hatte. Er war einer dieser Achtundsechziger gewesen, die von der großen Revolution geträumt hatten. Später war er dann Detektiv geworden und im Kampf gegen rechtsradikale Verschwörer umgekommen.
Philipp hob abwehrend die Hände. »Ich sag ja gar nichts.«
»Schon gut. Wie läuft’s denn bei dir so?«
»Hab mich für Politik und Wirtschaft eingeschrieben. Muss ja ein paar Leute geben, die durchblicken, wenn wir uns daran machen, den Neoliberalismus in die Knie zu zwingen.«
Philipp träumte vom sozialrevolutionären Umsturz. In dieser Hinsicht war er meinem Vater sehr ähnlich. Ich bin mit meinen Hoffnungen bescheidener. Mir würde es fast schon reichen, einen Revolutionär küssen zu dürfen.
»Hast du deine Eltern herumgekriegt, dass sie dir das finanzieren?«
Philipp lachte hämisch. »Nee, hab ich nicht mehr nötig. Bei mir laufen die Geschäfte zur Zeit ganz gut.« Er hob den linken Arm. An seinem Handgelenk blitzte eine teuer aussehende Uhr.
»Eine Omega, Schweizer Handarbeit. Wenn ich die wieder verkaufe, reicht’s für ein Jahr.«
»Wenn sie dich wegen deiner Dealerei erwischen, reicht’s für mehr als nur ein Jahr.«
»Sei nicht so spießig, Lenina.«
»Bin ich nicht. Ich finde nur, es passt nicht zu deiner Weltanschauung.«
»Haschisch ist eine revolutionäre Droge!«
»Das meine ich nicht. Du handelst kapitalistisch.«
»Quatsch! Sollen wir das Zeug etwa den Großkonzernen überlassen, damit die uns damit auch noch ausbeuten können?«
»Die Drogenmafia ist doch nichts anderes als ein Großkonzern.«
Jetzt war er richtig sauer. Er beugte sich nach vorn. »So wie du redest, kannst du ja gleich zu den Bullen gehen. Privatbullin bist du ja schon.«
»Red nicht so ein Blech«, sagte ich ruhig.
Das war jetzt der Moment, wo ich ihn an den Ohren hätte packen können. Er war nah genug dran. Ich hob die Hände. Aber wie das oftmals so ist, schießen mir im richtigen Augenblick die falschen Impulse durchs Hirn. Anstatt seinen Kopf zu packen, fasste ich nach dem Handgelenk mit der Uhr und sagte: »Oh, es ist schon spät. Ich hab noch einen Termin.«
Er sah mich spöttisch an. »Echt?«
Seine Augen waren leicht blutunterlaufen, er hatte sich mindestens drei Tage nicht rasiert und drei Wochen nicht gekämmt. Aber er roch gut. Und ich fand, er sah verwegen aus.
»Ja, tatsächlich«, erklärte ich. »Ich hab ganz gut zu tun in letzter Zeit. Meistens Kleinkram hier im Viertel, aber immerhin.«
»So, so.« Er starrte auf meine Hand an seinem Gelenk: »Ist das eine neue Kampftechnik?«
»Eine kleine Drehung mit dem Arm und du liegst unterm Tisch.«
Er lächelte amüsiert. »Wäre einen Versuch wert.«
Vermutlich wurde ich jetzt rot, denn ich hatte ein Quäntchen meiner unerlaubten Fantasien preisgegeben. Es gab ein paar Wurftechniken, die ich gern mal an Philipp ausprobiert hätte, um ihn auf die Matte zu legen und dann einen speziellen Haltegriff anzuwenden. Aber diese Obsession vertrug sich ganz und gar nicht mit meiner Aikido-Philosophie.
Ich ließ ihn los und stand auf. »Ich muss los. Du hast mehr Kohle als ich, du zahlst. Ruf mich an.«
Ich winkte einen Abschiedsgruß und wandte mich ab.
Als ich die Tür aufzog, hörte ich ihn rufen: »Lenina! Bist du heute Abend im Turbodrom?«
Ich zuckte mit den Schultern und trat nach draußen. Als ich am Fenster vorbeiging, vor dem er saß, hob er den Arm, deutete auf sein Handgelenk und verzog das Gesicht, als hätte er schlimme Schmerzen. Ich lachte und ging weiter. Wieso hatte er Nadine eigentlich nur so selten zum Lachen gebracht?
Ein feiner Nieselregen hatte eingesetzt. Auf dem Spritzenplatz hatten sich die Punks unter die Markise eines Dönerladens zurückgezogen. Nur noch eine Bank war besetzt, darauf lag Mary im Regen. Ihr Gesicht war weiß. Sie wirkte wie eine Wachspuppe. Ihr Mund stand offen. Ich dachte kurz daran hinzugehen und sie aufzuwecken, damit sie ins Trockene ging. Aber die Zeit drängte. Geistesabwesend überquerte ich die Straße und wurde von einem Schwachkopf im Audi TT angehupt.
ZWEI
Mein Büro liegt im vierten Stock eines ehemaligen Fabrikgebäudes. Ich bin eine der beständigsten Mieterinnen, die anderen Firmen wechseln häufig. Sie haben immer tolle Namen, hübsch designte Türschilder, auf denen die Worte »Media«, »Consulting« und »Communication« meist in Verbindung mit »Web«, »Net« oder »Production« zu finden sind, und Chefs, die Audi-, BMW- oder Mercedes-Zweisitzer fahren. Im Keller ist allerdings vor kurzem ein Musikstudio eingezogen. Seitdem sieht man gelegentlich junge Männer mit Zottelhaaren und Gesäßtaschen von der Größe eines Müllsacks der Hamburger Stadtreinigung vor der Tür herumlungern. Sie stehen da und rauchen mit einem Gesichtsausdruck, der darauf schließen lässt, dass sie die Warnhinweise auf den Zigarettenpackungen sehr ernst nehmen. Ansonsten scheinen sie nicht sehr risikofreudig zu sein, was man daran sieht, dass sie sogar im Sommer Pudelmützen tragen. Einer von ihnen interessierte sich für meinen alten Peugeot. Da es ein Erbstück ist, habe ich abgelehnt zu verkaufen.
Ich sprintete die Treppe rauf, um meine Kondition zu testen, und machte mich gleich daran, das Türschild auszuwechseln. Mein Vater war jetzt seit über zwei Jahren tot. Nachdem ich den Mord an ihm aufgeklärt hatte, übernahm ich sein Büro. Ich hatte sowieso keine konkreten Pläne, und irgendwie muss man ja seinen Lebensunterhalt verdienen.
Nach meinem ersten spektakulären Fall wurde die Detektivarbeit dröge. Es ist ein komischer Beruf, man verdient mehr als bei einem Mini-Job, genießt weniger Ansehen als eine Ich-AG, bringt die meiste Zeit damit zu, unklare Steuererklärungen zu verfassen und bräuchte eigentlich die Qualifikation eines Sozialarbeiters, Psychologen, Therapeuten und Theologen. Kenntnisse in Volks- und Betriebswirtschaft, Politologie, Soziologie und in diversen Naturwissenschaften wären auch nicht schlecht. Ich beherrsche leider nur Aikido und muss mich auf meinen hoffentlich halbwegs gesunden Menschenverstand verlassen.
Immerhin kommt man herum und lernt eine Menge Leute kennen. Entlaufene Töchter von hysterischen Müttern zu suchen, Softie-Väter in der Midlifecrisis aus den Betten blutjunger Verführerinnen zu holen oder bei Unterschlagungsfällen in linksalternativen Sozialvereinen zu ermitteln ist nicht gerade aufregend. Manchmal habe ich aber doch meinen Spaß, zum Beispiel neulich, als ich ein Eigentumsdelikt in einer Wohngemeinschaft anarchistischer Punk-Rocker aufklären sollte.
Auch wenn ich eine bescheidene Existenz führte, war ich doch ein bisschen stolz auf das neue Türschild. Vor ein paar Wochen hatte ich meine Wohnung aufgegeben und war aus Kostengründen hierher gezogen. Platz war genug da, mein Vater hatte auch hier gewohnt. Nach zwei Jahren in seinen professionellen Fußstapfen glaubte ich das Recht zu haben, auch privat seine Nachfolge anzutreten. Ich fasste mir ein Herz und ließ eine Menge Krempel vom Sperrmüll abholen. Sein Schreibtisch blieb natürlich da, auch das Bücherregal und das alte Braun-Radio. Seine Klassik-CDs konnte ich gut gebrauchen, aber die meisten seiner Bücher, vor allem die politischen, verkaufte ich ans Antiquariat. Die große Amerikakarte, die wir mal zusammen auf dem Flohmarkt gekauft hatten, rollte ich ein und stellte sie in die Ecke. Dann fuhr ich zu Ikea und holte das Nötigste. Jetzt war der Loft mein Reich und draußen hing das Schild »Lenina Rabe, Detektivin«.
Auch die Klingel hatte ich reparieren lassen. Kaum saß ich am Schreibtisch und suchte im rechten unteren Fach nach der Thermoskanne mit dem Yogi-Tee, ertönte der Gong, den ich mir von einem Bekannten aus dem Aikido-Verein hatte aufschwatzen lassen. »Klingt genau wie in einem buddhistischen Tempel«, hatte er gesagt.
Ich stellte die Thermoskanne auf den Tisch und rief: »Herein!«
Ein korpulenter Mann, Mitte vierzig, blauer Anzug, kariertes Hemd und Krawatte mit Elefantenmuster, trat ein. Er trug braune Schuhe, hatte eine Glatze, ein aufgedunsenes Gesicht und gefiel mir nicht.
Anstatt von seinem Äußeren auf seinen Charakter zu schließen, hätte ich mal lieber aufstehen und ihm entgegen gehen sollen. Aber ich blieb sitzen, merkte, wie ein ganz falsches Gefühl von Verachtung in mir erwachte und schenkte mir hochmütig einen Yogi-Tee ein. Ziemlich unprofessionell und mit meinen weltanschaulichen Idealen nicht zu vereinbaren. Vielleicht lag’s nur daran, dass mir das neue Türschild den Kopf vernebelte.
In dieser Hinsicht sorgte der Dicke für Klarheit: »Guten Tag, ich hätte gern Herrn Rabe gesprochen.«
»Gibt’s nicht mehr.«
Er trat näher. Seine Schuhe knarrten leise, die Sohlen quietschten auf dem Holzfußboden.
»Aber draußen ist doch ein Schild.«
»Lenina Rabe steht da drauf«, sagte ich.
Er wirkte ratlos: »Ich dachte, das sei eine Firmenbezeichnung.«
»Es ist ein Vorname.«
»Ach so, ja. Vielleicht sollte ich dann mit diesem Lenina Rabe sprechen.« Er blieb vor meinem Schreibtisch stehen. Groß war er nicht.
»Lenina ist weiblich«, kanzelte ich ihn ab.
»Oh … äh, nun ja, melden Sie mich an.«
Ich nippte am Yogi-Tee. Er war ziemlich stark und schmeckte nach Weihnachten ohne Zucker.
»Ich bin Lenina Rabe.«
»Hm.«
Der Tee wirkte. Ich sprang vom Drehstuhl und eilte zum Küchen- und Konferenztisch, schnappte mir einen Stuhl und stellte ihn ihm hin.
»Nehmen Sie Platz, Herr …?«
»Kutzke, Klaus Kutzke.« Er reicht mir die Hand. Sein Griff war weich, fühlte sich teigig an.
»Bitte sehr.«
»Also Sie sind die Detektivin?«
»Ganz recht.«
»Hm.« Er dachte nach, und ich nutzte die Gelegenheit, um noch einen Schluck von meiner Anti-Ego-Medizin zu nehmen. Er schaute sich im Zimmer um. Es war groß, aber viel gab es nicht zu sehen: eine kleine Küchenzeile neben dem Waschbecken, vor dem großen Fenster mit Blick auf die katholische Kirche der Tisch, ein paar Freischwinger, die Professionalität signalisieren sollten, eine Kaffeemaschine, die ich selten benutzte, über dem Tisch eine kleine Galerie von Komponistenporträts, ich bin ja Klassik-Fan.
Jetzt wanderte sein Blick über meine fast leere Schreibtischplatte, registrierte Telefon und Faxgerät, iBook und Drucker, schweifte weiter zum Bücher- und Aktenregal, in dem auch die kleine Musikanlage und eine Reihe CDs standen, und kam zurück. Nun war ich an der Reihe. Er verwendete doppelt so viel Zeit auf meinen Oberkörper wie auf mein Gesicht. Vielleicht war er aus der Textilbranche und studierte das Gewebe meines Rollkragenpullis.
Nein, war er nicht.
»Ich bin Bauunternehmer«, sagte er.
Ich nickte. »Was kann ich für Sie tun?«, fragte ich.
»Äh …« Er zögerte. »Ich kann doch auf Ihre Verschwiegenheit zählen?«
»Diskretion ist unser Geschäft, Herr Kutzke.«
Er rückte seinen Stuhl näher. Ich beugte mich vor, um ihn zu ermutigen. Er roch nach Rasierseife.
Er kratzte sich den Handrücken und schaute an mir vorbei auf das Bild von Mendelssohn-Bartholdy. »Ja, also, ich brauche jemanden, der meine Firma unter die Lupe nimmt.«
»Wirtschaftsprüfer?«
»Nein, nein, es geht um die Mitarbeiter.«
»Motivationstrainer?«
Er schüttelte den Kopf. »Es geht um die innere Einstellung, die Eignung.«
»Vielleicht brauchen Sie einen Psychologen.«
»So ähnlich.« Kutzke nickte ganz langsam. »Es muss jemand sein, der unbemerkt Fragen stellt und bestimmte Informationen liefern kann.«
»Klingt schon eher nach Detektiv. Um welche Informationen geht es denn?«
Er senkte die Stimme: »Da haben sich ein paar Gewerkschafter eingenistet. Normalerweise verpflichten sich unsere Mitarbeiter, auf die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft zugunsten eines internen Betriebsratsmodells zu verzichten. Wir haben ja praktisch Mitbestimmung in unserem Unternehmen, jedenfalls bei den ständig Beschäftigten: Der Betriebsrat ist paritätisch mit Vertretern der Unternehmensleitung und der Angestellten besetzt, alles vertrauensvolle Leute, die ich persönlich auswähle. Aber jetzt soll dieses bewährte Modell ausgehebelt werden. Dann sind wir ruiniert, das weiß ich jetzt schon. Ich muss unbedingt herausfinden, wer uns diesen Streich spielt.«
»Einen Betriebsrat zu gründen ist doch gesetzlich erlaubt.«
»Aber doch nicht in einem Unternehmen mit gerade mal 60 Mitarbeitern. Das sind doch größtenteils Saisonkräfte aus Polen! Die schuften ein paar Monate, dann verschwinden sie in den Osten und irgendwann stehen sie wieder auf der Matte.«
»Ich bin keine Juristin, Herr Kutzke, und das ist auch nicht mein Fachgebiet.«
Er legte einen Ellbogen auf die Tischplatte, kam näher. Ich lehnte mich zurück. Er roch nicht nur nach Seife, sondern auch nach Schweiß. Jetzt heftete er seinen Blick wieder auf meinen Oberkörper. Ich nahm einen Schluck Yogi-Tee und blieb gelassen. Was konnte dieser arme testosterongepeinigte Dickwanst schon dafür, dass die Damenmode enge Tops verlangte? Ich hatte ja nicht grundsätzlich was dagegen, aber lieber ließ ich mich von einem sympathischen Kerl begutachten.
»Eine Frau wäre vielleicht genau das Richtige«, sinnierte Kutzke. »Da kommen die nie drauf. Und dann schmeiß ich sie raus.«
»Wen?«
»Das sollen Sie doch herausfinden.«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. Er runzelte die Stirn. Ich schüttelte den Kopf: »Das ist nichts für mich.«
»Nur keine Angst. Sie müssen nicht malochen, dafür sorge ich schon.«
»Darum geht es nicht.«
»Ich zahle hundert Euro die Stunde«, rief er und fügte raunend hinzu: »Steuerfrei, wenn Sie mögen.«
»Nein.«
»Nein?«, fragte er verblüfft. »Warum? Keine Zeit? Dann schicken Sie jemand anderen. Sie haben doch Mitarbeiter?« Er schaute sich um.
»Was Sie da vorhaben ist eine Schweinerei, deshalb mache ich nicht mit.«
Er stand auf und stemmte die Arme auf die Tischplatte.
»Schweinerei? Was soll das heißen? Es ist meine Firma!«
»Wir müssen uns nicht darüber streiten. Suchen Sie sich einen anderen.«
»Das werde ich tun.« Er erhob sich, steckte den Elefantenschlips unters Jackett und knöpfte es zu.
Dann stand er da und glotzte mich wieder so komisch an. Ich stand auf, um ihn zum Gehen zu animieren.
Er leckte sich über die Oberlippe. »Sagen Sie mal, ist das hier wirklich Ihr Laden?« Er starrte an mir vorbei durch die Tür, die ins hintere Zimmer führte, mein privates Reich. Da stand mein Bett, ausnahmsweise ordentlich gemacht.
»Ja«, sagte ich. »Und dort ist die Tür.«
Anstatt sich umzudrehen, kam er auf mich zu.
»Sie sind doch eine ganz flotte Person«, sagte er. Jetzt, so direkt vor mir stehend, kam er mir doch nicht mehr so klein vor wie zu Anfang. »Und ich bin kein Kind von Traurigkeit.«
»Ich kann leider nichts für Sie tun, Herr Kutzke.«
»Ich würde mir das was kosten lassen«, sagte er.
»Ich bitte um Verzeihung, aber so jemanden wie Sie würde ich nicht mal als Müllschlucker benutzen.« Ich ging an ihm vorbei. »Da entlang, mein Herr.«
Er folgte mir mit quietschenden Schritten.
Ich zog die Tür auf. Im gleichen Moment fühlte ich seine Hand an meinem Hintern. »Komm schon, Kleine«, sagte er heiser.
Das war dann doch zuviel. Ich wirbelte herum, packte seinen Arm, verpasste ihm eine schnelle Drehung und wollte die Bewegung weiterführen, um ihn kopfüber auf den Boden zu befördern, aber da stand plötzlich Tom in der Tür.
»Hallo, Lenina.«
Ich schubste ihm den Unternehmer entgegen. »Gib ihm einen Arschtritt und komm rein.«
Kutzke taumelte die Treppe hinunter und fluchte. Ich zog Tom herein und schloss die Tür.
»Wow!«, sagte Tom. »Was war das denn?«
»Scheiße war das. Ich hab mich schlecht benommen.«
»Echt?«
»Ich hätte ihn nicht Müllschlucker nennen sollen.«
»Wenn’s weiter nichts ist.«
DREI
Tom. Mein Assistent. Gelegentlich jedenfalls. Ehemaliger Nachbar aus der Holländischen Reihe. Motiviert, aber unzuverlässig. Ist ja auch nur ein Nebenjob für ihn. Ansonsten ist er ungefähr in der gleichen Branche beschäftigt wie ich: Sicherheitsdienst. Seit er zu SJM gewechselt ist, kämmt er sich die Haare, hat sogar einen Scheitel. Obwohl er seine neue Uniform manchmal sogar in der Freizeit trägt, sieht er immer unordentlich aus. Es muss an seinem Knochenbau liegen: Bei ihm ist alles schiefer und lockerer zusammengebaut als bei anderen. Inzwischen trinkt er nur noch an freien Tagen. Davon hat er allerdings genug, denn er ist nur geringfügig beschäftigt. Nach einer Sauftour ist er immer besonders begriffsstutzig.
»Wieso kommt einer von der Müllabfuhr zu dir hoch?«, fragte er.
»Ich hab ihn Müllschlucker genannt, weil er mich geärgert hat.«
»Ach so.«
»Ist wohl gestern später bei dir geworden?«
»Hab doch heute meinen freien Tag. Was wollte der Typ denn?«
»Mit mir ins Bett.«
Tom riss die Augen auf: »Echt? Hast du jetzt mit solchen …«
»Quatsch. Eigentlich wollte er mir einen Auftrag geben. Aber der hat mir nicht gefallen. Seine Beschäftigten ausspionieren, um eine Betriebsratsgründung zu verhindern.«
»Klingt doch ganz locker.«
Ich seufzte. Das war das Problem mit Tom. Er hatte keine Moral.
»Oder hast du zuviel zu tun?«, bohrte er weiter. »Ich hab da noch Kapazitäten frei, falls du Bedarf hast.«
»Du meinst, du hast deinen letzten Lohn schon wieder verjubelt.«
»Na ja, es ist spät geworden gestern. Heute Abend muss ich wieder Baustellenaufsicht spielen.«
»Vom Bau war der Typ eben auch. Kutzke hieß der.«
Tom wurde ganz zappelig. »Echt jetzt? Ach du Scheiße! Hat der mich gesehen? Das gibt’s doch gar nicht! Mann, hab ich ein Pech. Wenn der mich erkannt hat, schmeißt er mich raus. Ich hab ihm einen Arschtritt verpasst. O Gott!«
Im Lamentieren war Tom ein Naturtalent. Seine Körpersprache war großartig. Er sah plötzlich aus wie eine Trauerweide nach einem Wirbelsturm. Ich schob ihm einen Stuhl hin. Er ließ sich drauffallen und jammerte weiter. Sein Kopf wackelte hin und her wie bei einem dieser Hunde, die manche Leute auf der Hutablage in ihrem Auto stehen haben. Ein Wackeldackel.
Schließlich hob er den Kopf: »Hast du ’n Bier für mich, Lenina?«
»Yogi-Tee.« Ich deutete auf die Thermoskanne auf dem Schreibtisch.
»Echt kein Bier?«, fragte er ungläubig und sah zu meinem Kühlschrank hinüber. Er wusste, dass ich immer ein Sixpack für ihn da hatte. Und er wusste auch, dass ich mich ärgerte, wenn er fünf davon innerhalb einer Stunde leer soff und mir dann Geld anbot, um mir die sechste Dose auch noch abzuluchsen. Und ich ärgerte mich darüber, dass ich überhaupt Bier gekauft hatte und ihm nach fünf Dosen mit dem moralischen Zeigefinger kam.
Es war eine Standardsituation. Ich seufzte. »Ist noch ’ne Dose drin.«
Tom sprang auf und flitzte zum Kühlschrank. »Ist ja ein ganzes Sixpack.«
»Nimm dir eine, Tom! Und verbeul sie nicht. Sonst krieg ich kein Pfand zurück.«
Er zerrte eine Dose aus der Packung. »Pfand?«
Er ließ sich wieder auf den Stuhl fallen, zog den Verschluss auf und nahm einen tiefen Schluck, mit dem er die Dose wahrscheinlich halb leerte.
Ich verzog mich hinter den Schreibtisch.
Tom legte entspannt ein Bein übers andere und sagte: »Ich brauch einen Job, Lenina.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Sieht schlecht aus. Zu den Punks wolltest du ja nicht mit.«
Er hob abwehrend die Dose. »Nee, nee, die sind mir zu assi.«
»Was sind die?«
»Asozial.«
Wer ist denn das nicht heutzutage, dachte ich.
»Irgend ’nen Job, Lenina.« Tom zerknüllte die Dose. »Ich brauch Kohle.«
»Eben hast du 15 Cent zerdrückt.«
Er schaute auf die Dose. »Tschuldigung. Darf ich noch eine?«
»Die letzte, Tom.« Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Ich stand auf, um noch einen Tee aufzubrühen.
»Ich hab nichts für dich, Tom. Der einzige Fall, der noch in Arbeit ist, ist diese Suchaktion nach dieser promiskuitiven Mutter.«
»Promi- was?« Zack, die Dose war auf.
»Eine, die mit jedem ins Bett geht, wenn sie mal wieder diesen Rappel kriegt. Die Familie will sie zurückhaben.«
»Das wär doch vielleicht was für mich.«
»Mach ich selbst.«
»Hm.«
Betretenes Schweigen. Biergluckern. Das heiße Wasser fing an zu brodeln. Ich griff nach der Teeschachtel mit der belebenden Mischung.
»Sobald was reinkommt, ruf ich dich an.«
»Mein Handy ist abgemeldet.«
»Ich find dich auch so.«
Er stemmte sich aus dem Stuhl. Jetzt war er entspannt. Und seine Knochen schienen noch mehr in Unordnung geraten zu sein.
»Darf ich noch eins auf’n Weg?«
»Meinetwegen.«
Er nahm alle vier.
»Eine«, sagte ich streng.
»Ach komm, Lenina. Ich bezahl sie dir, wenn ich wieder flüssig bin.«
»Ich will kein Geld. Stell sie zurück!«
Er stellte die Packung auf den Küchentisch, zerriss den Karton, nahm die Dosen raus und stellte eine zurück in den Kühlschrank. Dann grinste er mich scheel an, klemmte die drei anderen unter den Arm und huschte zur Tür. »Schmarotzer!«, rief ich ihm nach, aber da klappte die schwere Eisentür schon zu, und er war weg.
Am Abend sahen wir uns wieder. Draußen. Auf freier Wildbahn. Ich war ziemlich frustriert mit der letzten S-Bahn nach Altona zurückgekommen, nachdem ich die verschwundene Frau in einem Swinger-Club und im Laufhaus an der Reeperbahn gesucht hatte. Diese Partnertausch-Institutionen nervten mich. Wahrscheinlich lag es an den Männern, die dort mit ihren Schwänzen hausieren gingen wie Staubsaugervertreter. Vielleicht fühlte ich mich einfach nur schlecht, weil ich Single war. Hätte ich Philipp mitnehmen sollen? Womöglich hätte der sich von einer angetrockneten Ibiza-Blondine abschleppen lassen und ich hätte einen rasierten Gorilla mit Lederhaut und Goldkettchen abbekommen.
Aber geh da mal allein hin als Frau! Ich hatte mir extra ein spezielles Mantra ausgesucht, das ich innerlich vor mich hinmurmelte, um nicht schlecht draufzukommen, während ich das Bild der Gesuchten umherzeigte. Auch ein paar fiese Handgriffe gegen Tätschler und andere Zudringliche hatte ich mir überlegt. Aber es gibt ja genug Biedermänner, die es toll finden hart angefasst zu werden. Ergebnislos und völlig geschafft machte ich mich schließlich auf den Heimweg.
Der Regen hatte aufgehört. Der Boden war noch nass und glitschig. Es hatte sich merklich abgekühlt. Vor den grellen Schaufenstern eines Modegeschäfts stand ein Mann und verkaufte Trödelkram, ein abgehalfterter Hippie mit Gitarre hockte in einem Hauseingang und sülzte einen Country-Song. Untergehakte Mädchen suchten nach Abenteuern im Ottenser Nachtleben, eine Gruppe Jungs beriet, wo sie die nächsten Flaschenbiere kaufen wollten, zwei spätgeborene Punks mit Sicherheitsnadeln im Ohrläppchen hauten alle um Geld an. Ich gab jedem fünfzig Cent, um Buddha, Allah, Krischna, Vischnu, Jesus und wie sie alle heißen milde zu stimmen und mir ein günstiges Karma mit angenehmem Kismet zu erkaufen und entdeckte Tom. Er lag über den Knien einer alten Frau.
Es gibt auf dem Spritzenplatz eine Skulptur. Sie besteht aus zwei Frauen, einer jungen, die durch einen angedeuteten Torbogen spaziert und einer alten, die einfach nur dasitzt. Warum dieses Kunstwerk da steht, und was es bedeuten soll, außer dass jemand geht und jemand sitzt, weiß ich nicht. Man fragt nicht nach dem Sinn von etwas, das man jeden Tag im Vorbeigehen wahrnimmt, es ist einfach da.
Nun war Tom auch da. Es sah so aus, als versuchte er sich zu übergeben.
»He, Tom! Was soll das denn werden?«
Er drehte den Kopf in meine Richtung, schaute zu mir hoch und murmelte lallend: »Scheiße, Lenina.« Seine Mutter hätte er auch nicht anders begrüßt.
»Soll ich dir aufhelfen?«
»Lass mich bloß in Ruhe«, nuschelte er.
»Ist ein bisschen kalt, um hier herumzuliegen.« Und schlecht für’s Renommée, dachte ich, wenn dein Assistent hier unter den Augen der potenziellen Kundschaft verwahrlost. Schließlich war ich so was Ähnliches wie eine Stadtteil-Detektivin.
»Steh auf, Tom. Ich bring dich nach Hause.« Ich packte ihn am Arm und zog ihn hoch.
»Lass mich!« Er riss sich los. »Ich unterhalte mich gerade.«
»Was?« Ich gebe zu, ich war ein wenig zudringlich, als ich ihn jetzt schon wieder am Ärmel packen wollte.
Er wich aus und streckte abwehrend die Arme aus: »Geh weg!«
»He, he, he! Was ist denn los«, tönte es neben mir. Die beiden Punks waren herbeigeschlendert. Offenbar waren sie gut gelaunt und suchten nach Möglichkeiten, dies andere spüren zu lassen. »Hat diese Frau Sie belästigt?«, fragten sie Tom.
Tom sah sie an: »Schnauze, ihr, ihr …«
»He, he …«, sagte der eine.
»Was wolltest’n eben sagen?«, fragte der andere.
»Lasst mich, ihr, ihr … Bettler.«
Die Punks sahen sich verblüfft an. Tom drehte sich um und taumelte so schnell er konnte auf die geöffnete Tür der Gaststätte Möller zu.
»Der wollte uns beleidigen«, stellte der eine Punk fest. »So ein Würstchen.«
»Wenn er rauskommt, knöpf ich ihn mir vor«, sagte der andere.
»Lasst ihn in Ruhe«, sagte ich.
»Ist das dein Vater oder was?«
»Eher mein Sohn.«
Damit ließ ich sie stehen und ging auf die Kneipentür zu. Ich hatte das Gefühl, mich kümmern zu müssen. Unnötigerweise.