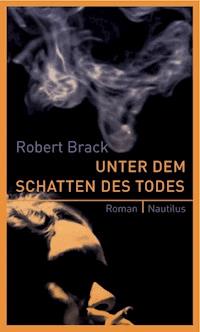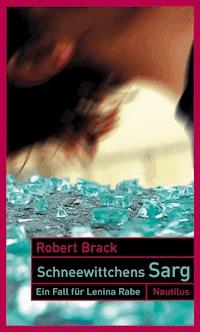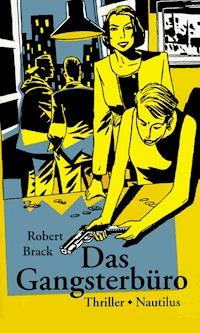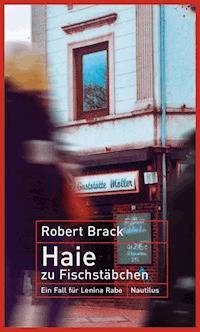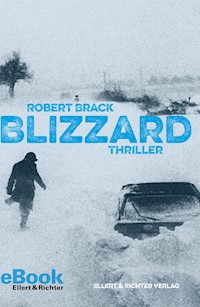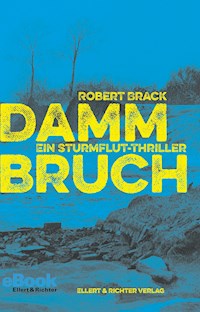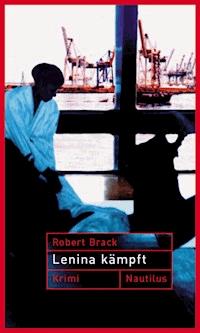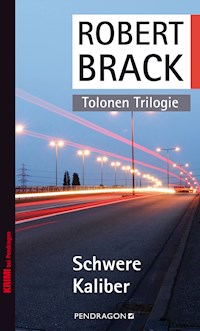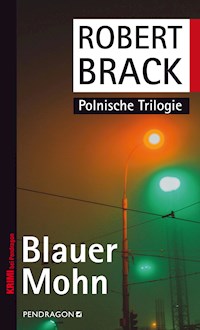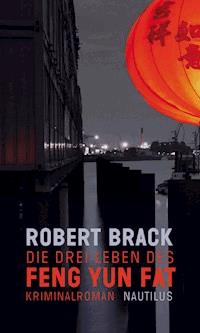
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Lenina Rabe
- Sprache: Deutsch
Lenina Rabe ist zurück: Hamburgs chinesische Köche schließen sich zu einer Gewerkschaft zusammen. Doch sie haben nicht mit dem Widerstand der mafiösen Restaurantbesitzer gerechnet … Feng Yun Fat, Inhaber des China-Restaurants "Hongkong-Drache" in Hamburg-Altona, beauftragt das Detektivbüro Rabe & Adler, seinen besten Spezialitätenkoch Wang Shuo zu suchen, der spurlos verschwunden ist. Dabei wollte Yun Fat ihm die Leitung eines neuen Gourmet-Lokals übertragen und ihn zum Küchenstar machen. Lenina Rabe und ihre Partnerin Nadine Adler, die mit konfuzianischen Sprichwörtern ebenso zackig um sich werfen, wie sie asiatische Kampfschläge austeilen können, stoßen bei der Gemeinschaft der chinesischen Köche jedoch auf unerklärliche Ablehnung. Bald erfahren sie von einer Sonderregelung für asiatische Spezialitätenköche, die zwar die Erteilung einer Arbeitserlaubnis erleichtert, sie aber dem Inhaber des Restaurants, der für ihre Einreise sorgt, auf Gedeih und Verderb ausliefert. So herrschen im Untergrund des bunten chinesischen Restaurantbetriebs sklavenähnliche Bedingungen. Auch Yun Fat entpuppt sich schnell als viel weniger großherzig, als es zunächst schien. Offenbar hat Wang Shuo eine Widerstandsbewegung und Meuterei der chinesischen Köche angestiftet. Das missfällt nicht nur den Restaurantbesitzern, sondern auch der Eight Treasures Inc., einer großen und offenbar mächtigen Organisation. Die betreibt hinter der Fassade des Lebensmittelgroßhandels ganz andere Geschäfte und schreckt vor keinem Anschlag zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Brack, Jahrgang 1959, lebt in Hamburg. Er wurde mit dem »Marlowe« der Raymond-Chandler-Gesellschaft und dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Zuletzt erschienen in der Edition Nautilus drei Romane über die politischen Verhältnisse in der Weimarer Republik: Und das Meer gab seine Toten wieder beschreibt einen Polizeiskandal aus dem Jahr 1931, Blutsonntag befasst sich mit den Ereignissen im Juli 1932 in Altona, Unter dem Schatten des Todes beschreibt die Hintergründe des Reichstagsbrands 1933 in Berlin. Mit Die drei Leben des Feng Yun-Fat kehrt der Autor in die Gegenwart zurück und knüpft an seine drei Lenina-Rabe-Kriminalromane Lenina kämpft, Haie zu Fischstäbchen und Schneewittchens Sarg an. Weitere Abenteuer von Rabe & Adler sollen folgen.
ROBERT BRACK
DIE DREI LEBEN DES FENG YUN-FAT
KRIMINALROMAN
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg
Schützenstraße 49 a · D-22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 2014
Originalveröffentlichung · Erstausgabe Februar 2015
Die Zitate aus dem Tao te king folgen
der Übersetzung von Richard Wilhelm
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
Autorenporträt Seite 2: Charlotte Gutberlet
Druck und Bindung:
Beltz Bad Langensalza
1. Auflage
Print ISBN 978-3-89401-813-9
E-Book ePub ISBN 978-3-86438-170-6
Inhalt
Kapitel 0.
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 11.
Kapitel 12.
Kapitel 13.
Kapitel 14.
Kapitel 15.
Kapitel 16.
Kapitel 17.
Kapitel 18.
Kapitel 19.
Kapitel 20.
Kapitel 21.
Kapitel 22.
Kapitel 23.
Kapitel 24.
Kapitel 25.
Kapitel 26.
Kapitel 27.
Kapitel 28.
Kapitel 29.
Kapitel 30.
Kapitel 31.
Kapitel 32.
Kapitel 33.
Kapitel 34.
Kapitel 35.
Kapitel 36.
Kapitel 37.
Kapitel 38.
Kapitel 39.
Kapitel 40.
Kapitel 41.
Kapitel 42.
0.
Explosion.
Wie fühlt sich das an? Wenn man mittendrin ist?
Bedrohlich.
Klar.
Unbegreiflich. Beängstigend.
Logisch.
Zwei Druckwellen, die erste in der Luft, die zweite in deinem Kopf.
Zwei Erschütterungen. Die erste um dich herum, die andere ganz tief in dir drin.
Schlagartig bist du taub. Und spürst diesen Druck im Kopf, obwohl er eigentlich von außen kommt.
Sofort wird dir schlecht. Nein, nicht sofort. Erst ein bisschen später. Zuerst bist du starr vor Schreck, wobei das Wort Schreck wie ein Scherz klingt, es ist ja viel schlimmer. Panik passt besser. Und dann Todesangst. Du wirfst dich zu Boden (Nadine) oder in eine Ecke (Lenina) und hoffst, dass das alles nicht wahr ist. Stellst fest, dass es doch wahr ist und fängst an zu zittern, zu keuchen. Zu wimmern (Nadine) oder zu würgen (Lenina).
Bis dir ein Gedanke kommt: Vielleicht war das nicht alles? Vielleicht fliegt gleich noch so eine Ladung herein und geht hoch? Und zerfetzt diesmal nicht nur den Schreibtisch aus vielen Kilogramm schweren Holzplatten, sondern die anwesenden Personen.
»Raus hier! Schnell!«
»Ich kann nicht, ich kann nicht!«
»Los, hoch!«
Gesprochene, aber nicht gehörte Worte.
Lenina zerrt Nadine hoch. Sie knickt weg, ihre Beine versagen. Sie hängt an ihr wie ein Sack Kartoffeln. Lenina zerrt den Kartoffelsack durch die Rauch- und Staubschwaden.
Beide müssen husten. Überall Trümmer und Schutt.
Es ist mörderisch.
Ja, genau.
Ein Mordanschlag.
Den Aufzug im Brandfall nicht benutzen.
Um sie herum, das bemerken sie jetzt, rennen Leute das Treppenhaus hinunter. Haben die auch was abgekriegt? Galt der Angriff vielleicht gar nicht ihnen? Haha. Träum weiter.
Der nette Dicke aus der Fotoagentur gegenüber hilft Lenina, Nadine die Treppe runterzuschleppen. Er ist bleich, gelblich bis grau im Gesicht. Um sie herum reden die Leute hektisch: Was war das? Was ist passiert? Gasexplosion? O Gott, ich hab meine Tasche oben vergessen! Mein Handy! Meine Jacke! Die Autoschlüssel! Das Smartphone!
Draußen setzen sie sich auf das Mäuerchen gegenüber oder auf eine der Bänke oder bleiben stehen. Schauen ängstlich die Backsteinwand hoch. Aus einem geborstenen Fenster dringen dünne Rauch- oder Staubschwaden. Hier und da zündet sich jemand eine Zigarette an. Einige tippen auf ihren Handys herum. Manche wählen 112 oder 110. Ist nicht mehr nötig, Blaulicht und Martinshorn nähern sich. Nadine macht sich los und geht mit unsicheren Schritten nach vorn bis zur Brüstung. Toller Blick auf die Elbe und den Hafen. Fähren und Barkassen tuckern vorbei. Ein Dreimaster mit weißen Segeln. Blauer Himmel, Sonnenschein. Der perfekte Tag für einen Granatenangriff auf das Detektivbüro Rabe & Adler.
1.
»Die haben nur eine Granate abgefeuert«, sagt Nadine. »Das bedeutet, sie wollten uns nicht umbringen. Es war nur eine Warnung.«
»Nur eine Warnung? Sieh dir mal unser Büro an! Dass wir unverletzt geblieben sind, ist ein Wunder.«
»Trotzdem.«
Lenina weiß, sie hat Recht.
Abends sitzen sie im Café. Immer noch mit diesem Pfeifen im Ohr. Nadine hat einen Nachruf auf ihren zerfetzten Schreibtisch ausgesprochen, sie haben mit den Biergläsern angestoßen und dann zwei Wodka dazubestellt. Seit der Explosion sind sie auf hundertachtzig und kommen nicht runter. Bei der Zeugenaussage auf der Polizeiwache haben sie sich zusammenreißen müssen, um nicht von ihrem aktuellen Fall zu reden. Alles herunterspielen, den Zufall bemühen, die Ratlosen mimen.
Keine Ahnung. Aus heiterem Himmel.
Ja, das Ding kam durchs Fenster.
Eine Granate? Im Ernst? Professionell mit einem Mörser abgefeuert? Wer tut denn so was?
Nee, wir haben nur mit banalen Fällen zu tun. Sie wissen ja, Scheidungssachen, Beziehungsprobleme, Personen- und Objektschutz in bescheidenem Rahmen, Entlastungs- oder Belastungsmaterial für Anwaltskanzleien beschaffen. Alltagsgeschichten. Nichts, wofür jemand einen Bürgerkrieg vom Zaun bricht.
»Wie kommen Sie auf Bürgerkrieg, Frau Rabe?«
Na ja, Mörsergranate, da hat man doch gleich diese Bilder aus den Nachrichten im Kopf.
»Aber in Hamburg herrscht kein Bürgerkrieg, Frau Rabe.« Was noch die Frage wäre, aber Lenina wollte sich nicht auf eine politische Diskussion einlassen über globalisierten Handel, Ausbeutung von Arbeitskräften in Übersee, das Mafia-Gebaren der kapitalistischen Unternehmen und die daraus resultierende Gewaltbereitschaft der Erniedrigten und Beleidigten, die die europäischen Metropolen als Zielscheiben entdecken…
Der Kripomann hob ungeduldig die Hand. »Hören Sie…« Nadine unterbrach ihn: »Haben Sie denn herausgefunden, von wo die Granate abgefeuert wurde?«
»Wissen Sie, wie lange unsere Ballistik-Experten brauchen, um die Flugbahn einer zerfetzten Granate zu ermitteln? Und ich meine, genau zu ermitteln, denn mit vagen Vermutungen ist uns nicht geholfen, wir können ja nicht auf bloßen Verdacht hin den ganzen Containerumschlag lahmlegen.«
»Bis Sie überhaupt anfangen, ist das Schiff, von dem die Granate abgefeuert wurde, längst auf hoher See«, nörgelte Nadine.
Lenina trat ihr unterm Tisch gegen das Schienbein.
Der Kommissar schaute die beiden Frauen mit einer Mischung aus professionellem Misstrauen, patriarchalischem Mitleid und sorgenvoller Ratlosigkeit an.
»Gehen Sie mal davon aus, dass es ein Unfall war. Ich meine in dem Sinne, dass unser Fenster zufällig getroffen wurde«, sagte Lenina.
»Sie meinen in welchem Sinn?«
»Das Ding ist losgeflogen und irgendwo gelandet«, erklärte Lenina.
»Sie meinen im Sinn von: dumm gelaufen?«
»So ungefähr.«
Er strich sich mit der Hand über den kahl rasierten Schädel und nickte vor sich hin.
»Dumm gelaufen kommt ja ziemlich häufig vor in unserer komplexen Welt«, fügte Nadine überflüssigerweise hinzu.
»Stellt sich nur die Frage, wieso jemand einen Mörser im Hafen aufstellt und mit einer Granate lädt.«
»Produktdemonstration«, sagte Nadine.
»Hä?«, machte der Kripomann.
»Der Hamburger Hafen ist ein großer Umschlagplatz für Kriegsgeräte aller Art und zwar in legalen und illegalen Geschäften. Da ist es doch nachvollziehbar, dass ein interessierter Kunde sich ein Gerät zeigen lässt, bevor er es containerweise einkauft.«
»Das finden Sie nachvollziehbar?«
»Jedenfalls nachvollziehbarer als der Gedanke, dass jemand in voller Absicht das Büro von zwei harmlosen Frauen beschießt, oder?«
Der Kripomann nickte bedächtig. »Vielleicht. Wobei Sie nicht unbedingt einem harmlosen Beruf nachgehen.«
»Trotzdem«, sagte Nadine, »erstatten wir Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung.« Und an Lenina gewandt ergänzte sie: »Wegen der Versicherung.«
»Was ist denn alles kaputtgegangen?«
»Nur ein alter Schreibtisch«, sagte Nadine. »Deutsche Eiche, wenn ich das mal so sagen darf, ein Erbstück, hat den Zweiten Weltkrieg überdauert, aber nun … da sieht man mal, in welchen Zeiten wir leben.«
»Vergessen Sie das mit der Versicherung«, sagte der Kripomann. »Das bringt nur einen Haufen Papierkram mit sich, und am Ende zahlen sie nichts oder einen symbolischen Betrag, weil der Wert nicht zu schätzen ist, aber den Versicherungsbetrag erhöhen sie auf jeden Fall. Und das könnte in diesem Fall teuer werden – eine Detektivagentur mit Fenstern zum Hafen, wo die ganze Zeit Kriegsgerät umgeschlagen wird.« Er grinste süffisant.
»Wir müssen los«, sagte Nadine. »Der Glaser wollte noch kommen.«
Das Ding war nämlich durchs Fenster gekommen. Weshalb sie Panzerglas erwogen, aber das wäre zu teuer. Außerdem kann man Backsteinwände ziemlich leicht durchschießen.
Nachdem der Glaser Maß genommen und Folie vor das kaputte Fenster genagelt hatte, blickten sie durch das Fenster der Teeküche, das heil geblieben war, nach draußen über die Elbe auf die Docks von Blohm & Voss, die Kräne, die Containerhalden. Nadine deutete auf den elegant geschwungenen Schattenriss der Köhlbrandbrücke: »Von dort können sie auch gefeuert haben, muss ja nicht direkt im Hafen gewesen sein.« Ihre Hand zitterte immer noch. Nadine ließ die Rollos herunter. Sie schauten sich an. Ihnen war mulmig zumute.
Nadine zählte die anstehenden Maßnahmen an den Fingern ab. »Wir trinken jetzt ein Bier.« (Daumen) »Und einen Schnaps.« (Zeigefinger) »Ich rauche ein paar Zigaretten.« (Mittelfinger) »Du schluckst ein Beruhigungsmittel.« (Ringfinger) »Und ich nehme ein paar Tabletten gegen meine Kopfschmerzen.« (Kleiner Finger)
Sie sitzen im Café, sind immer noch aufgedreht und kommen nicht runter. Die Folge ist, dass sie zu viel trinken (Lenina), zu viel rauchen (Nadine) und später einige Klubs aufsuchen, in denen sie schon seit ewigen Zeiten nicht mehr waren, zum Beispiel den Rotters’ Club oder das Espace. Nadine lässt sich irgendeine Pille andrehen und Lenina kriegt immer mehr Durst von dem ganzen Bier. Es nimmt kein gutes Ende. Sie verabschieden sich blass und taumelnd am Taxenstand und versprechen sich gegenseitig, dass sie morgen früh zu gewohnter Zeit im Büro sein werden, ein bisschen ängstlich, dort allein einzutreffen, schutzlos den traumatischen Erinnerungen oder dem nächsten Granatenangriff ausgeliefert.
Keine ist pünktlich.
Nur der Typ, mit dem sie verabredet waren, kam. Aber der wurde von jemandem aus dem Nachbarbüro über die Explosion aufgeklärt und verschwand eilig wieder.
Sie treffen sich nach eins zum Frühstück im Café gegenüber, bekommen kaum was herunter, schauen unschlüssig zu der großen, zweiflügeligen Tür des alten Kontor-Gebäudes aus dunklem Backstein. Stellen sich vor, wie sie durchgehen, in die bunt gekachelte Eingangshalle, den altertümlichen, aber tipptopp renovierten Aufzug betreten und nach oben sausen, direkt vor ihre Tür, die, nachdem sie den Schlüssel ins Schloss gesteckt haben, in drei Milliarden Einzelteile zerbirst, während sie als rohe Fleischbällchen über die Elbe geschleudert werden.
Alles nur Phantasie.
Sie sind nicht mehr dafür, dass die Phantasie an die Macht kommt.
Angstträume gehören in Ketten gelegt und ins Verlies verbannt.
Sagt Lenina.
Aber, hätte Nadine früher gesagt, das ist keine Lösung. Man muss die Angst überwinden, die Träume beherrschen.
2.
»Hast du den Knall eigentlich gehört?«
»Welchen Knall?«
»Die Explosion.«
»Ja, klar, das war…«
»Eben nicht, da war nichts. Nur dieser Druck. Alles flog durch die Gegend, geräuschlos, wie in einem Stummfilm.«
»Ich hab immer noch so ein Fiepen im Ohr.«
»Siehst du.«
»Siehst du was?«
»Keine Ahnung. Lass uns mal aufräumen.«
Besen, Staubsauger, Kehrblech. Staubtücher. Besser sind nasse Lappen, Putzlumpen. Abgeplatzter Putz, Risse in den Wänden. Stuck, der von der Decke gefallen ist. Und natürlich ist Nadines Bildschirm zerplatzt. Leninas Laptop mit dem Aluminiumgehäuse war zugeklappt und ist heil geblieben, obwohl zwei Beine ihres Ikea-Schreibtischs abgebrochen sind und er zur Seite gekippt ist. Laptop auf dem Boden, aber nicht mal eine Beule. Das Regal mit den Akten ist eingestaubt. Der Drucker und der kleine Büroserver, der Scanner und das Faxgerät sowie andere technische Details sind im »Technikraum«, also dem Kabuff nebenan, und glücklicherweise unversehrt.
Die Pinnwände mit den zahllosen Zetteln, Notizen, Visitenkarten, Rechnungen, Mahnungen, Urlaubsgrüßen und Zeitungsausschnitten und Schnipseln sind runtergefallen, alles liegt durcheinander. Beim Aufräumen fällt Lenina Nadines schon etwas verblichener Wahlspruch in die Hand: »Das Sein bestimmt das Bewusstsein, und wenn nicht, dann eben andersrum oder sonstwie.«
Sie findet ein vergessenes Rezept für Hustensaft und einen alten Benachrichtigungszettel der Bücherhalle: »Ihr Bürgerliches Gesetzbuch liegt für Sie zur Abholung bereit.« Lange her. Inzwischen haben sie alle Gesetzessammlungen griffbereit auf dem Regal neben den Schreibtischen an der Wand – wenn sie es wieder festgeschraubt haben: BGB, GG, Europäisches Recht, Völkerrecht, Menschenrecht, Seerecht, Umweltrecht, Kriegsrecht, internationales Strafrecht, Ausländerrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Abfallrecht, Aktienrecht, Bankrecht, Datenschutzrecht, Zwangsvollstreckungsgesetz, Beamtenrecht, Betreuungsrecht, Sozialgesetzbuch, Energierecht, Jugendrecht, Familienrecht, Genossenschaftsrecht, Baugesetzbuch, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Gesundheitsrecht, Lebensmittelrecht, Mietrecht, Nachbarrecht, Naturschutzrecht, Strafvollzugsgesetze, Tierschutzrecht, Urheberrecht, Waffenrecht, Wettbewerbsrecht, Luft- und Weltraumrecht, ArbG, HGB, CompR, BImSchG…
Gelegentlich schlagen sie was nach. Das bringt der Beruf so mit sich. Für juristische Spitzfindigkeiten verlassen sie sich allerdings auf ihren Hauptauftraggeber Dr. Jonni Simonson, eigentlich Johannes, aber er findet Jonni cool. Meint, das passt zu Hamburg. Lenina meint, der Vorname passt zu seinen meist zu bunten Krawatten. Nadine meint, er sieht toll aus und ist cool. Lenina findet ihn mindestens zwanzig Zentimeter zu groß, und dass dieses Schlaksige, Jungenhafte ihm in zwanzig Jahren gar nicht guttun wird, er geht ja jetzt schon gebeugt – ständiger Anlass zu Streit bei Rabe & Adler in langweiligen Zeiten, wenn mal wieder kein Fall vorliegt und sie sich nach einem Anruf von ihrem Hauptauftraggeber sehnen.
Der Anruf kommt jetzt. Erstaunlicherweise ist ihre Telefonanlage noch funktionstüchtig. Auf dem Display steht: JONNI. Lenina schaltet auf Konferenz.
»Agentur Rabe und Adler, guten Tag.«
»Hallo Lenina, bist du’s?« («Wieso fragt er eigentlich immer nach dir zuerst?«, nörgelt Nadine manchmal in düsteren Momenten, heute allerdings nicht.)
»Wir sind’s beide.«
»Oh, äh, hallo … wie läuft’s denn bei euch so?«
»Wir haben die Fenster auf. Eine leichte Brise weht von Westen her. Die Bergungsarbeiten gehen voran.«
»Ah, das beruhigt mich. Ich hab nämlich gehört, es soll irgendwo in eurer Nachbarschaft … Was meinst du mit Bergungsarbeiten?«
»Kopftücher, Arbeitskittel, in die Hände spucken.«
»Was willst du damit … war das bei euch … die Explo-, Deton-, dieser Vorfall?«
»Richtig erkannt.«
»Oh.«
Nadine schaltet sich ein: »Uns ist nichts passiert, Jonni.«
»Plastik vor den Fenstern, ein massakrierter und ein invalider Schreibtisch, ein toter Bildschirm, alle Gesetze liegen im Staub, Tinnitus-Syndrom und viele offene Fragen.«
»Ich komm vorbei. Ich komm sofort vorbei. Nur noch drei Termine, vier, dann bin ich bei euch, abends, könnte etwas später werden. Euch geht’s doch gut oder?«
»Wir kommen schon klar.«
»Ruft die Versicherung an! Protokolliert den Schaden! Hat die Polizei alles aufgenommen?«
»Hör auf, Jonni, es ist halb so schlimm.«
»Gut, ich melde mich später noch mal.«
»Mach das. Tschüß, Jonni.«
Lenina legt auf. Nadine wirft ihr einen finsteren Blick zu: »Wieso fertigst du ihn so schnell ab? Er hätte ruhig kommen können. Schließlich arbeiten wir für ihn.«
»Aber der Fall, um den es hier geht, hat nichts mit der Anwaltskanzlei Simonson zu tun. Das dürfte auch ihm klar sein, falls er überhaupt gedacht hat, dass wir das Opfer eines gut geplanten Anschlags geworden sind.«
»Du meinst, er denkt, es war nur ein Unfall?«
»Was weiß ich. Ist doch egal, was er denkt. Mit ihm hat das alles nichts zu tun.«
»Vielleicht ja doch. Die Sache mit den Hell’s Angels letztes Jahr. Das könnte doch ein später Racheakt sein.«
Nadine denkt an ihren Undercover-Einsatz als blonde Rockerbraut. Es ging darum, eine entgleiste Bürgertochter aus den Pranken eines motorisierten Barbarenhäuptlings zu befreien.
»Rocker können mit Schlagring, Messer und Knarre umgehen, nicht mit Kriegsgerät.«
»Du meinst, wir stecken richtig in Schwierigkeiten?«
»Ja, klar. Trouble is our business.«
»Ray Chandler war kein Taoist.«
»Aber Phil Marlowe vielleicht.«
»Lass mal. Ich finde das nicht witzig.«
»Ich auch nicht. Komm jetzt. Lass uns mal die Granatsplitter zusammenfegen und die Löcher von den Querschlägern abgipsen. Hier sieht’s aus, als hätte man uns ins Jahr 1945 zurückversetzt.«
Was ihnen in diesem Moment zugute kommt, ist die Tatsache, dass sie die Fähigkeit haben, stumpfsinnige und monotone Arbeiten in eine Art Meditation zu verwandeln. Sie gehen derart darin auf, dass sie am Abend wieder ein superordentliches, in allen Details blitzsauber poliertes Büro haben. Nur die Fenster wirken noch leicht provisorisch mit der Folie, die sich im Wind bläht.
3.
Alles fing an mit einem Polizeiüberfall auf das China-Restaurant von Yun-Fat in Altona. Eigentlich war es ein Kommando der Zollfahndung. In Kampfanzügen und bis an die Zähne bewaffnet stürmten sie am späten Nachmittag das kleine Lokal mit dem Feuer schnaubenden Drachen auf dem Schild über der Tür. Lenina hatte gerade ihre Aikido-Klamotten aus der Reinigung gegenüber geholt und schaute verblüfft zu, wie die Beamten mit Maschinenpistolen im Anschlag die Tür eintraten (der Hongkong-Drache war geöffnet). Als sie wenig später Yun-Fat herauszerrten und dabei mit dem Polizeistab (offizielle, verniedlichende Bezeichnung für den Teleskopschlagstock aus Stahl) auf ihn einprügelten, wurde sie sauer. Es war eine Frau, die ihn, als er sich losmachen wollte, mit dem Stock in die Kniekehle schlug, so dass er zusammenklappte. Dabei war er schon gefesselt.
Nun bringt es ja herzlich wenig, sich diesen Damen und Herren in der Kampfmontur entgegenzustellen und von Menschen- und Bürgerrechten zu faseln. So etwas endet meist mit den Worten: »Gehen Sie aus dem Weg, Sie behindern die Arbeit der Vollstreckungsorgane, wir haben einen richterlichen Befehl« usw. Aber man kann die Arbeit der Beamten, die im Dienst der Allgemeinheit stehen, dokumentieren. Also holte Lenina ihr Handy raus, um alles zu fotografieren. Bei demokratisch gesinnten Polizeibehörden, denen Transparenz gegenüber ihren Bürgern wichtig ist, kann man sogar die Namensschilder der beteiligten Polizisten anzoomen. In Hamburg allerdings geht das nicht, weil die willigen Vollstrecker ihre Arbeit lieber anonym erledigen.
Irgendwann, nachdem sie dokumentiert hatte, wie sie Yun-Fat in den Transporter geschubst, getreten und geboxt hatten, stand ein massiger Kerl vor ihr, auf dessen schwarzer Strickmütze weiße Blockbuchstaben prangten und erklärten, dass er die EINSATZLEITUNG hatte.
»Geben Sie mir mal das Handy«, verlangte er. Deeskalationstraining machte sie ja praktisch jeden Tag. Insofern war die Situation keine Überraschung für sie. Geschicklichkeit und Fingerspitzengefühl waren hier gefragt.
»Handy? Welches Handy?«
»Das, was Sie da gerade in die Tasche geschoben haben.« Er deutete auf ihre ausgebeulte graue Jogginghose, die sie nur anhatte, weil sie tatsächlich gejoggt war. Im Joggingtrott war ihr eingefallen, dass sie ja noch die Aikido-Klamotten aus der Reinigung abholen musste.
Lenina drehte die Taschen der Jogginghosen um. Sie waren leer. Verärgerter Blick seitens des Beamten. Er deutete auf ihren Bauch: »Da.« Die Tasche, in der man sich selbst die Hand geben kann. Sie klopfte drauf. »Hier ist nichts drin.«
Er wusste nicht mehr weiter und wiederholte stumpfsinnig seine Aufforderung: »Geben Sie mir das Handy.« Er deutete auf die Tüte, auf der ein buntes Hemd eine gute Figur machte, und die Worte »Blitz« und »Sauber« leuchteten. Sie hatte die Hand durch den Plastikgriff der Tüte geschoben, als sie anfing zu fotografieren, so dass es schwer geworden wäre, das Handy da hineinfallen zu lassen. Sie nahm die Tüte vom Handgelenk, machte sie auf und ließ den Mann einen Blick hineinwerfen. »Ist nichts drin.«
Seine Hand zuckte vor. Lange Finger in schwarzen Lederhandschuhen. Sie zog die Tüte weg. »Sie sehen, es ist nichts drin.«
Sie hörten ein Klopfen und schauten beide nach links zum Transporter. Am Fenster war Yun-Fats Vollmondgesicht zu sehen. Er grinste, feixte, winkte und klopfte fröhlich gegen das Fenster. Bis eine Faust von hinten ihn gegen die Scheibe drückte und eine zweite von rechts mit voller Wucht seine Schläfe traf und er mit einem Aufschrei umkippte.
»Was zum Teufel…«, murmelte der Einsatzleiter und sprang zum Wagen.
Lenina drehte sich um und ging weiter. Ihr kam der Gedanke, dass die Milch zuhause wahrscheinlich sauer geworden war. Der Bio-Supermarkt war gleich nebenan und bot vielleicht nicht hundertprozentigen, aber doch einen gewissen Schutz vor Fäusten oder langen Fingern in schwarzen Handschuhen.
In der Schlange an der Kasse, beladen mit einer Milchtüte, zwei Joghurts, einer Packung Tofu und einer Flasche Bier, fiel ihr ein, dass sie etwas für Yun-Fat tun sollte. Sie rief Jonni an. Und wurde prompt zu einer jener Tussis, die einem in der Schlange vor der Kasse auf die Nerven gehen: kein Wagen, kein Korb, zu viel Zeug auf die Unterarme gestapelt, Handy am Ohr, reden und gleichzeitig nach der Kreditkarte suchen, obwohl der zu zahlende Betrag einstellig ist. Fehlte nur noch, dass sie allen Umstehenden versicherte: »Das ist ein Notfall.«
Was es ja war. Aber Jonni ließ sie auflaufen.
»Nee, Leni, keine Chinesen.«
»Wieso denn? Was soll diese rassistische Scheiße?«
»Hat damit nichts zu tun. Chinesen sind extrem kompliziert. Da gibt’s Spezialisten.«
»Er ist hier aufgewachsen. Er hat die deutsche Staatsbürgerschaft.«
»Bist du sicher?«
»Na ja. Seine Eltern sind vor Urzeiten eingewandert.«
»Hat nichts zu sagen. Und selbst wenn…«
»Die haben ihn zusammengeschlagen.«
»Das tut mir leid.«
»Du bist zynisch, rassistisch und…«
»Lass mal, Leni. Ich könnte nicht, selbst wenn ich wollte.«
»Hör bloß auf mit dem Gequatsche von Überarbeitung.«
»Nee, nicht deswegen. Aber die haben ihre Leute, und wer sich einmischt, kriegt Ärger.«
»Blödsinn, das ist ein netter Typ mit einem winzigen Restaurant. Ein kleiner Chinese…«
»Es gibt keine kleinen Chinesen.«
»Was soll das denn heißen?«
»Hinter jedem Chinesen, egal wo er lebt, stehen eine Milliarde Menschen, ein Riesenreich, eine gigantische Wirtschaft, ein riesiger Machtapparat und vor allem…«
»Hör auf! Das ist ja völlig bescheuert.«
Sie wollte ihn schon wegdrücken, da kam er damit:
»Hast du eine Ahnung, warum das Lokal durchsucht wurde?«
»Nee…«
»Du sagst, die sind mit Maschinenpistolen da rein?«
»Ja…«
»Dann lass die Finger davon.«
»Idiot.«
Ende.
So viel zum Thema hilf deinem Nachbarn und zeige Zivilcourage.
4.
Es gelang ihr, Milch, Tofu, Joghurt und Bier nach Hause zu schleppen und im Kühlschrank zu verstauen. Danach ging Lenina mit Nadine im Auftrag von Jonni Simonson los, um ehemalige Mitarbeiterinnen eines erfolgreichen Kunstbuchverlags zu interviewen, die von einem sadistischen Inhaber und seiner ihm hörigen Verlagsleiterin aus dem Unternehmen gemobbt wurden, indem man ihnen Diebstähle und Sachbeschädigungen vorwarf, die nie stattgefunden hatten. Routine.
Abends saß sie dann im Hongkong-Drachen an ihrem Stammplatz unter der roten Laterne am Fenster. Um sie herum Business as usual.
Sie fragte Mai-Lin, Yun-Fats achtzehnjährige Tochter, was die Zollfahnder gesucht hätten.
»Was sie gesucht haben, weiß ich nicht. Jedenfalls haben sie nichts gefunden. Auch in unserem anderen Lokal nicht, das sie überfallen haben.«
»Ihr habt noch ein Lokal?«
»Wir sind eine große Familie.«
»Ja, klar.«
»Und nun halten sie meinen Vater fest, weil er angeblich irgendwelche Zollbestimmungen beim Lebensmittelimport missachtet hat.«
»Er ist im Importgeschäft?«
»Ist doch naheliegend, oder? Wenn man in mehreren Ländern Familie hat.«
»Wie groß ist denn eure Firma?«
»Och, es geht so. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht so genau. Mein Vater sagt immer, wir kämen gerade so zurecht und stöhnt über die vielen Gesetze, die ihn behindern, na ja.«
»Ich fand es ziemlich übel, wie die Bullen ihn behandelt haben.«
»Danke. Aber es geht ihm wieder ganz gut. Er hat nur eine Platzwunde und ein paar Quetschungen abbekommen.«
»Nur?«
Mai-Lin zuckte mit den Schultern. Ihre Mutter, die wie immer in einem geblümten Kleid im Hintergrund stand und auf Chinesisch Anweisungen erteilte, rief nach ihr. Mai-Lin drehte sich um, hielt Block und Stift hoch und sagte etwas. Dann senkte sie dienstbeflissen den Kopf und fragte: »Willst du was bestellen?«
»Dim Sum und eine kleine Miso-Suppe.«
»Dim Sum gibt’s nur mittags.«
»Dann eine große Nudelsuppe, vegetarisch.«
»In Ordnung. Wasser?«
»Bier.«
Sie rauschte davon, und es sah so aus, als würde ihre Mutter sie ausschimpfen, weil sie so lange mit Lenina gesprochen hatte. Aber das war schwer einzuschätzen. Ihre Mutter war rätselhaft, unzugänglich, vielleicht auch nur schüchtern. Auf Deutsch sagte sie nie etwas anderes als »Guten Tag« und »Auf Wiedersehen«, »Bitte sehr« und »Vielen Dank«.
5.
Zwei Tage später stand Yun-Fat im Büro Rabe & Adler und bewunderte die Aussicht über den Hafen. Auf seiner Stirn klebte ein Pflaster, und er hatte einen Arm in der Schlinge. Von wegen ein paar Prellungen: Sie hatten ihm den Arm angeknackst und eine Anklage wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Beleidigung eines Vollstreckungsbeamten aufgebrummt.
Darüber lachte er jetzt: »Das war nur, weil ich ein Bier getrunken hatte. Bier macht mich fröhlich, wenn ich gute Gründe habe. Es kam ein Anruf, ich hatte gute Gründe und trank ein Bier. Dann kamen die Bullen, und ich wurde geschlagen. Das hat mich wütend gemacht. Und die auch. Jetzt freut sich mein Arzt.« Er hob den bandagierten Arm und verzog das Gesicht.
»Warum wurde dein Lokal denn überhaupt durchsucht?«
»Zollgeschichte, Einfuhrgesetze, Bürokratenkram. Das europäische Lebensmittelrecht ist sehr undurchsichtig. Da tappst du schnell in eine Falle. Aber unser Anwalt kriegt das schon hin.« Er schaute sich um. »Tolles Büro. Hübsch eingerichtet.«
»Danke.«
Er deutete auf den alten Eichentisch, hinter dem Nadine saß. »Aber das Ding da ist alt.«
»Ein Erbstück«, sagte Nadine.
»Du hast einen Schreibtisch geerbt?« Er lachte vor sich hin.
»Was ist daran so witzig?«
»Ich hab ein Restaurant geerbt.«
»Wo ist die Ironie?«, fragte Nadine.
Yun-Fat ging ans Fenster. »Das ist der teuerste Ausblick, den ich kenne«, sagte er.
»Das Haus gehört unserem Anwalt. Also der Kanzlei, für die wir des Öfteren arbeiten. Wir haben Sonderkonditionen, sonst ginge das gar nicht.«
Yun-Fat schüttelte den Kopf und deutete Richtung Hafen-City. »Das meine ich nicht. Da, das ist die Ironie.« Lenina schaute über die bunt bemalten Häuser der Hafenstraße hinweg, den wulstigen Landungsbrückenklotz und eine gigantische RoRo-Fähre, die aussah wie ein schwimmender Hochsicherheitstrakt.
»Wieso?«
»Das da erben die Bürger von Hamburg von ihren Politikern. 600 Millionen Miese. Und da heißt es immer, die Chinesen hätten keine Demokratie.«
»Ich sehe nichts«, sagte Lenina.
Nadine kam ans Fenster und sagte: »Ich auch nicht.«
»Bravo«, sagte Yun-Fat. »Die Augen aufmachen und nichts sehen. Das ist eine Tugend, die mir gefällt.«
»Standhaft, entschlossen, schlicht und schweigsam – so kommt man der Menschlichkeit näher«, zitierte Lenina.
»Wer Geistern dient, die nicht seine eigenen sind, ist ein Schmeichler«, gab Yun-Fat zurück.
»Ihr mit euerm verdammten Konfuzius«, sagte Nadine.
»Sie zitiert lieber Sunzi«, sagte Lenina.
»Kenn ich nicht«, sagte Yun-Fat. »So heißt kein Chinese.«
»Mao Zedong hat ihn aber gekannt«, sagte Nadine.
»Den kenn ich auch nicht.«
»Wollen wir uns nicht setzen?«, sagte Lenina und deutete auf die gemütliche Sitzecke mit den teuren Designerstücken, die Jonnis Büro ihnen leihweise überlassen hat, weil die Farbe Schwarz nicht mehr zu ihrer Firmenphilosophie passte. Nadine brachte drei Schälchen Jasmin-Tee.
Yun-Fat schlug die Beine übereinander, und Lenina fiel erst jetzt auf, dass er einen Anzug trug. Modifizierter Boss-Zwirn, also an Armen und Beinen gekürzt. Ein diffus gemustertes dunkleres Braun, das nicht so recht mit den ochsenblutfarbenen Halbschuhen harmonierte. Keine Krawatte, aber ein strahlend weißes Hemd. So teuer war ihnen ihr chinesischer Freund noch nie erschienen.
»Ich hab einen Auftrag für euch«, sagte er. »Einer meiner Köche ist verschwunden. Ich schätze, er wurde reingelegt. Falsche Versprechungen. Traut sich natürlich nicht zurück. War aber ein guter Mann, sehr gut sogar. Ich würde ihm gern eine zweite Chance geben. Vor allem aber geht es darum, ihn vor Schlimmerem zu bewahren. Wenn er illegal arbeitet, wird er zum Sklaven. Das muss ja nicht sein.«
»Wieso ausgerechnet wir?«, fragte Nadine. »Wir kennen uns doch gar nicht aus im chinesischen Milieu.«
»Eben drum. Wenn ich losgehe oder einer meiner Leute, dann gehen überall die Türen zu und die Lichter aus. Ihr seid naiv, damit kommt man weiter.«
»Wir sind naiv?«, empörte sich Nadine.
Yun-Fat lachte. »Ihr erscheint so. Und damit habt ihr mehr Erfolg.«
»Na, danke auch.«
Er räusperte sich. »Es wäre auch ganz gut, wenn mein Name in diesem Zusammenhang nicht fällt. Nach den Erfahrungen der letzten Tage … Könnt ihr euch ja denken.«
»Und wer ist das, den wir finden sollen?«
»Er heißt Wang Shuo.«
»Wang ist der Familienname«, sagte Nadine.
»Manchmal nennt er sich auch Mang Liu, aus Spaß.«
»Wieso aus Spaß?«
»Liumang bedeutet auf Deutsch so viel wie, hm, Nichtstuer, Rumhänger. Gibt’s da ein besseres Wort?«
»Taugenichts«, schlug Lenina vor.
»Ja, aber mehr so im Sinne von unbequem.«
»Querulant«, sagte Nadine.
»Rowdy«, korrigierte Lenina.
»Shuo ist so ein bisschen ein Spinner. Er hatte Probleme zu Hause, also in China, war auch mal im Knast, weil er mit den Behörden nicht klarkam. Deshalb hat man ihm nahegelegt, ins Ausland zu gehen. Also eigentlich, damit er nicht im Knast landet. Er hat’s eingesehen und wollte weg. Wurde uns als Koch vermittelt.«
»Ist er politisch?«, fragte Nadine. Sie denkt immer sofort an Politik, Aktivismus, Unterstützung. Ist so ein Reflex aus ihrer Kampfzeit.
»Politisch, nee. Nur wenn man das Gegen-Politik-Sein als politische Einstellung sieht. Er hat nie über so was geredet, aber das machen die anderen Köche auch nicht. Will sich ja keiner verplappern, alle müssen schließlich wieder zurück. Was Shuo betrifft: Es kam heraus, dass er ein richtig guter Koch ist. Besser als alle anderen. Zu Anfang stellte er sich immer absichtlich blöd an, damit wir nichts merkten. Aber ab und zu passierte es ihm, dass er ein Gericht viel zu gut kochte. Meist später abends, wenn er heimlich ein bisschen Schnaps getrunken hatte. Und bei den Dim Sum, da ist er unglaublich geschickt und kennt die abseitigsten Rezepte.«
»Stimmt«, sagte Lenina. »Manchmal hat es bei euch wirklich ungewöhnlich gut geschmeckt.«
»Nicht sehr nett, was du da sagst.« Yun-Fat tat eingeschnappt.
»Es schmeckt immer gut, Fatti.«
»Nenn mich nicht so. Du machst es nur schlimmer.«
»Zurück zu unserem Rotsterne-Koch«, sagte Nadine. »Wo sollen wir überhaupt suchen?«