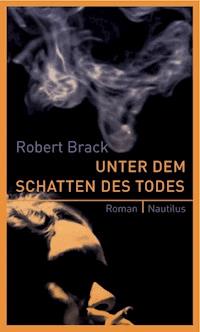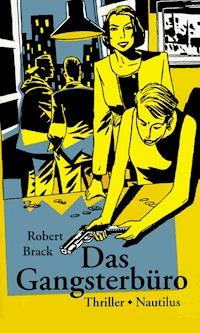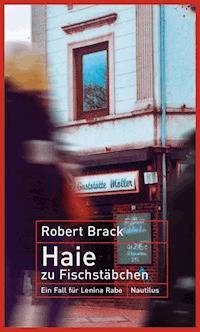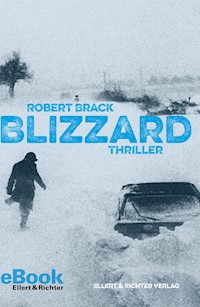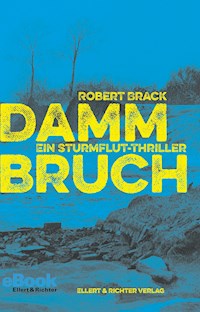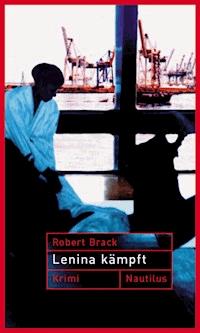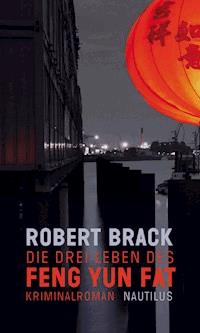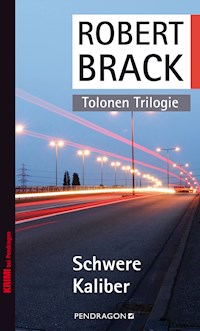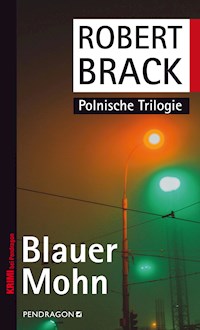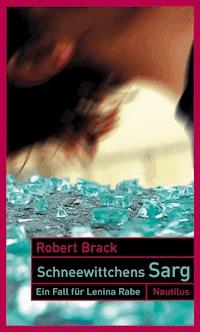
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Lenina Rabe
- Sprache: Deutsch
Die Aikido-Meisterin Lenina Rabe hat viel zu tun, denn zwei Aufträge verbinden sich auf unerwartete Weise. Ein geheimnisvoller Unbekannter bietet ihr einen astronomischen Vorschuss, wenn sie herausfindet, wer hinter der sogenannten Dänischen Befreiungsfront steckt. Mit ihrer Forderung, die Zwangsvereinigung Altonas mit Hamburg müsse rückgängig gemacht werden, macht diese Organisation nicht nur den Bürgermeister nervös. Gleichzeitig soll Lenina Schneewittchens Mörder finden. Beim Abriss eines Teils einer alten Fabrikhalle wurde die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Zwanzig Jahre lang lag sie dort im Keller begraben. Heute befinden sich in dem Gebäude Luxuswohnungen, aber damals hauste in der besetzten Fabrik eine alternative Lebensgemeinschaft. Bei ihren Nachforschungen wühlt Lenina viel Zwist unter den verbürgerlichten Ex-Engagierten auf, so dass sie froh um ihre neue Mitarbeiterin Nadine ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Brack, Jahrgang 1959, lebt in Hamburg. Er wurde mit dem »Marlowe« der Raymond-Chandler-Gesellschaft und dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Zuletzt erschienen in der Edition Nautilus drei Romane über die politischen Verhältnisse in der Weimarer Republik: Und #das Meer gab seine Toten wieder beschreibt einen Polizeiskandal aus dem Jahr 1931, Blutsonntag befasst sich mit den Ereignissen im Juli 1932 in Altona, Unter dem Schatten des Todes beschreibt die Hintergründe des Reichstagsbrands 1933 in Berlin. Mit Die drei Leben des Feng Yun-Fat kehrt der Autor in die Gegenwart zurück und knüpft an seine drei Lenina-Rabe-Kriminalromane Lenina kämpft, Haie zu Fischstäbchen und Schneewittchens Sarg an. Weitere Abenteuer von Rabe & Adler sollen folgen.
Edition Nautilus Verlag Lutz SchulenburgSchützenstraße 49 a · D-22761 Hamburgwww.edition-nautilus.deAlle Rechte vorbehalten · © Lutz Schulenburg 2006Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburgwww.majabechert.deAutorenfoto Seite 2: Charlotte Gutberlet
OriginalveröffentlichungErstausgabe Januar 2007
Print ISBN 978-3-89401-540-4E-Book ePub ISBN 978-3-86438-178-2
INHALT
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
ZWEIUNDDREISSIG
DREIUNDDREISSIG
VIERUNDDREISSIG
FÜNFUNDDREISSIG
EINS
Der ganze Stadtteil war eine Baustelle. Überall stöberten Bagger im Untergrund herum. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie die erste Leiche ausgruben. Dass es ausgerechnet Schneewittchen war, die sie dann fanden, war erstaunlich, und für die Gegend, in der ich wohne und arbeite, nur eine von mehreren fatalen Entwicklungen.
Aber ich gebe schon wieder meiner schlechten Angewohnheit nach, das Letzte zuerst abzuhandeln. Ich will lieber der Reihenfolge nach berichten, sonst macht diese ganze verrückte Geschichte keinen Sinn.
Alles fing damit an, dass eine Fahne gehisst wurde – so könnte man beginnen. Oder auch: Es war einmal ein alter Peugeot, der seinen Geist aufgab – nein, das klingt alles sentimental. Gefühle, jedenfalls meine eigenen, spielen in diesem Zusammenhang keine wesentliche Rolle.
Bleiben wir also bei den Fakten: Es gab einen dumpfen Knall und der Motor ging aus. Ich schaffte es gerade noch, den Wagen von der Max-Brauer-Allee auf den Parkplatz vor dem Bahnhof Altona rollen zu lassen, bevor er stehen blieb.
Zwei Polizisten, die in ihren dunkelblauen Uniformen aussahen, als wollten sie im nicht weit entfernten Rathaus einen Staatsstreich inszenieren, schoben mich in eine Parkbucht und salutierten lachend, als ich ausstieg.
»Vielen Dank, Kollegen«, sagte ich.
»Sieh mal an«, sagte der Jüngere, »eine von uns.«
»Nicht ganz«, korrigierte ich.
Der Ältere musterte mich grinsend. »Welches Revier?«
»Ottensen.«
Die beiden sahen sich an. In der Gegend gab es keine Wache.
»Privat.«
»Ach«, sagte der Jüngere enttäuscht.
»Kommen Sie doch zu uns«, meinte sein Kollege mit einem Blick auf meinen leicht verbeulten und angerosteten Peugeot.
»Dann können Sie sich einen besseren Wagen leisten.«
»Wohin, in die Abteilung für Hochstapler?«, wollte ich fragen. Aber im gleichen Moment begann eine Blaskapelle die dänische Nationalhymne zu spielen.
Die beiden Bullen drehten sich um und sagten gleichzeitig: »Scheiße, es geht schon los!«, fassten nach ihren Gummiknüppeln und rannten davon. Ich schaute ihnen nach. Im Laufen nahmen sie die Knüppel vom Gürtel und griffen nach den Handschellen, die an ihren Hintern hin und her wippten.
Ich schloss die Tür ab und gab dem Peugeot einen aufmunternden Klaps. Er würde schon wieder auf die Räder kommen. Zu den schrägen Klängen der Blaskapelle gesellten sich dünne Stimmen, die einen mir unverständlichen Text sangen. Vermutlich ging es um den Heldenmut der Dänen oder die Schönheit ihrer Heimat. An einem Fahnenmast, den ich bis dahin noch nie bemerkt hatte, wurde eine Flagge hochgezogen, weißes Kreuz auf rotem Grund. Die Hymne wurde beendet. Die Umstehenden riefen Bravo und wedelten mit kleinen Papierfähnchen. Es schien ihnen Spaß zu machen.
Ich nahm mir Zeit, meine Haare zu einem Pferdeschwanz zusammenzubinden und ging dann hinüber, um mir das Ereignis aus der Nähe anzusehen.
Jetzt bemerkte ich auch die Einsatzfahrzeuge der Bereitschaftspolizei. Die Transporter standen hintereinander am Rand des Busbahnhofs, vor ihnen Beamte mit Helmen, Schilden und Schlagstöcken. Die beiden Bullen, die mir so nett geholfen hatten, waren gerade dabei, zwei Männern, die hinter einem aufgebauten Rednerpult standen, die Arme auf den Rücken zu drehen.
»Nieder mit dem deutschen Terror! Altona skal være dansk!«, riefen die Fähnchenschwenker. Die Bereitschaftsbullen rückten näher.
Einer der Männer, den die beiden Bullen gerade in der Mangel hatten, schrie laut: »Ich protestiere! Ich bin der dänische Vizekonsul! Lassen Sie mich sofort los!«
Die freundlichen Bullen sahen sich ratlos an. Der zweite Mann in ihrem Gewahrsam wand sich wie ein Aal, schrie unverständliches Zeug und begann hysterisch zu lachen. Der jüngere Bulle versetzte ihm einen Schlag mit dem Knüppel auf den Hinterkopf, und er brach zusammen.
Wieder ertönte der Slogan: »Altona skal være dansk!«
Der angebliche Vizekonsul rief mit sich überschlagender Stimme: »Das wird ein Nachspiel haben!«
Es waren schätzungsweise doppelt so viele Polizisten wie Demonstranten da. Als ich mich umdrehte, wurde mir klar, dass sie versuchten, die Demonstranten einzukreisen. Einer von ihnen packte meinen Arm.
Das hätte er nicht tun sollen. Bevor er »hoppla« sagen konnte, lag er vor mir auf dem Boden. Er hatte mir die perfekte Ryote-Tori-Angriffsstellung geliefert, und ich hatte sie ganz korrekt mit Shiho-Nage, dem Schwertwurf, beantwortet. Ich duckte mich unter einem erhobenen Knüppel durch und rannte Richtung Bahnhofshalle.
»Sieh dich nie um, wenn du vor jemandem wegrennst, sonst kriegen sie dich!«, hatte mein Vater mir schon in frühester Kindheit beigebracht. Er hatte viel Demo-Erfahrung gesammelt und war ein Meister im Weglaufen vor den Bullen gewesen. Also schaute ich mich nicht um, sondern nutzte die Situation zu einem Slalom-Sprint zwischen den Autos hindurch, die gerade auf die Verladerampe des Autoreisezugs zurollten.
Ich durchquerte die Bahnhofshalle und war so aufgedreht, dass ich einfach weiterrannte, durch die Fußgängerzone hindurch, über den Spritzenplatz, dann die teilweise aufgebaggerte Hauptstraße entlang, immer geradeaus, Richtung Büro. So kann man auch sein tägliches Jogging-Programm absolvieren.
Vor dem Zugang zu dem Fabrikgebäude, in dem ich einen Loft im vierten Stock bewohne, hatten sie eine tiefe Grube ausgehoben und die Bauzäune so aufgestellt, dass der Weg zwischen ihnen hindurch wie ein ausgeklügelter Irrgarten anmutete.
Vor der Tür angekommen, neben der normalerweise mein Peugeot geparkt ist, fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, Geld in die Parkuhr am Bahnhof zu werfen. Nun ja, es war Gefahr im Verzug gewesen.
Ich suchte in meiner Jeanstasche nach dem Schlüssel und hörte hinter mir ein Räuspern.
»Hallo, Lenina!«
Ich wirbelte herum und stand vor einem dünnen Kerl in Jeans-Anzug und Cowboy-Stiefeln. Er hatte lange, sehr graue Haare, einen ebenso grauen Vollbart und sein Gesicht sah, abgesehen von der Nickelbrille, so ähnlich aus wie das von dem Typ, dessen Porträt mein Vater früher über das Sofa gehängt hatte. Karl Marx. Ich hatte es neulich im Regal hinter den Büchern wiedergefunden und den Wechselrahmen dann genutzt, um ein Bild von Jacqueline du Prés aufzuhängen.
Ich schaute ihn ratlos an.
»Du kennst mich nicht mehr«, stellte er fest.
»Anscheinend nicht«, gab ich zu.
Er hielt mir die Hand hin. Sie war faltig und sehr behaart. »Ich bin Paul. Du hast sogar mal Onkel zu mir gesagt.«
»Ach du Scheiße.«
Er lachte freudlos und schaute sich um. »Wo ist denn der Peugeot? Ich seh dich doch immer damit rumfahren.«
So ist das in diesem Viertel, in dem so viele Leute wie in einer Kleinstadt auf der Fläche eines Dorfes leben, man ist ständig unter Beobachtung.
»Motorschaden. Steht am Bahnhof.«
»Ich kann dir einen guten Mechaniker empfehlen.«
»Ich krieg das schon alleine hin.«
Er hob entschuldigend die Hände. »Ich will mich gar nicht in dein Leben drängen, Lenina. Aber –« Er zögerte.
»Ich hab jetzt keine Zeit«, sagte ich unwirsch und wandte mich ab. »– ich hab einen Auftrag für dich.«
Ich drehte mich wieder um.
»Du bist doch noch Detektivin?«, fragte er.
»Um was geht’s denn?«
Er trat von einem Fuß auf den anderen. »Können wir das nicht oben besprechen?«
»Um was geht’s?«, wiederholte ich.
Die Augen hinter seiner Nickelbrille zwinkerten nervös.
»Ich möchte, dass du Schneewittchens Sarg findest.«
Ich starrte ihn an. Solche Witzbolde kamen gelegentlich vorbei. Machten, wie sie sich einbildeten, hochintelligente Scherze und wollten, dass man mitlachte.
Aber Paul lachte nicht. Er grinste nicht mal. Er sah eher so aus, als könnte er jeden Moment zu heulen anfangen.
»Du bist doch Detektivin?«, fragte er noch mal und es klang schüchtern.
»Kommen Sie bitte mit.« Ich drehte mich um, schloss die Tür auf und betrat das kahle Treppenhaus.
ZWEI
Ich eilte ihm voraus und bemerkte dabei, dass ich es vor allem deswegen tat, um ihm zu zeigen, dass ich viel jünger und besser im Training war als er. Aber als ich oben ankam, war ich ziemlich aus der Puste, ich war ja immerhin vom Bahnhof hergerannt. Er war dicht hinter mir geblieben und atmete langsam und gleichmäßig.
Ich schloss die Stahltür mit dem Schild »Lenina Rabe, Detektivin« auf und betrat das Büro. Der vordere Raum des Lofts, mein Büro, war glücklicherweise vorbildlich aufgeräumt. Sogar der Küchenbereich glänzte. Im Hinterzimmer, meinem privaten Reich, sah es anders aus, aber das lag nur daran, dass ich zur Zeit Besuch hatte. Annie war aus Berlin rübergekommen, um sich bei mir auszuweinen, weil ihre Karriere als Sängerin einen Knick bekommen hatte. Wir waren letzte Nacht in unserer alten Stammkneipe, dem »Espace«, gewesen und hatten einen nostalgischen Abend verbracht bis zu dem Moment, als so ein Typ, der aussah wie ein weichgespülter Til Schweiger, Annie gefragt hatte, ob sie nicht die Annie sei, die er neulich auf MTV und so weiter … Sie waren dann zusammen weggegangen und ich allein nach Hause.
Aber jetzt stand, nachdem die Tür hinter ihm laut ins Schloss gefallen war, dieser alte Knacker in meinem Büro und sah sich meine »Galerie der Inspiration« an. Das waren Bilder von schwierigen Übungen, die ich mir noch draufschaffen musste. Einfache Skizzen, die ich selbst angefertigt hatte.
»Machst du immer noch Aikido?«, fragte Paul.
»Ja.«
»Und bist immer noch der Ansicht, dass die Revolution nicht auf der Straße, sondern im Kopf stattfinden muss?«
»Gibt’s irgendwas, das Sie nicht über mich wissen?«
Er lachte trocken. »Wohnst du immer noch allein hier?«
»Noch eine persönliche Frage und ich werfe Sie raus!«
Wieder dieses Lachen, das so gar nicht lustig klang. »Das würdest du glatt schaffen.«
»Klar. Und die Ermittlung können Sie dann auch vergessen.«
»Du kannst mich ruhig duzen. Mal abgesehen davon, dass wir uns schon ewig kennen, mag ich es nicht, gesiezt zu werden – außer von den Bullen«, setzte er hinzu.
Ich merkte, dass ich langsam von meinem Anti-Trip runterkommen musste. Es war völlig destruktiv, in meiner finanziellen Lage einen potenziellen Kunden zu verprellen. Außerdem vertrug es sich nicht mit meiner Lebensphilosophie. Auch der kleine Lehrmeister in meinem Ohr meldete sich jetzt zu Wort. »Koch ihm einen Yogi-Tee!«, verlangte er. Aber auf meinen Sensei war ich momentan schlecht zu sprechen, ich fand ihn zu vorlaut. Deshalb fragte ich den grauen Panther: »Wie wär’s mit einem Kaffee?«
»Gern.« Er setzte sich auf den Stuhl vor meinen Schreibtisch. Ungefragt. Na ja, mein Vater hatte es auch immer abgelehnt, sich halbwegs zivilisierte Umgangsformen anzugewöhnen. Muss wohl ein Generationsproblem sein.
Ich füllte die besten Bohnen von Café Libertad in die Mühle und ließ sie aufheulen. Dann brühte ich einen absolut unmodernen Filterkaffee auf. Nicht aus Zickigkeit, sondern weil meine Espresso-Maschine nur noch vor sich hinspuckte. Den Kaffee hatte Nadine mir neulich mitgebracht. Sie konsumierte nur politisch korrekt.
Paul holte eine Packung filterlose Gauloises aus der Jackentasche und zündete sich eine an. Wieder ungefragt. Ich seufzte. Der Sensei in meinem Ohr riet mir zu Gelassenheit, obwohl er Rauchen nicht ausstehen konnte.
Schließlich stellte ich zwei Becher auf den Schreibtisch und setzte mich dahinter. Paul warf vier Stück Zucker in den Kaffee. Ich trank ihn schwarz.
Paul schwieg, dachte nach, trank Kaffee und blies mir den Rauch über den Schreibtisch entgegen. Der Mann war eine echte Prüfung.
Auch wenn es eine absolut lächerliche Frage war, musste sie nun gestellt werden: »Wer ist Schneewittchen?«, sagte ich.
»War«, sagte er.
»Na gut, wer war Schneewittchen?«
Er hatte sich aus einem Stück Alufolie von der Zigarettenpackung einen kleinen Aschenbecher geformt, da ich ihm keinen angeboten hatte. So was hatte ich gar nicht. Da hinein drückte er jetzt die Kippe und nahm sich gleich eine neue Zigarette.
»Das weiß ich auch nicht so genau«, sagte er und ließ sein Feuerzeug aufflammen.
So langsam kam ich mir verarscht vor. »Das Raucherabteil ist draußen«, sagte ich und deutete zur Tür.
»Ich will es aber wissen«, sagte Paul bedächtig. »Ich will endlich wissen, wer sie auf dem Gewissen hat.« Er hielt inne, paffte vor sich hin und nippte an seinem Kaffee.
»Wir haben einen Erklärungsnotstand«, stellte ich fest.
Er nickte nachdenklich und sah mich dann an. Die Augen hinter seiner Nickelbrille waren blassblau. Konnte sein, dass ich mich gerade daran erinnerte, dass mich diese Augen schon mal angesehen hatten. Vor tausend-oder-so Jahren.
»Weißt du noch, wo ich wohne?«, fragte er.
»Nee.«
Er hüstelte ironisch. »Na ja … Aber du kennst die Friedensallee.«
»Ja, ja.«
»Und die Borselstraße und die Daimlerstraße, diese Ecke, wo früher lauter Fabriken standen und wo sich jetzt die Yuppies breitgemacht haben.«
»Yuppies?«
»Sagt man das nicht mehr?«
»Eher nicht.«
»Na ja, du weißt schon. Trendkapitalisten, Kriegsgewinnler der Neoliberalisierung.«
»Ja, ja.«
»Wir wohnen da immer noch. Damals, Anfang der 70er Jahre, als dieses Viertel hier total runtergekommen war, haben wir die Gebäude besetzt und ein Sozial-Projekt gestartet. Wir haben die Arbeiter, die Arbeitslosen und die Alten verteidigt, die bei einem drohenden Kahlschlag im Viertel obdachlos geworden wären. Wir haben uns um die Kinder und Jugendlichen gekümmert, die überhaupt keinen Anlaufpunkt hatten. Wir haben den Türken geholfen, sich in diesem Land zurechtzufinden. Wir haben Sozialarbeit geleistet, für die sich der Staat und die Gesellschaft zu schade waren. Wir haben das Viertel gerettet! Zusammen mit anderen Initiativen. Und dann kamen diese Yuppie-Scheißer und fingen an, uns zu enteignen. Und jetzt heißt Kommunikation und sozial nur noch, dass man in Trend-Bars geht, sich mit Alko-Pops bedröhnt, mit Techno betäubt und …«
»Techno ist tot«, zitierte ich meine Freundin Nadine. Er war mir entschieden zu laut geworden. Außerdem verstreute er seine Asche auf meinem Schreibtisch.
»Na und? Du weißt, was ich meine!«
»Klar. Aber was hat das mit Schneewittchen zu tun?«
Er hob die Hand und deutete ins Nichts. »Also gut, ich will mich kurzfassen. Das ist ja auch so was heutzutage, dass keiner mehr fähig ist zuzuhören. Aber bitte. Dann kriegst du jetzt die Kurzfassung. Später können wir ja noch mal über die Details sprechen.«
Ihm stand der Schweiß auf der Stirn, obwohl es im Büro nicht sehr warm war. »Meinetwegen«, lenkte ich ein.
»Das waren alles Studenteninitiativen. Später, als alle langsam mit dem Studium fertig wurden – Soziologen, Psychologen, Mediziner, Sozialpädagogen waren dabei –, wurden aus den Inis professionell organisierte Sozial-Projekte. Schließlich müssen auch engagierte Menschen Geld verdienen. Es gab aber zwei Jahrzehnte lang ein gemeinsames Dach und einen festgelegten Rahmen, in dem das alles stattfand, ein Trägerverein für die verschiedenen nichtkommerziellen Projekte, die ja auch immer noch dazugehörten. Das wurde dann allerdings immer weniger und inzwischen kocht jeder sein eigenes Süppchen.«
»Und du, was hast du gemacht und was machst du da jetzt?«
»Ich wohne immer noch da, und der Verein, das bin praktisch nur noch ich.«
»Sonst nichts? Beruflich, meine ich.«
»Ich hab das mit dem Studium nicht so auf die Reihe gekriegt. Erst Psychologie, dann Soziologie, dann Politologie und Geschichte. Eine Zeitlang wollte ich Lehrer werden, na ja. Dann bin ich eine Weile Taxi gefahren und später auf Altenpfleger umgesattelt. Das mach ich jetzt, ambulante Pflege.«
»Und wie kriegen wir nun die Kurve zu Schneewittchen?«, fragte ich, während er sich eine weitere Gauloise anzündete.
Er starrte in seinen leeren Becher: »Kann ich noch einen Kaffee haben?«
Ich stand auf und schenkte uns nach.
»Der Verein ist irgendwann in finanzielle Schwierigkeiten geraten«, fuhr Paul fort, nachdem er wieder vier Zuckerstücke versenkt hatte. »Die Gebäude mussten saniert werden und … na ja, manche wollten nicht zu tief in die eigene Tasche greifen. Aber ein Verein kann keine größeren Kredite aufnehmen. Und so wurden die Gebäude an uns nahestehende Personen verkauft. Eins blieb übrig, als Vereinssitz sozusagen. Es wurde jetzt wegen Baufälligkeit abgerissen. Das letzte Gebäude, das von dem ganzen Projekt übrig geblieben war.« Er schaute mich auffordernd an.
»Und?«
»Liest du keine Zeitung?«
»Ab und zu.«
»Es stand sogar in der taz.«
Die hatte Nadine schon länger nicht mehr bei mir liegen lassen.
»Mopo und Bild auf der ersten Seite, Abendblatt auch.«
»Ich konzentriere mich meistens auf ›Vermischtes‹ in der Buddhist Review aus Singapur«, sagte ich scherzhaft.
Er nahm es ernst. »Da wird es nicht gestanden haben.«
»Nein.«
»Sie haben eine Leiche gefunden, nachdem sie den Gebäudeteil abgerissen hatten und die Fundamente ausbuddelten. Die Leiche eines jungen Mädchens. Es war ja nicht mehr viel von ihr übrig. Aber die Autopsie hat ergeben, dass sie sechzehn oder siebzehn Jahre alt gewesen war, als sie starb. Und sie lag zwanzig Jahre in einem Grab unter dem Keller.«
»Schneewittchen.«
»Ja.«
»Wieso heißt sie so? Wer hat sie so genannt? Die Medien?«
»Nein, ich.«
»Warum.«
»Rot wie Blut, weiß wie Schnee, schwarz wie Ebenholz.«
Er hielt inne. Seine Gedanken drifteten ab. Ich ließ ihm ein bisschen Zeit und sagte dann: »Können wir bitte bei den Fakten bleiben?«
Er schrak zusammen. Seine Hände zitterten, als er zuerst den qualmenden Zigarettenstummel und dann den Kaffeebecher zum Mund führte.
»Es war ein Mädchen. Sie wohnte eine Zeitlang bei uns. Ich weiß nicht, wo sie herkam. Eines Tages war sie verschwunden. Ich dachte, sie sei vielleicht wieder zu ihren Eltern zurück oder sonst wohin.«
»Woran ist sie denn gestorben?«
Paul holte tief Luft. »Jemand hat ihr den Schädel eingeschlagen«, sagte er leise.
»Und was sollte dieser Spruch mit dem Sarg?«
»Bei der Leiche wurden Glassplitter gefunden.«
»Schneewittchens Glassarg.«
»Vielleicht.« Er zündete sich schon wieder eine Zigarette an. »Und ich soll ermitteln?«
Er nickte. »Und alles herausfinden.«
»Ich kann das aber nicht umsonst machen«, sagte ich.
»Ich hab ein bisschen Geld gespart. Das ist es mir wert.«
»Na gut, aber ich werde in den Privatangelegenheiten der Leute, die dort wohnen, herumschnüffeln. In Ihren auch.«
»Ja, mach das ruhig.«
»Und die Bullen haben keine Ideen dazu?«
»Die sind doch sowieso überarbeitet. Und eine zwanzig Jahre alte Leiche, von der nur noch die Knochen übrig sind … Da prüfen die die Vermisstenlisten und es ist erledigt.«
»Wie hieß sie denn?«
»Vera.«
»Und weiter?«
»Sie hat uns nie ihren Nachnamen gesagt. Es hat auch keiner gefragt.«
Die Türglocke ertönte. Besser gesagt, der Gong dröhnte. Paul fuhr zusammen.
»Entschuldigung.« Ich stand auf. Paul erhob sich ebenfalls und ging hinter mir her.
Ich schob die Tür auf. Im Treppenhaus stand eine adrett gekleidete Mitdreißigerin mit Puder, Rouge und Lippenstift im Gesicht.
»Guten Tag. Frau Rabe?«, sagte sie.
»Ja, bitte?«
Paul huschte vorbei. »Du weißt ja, wo ich wohne«, raunte er mir zu und hastete die Treppe hinunter.
Die Adrette hielt mir ihre Hand hin. Lange Fingernägel, metallicblau gefärbt. Fehlten nur noch die Rallye-Streifen auf ihrem leicht pinkstichigen Kostüm.
»Schleiz, mein Name.«
»Kommen Sie rein, Frau Schleiz.«
Ich deutete in den Büroraum, in dem die einfallenden Sonnenstrahlen schräge Streifen in die Nikotinschwaden schnitten.
DREI
»Darf ich rauchen?«, fragte Frau Schleiz, kaum dass sie sich auf den Besucherstuhl gesetzt und die Beine übereinander geschlagen hatte.
Ich deutete auf die Kippen im gefalteten Alupapier. »Der Klient vor Ihnen musste sich einen eigenen Aschenbecher basteln.«
»Oh, das ist kein Problem.« Sie hob ihre kleine weiße Handtasche, die tatsächlich so etwas wie Rallye-Streifen am Rand hatte, auf den Schoß, öffnete sie und holte einen kleinen silbernen Aschenbecher mit Klappdeckel hervor. »Darauf bin ich vorbereitet«, ergänzte sie.
Ich seufzte. Nach diesem Gespräch würde ich alle Fenster öffnen und das Büro aus gesundheitlichen Gründen für 24 Stunden schließen müssen.
»Was kann ich für Sie tun, Frau Schleiz?«
Sie reichte mir eine Karte. Die hatte sie offenbar extra für unsere Begegnung an einem Automaten drucken lassen. Es war nur ihr Name darauf und die Handy-Nummer. Immerhin stand auch der Vorname dabei: Eirin. Sollte das türkisch sein?
»Eirin ist aber ein ungewöhnlicher Name«, sagte ich.
»Sie betonen es falsch«, erklärte sie mit bedeutsamem Gesichtsaudruck. »Nicht auf der ersten Silbe, sondern auf der zweiten, Eirin, wie im Englischen.«
»Oh, ach so, Entschuldigung.«
»Ist nicht schlimm. Das passiert vielen hier im Westen.«
Jetzt erst fiel mir auf, dass sie einen leicht sächselnden Tonfall hatte.
»Worum geht es also, Frau Schleiz?« Ich erwartete nicht viel. Wahrscheinlich sollte ich mal wieder einen untreuen Ehemann oder Freund unter die Lupe nehmen. Zwei Drittel meiner Kundschaft besteht aus Frauen, die glauben, nicht genug über ihre Männer zu wissen. Meistens stimmt das auch. Aber wenn sie dann mehr über sie wissen, macht sie das auch nicht glücklicher. Aber Eirin Schleiz hatte ein anderes Anliegen.
»Wir verlangen absolute Diskretion«, sagte sie in geschäftsmäßigem Ton.
»Das geht in Ordnung. Diskretion ist die Grundlage meiner Arbeit.«
»Gut. Dann unterschreiben Sie das hier bitte.« Sie zog einen Zettel aus ihrer Handtasche, faltete ihn auseinander und legte ihn mir auf den Schreibtisch. Ein Hauch von tropisch anmutendem Parfüm wehte mit dem Zigarettenrauch über den Tisch.
»Ich verpflichte mich bezüglich des mir von Frau Eirin Schleiz unterbreiteten Angebots sowie bei nachfolgender Übernahme des Auftrags zu absoluter Diskretion«, stand darauf.
»Wenn ich das unterschreibe«, sagte ich, »muss ich Ihnen aber den doppelten Honorarsatz berechnen.«
»Wie hoch ist denn Ihr Honorarsatz?«
Ich dachte nach. Je nach Kunde schwankten meine Forderungen zwischen Null und Unendlich.
»Fünfzig Euro«, sagte ich, weil sie mir unsympathisch war.
»Hundert also«, sagte Frau Schleiz, ohne mit der Wimper zu zucken. »Damit verpflichten Sie sich allerdings auch zur Klärung der Angelegenheit innerhalb von zehn Tagen. Bei Nicht-Erfüllung besteht kein Honoraranspruch.« Sie hatte schon wieder einen Zettel in der Hand. Nun auch einen Kugelschreiber, mit dem sie die Zahl »100« in ein offenbar dafür vorgesehenes Feld eintrug.
»Wir gehen davon aus, dass Ihre eventuellen Spesen in diesem Betrag enthalten sind.« Sie reichte mir den zweiten Wisch. Darauf stand fast wörtlich das, was sie gerade gesagt hatte.
Ich überschlug kurz das möglicherweise dabei herauskommende Gesamthonorar, war in Gedanken schon auf dem Weg in die Südsee oder besser noch in die Mailänder Scala, riss mich aber zusammen und sagte: »Bei Nicht-Erfüllung berechne ich fünfundzwanzig Euro pro Stunde als Bearbeitungsgebühr.«
»Fair ist fair«, sagte sie. »Schreiben Sie’s dazu.«
Das tat ich und gab ihr beide Zettel unterschrieben zurück. Sie studierte alles mit gerunzelter Stirn und stellte fest: »Sie wollen drei Tagessätze als Garantiesumme?«
»Fair ist fair«, sagte ich. »Zweifellos werde ich Ausgaben haben.«
»Sie wissen doch noch gar nicht, um was es geht.«
»Wir können diese Zettel ja immer noch zerreißen.«
Sie seufzte und kramte wieder in ihrer Tasche. »Ich hoffe, Sie nehmen auch Bargeld.«
»Wenn es sein muss.« Ich legte so viel Missmut wie möglich in meine Stimme.
Jetzt hielt sie eine Menge Scheine in der Hand. »Also drei mal …?«
»Fünf.«
»… mal fünfundzwanzig macht … Dreihundertfünfundsiebzig. Ich gebe Ihnen vierhundert.«
Sie zählte die Scheine ab und legte sie mir hin. Mir wurde schlagartig klar, dass diese Sache nicht gut ausgehen konnte, wenn gleich zu Anfang so viel Geld im Spiel war. Ich ließ es erst mal liegen.
»Also?«, forderte ich Frau Schleiz auf.
Sie drückte die Kippe mit großer Sorgfalt in den kleinen Aschenbecher, klappte ihn zu und ließ ihn in die Handtasche fallen.
»Sie werden nur mir Bericht erstatten, und nur über diese Handynummer.«
»Okay.«
»Also passen Sie gut auf«, sagte sie lehrerinnenmäßig. »Sie sollen herausfinden, wer hinter dieser rot-weißen Terrorbande steckt.«
»Hinter wem?«
»Hinter der Dänischen Befreiungsfront.«
Ich sah sie erstaunt an. Kein abtrünniger Ehemann, kein untreuer Geliebter? Stattdessen – Politik? Oder war das hier ein Scherz auf meine Kosten?
»Sie wissen doch, wen ich meine?«
»Ja, ja, aber …«
»Die haben das Viertel im Würgegriff«, stieß Frau Schleiz wütend hervor.
»Ist das nicht ein bisschen übertrieben?«
»Übertrieben. Es fehlt nur noch, dass sie Schutzgelder erpressen!«
»Das tun sie doch nicht.«
»Nein, aber sie sind dabei, das ganze Viertel mit ihrem pseudopolitischen Unfug zu erobern. Und damit zerstören sie die Geschäftsgrundlage vieler kleiner Läden und Geschäfte.«
»Sie haben einen Laden hier in der Gegend?«, fragte ich.
Ganz kurz sah sie aus, als hätte ich sie bei etwas ertappt. Einen Laden für trendgerechte Handtaschen könnte sie haben. Aber damit verdiente man nicht so viel Geld, dass man sich meine neuen Honorarsätze leisten konnte.
»Aber nein!«, sagte sie unwirsch.
»Sondern?«
»Ich sagte doch, Ihr Auftraggeber bleibt ungenannt.«
»Schon gut.«
Sie kramte wütend in ihrem Täschchen. Nach den Zigaretten natürlich.
»Vorhin hat diese Terrorbande, wie Sie sie nennen, vor dem Altonaer Bahnhof die dänische Flagge gehisst.«
»Sehen Sie!« Das Feuerzeug flammte auf.
»Die Polizei hat sie anscheinend allesamt festgenommen.«
»Na, ein Glück.«
»Aber damit ist Ihr Problem doch gelöst.«
»Unsinn.« Sie blies mir den Rauch entgegen.
»Die werden verhört, die Personalien werden aufgenommen und wenn sie etwas Kriminelles getan haben, landen sie vor Gericht. Sie können sie anzeigen und auf Schadensersatz verklagen. Sie brauchen mich überhaupt nicht.«
»Doch, Frau Rabe, wir brauchen Sie. Es handelt sich nämlich in Wahrheit um eine Geheimorganisation.«
Das sagte sie mit so ernstem Gesichtsausdruck, dass mir das Lachen im Hals steckenblieb.
Sie schaute auf ihre hübsche kleine goldene Armbanduhr, stand auf und strich sich das Kostüm glatt.
»Sie sollen alles über diese Leute herausfinden, alles! Und mir umgehend berichten. Detailgenau. So schnell wie möglich. Aber keine schriftlichen Fixierungen!«
»Keine was?«
»Notizen und so weiter müssen Sie sofort wieder vernichten!« Ich blickte wohl immer noch begriffsstutzig drein.
»Verstanden?«, herrschte sie mich an.
»Ja, geht in Ordnung, Frau Schleiz.«
»Gut. Melden Sie sich sofort, wenn Sie etwas wissen. Es eilt.« Sie ließ die Kippe auf meinen wahrscheinlich leicht brennbaren Holzfußboden fallen und trat sie mit dem Schuh nachlässig aus.
»Auf Wiedersehen.«
Sie drehte sich um und stöckelte davon.
Eine Verrückte. Ich sollte solche Leute nicht ausnutzen, dachte ich mit Blick auf die Scheine auf meinem Schreibtisch. Oder das Schild an der Tür ändern. »Lenina Rabe – Psychotherapeutische Praxis«.
VIER
Ich hatte nicht viel Zeit, über meine neuen Fälle nachzudenken. Das Telefon klingelte ständig, und nacheinander kündigten Nadine, Annie und Susi ihr Kommen an. Das ist der Nachteil, wenn man ein Büro in zentraler Lage hat – alle kommen gern vorbei. Na ja, ich sollte nicht so nörgeln, das waren meine alten Freundinnen. Wir hatten schon lange nicht mehr zu viert zusammengesessen. Jede von ihnen hatte gleich mitgeteilt, dass sie davon ausging, dass wir heute Abend mal wieder »wie in alten Zeiten durchs Dorf ziehen« würden. Ich würde es als Teil meiner Recherche-Arbeit ansehen und tapfer ertragen, die anderen würden sich wahrscheinlich köstlich amüsieren. Na ja, Nadine vielleicht nicht so sehr …
Sie kam zuerst. Nachdem sie einmal durchs Büro gestreift war und alle Details gemustert hatte – sie sah auch jedes Mal, wenn sie kam, aus allen verfügbaren Fenstern nach draußen –, setzte sie sich auf das neue Sofa, das ich an die kahle Wand neben der Eingangstür gestellt hatte.
»Eine Menge Geld«, sagte sie und schüttelte ihr blondes Haar nach hinten. Sie trug ein Cordkostüm und hohe Stiefel. In letzter Zeit sah sie nicht mehr so streng nach autonomer Szene aus wie das Jahr zuvor. Aber ihre Ansichten waren radikal geblieben.
»Was?«
»Auf deinem Schreibtisch. Hast du gerade einen Fall beendet?«
»Im Gegenteil, das ist der Vorschuss auf einen Fall, der wahrscheinlich unlösbar ist.«
»Unlösbare Fälle gibt es nicht. Detektive lösen immer ihre Fälle.«
»Meine buddhistische Bildung sagt mir, dass dies eine Illusion ist. Wirklich gelöst wird ein Fall in den seltensten Fällen. Mit etwas Glück renkt man eine fehlerhafte Sache wieder halbwegs ein, aber das Schicksalsrad dreht sich unermüdlich weiter und der große Fluss des Lebens weicht nicht einen Millimeter aus seinem vorgegebenen Bett.«
Nadine lachte. »Häng das als Motto über deinen Schreibtisch.«
»Wäre das denn so witzig? Was hängt denn bei dir drüber?«
»Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Jedenfalls bis gestern. Ich hab’s runtergenommen. War sowieso eher als eine Aufforderung an mich selbst gedacht.«
»Und? Hat er gewirkt, der Spruch?«
»Ein bisschen. Ich hab mich entschlossen, mein Studium zu schmeißen.«
»Du spinnst.« Ich konnte das nicht glauben. Für mich war sie die ideale Person für eine Karriere an der Uni.
»Was soll ich mit Philosophie, Politik, Geschichte und all dem Kram anfangen? Als Expertin im Fernsehen den Leuten die Sicht auf die Wahrheit vernebeln? Es gibt keine Jobs in dem Bereich.«
»Ich dachte, du machst es, weil es dich interessiert.«
»Alles graue Theorie im Dienst der herrschenden Klasse. Und völlig abgehoben.«
»Philip hat mir mal vorgeschlagen, ich solle Jura studieren.«
Nadine starrte ins Leere. »Philip. Den müssen wir auch mal wieder im Knast besuchen. Aber Jura? Das ist doch lächerlich. Wer das Geld hat, hat die Macht, und wer die Macht hat, hat das Recht. So einfach ist das in unserer Gesellschaft.«
»Was willst du also tun?«
Sie lächelte verschmitzt. Es kam selten vor, dass man ihre Grübchen sah. Nur wenn sie wirklich gut gelaunt war. Sie war immer viel zu streng mit sich.
»Die Macht der Verhältnisse im Kleinen bekämpfen. Und dafür, dachte ich mir, könnte ich mich als Mitgesellschafterin eines kleinen kapitalistischen Unternehmens bewerben.«
Ich schaute sie wahrscheinlich ziemlich belämmert an. Nadine kam aus gut betuchter Familie und war erst kürzlich aus ihrem Elternhaus in Blankenese ausgezogen, in eine kleine Wohnung hier in der Nähe. Sie kellnerte jetzt, weil sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen wollte. Und auf einmal wollte sie sich als Unternehmerin betätigen?
Sie fand meinen Gesichtsausdruck wohl witzig, denn sie lachte schon wieder.
»Es wird allerdings schwierig werden, die Inhaberin des Unternehmens davon zu überzeugen, dass sie mich braucht.«
Jetzt fiel bei mir der Groschen. Ich schüttelte heftig den Kopf.
»Das ist doch Quatsch. Das hier wirft ja nicht mal genug für mich allein ab.«
»Es wird Zeit, dass du deine Agentur professionalisierst, Leni.« Ich kam da nicht mehr ganz mit. »Wieso willst du denn jetzt auf einmal …« Ich brach ab, weil ich merkte, dass mir der Gedanke, jemand anderes könnte in meinem Reich mitregieren wollen, überhaupt nicht gefiel.
Sie spürte meine Verunsicherung und sagte: »Ist nur so eine Idee, Leni, denk mal drüber nach. Oder vergiss es jetzt und erzähl mir von deinem neuen Fall. Und hör auf, so rumzustehen wie Pik Sieben, sondern mach uns mal einen Kaffee.«
Tatsächlich war sie die Einzige, von der ich mich ganz gern mal herumkommandieren ließ. Ich nahm den Wasserkessel und füllte nach.
»Es sind zwei Fälle …« Ich erzählte ihr von meinen neuen Kunden.
»Den Schneewittchen-Fall hätte ich abgelehnt«, sagte Nadine, als ich ihr den Becher mit dem schwarzen Kaffee reichte. »Den wirst du nicht lösen und Geld bringt er auch nicht ein, jede Wette.«
»Du könntest ja zunächst als Controllerin einsteigen«, sagte ich bissig.
Sie ignorierte die Bemerkung. »Die Sache mit der dänischen Befreiungsfront klingt ziemlich fies. Das kannst du eigentlich gar nicht machen.«
»Ich hab das Geld schon bekommen.«
»Aber von einem unbekannten Auftraggeber.«
»Ich kann nicht alle Aufträge ablehnen, Nadine, ich lebe von dieser Arbeit.«
»Ja, klar. Aber zuerst einmal solltest du herausfinden, wer hinter diesem Auftrag steckt.«
»Ich dachte, ich mache es umgekehrt. Erst enttarne ich diese dänischen Spinner und dann habe ich vielleicht etwas in der Hand, um meinen Auftraggeber aus der Reserve zu locken.«
»Konventionelle Strategie«, sagte Nadine. »Warum nicht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Wir gehen zu Steve.«
»Wer ist Steve?«
»Er verwaltet die nichtoffizielle alternative Altona-Homepage. Und er ist so eine Art Jäger und Sammler des Informationszeitalters. Er weiß alles über diesen Stadtteil.«
»Klingt gut. Gehen wir also zu Steve.«
Nadine sah auf die Uhr. Es war kurz vor sechs. »Um diese Zeit schläft er noch. Und außerdem …« Der Gong ertönte.
»… erwarten wir Besuch.«
Ich öffnete die Tür und herein kamen Susi und Annie, beide ganz böse aufgebitcht. Ich sah gleich, dass Annie ziemlich sauer auf Susi war. Die wiederum war schon in Partylaune.
Auf meine besorgte Frage, wie es ihr geht, antwortete Annie: »Beschissen.« Und ließ sich die dunklen Haare vors Gesicht fallen, um ihre Augenringe zu verdecken.
Sofort mischte Susi sich ein: »Sie hat eine total falsche Einstellung, deshalb fühlt sie sich schlecht.«
»Sei doch still«, sagte Annie leise und ging an ihr vorbei zum Sofa, wo sie sich auf den Platz fallen ließ, auf dem eben noch Nadine gesessen hatte.