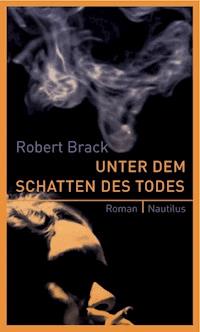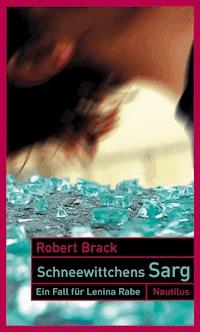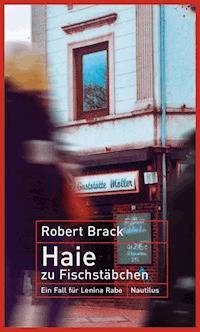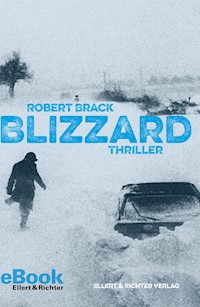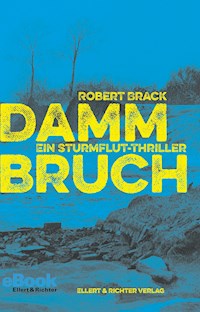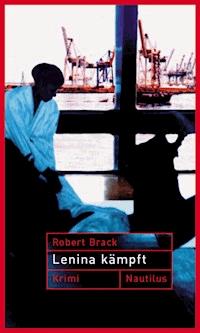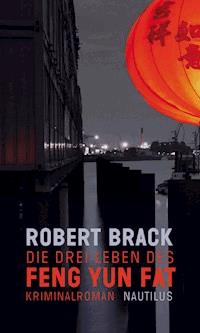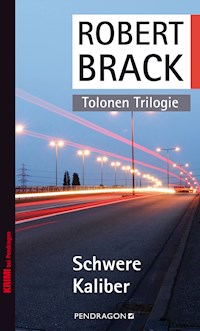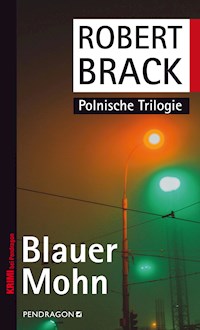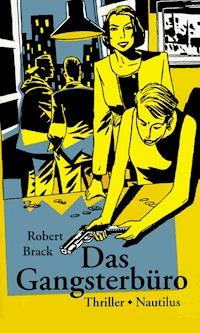
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Krimipreis! Über den Dächern von Berlin hat sich der pensionierte Geheimdienst-Profi Malakoff behaglich eingerichtet. Leider bringt die Wende zahlreiche Unannehmlichkeiten mit sich, nicht zuletzt finanzieller Art. Und so ist der einstige IM "Anarchist" gezwungen, seine Tätigkeit zu privatisieren. Gemeinsam mit Profis aus alten Tagen und entwurzelten Nachwuchstalenten gründet er ein Büro für illegale Ermittlungen. Der erste Auftrag gilt der Beschaffung eines politisch wertvollen rumänischen Gemäldes, das zuletzt kurz vor Ausbruch der Nelkenrevolution in Lissabon gesehen wurde. Malakoff wittert das große Geld und bald schon sind nicht nur rumänische Kryptokommunisten und Royalisten, sondern auch Hongkong-Chinesen und portugiesische Ganoven eifrig dabei, zwischen Berlin, Paris und Lissabon ein dichtes Intrigen-Netz zu knüpfen, das nur noch mit Hilfe von Schusswaffen durchlöchert werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Brack, Jahrgang 1959, lebt in Hamburg. Er wurde mit dem »Marlowe« der Raymond-Chandler-Gesellschaft und dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Zuletzt erschienen in der Edition Nautilus drei Romane über die politischen Verhältnisse in der Weimarer Republik: Und das Meer gab seine Toten wieder beschreibt einen Polizeiskandal aus dem Jahr 1931, Blutsonntag befasst sich mit den Ereignissen im Juli 1932 in Altona, Unter dem Schatten des Todes beschreibt die Hintergründe des Reichstags-brands 1933 in Berlin. Mit Die drei Leben des Feng Yun-Fat kehrt der Autor in die Gegenwart zurück und knüpft an seine drei Lenina-Rabe-Kriminalromane Lenina kämpft, Haie zu Fischstäbchen und Schneewittchens Sarg an. Weitere Abenteuer von Rabe & Adler sollen folgen.
Robert Brack
DAS GANGSTERBÜROThriller
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg
Schützenstraße 49a · D-22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 1994
Originalveröffentlichung · Erstausgabe 1995
Umschlaggestaltung: Markus Huber, Hamburg
Autorenporträt Seite 2: Charlotte Gutberlet
ePub ISBN 978-3-86438-181-2
Inhalt
TEIL 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
TEIL 2
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
TEIL 3
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
TEIL 1
Two doors down, there’s a barstoolThat knows me by nameAnd we sit there together and wait for you(Dwight Yoakam: »Two doors down«)
1
»Zieh deine Uniform an!«
»Aber Liebling, ich …«
»Zieh sie an!«
»Muss das wirklich sein?«
»Tu, was ich sage.«
»Ich kann das nicht …«
»Los, mach schon!«
»Also gut.«
Der nicht mehr ganz junge, aber nach eigenem Urteil vielversprechendste Hauptmann der portugiesischen Armee schob die Bettdecke zurück und richtete sich auf. Bis auf die vor vielen Jahren in Paris erstandenen Boxershorts mit einem verblichenen Vichy-Karomuster war er nackt. Einen Moment lang saß er mit gesenktem Kopf auf dem Bettrand und betrachtete seine bloßen Füße. Er stöhnte leise, als sie ihm mit einer Hand ganz leicht auf den stark behaarten Rücken schlug. Dann stand er auf.
Für seine knapp 45 Jahre sah er noch ganz passabel aus. Zwar hatte er an den Hüften und am Bauch ein wenig zugelegt, aber sein regelmäßiges Jogging-Training hatte ihn trotz seiner leicht untersetzten Gestalt vor der frühzeitigen Verfettung bewahrt. Unschlüssig stand er neben dem Bett. Seine Uniform lag auf dem Boden. Er bückte sich nach seinem Unterhemd, nach den Socken und dem frisch gebügelten Armeehemd.
»Soll ich auch die Strümpfe …«
»Alles! Ich will auch, dass du deine Mütze trägst.«
Der Hauptmann griff nach seiner goldenen Armbanduhr, die auf dem Nachtschränkchen lag.
»Liebling, ich glaube, wir haben gar nicht genug Zeit …«
»Du wolltest mich doch unbedingt sehen, oder?«
»Ja, natürlich.«
»Du hast die ganzen Wochen nur an mich gedacht.«
»Aber ja.«
»Na, also.«
Er zog sich an. Nachdem er die Uniformjacke zugeknöpft hatte, setzte er sich auf den mit dunkelrotem Samt gepolsterten Empire-Stuhl und nahm sich die Socken und die Schuhe vor. Zwischendurch deutete er auf den Sektkübel, der auf einem Servierwagen vor dem Bett stand.
»Möchtest du nicht schon einen Schluck, Liebling?«
»Noch nicht, du weißt doch, dass ich hinterher immer Durst bekomme.«
»Ja, natürlich.«
Endlich hatte er die Schuhe zugebunden. Er richtete sich auf, stand gerade, beinahe militärisch.
»Die Mütze.«
»Ach ja.« Er blickte zerstreut um sich: »Wo ist sie denn?«
»Du hast sie doch aufgehabt, als du hierher kamst, oder?«
»Ja, ich glaube schon.«
Auf seinem runden Gesicht zeigten sich zahllose Sorgenfalten.
»Bist du sicher?«
»Ich kann doch unmöglich ohne …«
Er fuhr sich mit der rechten Hand über das schon ansatzweise ergraute Haar, das sie wenige Minuten vorher total durcheinandergebracht hatte. Unwillkürlich strich er es glatt. Sie lachte.
»Los, mach schon, such deine Mütze!«
Er suchte auf dem schmalen Sekretär vor dem fleckigen Spiegel, auf dem kleinen Tisch zwischen den breiten Sesseln, sogar darunter, sah auf der Kommode mit der Minibar nach, stieß beinahe den Servierwagen um und fluchte.
»Verdammt, es ist viel zu dunkel hier. Und außerdem zu eng!«
Das Zimmer war ungefähr 14 Quadratmeter groß, und es standen viel zu viele Möbel darin. Die Decke war über drei Meter hoch und trug auf diese Weise dazu bei, den klaustrophobischen Effekt zu verstärken. Vor dem hohen Fenster hingen schwere dunkelrote Vorhänge. Die einzige angeschaltete Lampe war die altmodische Messingfunzel über dem Bett.
»Ich brauche Licht!«, rief der Hauptmann und riss mit großer Geste die Vorhänge auf. Es blieb trotzdem dunkel.
Die Frau im Bett kicherte albern.
Die hohen Fensterflügel waren mit zwei hölzernen Fensterläden verrammelt. Zornig zog er sie auf. Sie öffneten sich nach innen.
Das grelle Licht der Nachmittagssonne durchflutete das kleinste Zimmer des Hotel Avenida Palace in Lissabon. Obwohl das Fenster geschlossen war, hörte man deutlich den Verkehr, der einige Stockwerke tiefer um den Praça dos Restauradores lärmte, hochtourig gefahrene Kleinwagenmotoren, quäkende Hupen, hysterische Bremsgeräusche.
Der Hauptmann drehte sich um und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war verdammt warm in diesem Zimmer, aber für ein kühleres auf der anderen Seite des Hotels hätte er wesentlich mehr bezahlen müssen. Die Frau im Bett zog sich die Decke über den Kopf und kicherte weiter. Unter dem dünnen Stoff zeichnete sich ihr Körper ab. Kopf, Arme, Brüste, Bauch, Schenkel. Sie hatte die Beine gespreizt und bewegte sich. Zwischen den Beinen war etwas, das nicht dorthin gehörte. Mit einem lauten Seufzer stieß er sich von der Fensterbank ab, machte zwei Schritte Richtung Bett, zog die Decke von ihr weg und sah die Mütze in ihrem Schoß liegen.
Sie lachte albern und rief: »Na los, zieh dir deine Mütze an!« Er wollte sich gerade auf das Bett knien, als es laut an der Tür klopfte. Verwirrt ließ er die Decke auf den Boden fallen und richtete sich auf.
»Was ist los?«
»Da sind sie schon«, murmelte er.
»Bleib hier!«
Er ging zur Tür, drehte sich um und sagte: »Deck dich zu.« Zwei Schritte durch den engen Vorraum und er war an der Tür. Er öffnete sie. Draußen standen zwei Pagen in Uniform und hielten ein großes Paket in den Händen. Sie sahen ihn fragend an.
»Zu früh«, sagte er mehr zu sich selbst. Dann ließ er sie eintreten.
Sie bauten sich vor dem Bett auf und heuchelten Desinteresse, angesichts der nackten, dunkelhaarigen Schönheit, die sich dort räkelte.
Sie sah ihn zornig an: »Bist du verrückt? Was soll das?«
Sie hob die Decke vom Boden auf und hüllte sich ein.
»Ich dachte, du würdest es gerne bei dir haben.«
Mühsam suchte er nach Kleingeld in seinen Hosentaschen. Die beiden Pagen lehnten das ein Meter fünfzig hohe Bild an den Sekretär, der gegenüber dem Bett stand, und nahmen das Trinkgeld entgegen. Nach einem weiteren Blick auf die Frau im Bett stolperten sie nach draußen.
»Du Idiot«, sagte sie, »morgen stehen wir in der Zeitung.«
»Freust du dich nicht?«, fragte er verunsichert.
»Dass ich morgen in der Zeitung stehe? Du machst mir Spaß.«
Er setzte sich auf den Rand des Bettes und beobachtete, wie die Decke wieder von ihren Schultern rutschte. Mit der linken Hand griff er nach ihren Brüsten, um sie zu streicheln. »Ich liebe dich«, sagte er.
»Du Idiot.«
Sie zog die Mütze unter der Bettdecke hervor und warf sie gegen das in braunes Packpapier eingewickelte Bild.
»Fehlt nur noch, dass die Polizei jetzt hier reinstürmt. Wieso hast du das Bild herbringen lassen?«
»Es konnte doch nicht in diesem feuchten Keller bleiben.«
»Du bist verrückt. Hätte das nicht Zeit gehabt?«
»Wir haben Jahre gebraucht, um es zu bekommen. Wir sollten jetzt nicht nachlässig werden.«
»Ich habe Jahre gebraucht. Du hast gar nichts dazu getan.«
»Wir haben es gemeinsam … es war mein Plan.«
»Ach ja? Wer hat denn diesen alten Knacker bearbeitet, du vielleicht?«
»Ich war es, der ihn kennengelernt hat.«
»Ja, ja, du hast mit ihm Kaffee getrunken. Aber ich musste ihn im Bett bei Laune halten. Weißt du überhaupt, wie das ist, mit einem 70-Jährigen, kannst du dir das vorstellen? Ein Invalide!«
»Hör auf.«
»Ja, hör auf. Wahrscheinlich wird die ganze Sache auffliegen und wir landen beide im Knast.«
»Tun wir nicht, weil ich nämlich alles gut organisiert habe.« »Irgendein Erbe wird auftauchen und uns die Hölle heißmachen.«
»Es gibt keine Erben. Der Mann war allein. Ich habe alle Akten durchgesehen, die es gab. Er ist ganz allein nach Lissabon gekommen und hat vom Verkauf seiner Bilder gelebt. Nur dieses eine ist übrig geblieben, weil er es nicht weggeben wollte. Der einzige Kontakt zu seiner Heimat war dieser Schriftsteller, der vor zwei Jahren gestorben ist. Seitdem hat er niemanden gesehen außer uns und seiner Haushälterin. Wer soll uns also die Hölle heißmachen?«
»Ich traue deinem Organisationstalent nicht«, sagte sie schmollend. »Du hast nicht mal deine Mütze wiedergefunden.«
»Wo ist sie überhaupt?«
Sie suchten beide den Boden neben dem Bett ab.
»Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist sie unters Bett gerutscht«, sagte sie.
Er kniete sich nieder und suchte mit den Händen unterm Bett. Alles, was er zutage förderte, war eine Menge Staub. Er musste husten. Als er sich aufrichtete, saß sie mit angezogenen Beinen auf dem Bett und hatte die Mütze auf dem Kopf. Sie lachte laut und aufreizend, streckte ihm die Arme entgegen und sagte:
»Los, Soldat, komm jetzt …«
Als er sich über sie beugen wollte, donnerten Fäuste gegen die Tür und eine herrische Stimme rief: »Aufmachen!«
Sie sahen sich erschrocken an.
»Was ist das?«, fragte sie. »Noch so eine Überraschung?«
»Nein, das heißt …«, stammelte er, »… die Blumen?«
Die Fäuste donnerten erneut gegen die Tür.
»Ist das der Blumenhändler?«, fragte sie hysterisch. »Brechen die neuerdings in Hotelzimmer ein?«
»Ich weiß nicht, was das ist.«
»Du hast alles organisiert, wie? Draußen stehen die Bullen, sie werden uns verhaften, wir werden uns nie mehr wiedersehen, weil du dieses verdammte Bild unbedingt hierhaben wolltest. Das ist ja großartig, wie du das alles organisiert hast.«
Wieder krachten Fäuste gegen die Tür.
»Das gibt’s doch gar nicht«, sagte er.
»Und was nun? Willst du warten, bis sie die Tür eingetreten haben? Wo ist deine Pistole?«
»Was?«
»Ich liege hier nackt herum und die treten die Tür ein. Wo ist deine gottverdammte Pistole?«
Die Pistole steckte im Halfter und das lag auf dem Tisch. Der Hauptmann stand zitternd auf. Jetzt schlug niemand mehr gegen die Tür, aber man hörte undeutliche Stimmen. Er öffnete das Halfter, zog die Pistole raus und entsicherte sie. Dann ging er in den Vorraum und horchte an der Tür. Jemand redete, aber er verstand kein Wort.
»Wer ist da draußen?«, fragte er mit quäkender Stimme.
Zwei Stimmen antworteten gleichzeitig: »Wir bringen die Blumen!« Dann lachten sie albern.
»Was ist los?«, rief die Frau vom Bett aus.
»Blumen, sie bringen die Blumen«, sagte der Hauptmann ungläubig.
»Mach die Tür auf, mein Liebling!«, sang eine Stimme draußen vor der Tür.
»Mach nicht auf!«, rief die Frau. »Die bringen uns um.«
Der Hauptmann drehte mit der linken Hand umständlich den Schlüssel im Schloss um, in der rechten hielt er die schussbereite Pistole. Er zog die Tür nach innen auf und sah draußen zwei Feldwebel stehen, die sich ganz offensichtlich von seinem Rang nicht beeindrucken ließen.
»Was soll das hier mit diesem Lärm?«, fragte er umständlich. Statt einer Antwort hielt ihm der eine der beiden einen riesigen Blumenstrauß unter die Nase.
»Das sollen wir hier abgeben«, sagte er.
»Es wird das Letzte sein, was wir für Sie tun können«, ergänzte der andere schnippisch. Beide grinsten ihn frech an und drängten ihm den Blumenstrauß auf, den der Hauptmann mühsam mit der freien linken Hand in Empfang nahm, während er gleichzeitig darauf wartete, sich mit der Pistole verteidigen zu müssen.
Doch die beiden Soldaten traten zurück, salutierten nachlässig mit verächtlichem Gesichtsausdruck, drehten sich um und gingen durch den langen Korridor davon.
Der Hauptmann schob die Tür vorsichtig mit dem Fuß zu und trat zurück ins Zimmer. Er legte den riesigen Strauß aufs Bett und sah in das angsterfüllte Gesicht seiner Geliebten.
Sie versuchte zu lächeln, aber es kam nur eine Grimasse zustande.
»Also doch nur Blumen?«, stotterte sie, und ihre Hand tastete über das Bettlaken nach seiner, die noch immer die Pistole hielt. »Für mich?«
»Ja«, sagte er finster, »nur Blumen. Aber es stimmt trotzdem was nicht.«
»Wieso? Die sind doch hübsch …«
»Ich hatte Rosen bestellt, aber das hier sind Nelken, rote Nelken.«
Auf diese Weise erfuhren Carlos Coelho, der nicht mehr ganz junge, aber nach eigenem Urteil vielversprechendste Hauptmann der portugiesischen Armee, und seine Geliebte Carmen Cassunto, dass in Portugal die Nelkenrevolution ausgebrochen war. Zwei Tage später, am 27. April 1974, waren sie bereits ins französische Exil abgereist.
Das teure Gemälde hatten sie gar nicht erst auspacken müssen.
2
Der Heilige trug einen Mantel aus Spinnweben. Und genau das war der Grund, warum die Bürokraten ihn aus dem Verkehr ziehen wollten. Die kleine Holzfigur stand auf einem roh gezimmerten Regal direkt über dem seit 50 Jahren dort provisorisch eingebauten Holzkohlegrill und verursachte laut Einschätzung einer Beamtin des Gesundheitsamtes »unhygienische Bedingungen«. Der Holzkohlegrill und das Regal mit den verstaubten Weinflaschen gehörten zur Tasca von Senhor Pereira, die den inoffiziellen Namen »Höhle des heiligen Lüstlings« trug. Die Existenz dieser kleinen Eckkneipe im Lissaboner Stadtteil Bairro Alto war genauso inoffiziell wie der Name, denn eigentlich sollte sie bereits seit Monaten geschlossen sein, weil ihre Einrichtung den Normen der Europäischen Union widersprach.
Senhor Pereira, den seine Kunden einfach nur Nuno nannten, weil sie alle seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten mit ihm befreundet waren, kannte diese Normen nicht. Sie waren ihm sogar scheißegal. Er hatte diese Tasca im Alter von 29 Jahren übernommen und sich fest vorgenommen, sie noch weitere 50 Jahre zu führen, auch wenn ihm bis dahin sein letzter übrig gebliebener Schneidezahn ausfallen würde.
Aber nun war diese Beamtin bereits zum zweiten Mal hier aufgekreuzt. Das war ungeheuerlich, denn bis dahin war es keiner Frau erlaubt gewesen, diesen Verein männlicher Müßiggänger zu stören. Sie hatte noch nicht mal einen Rock getragen, sondern Jeans. Und rumkommandiert hatte sie, dass den alten Männern, die gerade bei ihrem Frühstückswein saßen, hören und sehen verging. Es fing damit an, dass sie den mit Kippen übersäten Steinfußboden bemängelte, dann darauf hinwies, dass ein paar Kacheln von den Wänden gefallen waren und dahinter ein bisschen morsches Mauerwerk zu sehen war. Die Pin-up-Girls auf den Kalenderbildern und Fotos, die über den ganzen Raum verteilt waren, hatte sie mit verkniffenem Mund gemustert. Als sie den Heiligen sah, dem ein findiger Bastler und Stammkunde ein Geschlechtsteil verpasst hatte, das ziemlich keck in die Höhe ragte, lachte sie hämisch. Dann erklärte sie das Schnapsregal für unsachgemäß angebracht und forderte die sofortige Beseitigung der beinahe hundert Jahre alten Spinnweben, die überall dekorativ herumhingen, natürlich auch über dem Grill und in den Ecken bei den uralten Weinfässern, die angeblich ebenfalls irgendeiner neuen Norm widersprachen. Abgesehen davon, fügte sie hinzu, sei es zwar nicht ihr Zuständigkeitsbereich, aber die Weingläser ohne Eichstrich könne Nuno ebenfalls vergessen.
Was er mit einem Eichstrich solle, hatte Nuno gefragt, wo er doch die Gläser immer bis zum Rand fülle. Das sei eben neuerdings so üblich in Europa, hatte sie schnippisch geantwortet. Dann stellte sie ein letztes Ultimatum: In drei Tagen sollten die Spinnweben verschwunden, der Grill beseitigt und alles blitzblank geputzt sein, sonst würde die Tasca geschlossen, und zwar nicht vorübergehend, sondern für immer. Anschließend drehte sie sich auf den hochhackigen Absätzen um und stolzierte nach draußen, wo sie in einen nagelneuen Fiat Uno stieg, der knallrot in der Frühlingssonne glänzte.
»Dann mach ich eben einen Privatklub auf«, murmelte Nuno achselzuckend und setzte sich zu seinen Freunden an den Tisch, die gerade begonnen hatten, sich über bestimmte, in Jeans eingezwängte weibliche Körperteile zu unterhalten.
Ein einziger Gast nahm nicht an dieser Unterhaltung teil, weil er nicht dazugehörte und außerdem viel jünger war. Und abgesehen davon, dass er die junge Beamtin eigentlich ganz hübsch und beinahe sympathisch gefunden hatte, war er nicht mal Portugiese.
Der Mann, der sich seit fast fünf Jahren Anton Ruger nannte und einen vorbildlich gefälschten deutschen Pass bei sich trug, hatte diese Tasca nur zufällig betreten. Er war aus dem 20 Kilometer entfernten Sintra mit dem Zug angereist, um sich mit Zeitungen einzudecken und einen Geschäftsfreund zu besuchen. Die englischen, französischen und deutschsprachigen Zeitungen lagen vor ihm auf der verkratzten Marmorplatte. Daneben ein Glas Vinho Verde, das er noch nicht angerührt hatte. Er war sich nicht sicher, ob er es wirklich austrinken sollte, schließlich war es noch früh am Tag. Andererseits war er nervös. So nervös, dass sogar sein Magen rumorte. Er schob es auf den strengen Geruch der Fischsuppe, die in einem Topf auf einer verrosteten einzelnen Herdplatte neben dem Grill vor sich hin brodelte. Darin schien sich so viel Knoblauch zu befinden, dass man eine ganze Kompanie damit hätte vergiften können. Aber es war nicht wirklich der Geruch dieser Suppe, der ihm zu schaffen machte.
Er trug eine Sonnenbrille, obwohl hier in diesem kühlen Raum ein eher diffuses Licht herrschte. Außerdem einen leicht zerknitterten naturweißen Leinenanzug, der eher praktisch als elegant wirkte, ein dezentes dunkelblaues Sommerhemd, gleichfarbige Socken und braun-weiße italienische Sommerschuhe. In seinem Ausweis war das Geburtsjahr 1954 angegeben. Also war er jetzt »offiziell« 39 Jahre alt. Er trug sein Haar kurzgeschnitten und fragte sich jeden Morgen, was er mehr verabscheuen sollte, die überflüssigen Locken oder die kürzlich aufgetauchten grauen Strähnen. Er war einen Meter achtzig groß und wunderte sich, dass er noch nicht fett geworden war, seit er mit dem regelmäßigen Trainieren aufgehört hatte. Sein glattrasiertes Gesicht war breit, beinahe quadratisch, und die kleinen Narben kamen nicht davon, dass er sich jeden Morgen nass rasierte. Sie erinnerten ihn immer wieder daran, dass er in einem Land aufgewachsen war, wo man Stacheldraht benutzte, um Dinge und Menschen voneinander zu trennen.
Auf der Titelseite der »Süddeutschen Zeitung« las er einen Bericht über die Verleihung irgendwelcher Orden an deutsche Bundeswehrsoldaten. Sie hatten sogar ein Bild dazu abgedruckt, auf dem der Bundespräsident zu sehen war, wie er einem der Soldaten die Hand schüttelte. Sie hätten sich im humanitären Einsatz in Somalia bewährt, hieß es. Ruger kannte das Gesicht des einen Soldaten aus dem Fernsehen. In der Reportage war gezeigt worden, wie der Soldat mit einigen Kameraden den Kindern von Belet Huen ein Lied beigebracht hatte: »Hänschen klein«.
Ziemlich albern, mit einer Sonnenbrille in einer solchen Kaschemme Zeitung lesen zu wollen. Ruger nahm die Brille ab. Durch die offenstehende Tür blickte er nach draußen. Die Tasca lag am Rand eines kleinen Platzes, in dessen Mitte ein leerer Springbrunnen stand. Davor gab es eine freie Fläche, wo die Männer täglich »Chinquilho« spielten, ein Spiel, bei dem es darauf ankommt, Metallscheiben möglichst dicht neben einen in den Boden geschlagenen Holzstock zu werfen.
Die Männer in der Tasca sprachen jetzt von weiblichen Körperteilen im Allgemeinen. Jemand legte ein Kartenspiel auf den Tisch. Nuno stand auf und schaltete den Fernseher ein, der hoch oben in der Ecke neben dem Eingang auf einem Regalbrett stand, auf dem außerdem ein paar vertrocknete Zwiebeln und Maiskolben herumlagen. Die anderen begannen »Sueca« zu spielen. Eine Weile sprachen sie von schwedischen Blondinen, die sie fälschlicherweise als heißblütig einschätzten, dann versickerte das Gespräch und man hörte nur noch das Brodeln des Suppentopfes und das Geschrei der Kinder, die drüben im Park herumtobten.
Die Kinder rannten um den leeren Brunnen herum, auf dessen Rand zwei Männer saßen. Sie ließen sich offenbar gelangweilt von der Sonne bescheinen. Der eine, ein schmächtiger Kerl mit einem länglichen Gesicht, rauchte eine Zigarette. Er hatte Bluejeans und eine schwarze Lederjacke an. Der andere war stämmiger gebaut, mit zu kurzen Beinen, und hatte die Hände in einer beigen Bundhose mit Schlag vergraben. Darüber trug er ein zu enges weißes T-Shirt mit dünnen blauen Querstreifen.
Ruger hatte die beiden noch nie gesehen. Jedenfalls nicht vor heute Morgen, als er plötzlich bemerkt hatte, wie sie ihm aus dem Zug und durch den Bahnhof gefolgt waren. Als er aus dem Rossio-Bahnhof trat, war er stehen geblieben, um sie zu beobachten. Offenbar wussten sie nicht genau, was sie tun sollten. Blieben einfach stehen und glotzten blöd zurück. Er hatte überlegt, ob es sich lohnte, diese beiden Idioten überhaupt ernst zu nehmen, sich dann aber an den Mann erinnert, der ihn vor einigen Tagen vor seiner Pension in Sintra abgefangen hatte. Wenn er nicht so überraschend schnell reagiert hätte, wäre er zusammengeschlagen worden. Er hatte sich selbst gewundert, wie gut es ihm nach all den Jahren noch gelang, die Faustschläge zu parieren. Der Kerl lag auf dem Boden, ehe er seinen Schlagring richtig benutzen konnte. Reine Glückssache.
Jetzt also noch zwei andere. Wie viele würden wohl dazukommen? Und von wem waren sie geschickt worden? Von jemandem mit vielen Freunden offenbar.
Er hingegen war allein. So gut wie. Ihm lief es kalt den Rücken runter.
Nuno stellte ungefragt einen Teller mit Suppe auf seinen Tisch.
»Eine Spende vom heiligen Lüstling«, sagte er, ohne auf eine Antwort zu warten, und ging zur Tür.
Aus der Nähe betrachtet sah die Suppe gar nicht übel aus. Wenn man Stockfisch mag. Ruger nahm den Löffel in die Hand und probierte. Knoblauchsuppe mit Stockfisch. Höllisch scharf. Tintenfischstücke schwammen auch darin herum.
»Du bist noch jung, du brauchst das«, rief einer der Kartenspieler ihm zu. »Du brauchst Kraft, du musst uns vertreten, wenn die Beamtin wieder zurückkommt.«
Die alten Männer lachten.
Ihm blieb nichts anderes übrig, als die Suppe zu essen. Als er den Teller leer hatte, fühlte er sich besser. Er trank den Vinho Verde aus und blickte wieder nach draußen. Der alte Nuno unterhielt sich auf der anderen Straßenseite mit den beiden Männern, die vom Brunnen gewollt gelangweilt herübergeschlendert waren. Der in der Lederjacke redete, der andere hatte noch immer die Hände in den Hosentaschen und stierte dumpf herüber. Der Wirt nahm einen Zettel entgegen, nickte und kam mit kleinen Trippelschritten über die Straße zurückgelaufen.
Die beiden Männer verschwanden aus Rugers Blickfeld.
Nuno trat zu ihm an den Tisch und überreichte ihm den einmal gefalteten Zettel. Dann nahm er wortlos den Teller und das Glas vom Tisch und schlurfte hinter die Theke. Ruger faltete den Zettel auseinander. Es stand nur eine Telefonnummer darauf. Eine Nummer, die er gut kannte.
Er drehte sich um und sah, wie der alte Wirt mit dem frisch gefüllten Glas in der Hand zu ihm zurückschlurfte. Der Wein schwappte über den Glasrand auf die Greisenhand und tropfte zu Boden.
»Gibt’s hier ein Telefon?«
Der Alte schüttelte mit dem Kopf: »Hat’s hier noch nie gegeben. Trink! Das macht wach.«
Er stellte das Glas auf den Tisch und blieb einfach stehen. Leicht gebeugt, abwesend, als ob er mit einem Schlag eingeschlafen wäre.
Die anderen Männer spielten weiter, der Fernseher plapperte vor sich hin und zeigte undeutliche vernebelte Bilder, draußen immer noch Kinderlärm. Ruger hatte das Gefühl, dass plötzlich alles in Zeitlupe ablief. Und ihm kam der blödsinnige Gedanke, es könne an der Suppe liegen. Er griff nach dem Glas, verschüttete seinerseits etwas Wein auf Tisch und Hosenbein und trank es in einem langen konzentrierten Zug leer. Dann stand er auf und zog seine Brieftasche aus der Innentasche des Jacketts. Er sah den Wirt fragend an, der ihn aus dunkelbraunen Augen unter buschigen weißen Brauen regungslos anstarrte.
Es dauerte eine Weile, bis Nuno sich zu einer Handbewegung entschließen konnte. Er deutete auf die kleine Holzstatue auf dem Tresen: »Der Heilige kassiert heute.«
»Der Hurenheilige nimmt gern dein Geld«, rief einer der Kartenspieler.
Und damit schien der Bann gebrochen zu sein. Alles hatte plötzlich wieder seine normale Geschwindigkeit.
Ruger ging zum Tresen und legte die Escudo-Scheine neben die Holzstatue. Die Kartenspieler lachten.
»Vorsicht mit dem Ding da!«
Ruger warf einen letzten Blick auf die zahllosen Spinnweben und die vergilbten Pin-up-Fotos, nickte dem Wirt zu und verließ das Lokal.
Draußen war es wärmer und heller, als er erwartet hatte. Er zog die Sonnenbrille wieder auf und blickte sich um. Von den beiden Männern war nichts mehr zu sehen. Er sah auf seine goldene Schweizer Armbanduhr, die noch teurer gewesen war, als sie aussah.
11.30 Uhr. Er hatte viel zu lange in der Tasca gesessen.
Was er nun brauchte, war ein Telefon.
Er ging durch einige schmale Gassen und kleine Straßen und erreichte schließlich das Postamt an der Praça Luís de Camões.
Wieso war er nicht hingegangen, wie er es geplant hatte, wie es abgesprochen war? Wieso musste er jetzt auf einmal telefonieren? Extra einen Umweg zum Postamt machen, wo er doch verabredet war? Nur weil zwei zwielichtige Figuren ihm die Telefonnummer, die er sowieso auswendig kannte, auf einen Zettel geschrieben überbringen ließen? Von so etwas ließ er sich neuerdings beeindrucken? Lag es daran, dass er jetzt allein war, sein eigener Nachlassverwalter sozusagen, seitdem sein Partner weg war? Was heißt hier weg? Pedro Lopes war tot, einfach gestorben, war ja alt genug gewesen. So was passiert eben. Pech für Ruger, dass seitdem alles nicht mehr so weiterging wie bisher.
Er wählte die Nummer und las sie dabei ganz mechanisch vom Zettel ab.
Ausgerechnet sie meldete sich. Gleich nach dem ersten Klingelzeichen.
»Inês? Ich bin’s.«
»Warum rufst du an? Du sollst nicht mehr anrufen.«
»Ich muss mit Henrique sprechen. Wir waren verabredet.«
»Er ist nicht da, ihr könnt euch nicht sehen.«
»Wann kommt er zurück?«
»Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass er dich nicht mehr sehen will.«
»Was ist denn passiert? Wir hatten noch etwas zusammen zu erledigen.«
»Daraus wird nichts mehr.«
»Vielleicht sollte ich doch vorbeikommen.«
»Du kannst jetzt nicht vorbeikommen.«
»Warum?«
»Es geht nicht. Hör auf zu fragen.«
»Ist jemand bei dir?«
»Ich muss jetzt aufhören.«
»Wann sehen wir uns wieder?«
»Wir sehen uns überhaupt nicht mehr wieder.«
»Aber das kann doch nicht …«
»Wenn du unser Freund bist, dann kommst du nicht mehr her.«
»Hör mal …«
»Ich will dich nicht mehr sehen.«
Sie legte auf.
Eine Weile noch hielt er den Hörer in der einen Hand und starrte auf den Zettel in der anderen. Dann erst merkte er, dass er den ganzen Zeitungsstapel in der Tasca liegen gelassen hatte.
»Irgendwas läuft total schief.«
Eigentlich alles.
3
Im Zug nach Sintra musste er die Debatte von zwei englischen Ehepaaren anhören, die sich über die qualitativen Unterschiede von Portwein und Sherry stritten. Das war der Nachteil von Sintra, die Engländer, die sich dort zum Teil sogar als Dauergäste eingenistet hatten. Engländer im Pensionsalter lernen gerne jemanden kennen. Sie schrecken nicht davor zurück, gänzlich unbekannte Personen in schummrigen Bars anzusprechen. Auch wenn man diesen Personen deutlich ansieht, dass sie allein sein möchten. Ruger hatte zahllose Gespräche dieser Art geführt. Die Männer, die ihn leutselig ansprachen, sahen grundsätzlich gleich aus: rüstig, braungebrannt, grau- bis weißhaarig, trugen helle Windjacken, weiße Hosen und altmodische Sandalen. Wenn Ruger in seine Lieblingsbar um die Ecke ging, trug er im Allgemeinen Tennisschuhe. Also fragten ihn diese Typen immer, ob er mal Profi gewesen sei. Und dann monologisierten sie über ihren Besuch in Wimbledon. Immerhin hatte er noch keinen getroffen, der über Cricket reden wollte. Obwohl es hier im Ort einen Verein gab. Dafür sprachen alle über die beiden Schlösser, für die Sintra berühmt war, den mittelalterlichen Palácio Nacional unten im Ort und den Palácio da Pena auf dem Berg. Und weil der Palast dort oben auf dem Gipfel ein wüstes Konglomerat an kitschigen Baustilen aus allen Ländern und Zeiten war, landeten seine gebildeten Gesprächspartner grundsätzlich irgendwann bei Neuschwanstein, weil sie natürlich wegen seines Akzents mitbekommen hatten, dass er aus Deutschland kam. Und dann wurde es unangenehm. Nicht wegen Neuschwanstein, sondern weil dann die Ausfragerei begann. Wo er herkäme, welchen Beruf er habe, wie lange sein Urlaub dauere.
Außer der Nähe zu Lissabon und der Möglichkeit, dort hin und wieder zu Geld zu kommen, gab es zwei Gründe, hier und nicht woanders die Zeit totzuschlagen: Zum einen hat man in einem solchen Tourismus-Ort, wo andauernd Leute ankommen und abreisen, das Gefühl, mit der Welt dort draußen in Verbindung zu stehen; zum anderen war da noch diese kleine Bar in einer Seitengasse, die den Namen von Alfonso VI. trug, jenem geistesgestörten König, der im 17. Jahrhundert nach seiner Abdankung fünfzehn Jahre lang in einem Zimmer des Palácio Nacional gefangen gehalten wurde.
In der Bar »Alfonso 6« gab es einen Cocktail gleichen Namens, der aus Brandy, Portwein und einigen angeblich geheimen Zutaten gemixt wurde und ein bisschen nach Nuss schmeckte. Aber der wahre Grund dafür, dass Ruger sich diese Bar als Stützpunkt für lange Nachmittage und träge Abende ausgesucht hatte, war die Wirtin. Er mochte sie, und auch sie konnte ihn offenbar ganz gut leiden. Beide taten so, als läge es daran, dass sie die gleiche Zigarettenmarke rauchten. Sie war mindestens zehn Jahre älter als er und wahrscheinlich nie wirklich hübsch gewesen, ein bisschen zu breit in den Hüften, zu groß die Nase, zu streng das Gesicht. Aber ihre Souveränität gefiel ihm und wie sie in ihrem einfachen schwarzen Kleid und den schwarzen Leinenschuhen mit federndem Gang umherlief und ihre Arbeit versah. Sie sprachen nie viel miteinander, schon gar nicht über persönliche Dinge.
Als er am Nachmittag mit dem Zug angekommen war, ging er als Erstes in ihre dunkle Bar, die zum größten Teil von einer langen hölzernen Theke ausgefüllt wurde. Sie empfing ihn mit einem ungewohnt sorgenvollen Gesichtsausdruck, grüßte knapp und deutete mit dem Kopf in die hinterste Ecke, wo drei Männer an einem kleinen Tisch saßen.
Zwei von ihnen kannte er schon. Es waren die beiden, die auf dem Platz vor der Tasca in Lissabon herumgelungert hatten. Die beiden mit der Telefonnummer auf dem Zettel. Sie sahen ihn reinkommen, und der mit der Lederjacke nickte ihm zu, an den Tisch zu kommen.
Den dritten sah er nur von hinten. Das heißt, er sah eigentlich nur einen abgetragenen schwarzen Anzug und einen Borsalino-Hut. Keine Zeit, das albern zu finden, der Kerl drehte sich um.
Er sah aus wie ein Klischee-Zigeuner, der von Haus zu Haus zieht, um Teppiche zu verkaufen. Langes, kantiges Gesicht, eingefallene Wangen, Hakennase, und als er verkniffen grinste, sah man die Goldzähne. Sein Anzug musste irgendwann mal viel gekostet haben, soweit Ruger das beurteilen konnte. Ansonsten trug er ein weißes Hemd, um dessen Kragen ein ledernes Band geschlungen war, das von einer Silberbrosche zusammengehalten wurde. Eine Silberbrosche in Form eines Pantherkopfes, dessen Augen zwei winzige Smaragde waren. An seinen zwei Händen zählte Ruger fünf schwere Ringe. Er saß lässig zurückgelehnt auf seinem Stuhl, die Beine übereinandergeschlagen. Seine Füße steckten in Cowboystiefeln.
Er drehte sich erst um, als Ruger dicht neben ihm stand. Höhnisch grinsend schob er ihm einen Stuhl hin. Er strengte sich nicht besonders an dabei. Ein Arschloch eben.
Ruger wandte sich um und bestellte bei Francisca einen Brandy. Auf den Cocktail hatte er keine Lust mehr. Dann setzte er sich hin. Er war zu müde, um hier eine großartige Show abzuziehen. Es ging um Geschäfte, es ging um seine Zukunft, vielleicht ging es sogar darum, ob er diese Bar lebend verlassen würde.
»He!«, sagte der Mann mit dem Hut zu dem untersetzten Typen im zu engen T-Shirt: »Willst du uns nicht vorstellen?«
Der Angesprochene zuckte gelangweilt mit den Schultern und sagte dann mit nöliger Stimme: »Das ist Vincente Mouíz, das hier ist Anton Ruger.« Dann deutete er auf sich und seinen Kumpel: »Ich bin ich und er ist er.«
Mouíz hob grüßend die Hand zur Hutkrempe. Wahrscheinlich übte er so was vor dem Spiegel. Dann drehte er den Kopf und musterte die Bar.
»Hübscher Ort«, sagte er. »Sehr angenehm, um kleine Geschäfte zu erledigen. Ich glaube, wir werden noch öfter hierher kommen. Nur schade, dass wir Sie dann nicht mehr antreffen werden.«
Francisca trat an den Tisch und stellte den Brandy hin. Sie würdigte die drei Männer keines Blickes. Sie hatten ihre Getränke schon bekommen: Mouíz einen Kaffee, die beiden anderen Bier.
Die Wirtin blieb einen Moment länger neben Ruger stehen, als nötig gewesen wäre. Ein paar Sekunden, für die er ihr dankbar war.
Nachdem sie gegangen war, nippte er an seinem Brandy, während Mouíz sich nahe zu ihm hinbeugte. Eigenartigerweise roch er nach Rosenwasser.
»Sie wissen, wer uns geschickt hat?«
»Ich kann’s mir denken.«
»Erzählen Sie mir, was Sie denken. Ich liebe es, die Gedanken anderer Menschen zu erforschen. Die da können ja weghören.« Er wedelte nachlässig mit der Hand über den Tisch, als wolle er ein paar Mücken davonscheuchen.
Wie auf Kommando machten die beiden Handlanger desinteressierte Gesichter.
»Garett«, sagte Ruger.
Mouíz nickte aufmunternd.
»Filipe Sousa Garett.«
»Drei Gedanken in einem Kopf«, witzelte Mouíz.
»Ich schätze, meine Lizenz ist abgelaufen.«
»Ich würde es anders ausdrücken.«
»Wie denn?«
»Es hat nie eine Lizenz gegeben.«
Ruger griff nach seinem Brandyglas: »Tja.«
»Oder hat Garett etwa seinen Namen irgendwo draufgeschrieben?«
»Pedro hatte eine Lizenz, oder nicht?«
»Hatte er die? Woher soll ich das wissen?«
»Ich dachte, Sie wissen alles.«
»He! Nicht frech werden! Ich mag es nicht, wenn einer frech wird, mit dem ich über geschäftliche Angelegenheiten reden muss. Das sind komplizierte Dinge, die man ernst nehmen muss. Blöde Witze machen die Sache nur noch komplizierter, und dann verlieren wir die Geduld.«
Er deutete auf die beiden anderen, die zurückgelehnt mit verschränkten Armen auf ihren Stühlen saßen. Gelangweilt, aber wachsam.
»Was wollen Sie denn wissen?«
»Sie sollen mir erzählen, was sie getan haben. Ich will sichergehen, dass Sie nicht zu billig davonkommen.«
»Das ist alles?«
»Und dann wird die Lizenz eingezogen.«
»Aha, also doch.«
»Ein bisschen Strafe muss sein.«
»Na schön. Was soll ich denn erzählen? Ich habe einfach nur weitergemacht. Alles zu Ende gebracht, was ich mit Pedro zusammen aufgezogen habe.«
»Alles verkauft?«
»So gut wie. Nach und nach. Wir haben alles in kleinen Mengen verkauft, wie es abgesprochen war. Das heißt, so wie ich glaube, dass es abgesprochen war. Ich war ja nie dabei, als Pedro und Garett verhandelt haben. Aber soviel ich weiß, hat Pedro immer seine Prozente abgeführt.«
Mouíz nickte: »Hat er.«
»Na also. Was ist falsch daran, wenn ich es genauso mache?«
»Alles. Wer nicht zur Familie gehört, macht auch keine Geschäfte.«
»Welche Familie denn?«
»Pedro war eine Ausnahme, das wissen Sie doch?«
»Nein.«
»Er war der Einzige, der das Monopol brechen durfte, der Einzige, der eine Lizenz bekam, weil er zur Familie gehörte.«
»Ich verstehe kein Wort.«
»Pedro ist der Schwager von Garett.«
»Was?«
Mouíz grinste hämisch und schob sich den Borsalino in den Nacken.
»Nicht gewusst, was?«
»Nein.«
»Haben Sie mal Garetts Frau gesehen?«
»Ich habe nicht mal ihn gesehen.«
»Aber seine Frau bestimmt. Sie sehen doch fern? Ich weiß, dass Sie einen Fernseher in ihrem Zimmer haben.«
»So?«
»Ja. Fernanda ist ein Star. Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin. Jeder kennt sie. Sie ist eine Institution.«
»Und weiter?«
»Fernanda Lopes ist die Schwester von Pedro. Deshalb hat Pedro die Lizenz bekommen. Er durfte sie sogar behalten, obwohl seine Schwester sich von Garett getrennt hat.«
Ruger schüttelte ungläubig den Kopf: »Komische Geschichte.«
»Ja, komisch, nicht. Und sehr familiär. Deshalb passen Sie auch überhaupt nicht rein.«
»Pedro hat mir nie etwas davon erzählt.«
»Vielleicht war er nicht besonders stolz darauf, vielleicht schämte er sich, vielleicht war er gar kein so guter Freund, wie Sie dachten.«
»Er hat mir das gesamte Lager überlassen.«
»Hat er das?«
»Ja. Er hat wörtlich gesagt: Verkaufe und verschwinde.«
»Sie sind nicht verschwunden, das war Ihr Fehler.«
»Den Eindruck habe ich auch.«
»Und jetzt sind Sie pleite.«
»Bin ich das?«
»Wir haben Henrique besucht. Er hat uns zum Lager geführt. Wir haben es ausgeräumt. Er hat uns sogar dafür bezahlt. Sozusagen ein zusätzliches Geschäft, damit er auch weiterhin die Schönheit seiner Tochter bewundern kann.«
Ruger hätte nicht »Schweinehund!« sagen sollen, nicht dieses Wort und nicht so laut, am besten hätte er gar nichts gesagt. Denn das nächste, was er spürte, außer diesem Schmerz der Erniedrigung in der Brust, war der unvorhergesehene Faustschlag, der seine Nase traf. Sein Kopf wurde nach hinten geworfen, aber er fiel nicht vom Stuhl. Einen Moment lang starrte er benommen ins Nichts, dann fixierte er wieder das Gesicht des höhnisch grinsenden Mouíz, der die Faust immer noch geballt hielt, bereit, ein zweites Mal zuzuschlagen. Die beiden Handlanger waren aufgesprungen, um sich jeden Moment auf ihn zu stürzen, wenn es sein musste.
Er spürte, wie ihm das Blut aus der Nase tropfte.
Dann stand Francisca neben ihm und hielt ihm eine saubere und gebügelte Serviette hin. Er zögerte, dann nahm er sie doch. Sie blieb neben ihm stehen.
Mouíz schüttelte betrübt den Kopf.
»Dein Kunde ist schrecklich unvorsichtig«, sagte er zu ihr. »Wenn er nicht aufpasst, wird er sich ganz schlimm verletzen. Das liegt daran, dass er seinen Platz im Leben noch nicht gefunden hat. Er hat sich am falschen Ort breitgemacht. Hier kommt er nämlich ganz bestimmten Leuten ins Gehege. Wer keine Lizenz hat, ist unerwünscht. Das muss er noch lernen. Und er muss lernen, dass man ohne ausreichendes Kapital keine Firma aufmachen kann. Kapital hat er keins mehr, nicht einen Escudo. Er hat nämlich vergessen, es auf die Bank zu bringen.«
Er stand auf, gab Ruger einen spielerischen Klaps mit dem Handrücken auf den Hinterkopf und sagte: »Kapiert?«
Ruger nickte.
Mouíz drehte sich um und ging Richtung Ausgang. Die andern beiden standen ebenfalls auf und schlenderten provozierend lässig hinterher. Der Stämmige ließ dabei seine Hand über den langen Tresen gleiten. Der Schmächtige hielt ihm die Tür auf. Als sie draußen waren, begann er zu pfeifen. Sie verschwanden um die Ecke.
Francisca setzte sich gegenüber von Ruger auf den Stuhl und sah ihn an:
»Das sah so aus, als sei etwas zu Ende gegangen.«
Ruger nickte.
»Was hast du für Geschäfte gemacht?«, fragte sie.
»Waffen.«
»Und ich dachte immer, du wärst Schriftsteller.«
Er zuckte mit den Schultern, die Serviette immer noch vor das Gesicht haltend.
»Ich möchte mal wissen, wie ich hier wegkommen soll, wenn ich kein Geld mehr habe«, murmelte er. Natürlich hatten sie alles Bargeld aus seinem Zimmer mitgenommen. Und das, was Henrique deponiert hatte, dürfte ebenfalls »abgehoben« worden sein.
»Soll ich dir deine Uhr abkaufen?«
»Wenn du willst.«
»Ja«, sagte sie, »ich glaube, ich hätte gern ein Erinnerungsstück.«
4
Für ihn gab es kein Erinnerungsstück mehr. Sie hatten ihm sogar seinen Colt »Double Eagle« weggenommen. Na gut, jetzt war es sowieso egal, denn er hätte die Pistole wohl kaum mit ins Flugzeug nehmen dürfen. Außerdem war es besser, in seinem neuen Exil ohne Waffe anzukommen. In dieser Hinsicht war er abergläubisch.
Er war der einzige Passagier des TAP-Flugs von Lissabon nach Paris. Er hatte tatsächlich die ganze Maschine für sich alleine, inklusive Stewardess. Alles sah danach aus, als ob man ihn unbedingt und auf der Stelle aus dem Land haben wollte.
Aus Gewohnheit hatte er sich beim Betreten der Maschine sämtliche Zeitungen geben lassen, die vorrätig waren. Nun lagen sie auf dem Sitz neben ihm, aber er konnte sich nicht entschließen, sie zu lesen. Die Gegenwart ist eine ziemlich uninteressante Angelegenheit für einen, der gerade festgestellt hat, dass er keine Zukunft besitzt. Auf die Idee mit Paris war er ganz spontan gekommen. Eine Gefühlsentscheidung, über die er sich nur wundern konnte. Aber er war schon auf dem Weg.
Die Stewardess fragte ihn, ob er zum Kaffee ein Frühstück haben möchte, und er schüttelte den Kopf. Ob sie es mit ihren moralischen Grundsätzen vereinbaren könne, ihm jetzt schon einen Aperitif zu servieren? Das schon, sagte sie lachend, aber das Mittagessen würde er trotzdem erst später bekommen. Sie war eine von der pragmatischen Sorte, ganz hübsch, ganz nett, braune Augen, schwarze Locken. Nachdem sie ihm den Martini dry hingestellt hatte, setzte sie sich auf die Armlehne der Sitzreihe gegenüber, mit einem Becher Mineralwasser in der Hand.
»Sie sind mein letzter Fluggast«, sagte sie fröhlich. »Ich mache Schluss. Wenn ich in Paris aussteige, bin ich eine freie Frau.« »Darauf stoßen wir an.«
»Tut mir leid, dass ich nur Wasser trinke, aber ich musste auf dem Flughafen mit meinen Kollegen Sekt trinken. So früh am Morgen ist das schon viel zu viel Alkohol.«
»Macht nichts. Wenn Sie eine freie Frau sind, können Sie tun und lassen, was Sie wollen.«
»Auf die Freiheit.« Sie hob ihren Plastikbecher und zögerte kurz, als sei ihr gerade etwas eingefallen.
»Ja, trinken wir auf die Freiheit.«
»Ich glaube, ich habe ein bisschen Lampenfieber, jetzt, wo alles anders wird. Na ja …« Sie machte eine geringschätzige Handbewegung.
»Offenbar bin ich auch der letzte Fluggast der Fluggesellschaft.«
»Alle anderen haben offenbar den inoffiziellen TAP-Slogan ernstgenommen.«
»Hm?«
»Take another plane.«
»Ach so.«
»Sie sind aus Deutschland, stimmt’s?«
»Ja.«
»Aber Sie sehen nicht so aus, als ob Sie Urlaub gemacht hätten.«
»Ist es so schlimm?«
»Sie sehen beunruhigt aus. Haben Sie einen Unfall gehabt?« Sie deutete auf die Narben in seinem Gesicht.
»Das ist lange her. Aber tatsächlich habe ich gerade meinen letzten Rettungsanker verloren.«
»Leben Sie in Portugal?«
»Ich war vier Jahre dort, aber das ist jetzt vorbei.«
»Hatten Sie beruflich da zu tun?«
»Ja, so kann man das nennen.«
»Darf ich fragen, in welcher Branche?«
»Sie dürfen mich alles fragen. Ich habe so viel zu verbergen, dass ich mir wie ein schwarzes Loch vorkomme. Also warum nicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ich war Waffenhändler.«
»Das ist aber kein sehr schöner Beruf.«
»Wie man’s nimmt. Für Waffen habe ich mich eigentlich schon immer begeistern können.«
»Das ist so eine komische Männerangelegenheit.«
»Das stimmt. Obwohl es auch viele Frauen gibt, die sehr gut schießen können.«
»Sie meinen im Sport? Haben Sie Sportwaffen verkauft?«
»Nein, eigentlich solche, mit denen man Menschen umbringen kann.«
»Wurden mit Ihren Waffen Menschen umgebracht?«
»Ich glaube schon.«
»Und, haben Sie es nie bereut, sie verkauft zu haben?«
»Nein, eigentlich nicht. Ich hatte keine andere Wahl.«
»Man hat immer eine Wahl.«
»Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Aber man wählt dann doch, was einem am ähnlichsten ist.«
»Um Ausreden sind Sie jedenfalls nicht verlegen.«
»Ich habe mir immer gesagt, dass es genauso gut mich treffen kann.«
»Was?«
»Die Kugel aus einer Waffe.«
»Mit solchen Spitzfindigkeiten kann man alles rechtfertigen.«
»Das ist keine Spitzfindigkeit.«
»Unsinn! Sie leben doch nicht gefährlich, nur weil Sie Waffen verkaufen.«
»Nein, nicht unbedingt.«
»Und jetzt haben Sie Ihr Geschäft aufgeben müssen?«
»Sie können wohl Gedanken lesen?«
»Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, sind Sie pleitegegangen.«
»Man hat mich pleitegehen lassen.«
»Sie sehen wirklich sehr gequält aus. Soll ich Ihnen noch einen Drink bringen?«
»Das wäre nett.«
Es wäre auch nett, wenn dieses Gespräch aufhören würde, dachte Ruger. Das Flugzeug hatte sich in einen Beichtstuhl verwandelt. Warum sollte er beichten, wenn er doch nichts bereute? Warum sollte er ausgerechnet dieser Frau seine Lebensgeschichte erzählen? Weil sie hübsch war? Weil sie einen guten Martini mixen konnte?
Sie kam mit einem frischen Becher zurück, entschuldigte sich aber gleich wieder. Sie müsse vorn noch einige Sachen erledigen, käme aber bald wieder zu ihm: »Ich muss mich schließlich um meinen letzten Fluggast gut kümmern.« Ja, ja, vielen Dank. Er legte den Spieß mit der Olive auf die Papierserviette und lehnte sich zurück.
Er dachte darüber nach, was aus ihm, dem einstigen braven Soldaten, geworden war. Ausgerechnet in jenem Jahr, als er nach langem Auslandsaufenthalt nach Berlin zurückgekehrt war, musste er miterleben, wie seine ganze Welt mit einem Mal zusammenbrach. Dabei hatte er sich so auf seine Rückkehr gefreut, vor allem auf einige Orte, die er mochte: den Alexanderplatz, die Karl-Marx-Allee, Unter den Linden, überhaupt ganz Berlin-Mitte. Er war ja kein geborener Berliner, also hatte er nicht gerade ein intimes Verhältnis zur Hauptstadt der DDR gehabt, aber ein sentimentales schon. In seinem Kopf hatte sich die Idee festgesetzt, es sich erst mal hinter der Mauer gemütlich zu machen. Im Schatten der Mauer eine Weile eine ruhige Kugel schieben. Es würde ihm bestimmt auch Spaß machen, von der richtigen Seite aus durch das Brandenburger Tor zu gucken. Na ja, das waren so Ideen. Als er dann nach Berlin kam, fingen die Leute an, auf der Mauer herumzutanzen. Und ein paar Monate später war nicht mehr viel von ihr übrig. Von seinem Job auch nicht. Plötzlich war er Zivilist, arbeitslos und stand auf der Liste irgendeiner angeblich nicht existenten »Koordinationsstelle zur Verfolgung regierungskrimineller Vergehen staatlichmilitärischer Organisationen der ehemaligen DDR« des Westberliner Staatsschutzes. Dabei war es seine Aufgabe gewesen, den Staat zu schützen. Den anderen.
Eine Weile dachten er und einige Kollegen, die sich aufgeschreckt von der politischen Entwicklung in Berlin zusammengefunden hatten, man müsse nur Ruhe bewahren und gleichzeitig seine Schäfchen unbemerkt ins Trockene bringen und den Absprung ins Ausland planen. Sie hatten Wohnungen, sie hatten Geld, sie verfügten über ein Informationsnetz und arbeiteten daran, ganz bestimmte Geldquellen aufzutun. Dazu mussten einige Funktionäre bearbeitet werden, von denen die meisten plötzlich kalte Füße bekamen. Und manche, die direkt an der Geldquelle gesessen hatten, waren schon verschwunden. Trotzdem schaffte es die Gruppe, an ein Konto mit knapp 10 Millionen Mark ranzukommen, das der militärische Geheimdienst in der Schweiz besessen hatte. Aber kaum gab es eine Zugriffsmöglichkeit, stand auch schon der Staatsschutz vor der Tür. Es hatte einen Verräter in den eigenen Reihen gegeben, der lieber mit seiner Frau ein Reihenhaus in Berlin als ein Luxushotel in der Karibik bewohnen wollte. Seine Zeit im Reihenhaus war dann leider sehr kurz bemessen: Eines Morgens fand ihn seine Frau mit einer Kugel im Kopf auf der Treppe vor ihrer Haustür. Neben ihm lag die aktuelle Ausgabe des Neuen Deutschland