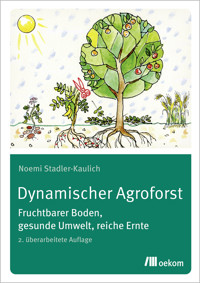Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Agroforstwirtschaft - zukunftsfähige Landnutzungsmethode
Das E-Book Handbuch Agroforstwirtschaft wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Agroforstwirtschaft, Zukunftsfähige Landnutzungsmethode
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
An diesem Handbuch haben viele Personen mitgewirkt, die sich für die Agroforstwirtschaft begeistern.
Ihnen allen danke ich für‘s Korrekturlesen, für ihre Anregungen und weitere „Zu-Taten“.
Interessierte an den einzelnen Funktionen der Pflanzen erfahren mehr unter: https://smagy.de
Über Fragen, Anregungen und Kritik freut sich die Autorin.
Das vorliegende Handbuch über die grundlegenden Prinzipien der Agroforstwirtschaft ist bereits in die Sprachen Spanisch und Französisch übersetzt. Weitere Sprachen können folgen, denn die Natur funktioniert überall nach denselben Grundsätzen. Die Autorin freut sich über einen Kontakt zu Wissensträgern aus unterschiedlichen Ökoregionen, die mit ihr die Pflanzlisten für die Begleitarten in dem jeweiligen Ökosystem erarbeiten, damit das Handbuch weltweit zur Verbreitung von Agroforst beitragen kann.
Kontakt: [email protected]
Anmerkungen zum Text:
Mit einem * versehene Begriffe werden kursiv im nächstfolgenden Abschnitt erklärt.
Im gesamten Text steht die männliche Form stellvertretend für Personen aller Geschlechter.
Die Handlungsempfehlungen in diesem Buch erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen.
INHALT:
Vorwort
Agroforst - Bäume und Sträucher in der Landwirtschaft
Bäume und Sträucher - Förderung der landwirtschaftlichen Produktion
Wurzeln und ihre Symbionten - Schlüsselfaktoren der Bodenfruchtbarkeit
Fruchtbarer Boden – Produktive Nutzpflanzen
Easy Agroforst <-> Dynamischer Agroforst
Von Planung bis Implementierung einer Agroforstfläche
6.1 Artenvielfalt und Dichte
6.2 Zusammenstellung unterschiedlicher Pflanzenarten
6.3 Planung der Agroforstfläche
6.3.1 Hauptziel der Agroforstfläche
6.3.2 Auflistung der Rahmenbedingungen
6.3.3 Erwünschte Nutzarten und Anbaukulturen
6.3.4 Anzahl und Auswahl der Begleitvegetation
6.3.5 Die Anordnung von Nutz-, Kultur- und Begleitvegetation auf der Fläche
6.4 Auswahl von Pflanz- und Saatgut
6.5 Ausmessung der zukünftigen Agroforstfläche
6.6 Skizze für Aussaat und Pflanzung
6.7 Einzäunung der Agroforstfläche
6.8 Vorbereitung der Pflanzlöcher
6.9 Auspflanzung
6.10 Vorbereitung der Agroforstflächen für Ackerkulturen und Gemüsebau
Pflege einer Agroforstfläche
7.1 Prinzipien der Pflege
7.2 Selektives Säubern
7.3 Mulchen
7.4 Bewässern
7.5 Schnitt
Tiere im Agroforst
8.1 Geflügel
8.2 Weidetiere
8.3 Bienenhaltung
Mehrwert: Fragmentiertes Zweigholz
Mehrwert: Pflanzenkohle
Pflanzenbeschreibung für den dynamischen Agroforst in Mitteleuropa
Zusammenfassung: von easy bis dynamische Agroforstwirtschaft
Vorwort
Dieses Handbuch erläutert Landwirten mit und ohne Nutztieren, Gemüsebauern und Gartenbesitzern die praktische Anwendung der Agroforstwirtschaft - eine Kombination von Ackerbau oder Grünfläche mit Bäumen und Sträuchern - in ihren unterschiedlichen Anwendungsformen. Schritt für Schritt wird Anlage und Pflege eines Agroforstsystems erklärt, mit dem Ziel:
Erfolgreiche Nutzung einer Wirtschaftsfläche
inklusive
- Verbesserung von Bodenfruchtbarkeit und Bodenwasserhaushalt
- Anpassung der Anbaukulturen an die Klimaveränderungen
- Wiederherstellung der lokalen Biodiversität
- Klimaschutz
Agroforst kopiert grundlegende Prinzipen der Natur: Artendiversität, Kooperation zwischen Pflanzen und möglichst ganzjährig bodenbedeckender Pflanzenstand. Ein weiteres Prinzip ist die Entstehung von fruchtbarem Boden durch die naturgegebene Aufeinanderfolge unterschiedlicher Pflanzenarten auf einer bestimmten Fläche, genannt Sukzession. Durch eine agroforstliche Flächennutzung lässt sich Bodenbildung sogar zeitlich komprimieren, da Pflanzenarten miteinander kombiniert werden, die natürlicherweise nicht zur selben Zeit, sondern nacheinander vor Ort stehen würden. Diese Artenkombinationen führen rasch zu einer fruchtbaren Erde mit hohem Wasserspeichervermögen. Agroforst fördert natürlicherweise stattfindende biologische Prozesse im Boden und eignet sich deshalb zur Bodensanierung bei gleichzeitig guten Erträgen.
Die Bodenbildung beginnt mit der Verwitterung von Gestein durch Wind und Wetter. Lichtbedürftige Pionierarten sind die Erstbesiedler einer Kahlfläche. Sie gedeihen auch bei Nährstoffarmut oder Nährstoffungleichgewicht und bereiten den Boden für die Sekundärvegetation. Abgestorbene Pflanzenteile werden durch entsprechende Organismen zersetzt. Im Laufe der Zeit wird die Erdauflage immer dicker, so dass sich anspruchsvollere Pflanzenarten ansiedeln können. Die Sukzession führt zu einem Wald mit humusreichem Boden, ein Produkt zersetzender und aufbauender Prozesse der Bodenorganismen. Humus in der Erde speichert Pflanzennährsubstrate und Wasser.
Wurzelsymbionten* erhalten für die Versorgung ihrer Wirtspflanzen kohlenstoffhaltige Nährsubstrate aus der Fotosynthese. Auf diese sind sie angewiesen, denn in der Dunkelheit unter der Erde können sie Sonnenlicht nicht nutzen. Durch diese zuckerhaltigen Wurzelausscheidungen wird das Erdreich zu einer langfristigen Kohlenstoffsenke. Je artenreicher die zur Verfügung stehende Biomasse ist und je höher der Energieeintrag aus Wurzelexsudaten im Boden, desto zahlreicher und artenreicher sind die Bodenorganismen und desto effektiver ist der Humusaufbau. Je höher der Humusanteil im Boden, desto höher ist das Bodennährstoffspeichervermögen, die Bodenwasserspeicherkapazität und sein Beitrag als Kohlenstoffsenke, denn Humus besteht zu 58 Prozent aus Kohlenstoff.
Wurzelsymbiont: Ein Symbiont ist der kleinere Partner einer symbiontischen Beziehung, in diesem Fall an einer Pflanzenwurzel, zum Beispiel Knöllchenbakterien oder Wurzelpilze (Mykorrhiza).
Bäume und Sträucher tragen wesentlich zu einem lebendigen, fruchtbaren Boden bei. Doch sind sie heute von Acker und Grünland weitestgehend verbannt. Das erklärt unter anderem den aktuellen Verlust der Bodenfruchtbarkeit. Die Trennung zwischen Landwirtschaft und Forstwirtschaft sollte aufgehoben und beide Handlungsfelder, sowohl in der Praxis als auch in der Ausbildung, zusammengeführt werden. Die Agroforstwirtschaft ist ein konkreter Schritt in diese Richtung.
Wer nun neugierig ist: „Wie soll das geh’n, wenn Bäume auf dem Acker stehn?!“ erfährt in diesem Handbuch, welch großer Vorteil Bäume und Sträucher auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sind und die so häufig als problematisch angeführte Beschattung gar kein Problem darstellt.
Agroforst – Bäume und Sträucher in der Landwirtschaft
Agroforst:
ist ein Produktionssystem nach dem Vorbild der Natur, in dem Kulturpflanzen oder Grünland mit Bäumen und Sträuchern zur gegenseitigen Unterstützung auf derselben Produktionsfläche kombiniert werden; auch Tiere profitieren von diesem naturnahen Landnutzungssystem.
ist ein Produktionssystem in ständigem Veränderungsprozess und gleichzeitig ein stabiles Ökosystem mit hoher Resilienz gegenüber Störungen.
ist genauso auf kleinen Flächen anzuwenden wie auf großen Feldern, als Baumreihen auf dem Getreideacker oder Komponente im intensiven Gemüsebau, auch im Garten oder Hochbeet.
wird jeweils an die Standortbedingungen angepasst und ist deshalb immer ganz spezifisch.
kann erheblich zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen beitragen.
erlaubt unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, wie nur zwei Arten auf der Produktionsfläche (
easy
Agroforst, zum Beispiel Getreide mit Wertholzbaumreihen) als auch eine Vielzahl dicht gepflanzter Nutz- und Begleitarten in derselben Parzelle (
dynamischer
Agroforst).
Dynamischer Agroforst imitiert die Abläufe der Natur besonders intensiv und wird deshalb gerne auf problematischen Böden oder in Trockengebieten angewandt, da sich Bodenfruchtbarkeit und Bodenwasserhaushalt rasch verbessern, das lokale Ökosystem gesundet und landwirtschaftliche Produktion möglich wird.
Dynamischer Agroforst nutzt im Pflanzenkonsortium verschiedene Begleitarten mit Ammenfunktion für die Anbaukulturen: Schutz gegen Wind und Wetter, Biofertilisation*, Bioirrigation* und Repellentwirkung gegen Schädlinge. Der Schnitt der Begleitvegetation liefert die Biomasse für den Humusaufbau.
verholzte Biomasse aus dem Pflanzschnitt in dynamischen Agroforstsystemen kann zu Pflanzenkohle* transformiert werden. Diese verbessert nach ihrer Anreicherung mit Nährsubstraten die Fruchtbarkeit und Wasserspeicherfähigkeit des Bodens über Jahrhunderte und ist eine bedeutende Kohlenstoffsenke.
Pflanzenkohle: Organisches Material – in der Regel Äste aus dem Baumschnitt, die dicker sind als das Handgelenk – ist zu stabilem Kohlenstoff pyrolisiert und deshalb eine langfristige Kohlenstoffsenke. Zahlreiche Hohlräume verbessern die Bodenstruktur, speichern Nährstoffe und Feuchtigkeit, bieten Bodenorganismen ein geeignetes Habitat und immobilisieren Bodengiftstoffe, wie zum Beispiel Schwermetalle, die in Folge nicht von den Nutzpflanzen aufgenommen werden und deshalb auch nicht in die menschliche Nahrung gelangen können.
Totholz bestimmter Baumarten der Agroforstfläche kann für die Pilzproduktion verwendet werden.
Ertragreiche Ernten bei gleichbleibend hoher oder sich sogar verbessernder Bodenfruchtbarkeit gibt es nur bei permanenter Neubildung humusreicher Erde in einem lebendigen, gut durchwurzelten Boden. Voraussetzung dafür sind Bäume und Sträucher mit ihren Symbionten im Wurzelraum, eine Vielfalt weiterer Bodenorganismen und das Vorhandensein von Biomasse über und unter der Erde.
Merke: Agroforst ist eine landwirtschaftliche Produktionsmethode mit Gehölzen auf dem Acker, der Grünfläche, dem Obstbau oder den Gemüsebeeten, die im Großen oder kleinen, mit oder ohneNutztiere angewandt werden kann, zur Bodenfruchtbarkeit beiträgt und das Klima schützt.
Anmerkung: Immer wieder wird über Wechselwirkungen zwischen Pflanzen berichtet, bei der eine über bestimmte Ausscheidungen die andere in ihrer Entwicklung behindert. Diese Allelopathie wird zum Beispiel für die Walnuss beschrieben. Derartige Beobachtungen kann ich in meinen Agroforstsystemen, unter anderem mit Walnuss, bislang nicht machen. Im Gegenteil kann folgende Unternutzung bei erwachsenen Walnussbäumen vorkommen: Rhabarber, Kartoffel, Zwiebeln, Rote Beete, Blumenkohl, Pastinaken, Lattich, Quitte, Johannisbeere, Himbeere, Walderdbeere, Weizen, Hafer, Salbei, Kapuzinerkresse, Beinwell, Pfefferminze, Johanniskraut, Clematis, Krokusse.
Schaubild 1.1: Argumente für Agroforst:
Bäume und Sträucher – Förderung der landwirtschaftlichen Produktion
Der Boden ist die Grundlage des Lebens. Fruchtbare, humushaltige Erde ist Voraussetzung zweier lebenswichtiger Elemente für den Menschen: Nahrung und Trinkwasser. Jedes Weizenkorn, jedes Radieschen und jeder Apfel setzen sich aus vielfältigen Substanzen zusammen, die in Kombination mit der Energie der Sonne dem Boden entnommen wurden. Diese dem Boden entzogenen Baustoffe – üblicherweise werden sie geerntet, das heißt aus der produktiven Fläche entfernt - müssen dem Erdboden wieder zurückgegeben werden. Nur so bleibt seine Befähigung, weiterhin Getreide, Gemüse und Früchte zu erschaffen, erhalten. Die Verfügbarkeit von „Nährstoffen des Erdreichs“ für die Pflanzen, sowie die Feuchtigkeit, ist abhängig vom Humusgehalt des Bodens. Deshalb ist Humus ein wichtiger Bestandteil des fruchtbaren Erdbodens. Gewisse landwirtschaftliche Praktiken führen heutzutage jedoch zu gravierenden Bodenhumusverlusten. Der Bundesverband Boden e.V. schätzt, dass 45 Prozent der Böden in Europa einen geringen bis sehr geringen Anteil von unter 1 bis maximal 2 Prozent Humusgehalt haben.
Die Anwendung von Agroforst führt zu Humusanreicherung im Boden. Dies geschieht:
über die kontinuierlich absterbenden und sich neu bildenden Wurzelhärchen an den weitläufig verzweigten Wurzeln eines jeden Gehölzes. Wurzelmasse ist Biomasse und die Zersetzung abgestorbener Wurzelteile durch Bodenorganismen reichert den Boden beständig mit Humus an.
über die Blätter der Gehölze. Diese enthalten Nährstoffe, die zum Teil von tiefreichenden Wurzeln aus tiefliegenden Bodenschichten gelöst worden sind. Wenn im Herbst das Laub zu Boden fällt bildet es zuerst eine Mulchschicht, um später durch Bodenorganismen zersetzt zu werden. Durch die Zersetzung der Laub-Biomasse reichert sich der Oberboden mit „neu-gewonnenen“ Nährstoffen an. Dieser Prozess nennt sich Nährstoffpumpe*. Benachbarte Nutzpflanzen profitieren von diesem Bodenaufbau.
Nährstoffpumpe: Bezeichnung für den Prozess, bei dem Pflanzen über tiefreichende Wurzeln Nährstoffe aufnehmen, daraus Blätter, Äste und Wurzelmasse bilden und diese Biomasse später von Bodenorganismen zersetzt wird, so dass „neue“ Nährsubstanzen den lokalen Nährstoffkreislauf bereichern.
über kohlenstoffhaltige, energiereiche Ausscheidungen, mit denen Pflanzen ihnen zugehörige Organismen im Boden versorgen und als Gegenleistung nährende und gesundheitsfördernde Substanzen erhalten. Gut versorgte Bodenorganismen sind sehr aktiv, vermehren sich zahlreich und werden nach ihrem Absterben selbst zu Humus.