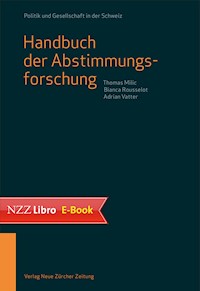
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Politik und Gesellschaft in der Schweiz
- Sprache: Deutsch
Band 2 der Reihe 'Politik und Gesellschaft in der Schweiz' Zentrale Fragen in der Abstimmungsforschung sind etwa: Wird das Volk von den Parteien gesteuert? Wären gewisse Abstimmungsergebnisse anders ausgefallen, hätten sich alle beteiligt? Wie informiert ist die Schweizer Bevölkerung über die ihr vorgelegten Sachfragen? Die drei Politikwissenschaftler bieten einen systematischen Überblick über die schweizerische Abstimmungsforschung. Ein erster Teil beschäftigt sich mit der Ausgestaltung der direkten Demokratie auf nationaler, kantonaler und lokaler Ebene und der Nutzung der direktdemokratischen Instrumente. Ein zweiter Teil handelt von den Wirkungen der Volksrechte auf das politische System der Schweiz. Der weitere Fokus liegt auf dem Entscheidverhalten der Schweizer Stimmbürger. Dabei stellen die Autoren zunächst die dominanten theoretischen Ansätze zur Erklärung des Abstimmungsverhaltens vor, dann präsentieren und kommentieren sie kritisch die Schweizer Anwendungen, um schliesslich die Ergebnisse der Abstimmungsforschung aufzuführen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Freitag und Adrian Vatter (Hrsg.)
Politik und Gesellschaft in der Schweiz
Band 1:Markus Freitag (Hrsg.),Das soziale Kapital der Schweiz
Band 2:Thomas Milic, Bianca Rousselot, Adrian Vatter,Handbuch der Abstimmungsforschung
Band 3:Markus Freitag und Adrian Vatter (Hrsg.),Wahlen und Wähler in der Schweiz
Weitere Bände in Vorbereitung
Verlag Neue Zürcher Zeitung
Handbuchder Abstimmungs-forschung
Thomas Milic
Bianca Rousselot
Adrian Vatter
Verlag Neue Zürcher Zeitung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2014 Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2014 (ISBN 978-3-03823-909-3)
Titelgestaltung: icona basel
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-03810-043-0
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Neuen Zürcher Zeitung
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 2.1: Typen direktdemokratischer Verfahren
Abbildung 2.2: Klassifizierung direktdemokratischer Verfahren nach Vatter (2000)
Abbildung 2.3: Erfolgsraten von Volksinitiativen und Referenden (1848–2013, absolut, in %)
Abbildung 3.1: Eine Wirkungsanalyse für das halbdirektdemokratische System der Schweiz im Vergleich zu einer rein repräsentativen Demokratie auf der Basis empirischer Befunde
Abbildung 4.1: Ausschöpfungsquote Vox-Umfragen (1999–2013, in %)
Abbildung 4.2: Links-rechts-Selbsteinschätzung, Parteiverbundenheit und politisches Interesse
Abbildung 5.1: Die vier sozioökologischen Räume nach Nef (1980)
Abbildung 5.2: Die Abstimmung über das Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (26.9.2010, Ja-Stimmen-Anteile in % nach Bezirken)
Abbildung 5.3: Der Kausaltrichter der Michigan-Schule
Abbildung 5.4: Parteibindungen in der Schweiz. Anteil Parteiungebundener und solcher, die auf die Frage nach der Parteigebundenheit keine materielle Antwort zu geben vermögen (2000–2012, in % der Stimmberechtigten)
Abbildung 5.5: «Rationales», am finanziellen Eigeninteresse orientiertes Stimmverhalten bei der Abstimmung über den Neuen Finanzausgleich (28.11.2004, Nein-Stimmen-Anteile der Kantone in % [schwarze Linie] in der Reihenfolge der wirtschaftlichen Leistungskraft der Kantone [Säulen])
Abbildung 5.6: (Annähernder) Mainstream-Effekt bei der Abstimmung über den Verzicht der Einführung der allgemeinen Volksinitiative (27.9.2009)
Abbildung 5.7: Polarisierungseffekt bei der Abstimmung über die Lehrstelleninitiative (18.5.2003)
Abbildung 6.1: Vorlagenspezifische Informiertheit der Schweizer gemäss unterschiedlichen Studien (Anteile tief, mittel und hoch informiert, in %)
Abbildung 6.3: Mobilisierung bei Abstimmungen. Anteil eingegangener Stimmzettel im Vorfeld des Urnengangs vom 3.3.2013 im Kanton Genf
Abbildung 6.4: Der Inseratenkampagnenverlauf bei den Urnengängen vom 9.2.14 und 18.5.14, Anzahl aufgegebener Inserate in den letzten acht Wochen vor dem Abstimmungstermin
Abbildung 6.5: Übersicht der Mediennutzung earned media sowie Bundesbüchlein
Abbildung 6.6: Übersicht der Mediennutzung paid media
Abbildung 6.7: Die 13 intensivsten Inseratekampagnen (1981–2010)
Abbildung 6.8: Stimmabsichten (in %, geäussert bei der Vorbefragung) und Stimmentscheid (in %, geäussert bei der Nachbefragung) bei den Abstimmungen über das Gurtenobligatorium und die Brotgetreideverordnung (eidgenössischer Urnengang vom 30.11.1980)
Abbildung 6.9: Entscheidzeitpunkt und Entscheidschwierigkeit bei 13 ausgewählten Vorlagen (Anteil «von Beginn weg klar» [Säulen] in % und Anteil «eher leichter Entscheid» [Linie] in % aller Stimmenden)
Abbildung 6.10: Kampagnenausgaben und Regierungsunterstützung an der Urne (1981–2006)
Abbildung 6.11: Propagandastruktur und Abstimmungserfolg (2005–2011)
Abbildung 6.12: Kenntnis der Parteiparolen (Anteile jeweils in % aller Stimmberechtigten)
Abbildung 6.13: Anzahl abweichender kantonaler Parolen und die Abweichung des Stimmverhaltens der jeweiligen Parteianhängerschaften von der Empfehlung der nationalen Mutterpartei in Prozentpunkten
Abbildung 6.14: Anteil Nutzung Bundesbüchlein (2000–2013, in % der Teilnehmenden)
Abbildung 6.15: Regierungskonformes Stimmverhalten (in %) und Nutzung des Bundesbüchleins
Abbildung 7.1: Beteiligung bei eidgenössischen Urnengängen (1951–2012, Jahresdurchschnitte und gleitender Fünfjahresdurchschnitt, in %)
Abbildung 7.2: Beteiligungsmuster bei Abstimmungen und Wahlen in der Stadt St. Gallen (2010–2013)
Abbildung 7.3: Typen von Urnengängern und ihre Anteile am Total aller Stimmberechtigten bei Sachabstimmungen in der Stadt St. Gallen (2010–2013, in %)
Abbildung 7.4: Stimmbeteiligung, Alter und Geschlecht (in %)
Abbildung 7.5: Stimmbeteiligung in den Kantonen (2001–2010, in %)
Abbildung 7.6: Durchschnittliche kantonale Leerstimmenanteile bei allen eidgenössischen Abstimmungen (1971–2007, in %)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 2.1: Übersicht über die Volksrechte in der Schweiz (Bundesebene)
Tabelle 2.2: Ergebnisse von obligatorischen und fakultativen Referenden sowie Volksinitiativen in der Schweiz (1848–2013)
Tabelle 2.3: Beispiele obligatorischer Referenden (ab 1990, unvollständige Liste)
Tabelle 2.4: Themen der eidgenössischen Volksabstimmungen (1971–2011)
Tabelle 2.5: Referendumspflichtige Vorlagen inklusive dringlich erklärter Bundesbeschlüsse (1874–2011)
Tabelle 2.6: Beispiele fakultativer Referenden (ab 1990, unvollständige Liste)
Tabelle 2.7: Volksinitiativen und Gegenvorschläge (1848–2013)
Tabelle 2.8: Beispiele für Volksinitiativen (ab 1989, unvollständige Liste)
Tabelle 2.9: Stimmbeteiligung seit 1990 (Jahresdurchschnitte in %)
Tabelle 2.10: Übersicht über die wichtigsten Volksrechte in den Kantonen
Tabelle 2.11: Unterschriftenquorum, Zahl und Erfolgsgrad kantonaler Volksabstimmungen (1970–2013)
Tabelle 2.12: Anteil Gemeinden mit Parlament nach Einwohnerzahl und Sprachregion (in %)
Tabelle 2.13: Typen direktdemokratischer Instrumente auf der Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene
Tabelle 4.1: Datentypen und ihre Beziehungen nach Aggregierungsniveau
Tabelle 4.2: Datentypologie nach Genese und Aggregierungsniveau mit empirischen Beispielen
Tabelle 6.1: Durchschnittliche Nutzung von Medienquellen (in %)
Tabelle 6.2: Geschätzter Kampagnenaufwand für zehn ausgewählte Vorlagen gemäss Medienquellen
Tabelle 6.3: Abstimmungsresultat und Propagandastruktur (1977–1981)
Tabelle 6.4: Abstimmungsresultat und Propagandastruktur
Tabelle 6.5: Abweichung kantonaler Parolen von jener der nationalen Mutterpartei (1981–2011, in %, gerundet)
Tabelle 6.6: Parolenkonformität: Abweichung des Stimmverhaltens der Parteianhängerschaften von den Parolen ihrer Parteien (106 Vorlagen 2000–2011, in %). Total ausgewählte Konfliktfelder und -konstellationen
Tabelle 6.7: Parolenkonformität: Abweichung des Stimmverhaltens der Parteianhängerschaften von den Parolen ihrer Parteien (106 Vorlagen 2000–2011, in %). Total ausgewählte Konfliktkonfigurationen
Tabelle 6.8: Verwendung von Entscheidhilfen bei Abstimmungen (Angaben von Empfehlungen bei der Motivfrage, in % aller Motivangaben)
Tabelle 6.9:Correct voting bei Sachabstimmungen in der Schweiz (jeweils die drei Höchst- und Tiefstwerte, in %)
Tabelle 6.10: Stimmverhalten bei Minderheitenvorlagen
Verzeichnis Kästen
Kasten 2.1: Entwicklung der direkten Demokratie in der Schweiz
Kasten 2.2: Kollision zwischen Stände- und Volksmehr bei Abstimmung über Verfassungsänderungen
Kasten 2.3: Wie ergreift man das fakultative Referendum?
Kasten 2.4: Volksinitiative beim Bund: Verfahrensgang und politischer Prozess
Kasten 2.5: Völkerrechtswidrigkeit und Ungültigkeit von Volksinitiativen
Kasten 2.6: Auszug Kantonsverfassung Glarus: Landsgemeinde
1Einleitung
Moderne Demokratien kennen zwei spezifische Modi der konventionellen Teilnahme des Bürgers am demokratischen Entscheidungsprozess: den Modus der Wahl und jenen der Abstimmung. Wahlen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Entscheidungsvollmacht übertragen. Sie stellen eine Technik dar, um die Mitglieder von Repräsentativkörperschaften und die Inhaber von Staatsämtern durch die Stimmabgabe der Wahlberechtigten zu bestimmen (vgl. Arzheimer und Falter 2003). Abstimmungen dagegen übertragen keine Entscheidungsvollmacht an Repräsentativorgane, sondern befähigen den Stimmbürger vielmehr dazu, direkt über Sachfragen zu entscheiden. Dabei ist die Abstimmungs- oder direkte Demokratie kein der repräsentativen Demokratie gegenübergestellter, eigenständiger und umfassender Demokratietypus. Vielmehr können direktdemokratische Instrumente als mögliche Bestandteile des komplexen institutionellen Gefüges politischer Systeme und als Elemente der Ausübung der Herrschaftsfunktion verstanden werden, die damit nicht nur ein Mittel zur politischen Bürgerpartizipation darstellen, sondern vielmehr als zusätzliche politische Institutionen einen die repräsentative Demokratie ergänzenden Status erhalten (vgl. Schiller 2002).
Wie in der Wahlforschung kann auch in der Abstimmungsforschung zwischen System- und Verhaltensforschung unterschieden werden. Während sich die Wahlsystemforschung damit beschäftigt, welche Auswirkungen die unterschiedliche Ausgestaltung des Wahlsystems auf das politische System, auf politische Prozesse und Akteure hat, untersucht die Wahlverhaltens- oder Wählerforschung das individuelle Verhalten der Wähler bzw. die Erklärungsfaktoren für die individuelle Wahlbeteiligung und den Wahlentscheid (vgl. Arzheimer und Falter 2003). Analog gilt, dass sich Abstimmungssystem- oder Direkte-Demokratie-Forschung mit den Auswirkungen der unterschiedlichen Ausgestaltung direktdemokratischer Instrumente auf politische Systeme, Prozesse und Akteure beschäftigt, während Abstimmungsverhaltensforschung, analog zur Wahlverhaltensforschung, folgende Fragen zu beantworten versucht: Welche Bürger beteiligen sich aus welchen Gründen an einer Abstimmung? Wie lässt sich der individuelle Abstimmungsentscheid erklären? Welche Prognosen sind für den Ausgang zukünftiger Abstimmungen möglich? Ist vor allem Wahlverhaltensforschung gemeint, wenn man heute von Wahlforschung spricht, so ist auch Abstimmungsverhaltensforschung gemeint, wenn wir im Rahmen dieses Buches von Abstimmungsforschung sprechen.
Es muss jedoch angefügt werden, dass sowohl Wahlverhaltens- und Wahlsystemforschung als auch Abstimmungsverhaltens- und Abstimmungssystemforschung eng miteinander verbunden sind, da jeweils das System den Rahmen vorgibt, innerhalb dessen sich Verhalten überhaupt erst vollziehen kann, und weil umgekehrt die politischen Wirkungen der Ausgestaltung eines Systems vom tatsächlichen Verhalten der Bürger abhängen (vgl. Arzheimer und Falter 2003). In den gängigen Theorien der Wahlforschung – vom Rational-Choice-Ansatz abgesehen – wurde dem Wahlsystem als möglichem Faktor der Wahlentscheidung nur begrenzt Aufmerksamkeit geschenkt.1 Bei der Abstimmungsverhaltensforschung hingegen muss zur Beantwortung ihrer Kernfragen das Augenmerk stärker auf den Abstimmungsentscheid beeinflussende Kontextfaktoren wie die Art des direktdemokratischen Instruments und andere, systemische Faktoren gelegt werden, um Unterschiede im Abstimmungsverhalten zu erklären. Dies manifestiert sich unter anderem darin, dass zwar die grossen Theorien der Wahlforschung – der soziologische Ansatz, der sozialpsychologische Ansatz und Rational Choice – auch die grossen Ansätze der Abstimmungsforschung darstellen und es keine alternativen «grossen» Theorien der Abstimmungsforschung gibt. Die Abstimmungsforschung hat sich jedoch schon seit ihren Anfängen mit jenen Spezialfragen beschäftigt, denen wir einen grossen Teil unserer Ausführungen widmen.
Das vorliegende Handbuch, das sich als Einführung in die Abstimmungsforschung in der Schweiz an Studierende und Forschende, aber auch an Praktiker und generell Interessierte richtet, beschäftigt sich somit hauptsächlich mit der Abstimmungsverhaltensforschung. Es zieht aber bestimmte Aspekte der institutionellen Systeme, in denen das Abstimmungsverhalten zwangsläufig eingebettet ist, ebenfalls in Betracht. Um ein ganzheitliches Verständnis der direkten Demokratie und der Abstimmungsforschung in der Schweiz zu schaffen, sollen also auch die Wirkungen, welche die direkte Demokratie im politischen System der Schweiz entfaltet, sprich Aspekte der Abstimmungssystemforschung, kurz beleuchtet werden. Diese stellen aber, wie erwähnt, nicht das Hauptaugenmerk unserer Studie dar, sondern dienen vielmehr der Einbettung in den weiteren Kontext der Direkte-Demokratie-Forschung.
Der erste Teil des Buches bietet somit einen Überblick über das institutionelle System der direkten Demokratie in der Schweiz und beschreibt die direktdemokratischen Instrumente, die es auf nationaler, kantonaler sowie kommunaler Ebene gibt. Um diese Übersicht systematisch zu gestalten und die direktdemokratischen Instrumente in ihren Grundlagen und potenziellen Wirkungen zu verstehen, werden sie in eine grundlegende Typologie eingebettet, die nicht nur auf die Schweiz bezogen ist, sondern eine generelle Verortung in übergeordneten Demokratietypologien zulässt. Es werden auch einige Eckdaten zu Nutzungshäufigkeiten, Erfolgsquoten, Stimmbeteiligung und betroffenen Politikfeldern vermittelt sowie konkrete Beispiele zu den verschiedenen direktdemokratischen Instrumenten behandelt.
Der zweite Teil widmet sich den Wirkungen dieser Instrumente im schweizerischen politischen System sowohl in Bezug auf Akteure und Prozesse als auch auf die Politikgestaltung und Policy Outputs. Im Zentrum stehen damit die Funktions- und Wirkungsweisen der unmittelbaren Volksrechte im Rahmen eines halbdirektdemokratischen Systems wie der Schweiz auf die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hierbei werden insbesondere auch die unterschiedlichen Effekte der direkten Demokratie im Vergleich zu repräsentativen Demokratien herausgearbeitet.
Der dritte Teil beschäftigt sich sodann mit den Daten, die der Abstimmungsforschung in der Schweiz zur Verfügung stehen, und beleuchtet die zur Anwendung kommenden Methoden. Zunächst werden einige grundlegende Eigenschaften von sozialwissenschaftlichen Daten und die Vor- und Nachteile bestimmter Datentypen zur Sprache kommen, aber auch konkrete Datenbeispiele respektive -quellen für die Schweizer Abstimmungsforschung erörtert. Das Hauptaugenmerk liegt neben vornehmlich amtlichen Aggregatdaten auf individuellen Umfragedaten, namentlich den für die Schweizer Abstimmungsanalysen wesentlichen Vox-Analysen. Das Kapitel beschäftigt sich auch mit den Methoden der Datenerhebung und -auswertung sowie den mit ihnen verknüpften methodischen Problemen, besonders den Vox-Umfragen. So kommen Aspekte der Stichprobenziehung ebenso zur Sprache wie Frageeffekte und das Problem der non-attitudes.
Das Kernstück dieses Handbuchs ist der vierte Teil, der sich mit den wichtigsten Theorien und Ansätzen der Abstimmungsforschung beschäftigt und deren Anwendung und Entwicklung in der Schweiz beschreibt. Die hier vorgestellten strukturtheoretischen, sozial- und kognitionspsychologischen sowie Rational-Choice-Ansätze stellen zwar die grossen Theorien der Wahl(verhaltens)forschung dar. Sie sind jedoch, wie erwähnt, auch die Basis zur Erklärung des Abstimmungsverhaltens, wenn auch mit besonderen, hier erläuterten Ausprägungen. Zunächst werden in diesem Kapitel die einzelnen Ansätze theoretisch dargestellt. Im Folgenden sollen Anwendungsbeispiele und Weiterentwicklungen aus der nicht schweizerischen, besonders der US-amerikanischen Abstimmungsforschung genannt werden. Sodann werden jeweils die wichtigsten Schweizer Anwendungen vorgestellt und gewürdigt, wobei grosses Gewicht auf aktuellen Studien liegt.
Der fünfte Teil dieses Handbuchs widmet sich den spezifischen Sonderfragen, welche die Abstimmungsforschung – auch als Antwort auf Kritiker der direkten Demokratie – über diejenigen der Wahlforschung hinaus stellen muss (vgl. Cronin 1989). So werden hier Untersuchungen zum Kompetenz- und Kognitionsniveau der Stimmbürgerschaft, zu Medien- und Propagandawirkungen auf das Abstimmungsverhalten, zur Käuflichkeit von Abstimmungen, zu Parteien- und Behördeneinfluss auf das Abstimmungsergebnis, zum correct voting sowie zur Rolle von Meinungsumfragen vorgestellt.
Ein letztes Kapitel befasst sich schliesslich mit der Partizipation bei Schweizer Sachabstimmungen und deren Determinanten. Neben individuellen Einflussfaktoren werden institutionelle Determinanten sowie ökonomische Erklärungen beleuchtet. Eine wichtige Frage, die an dieser Stelle behandelt wird: Führen Abstimmungen bei höherer Beteiligung systematisch zu anderen Ergebnissen? Andere wichtige Aspekte sind beispielsweise die Gründe für Abstentionismus oder das Problem der voter fatigue, sprich, ob man in der Schweiz von zu viel direkter Demokratie sprechen kann.
Generell liesse sich hier nun die Frage stellen, warum sich ein Werk mit dem Titel Handbuch der Abstimmungsforschung ausschliesslich mit der Erklärung des Abstimmungsverhaltens in der direkten Demokratie der Schweiz beschäftigt. Diese Frage wäre durchaus berechtigt, finden doch direktdemokratische Sachabstimmungen auf nationaler, subnationaler und lokaler Ebene nicht nur in der Schweiz, sondern in unterschiedlicher Ausprägung auch in den USA, in verschiedenen europäischen Staaten oder in Südamerika statt (Altman 2010, Hug 2004). Und es ist gerade dieser zunehmende Trend der weltweiten Nutzung direktdemokratischer Instrumente2 (Hug 2004, Kriesi 2005, Papadopoulos 1998), der aus unserer Sicht ein Überblickswerk über die «grossen Theorien» des Abstimmungsverhaltens und deren empirische Anwendung unabdingbar macht. Es darf jedoch festgehalten werden, dass in keinem anderen Land der Welt die Volksrechte so stark ausgebaut sind und so häufig genutzt werden wie in der Schweiz. Zwischen 1848 und 2013 fanden 571 eidgenössische Volksabstimmungen3 und damit mehr als die Hälfte aller nationalen Volksabstimmungen weltweit statt (Hug 2004, Kriesi 2005, Vatter 2007a). Somit bietet sich die Schweiz, die zu Recht als die «Avantgarde der direkten Demokratie» bezeichnet werden kann (IRI 2002), als Versuchslabor zur empirischen Erforschung nicht nur der Wirkungen direktdemokratischer Prozesse auf das politische System und seiner Akteure, sondern vor allem des Abstimmungsverhaltens geradezu an. Obwohl die hiesige Abstimmungsforschung gerade der US-amerikanischen empirischen Forschung, der wir im Theorieteil ebenfalls viel Raum geben, viel zu verdanken hat, bietet die Schweiz den idealen Anwendungskontext zur Darstellung der grossen Theorien und Sonderfragen der Abstimmungsforschung. Der folgende Überblick über die Entwicklung der Abstimmungsforschung in der Schweiz, der als Einstieg in das Handbuch dient, wird dies genauer veranschaulichen.
1.1Eine kurze Geschichte der Abstimmungsforschung in der Schweiz
Die Politikwissenschaft in der Schweiz kann – wie anderswo in Europa – als eine «verspätete Sozialwissenschaft» betrachtet werden, die als empirische Erforschung sozialer Phänomene – im Unterschied zur normativen Theoriebildung – zunächst nur in der «Diaspora» verwandter Disziplinen verfolgt und erst spät als eigenständige sozialwissenschaftliche Disziplin etabliert wurde. Wie auch die deutsche Politikwissenschaft war die schweizerische Politologie4 dabei stark in der US-amerikanischen political science verwurzelt, die sich – auch dank der in den 1930er- und 1940er-Jahren emigrierten deutschen Wissenschaftler – früher entwickelt hatte (Patzelt 1993: 260ff., Ruloff 2003: 22ff.).
Erst in den 1950er-Jahren bildete sich in der Schweiz das Bewusstsein heraus, «dass Politik weniger als bisher unter dem Gesichtspunkt ihrer institutionellen Aspekte betrachtet werden müsse, sondern mehr unter dem des politischen Verhaltens und Handelns» (Ruloff 2003: 24). Es erstaunt daher nicht, dass auch das Abstimmungsverhalten in der Schweiz mit wenigen Ausnahmen (Giovanoli 1932, Hümbelin 1953, Weber 1963) erst spät Gegenstand empirischer Forschung wurde. Noch zu Beginn der 1970er-Jahre konstatierte Neidhart, dass zwar in der Schweiz dank der «ungebrochenen Geschichte der schweizerischen Demokratie» eine Fülle von politischen Verhaltensdaten existiere, diese aber weitgehend unbearbeitet geblieben sei (Neidhart 1971: 61). Gilg und Gruner (1968: 10) hielten gleichzeitig fest, dass vorangehende Studien «den Volksentscheid aus den wissenschaftlichen Analysen geflissentlich ausklammern, obschon er der zentralste Teil des politischen Prozesses in der direkten Demokratie» sei. Ein Grund für dieses Defizit lag darin, dass es von politischer wie auch wissenschaftlicher Seite in der Schweiz gewisse Vorbehalte gegenüber dem Versuch gab, die Motive und Einstellungen der Stimmbürger bei einem Abstimmungsentscheid auszuloten. «Vox populi, vox dei» war die generelle Auslegung des Volksverdikts an der Urne, wonach im Anschluss an eine Abstimmung nicht herumgedeutelt werden sollte, ob das Volk richtig oder falsch entschieden habe (Gilg und Gruner 1968: 10, Linder 1996: 3).
Von Abstimmungsforschung als politikwissenschaftliche Disziplin lässt sich in der Schweiz daher erst ab den 1970er-Jahren sprechen, als sich zwei grobe Forschungsrichtungen herauskristallisierten (Epple-Gass 1989), die erst spät wieder synthetisiert werden sollten (Vatter 1994a). Das hauptsächliche Unterscheidungsmoment dieser beiden Richtungen liegt in den unterschiedlichen Analyseebenen, auf denen das Abstimmungsverhalten untersucht wird: Zum einen wird das Verhalten der Stimmbürger an der Urne auf Individualebene mithilfe von Umfragedaten analysiert, zum anderen ist es auf Aggregatdatenbasis Gegenstand «ökologischer»5 Untersuchungen.6
Während für Aggregatdatenanalysen in der Schweiz eine Fülle von Datenmaterial auf kantonaler und kommunaler Ebene existierte (Neidhart 1971)7, mussten die Daten für Untersuchungen auf der Individualebene erst noch erhoben werden. Dies stellte für die Schweizer Abstimmungsforschung jedoch nicht nur aus den oben genannten Gründen und dem allgemeinen Misstrauen der Demoskopie gegenüber ein Problem dar. Es wurde auch bezweifelt, dass Meinungsforschung in der kleinräumigen und sprachkulturell heterogenen Abstimmungsdemokratie Schweiz von Nutzen sei. «In direkten Demokratien mit einer Vielzahl von Abstimmungen zwischen zwei Wahlen kommt der öffentlichen Meinung eine andere Bedeutung zu: Sie interessiert nicht im Umfeld von Wahlen, sondern praktisch permanent. Die kontinuierlichen Entscheidungen sind dabei eine fortgesetzte Möglichkeit, sein eigenes Programm ‹abzustimmen›. Die Abstimmungsdemokratie der Schweiz wurde denn auch häufig als Grund dafür bezeichnet, weshalb es Umfragen hierzulande gar nicht brauche» (Longchamp 1998). Zudem waren die finanziellen Mittel für die Erhebung der Individualdaten durch persönliche Interviews nur relativ schwer zu beschaffen (vgl. Linder 2003).
Erste Erfahrungen mit der politischen Meinungsforschung wurden in der Schweiz in den frühen 1960er-Jahren gemacht (Seitz 1997: 339).8 Umfragen zu Nationalratswahlen fanden erstmals 1963 im Testkanton Aargau (Gruner 1963) und 1971 gesamtschweizerisch statt (Sidjanski 1972). 1977 gelang es schliesslich auf Initiative des Demoskopen Werner Ebersold und des Berner Historikers Erich Gruner, die Vox-Analysen eidgenössischer Abstimmungen zu lancieren.9 Die Vox-Nachbefragungen wurden zunächst als Kooperation zwischen der Schweizerischen Gesellschaft für praktische Sozialforschung10 und dem damaligen Forschungszentrum für Geschichte und Soziologie der schweizerischen Politik an der Universität Bern, ab 1985 dann in der Arbeitsgruppe Vox, der auch die politikwissenschaftlichen Institute der Universitäten Zürich und Genf angehören, durchgeführt. Sie eruierten die vox populi, die individuellen Einstellungen und Motive der Stimmbürger in Bezug auf ihren Stimmentscheid. Diese Vox-Umfragen wurden schon bald zu einer unverzichtbaren Informationsquelle für Öffentlichkeit, Medien, Politik und Politologie in der Schweiz (Linder 2003, Longchamp 2007).11 Damit stand der politikwissenschaftlichen Forschung neben den Aggregatdaten nun auch eine Fülle von Individualdaten für die Abstimmungsanalyse zur Verfügung.
An dieser Stelle wird ein historischer Überblick über die verschiedenen Stationen der Entwicklung der schweizerischen Abstimmungsforschung geliefert, ohne genauere Betrachtung der einzelnen Studien. Eine detaillierte Besprechung der Arbeiten findet sich im Kapitel zur empirischen Abstimmungsforschung in der Schweiz.
1.1.1Abstimmungsforschung auf der Aggregatdatenebene in der Schweiz
Epple-Gass (1989) unterscheidet drei jüngere «Schulen» der ökologischen Abstimmungsforschung in der Schweiz: die soziologische «Zürcher Schule», die historisch-politologische «Berner Schule» und die «politökonomische Schule». Als weitere «Schule» nennt er eine Reihe von älteren Studien, die – wie man bereits an den unterschiedlichen Publikationsdaten und -orten ablesen kann – jedoch nicht wirklich einer eigentlichen «Schule» zuzuordnen sind. Ihnen ist vor allem gemeinsam, dass sie sich vor den 1970er-Jahren mit Abstimmungsanalysen auseinandersetzten und ihnen daher weniger ausgereifte statistische Methoden zur Verfügung standen (Epple-Gass 1989: 38, siehe auch Seitz 1997: 308). Zu dieser «alten Schule» zählt Epple-Gass (1989) Autoren wie Batteli (1932), Giovanoli (1932), Hümbelin (1953) und Weber (1963). Laut Seitz (1997) seien auch die Arbeiten von Funk (1925) und Imboden (1963) zu nennen, jedoch handle es sich mit Ausnahme von Hümbelin (1953) nicht um tatsächliche ökologische Abstimmungsanalysen, sondern eher um juristisch und staatspolitisch orientierte Arbeiten mit normativem Unterton, die mehr von «Sorge um die staatsbürgerlichen Grundlagen des politischen Systems» als von wissenschaftlicher Neugier inspiriert gewesen seien. Deren Hauptinteresse galt der Abstimmungsträgheit als «Symptom mangelnder staatsbürgerlicher Anteilnahme» und weniger dem Stimmverhalten (Seitz 1997: 308). Besonders Hümbelin leistet mit seiner Dissertation Eidgenössische Volksabstimmungen im Lichte der Statistik von 1953 Pionierarbeit für die schweizerische Abstimmungsforschung, indem er die ihm neu zur Verfügung stehenden statistischen Methoden zur Bestätigung seiner Beobachtungen verwendet und Begrifflichkeiten klar definiert.
Methodologische Pionierarbeit für die schweizerische ökologische Abstimmungsforschung leistete laut Seitz (1997) auch die «soziologische Schule» um die Zürcher Soziologen Nef, Meier-Dallach, Rosenmund und Ritschard sowie den Lausanner Soziologen Joye.12 Kennzeichnend für diese Schule ist, dass sie zur Erklärung des Abstimmungsverhaltens implizit von einem sozialstrukturellen Modell ausgeht (vgl. Lazarsfeld et al. 1969). Wie Epple-Gass (1989) aufzeigt, lehnen sich die «Zürcher» jedoch auch stark an den strukturtheoretischen Ansatz des Soziologen Heintz (1982) an, den Nef (1980) und Meier-Dallach et al. (1982) in ihren Studien zum Abstimmungsverhalten praktisch anwenden. Gemeinsam ist der «soziologischen Schule», dass ihre Vertreter davon ausgehen, dass das Abstimmungsverhalten «als Ausdruck von räumlich bestimmbaren, kollektiven politischen Orientierungen» betrachtet werden kann (Seitz 1997: 311) und in seiner räumlichen Ausdifferenzierung «nicht amorph variiert, sondern dass in gewissem Ausmass segregierte Verhaltensdimensionen von überdauernder, nicht bloss situativ-partikulärer Bedeutung existieren» (Nef 1980: 155). Ziel der «soziologischen Schule» ist es, solche «Präferenz- oder Konfliktdimensionen», d.h. Dimensionen der politischen Auseinandersetzung, zu bestimmen und räumlich zu verorten.
Als eine der ersten Arbeiten dieser «Zürcher Schule» untersucht Nef (1980) in einer grundlegenden Analyse sämtlicher 137Volksabstimmungen zwischen 1950 und 1977 die Abstimmungsresultate auf Kantonsebene mit dem Ziel, die Effekte soziostruktureller und soziokultureller Teilung auf das Abstimmungsverhalten zu messen und elementare politische Orientierungsmuster zu eruieren. Er bedient sich dabei vor allem der Faktoranalyse zur Untersuchung des statistischen Zusammenhangs zwischen den kantonalen Abstimmungsergebnissen und der Regressionsanalyse zur Identifikation der «Determinationsmuster», bei denen die Präferenzdimensionen gewissen räumlichen Strukturelementen zugeordnet werden. Weitere Studien von Nef und Ritschard (1983), Meier-Dallach et al. (1982) und Joye (1987) beschäftigen sich ebenfalls mit den «sozioökonomischen Räumen» als Analyseeinheit und versuchen auf ähnliche Weise die durch die unterschiedlichen Raummerkmale stimulierten «Konflikt- oder Präferenzdimensionen» zu identifizieren. Sie unterscheiden sich von der Studie Nefs (1980) vor allem in Bezug auf das Aggregationsniveau und auf die Auswahl der Abstimmungen. Theoretische Annahmen und angewendete Methoden sind ähnlich (Epple-Gass 1989: 48).13 Genau an diese Aspekte richtet sich die Kritik, die besonders vonseiten der Berner «historisch-politologischen Schule» an den Zürcher Studien geübt wurde.
Wie die Zürcher Schule basiert auch die historisch-politologische Berner Schule auf dem sozialstrukturellen Ansatz. Die beiden Schulen teilen also gewisse Annahmen in Bezug auf die räumliche Ausdifferenzierung des Abstimmungsverhaltens und deren Determinanten14, und auch in ihrem konzeptionellen Vorgehen weisen die Studien Ähnlichkeiten auf (Seitz 1997: 327). Im Gegensatz zur Zürcher Schule hat die Berner Schule jedoch nur einen deskriptiven Anspruch, «ihre theoretischen Annahmen und analytischen Ziele sind bescheiden» (Epple-Gass 1989: 49). Zudem zeichnet sie sich durch eine gewisse Skepsis gegenüber der Zulässigkeit respektive den Ergebnissen der von den Zürchern verwendeten statistischen Methoden aus, was bei den Bernern in einer Art selbstauferlegter methodischer Zurückhaltung – besonders in Bezug auf die in den Zürcher Studien prominente Faktoranalyse15 – resultiert. Während sich die soziologische Schule also stark statistischer Methoden bedient, ist die Berner Schule klar historisch orientiert. Der von ihrer Seite an die Zürcher gerichtete Vorwurf der Ahistorizität überrascht daher nicht. Dieser bezieht sich vor allem auf die Ausklammerung der geschichtlichen Ebene hinsichtlich der politischen Auseinandersetzung, des Einflusses von Eliten und Medien, Parteien und anderen Organisationen sowie der mangelnden Berücksichtigung der Ähnlichkeit von Inhalt und Konfliktkonstellation bei der Abstimmungsgruppierung (Epple-Gass 1989: 48f.). Zwar verwenden auch die Berner statistische Methoden, diese werden jedoch auf ihre «historische Plausibilität» geprüft (Seitz 1997: 327).
Als Vertreter der historisch-politologischen Schule ist vor allem der Berner Historiker und Politikwissenschaftler Peter Gilg zu nennen, der als Erster der «jüngeren Schule» ökologische Abstimmungsanalysen durchführte. Gemeinsam mit Ernst Frischknecht veröffentlichte er 1976 die Studie «Regionales Verhalten in eidgenössischen Volksabstimmungen», in der auf Bezirksdatenbasis eine Typologisierung der Kleinregionen der Schweiz in Bezug auf ihr Abstimmungsverhalten vorgenommen wird.16 Dazu bilden auch Gilg und Frischknecht Gruppen von Abstimmungen, deren Ähnlichkeit sie untereinander jedoch mithilfe von Korrelationen eruieren und die sie anschliessend auf ihre inhaltliche Relevanz prüfen.17 Mithilfe einer Faktoranalyse, welche die Korrelationsanalyse weitgehend bestätigt, zeigen sie schliesslich, «wie sich die politische Landschaft der Schweiz in dreifacher Hinsicht in drei Grossräume gliedern lässt» (Gilg und Frischknecht 1976: 197). In der 1987 folgenden Arbeit «Stabilität und Wandel im Spiegel des regionalen Abstimmungsverhaltens» schliesst Gilg an den deskriptiven Anspruch seiner früheren Studie an, verzichtet in seinem Versuch einer Gliederung der schweizerischen politischen Landschaft diesmal jedoch gänzlich auf die Methode der Faktoranalyse. Er analysiert die Volksabstimmung von 1874 bis 1980, unterteilt in sechs Perioden, für die er unterschiedliche Präferenz- oder Konfliktdimensionen festhält.18 Aus diesen Konfliktdimensionen kristallisieren sich in der Analyse schliesslich temporär mehr oder minder konstante Pole19 heraus, die Gilg unterschiedlichen regionalen Charakteristika zuordnet.
Die Stärke der Berner Schule ist ihre kritische Distanz zu den verwendeten statistischen Methoden sowie zu ihren eigenen Annahmen: Durch den Verzicht auf Faktoranalysen und die Gruppierung von solchen Abstimmungen, die untereinander stark korrelieren, soll der Kritik begegnet werden, dass eine induktiv gewonnene Abstimmungsgruppe nicht unbedingt eine Präferenzdimension repräsentiert. Denn es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Abstimmungsvorlagen in der ganzen Schweiz einheitlich rezipiert werden (Epple-Gass 1989: 50, Seitz 1997: 331). Die Schwäche der Berner Schule ist wiederum ihre Theorieabstinenz und ihr bereits erwähnter deskriptiver Charakter. «Die Rückkoppelung des Abstimmungsverhaltens zu soziostrukturellen und -kulturellen Merkmalen der regionalen Untersuchungseinheiten bleibt oberflächlich und statistisch ungeprüft» (Epple-Gass 1989: 51). Eine schwache theoretische Abstützung kommt vor allem dort zum Vorschein, wo wegen mangelnder Erklärungskraft des Vorlageninhalts Faktoren wie Sprache und Urbanität eingeführt werden, deren Verhaltensrelevanz jedoch unerklärt bleibt, und die auf anderer Ebene anzusiedeln sind als inhaltsbezogene Faktoren.
Kritik an beiden Schulen und ihrem induktiven Vorgehen bei der Gewinnung der Abstimmungsgruppen übt Gruner (1987: 285f.): «Sie machen eine aus Abstimmungsverhalten hergeleitete Subkultur zu einem Substrat», das «dann wieder das Abstimmungsverhalten erklärt». Kritisch betrachtet werden kann auch die «Stabilitätsfixierung» beider Schulen, die sich ebenfalls – theoretisch – als Artefakt der Methode (hier der Korrelationsanalyse) ergibt, da zufällige mit erklärbaren Ähnlichkeiten verglichen werden (Epple-Gass 1989: 53).20
Dieser «Stabilitätsfalle» entgeht die politökonomische Schule, die Epple-Gass (1989) ebenfalls zur ökologischen Abstimmungsforschung zählt. Laut Epple-Gass ist der politökonomische Ansatz dynamisch, da er die wirtschaftliche Entwicklung in die Analyse miteinbezieht und sich für die Veränderung des Abstimmungsverhaltens interessiert. Die politökonomische Schule geht von der grundlegenden Annahme aus, dass individuelles Verhalten im wirtschaftlichen und politischen Bereich durch den gleichen Ansatz erklärt werden kann. Parteien, Politiker und Wähler verhalten sich wie rationale Akteure auf einem Markt, auf dem politische Macht in Form von Wählerstimmen gegen die Realisierung politischer Ziele getauscht wird. Die Rationalität der Marktteilnehmer bezieht sich dabei ausschliesslich auf die optimale Erreichung ihrer persönlichen ökonomischen und politischen Ziele (Downs 1957b). Auch in der schweizerischen direkten Demokratie kann der Bürger sein politisches «Geld» einsetzen, und zwar nicht nur im Rahmen von Wahlen, sondern mehrmals jährlich durch seinen Abstimmungsentscheid. Zur Reduktion der Informationskosten verwendet der nutzenmaximierende Stimmbürger dabei jedoch eine Abkürzung, d.h. leicht verfügbare Informationen über die Wirtschaftslage: «Voters tend to blame the government when economic conditions worsen, and to support the government when economic conditions improve. It is therefore hypothesized that the better the state of the economy, the smaller the share of voters rejecting a referendum» (Schneider et al. 1981: 235).
Vertreter dieser politökonomischen Schule in der Schweiz sind Friedrich Schneider und Werner Pommerehne, die in verschiedenen Studien (Pommerehne und Schneider 1985, Schneider 1985, Schneider et al. 1981) versuchen, politökonomische Hypothesen bezüglich des Zusammenhangs zwischen Abstimmungsverhalten und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Parolen von Interessengruppen bzw. der Kaufkraftinzidenz zu testen. In einer späteren Anwendung dieses Ansatzes überprüft Adrian Vatter in seiner Dissertation von 1994 anhand von 20 kantonalen Finanzvorlagen, inwiefern sich politische Akteure eigennützig verhalten und somit der ökonomischen Theorie entsprechend handeln. Er kommt zum Schluss, dass der Ansatz nur eingeschränkt unter bestimmten Bedingungen anwendbar ist (Vatter 1994a).
Neben diesen drei respektive vier von Epple-Gass benannten Haupt-Schulen der Abstimmungsforschung auf Aggregatebene in der Schweiz nennt Seitz eine weitere, jüngere Schule um den Lausanner Politikwissenschaftler Papadopoulos, die sich insbesondere mit der Rolle der Eliten beschäftigt (Seitz 1997: 309). Wie Linder (2003: 233) jedoch anfügt, «brach die kaum begonnene akademische Tradition» der Aggregatdatenanalyse in der Abstimmungsforschung an den Schweizer Universitäten trotz einiger Widerbelebungsversuche (Linder et al. 2000) und trotz ihrer praktischen Vorteile hinsichtlich der Datenverfügbarkeit jäh ab. Ein Grund dafür lag darin, dass das Bundesamt für Statistik die Finanzierung der Aggregatdatenstudien einstellte.
1.1.2Abstimmungsforschung auf der Individualdatenebene in der Schweiz
Seit 1977 führt die Vox-Arbeitsgemeinschaft regelmässig Abstimmungsanalysen zu den einzelnen eidgenössischen Vorlagen durch. Einen wichtigen Schritt für die schweizerische Abstimmungsforschung machten Gruner und Hertig 1983, als sie erstmals systematisch einen Datenpool der Vox auswerteten. Dieser enthielt die ersten 41Vorlagen, für die Individualdaten erhoben wurden, und damit über 7000 Fälle (Gruner und Hertig 1983, siehe auch Linder 2003: 231, Trechsel 2002: 559). Ihr Hauptinteresse gilt in dieser Studie der Frage, wie die Stimmbürger auf behörden- und medienseitige Informationsangebote, Parolen und Propaganda reagieren und wie hoch ihre politische Kompetenz ist. Die zentrale Hypothese von Gruner und Hertig ist, dass die Stimmbürgerschaft von der Komplexität der Sachentscheidungen im modernen Dienstleistungsstaat überfordert ist. Sie kommen zum Schluss, dass die «materielle Problemlösungskapazität» der Stimmberechtigten niedrig ist und sehen ihre Hypothese damit bestätigt. Zehn Jahre später veröffentlicht Kriesi (1993) von ihm und seinem Genfer Team durchgeführte Abstimmungsstudien, die auf einem Datensatz der Vox-Analysen von 1981 bis 1991 mit etwa 20000Fällen beruhen. Wie bereits die Studie von Gruner und Hertig beschäftigt sich der Sammelband mit Fragen zum Abstimmungsverhalten, zur politischen Kompetenz sowie zur Partizipation.
Nach diesen Pionierarbeiten machte die schweizerische Abstimmungsforschung auf Individualdatenebene grosse Fortschritte und seither wurden verschiedentliche Untersuchungen zu spezifischen Fragestellungen und auf Basis variierender theoretischer Ansätze vorgenommen. Details zu diesen Studien finden sich in den Kapiteln zur empirischen Abstimmungsforschung in der Schweiz. An dieser Stelle folgt ein Überblick über die direktdemokratischen Instrumente der Schweiz.
2Institutionen und Praxis der direkten Demokratie in der Schweiz
In modernen Demokratien gibt es prinzipiell zwei spezifische Formen der konventionellen Teilnahme des Bürgers am demokratischen Entscheidungsprozess: den Modus der Wahl und den Modus der Abstimmung. Abstimmungen unterscheiden sich von Wahlen dadurch, dass sie keinen Partizipationsmodus zur Übertragung von Entscheidungsvollmacht auf Repräsentativorgane, sondern einen Modus zur direkten Entscheidung der Stimmbürger über Sachfragen darstellen.21 Abstimmungen sind damit Teil dessen, was man als direktdemokratische Mitbestimmung bezeichnen kann, und schliessen per definitionem Verfahren der Direktwahl oder Abberufung von Amtsträgern aus.22 Der Begriff «direkte Demokratie» wird dabei häufig explizit oder implizit als Bezeichnung für einen eigenständigen, der repräsentativen Demokratie antithetisch gegenüberstehenden Demokratietypus verwendet (Schmidt 1995). Unter den Bedingungen der Moderne sind die heutigen Demokratien, die sich sowohl durch Flächenstaatlichkeit als auch durch arbeitsteilige, pluralistische Gesellschaften auszeichnen, jedoch ipso facto repräsentativ verfasst (Kelsen 1981, Schiller 2002).23 Direktdemokratische Instrumente haben in diesen repräsentativen Demokratien also «nur» einen Ergänzungsstatus (Schiller 2002: 36). Als Elemente der Herrschaftsfunktion, und nicht nur Instrumente der Partizipation, sind sie – je nach Ausgestaltung – als ergänzende Institutionen (z.B. als Legislativinstanz) im demokratischen politischen System zu verstehen und haben auf dieses einen mehr oder minder starken transformierenden Einfluss.24 In anderen Worten lassen sich direktdemokratische Instrumente auf unterschiedliche Weise im «Dreieck der Verfassungsorgane»–Legislative, Exekutive, Judikative – eines jeweiligen politischen Systems verorten und mit ihrem jeweiligen Ergänzungsstatus gewichten (Schiller 2002: 18). Sprechen wir von direkter Demokratie, so meinen wir hier die «Gesamtheit der Instrumente direktdemokratischer Entscheidfindung» (Jung 2001: 13), die sich in unterschiedlichen Systemen auf verschiedene Weisen manifestieren.
Wie Wahlen durch Wahlgesetze geordnet werden, so sind auch für direktdemokratische Instrumente Verfahrensregeln erforderlich, die diese Instrumente nicht nur zwischen unterschiedlichen politischen Systemen, sondern auch innerhalb des gleichen politischen Systems differenzieren.25 Diese Verfahrensregeln können dabei sehr unterschiedlich ausgestaltet sein und den Akteuren – seien dies Regierung, Opposition, Parteien oder sei dies die Gesamtheit der Stimmberechtigten – ein unterschiedliches Mass an Entscheidungsmacht zuschreiben. Im Folgenden sollen daher die wichtigsten Kriterien, nach denen sich direktdemokratische Instrumente unterscheiden lassen, dargestellt und darauf aufbauend eine weiterreichende Typologie direktdemokratischer Instrumente eingeführt werden.
2.1Typen direktdemokratischer Verfahren
Das gestiegene Interesse an direktdemokratischen Verfahren führte in den letzten Jahren zu dem Versuch, die verschiedenen Instrumente der direkten Demokratie zu kategorisieren und eine solche Abstimmungstypologie auch in übergeordnete Typologien demokratischer Systeme, wie z.B. Lijpharts (1999, 2012) Unterscheidung in Mehrheits- und Konsensusdemokratie, einzubetten.26 Dabei können, je nach Herangehensweise, verschiedene Kriterien zur Anwendung kommen. Als wegweisend gilt der Typologisierungsversuch von Smith (1976), der direktdemokratische Verfahren zum einen danach unterscheidet, welchen Grad an Kontrolle in Bezug sowohl auf die Auslösung als auch die genaue Fragestellung die Regierenden über das Verfahren haben, und zum anderen, ob diese hegemoniale oder antihegemoniale Konsequenzen für das Regime haben können.27 Ein weiterer Kategorisierungsversuch, der auch übergeordnete Typologien demokratischer Systeme berücksichtigt, stammt von Jung (2001: 90). Aufbauend auf den Arbeiten von Smith (1976), Moeckli (1991, 1994) und anderen (etwa Hamon 1995, Setälä 1999, Suksi 1993, Uleri 1996) schlägt Jung zusammenfassend vier hauptsächliche Kriterien zur Klassifikation vor:
1)die auslösende Instanz (Wer verfügt über die Kompetenz zur Auslösung einer Abstimmung?);
2)die Urheberschaft des Abstimmungsgegenstands (Wer ist der Urheber der zur Abstimmung stehenden Vorlage?);
3)den Charakter der Abstimmung (Hat die Abstimmung Zustimmungs- oder Entscheidungscharakter, d.h. findet sie vor oder erst nach einem Parlamentsentscheid statt?); sowie
4)die Regeln der Abstimmung (Nach welchen Regeln wird entschieden? Gilt das einfache Mehr oder existieren bestimmte Zustimmungs- und/oder Beteiligungsquoren?).
Für eine Typologisierung direktdemokratischer Instrumente, die hier vor allem dazu dienen soll, die in der Schweiz existierenden Volksrechte zu kategorisieren und gleichzeitig in die übergeordnete Lijphart'sche Demokratietypologie einzubetten und somit Vergleiche mit anderen Systemen zu erlauben, fokussieren wir auf die Kriterien 1, 2 und 4, da diese die Charakteristika der verschiedenen direktdemokratischen Instrumente hinsichtlich Form und Wirkung hinreichend beschreiben.28
In Bezug auf das erste Kriterium können eine Reihe von Merkmalsausprägungen festgehalten werden, die sich wiederum in unterschiedlicher Weise in die Demokratietypologie Lijpharts (1999, 2012) einbetten lassen. Als auslösende Instanz kommen beispielsweise die Regierung, eine Parlamentsmehrheit respektive -minderheit in einer oder beiden Kammern, das Staatsoberhaupt, eine bestimmte Anzahl von Regionalparlamenten oder -regierungen oder das Volk, sprich ein Teil der Stimmbürgerschaft, infrage. Setzt man diese verschiedenen Ausprägungen in einen Zusammenhang mit dem Grad des Konkordanz- respektive Mehrheitscharakters eines Systems, so lassen sich diese in zwei grobe Kategorien zusammenfassen: Auf der einen Seite liegt das Auslöserecht bei den «Regierenden», was tendenziell dem Mehrheitsprinzip entspricht, auf der anderen Seite liegt es beim «Volk»29, was eher dem Konkordanz- oder Machtteilungsprinzip entspricht. Wie Vatter (2014) sprechen wir in Anlehnung an Suksi (1993) und Hug (2004) von «kontrollierten» respektive «passiven» Referenden, wenn Regierung oder Parlamentsmehrheit als auslösende Instanz fungieren, und von «unkontrollierten» respektive «aktiven» Referenden, wenn eine Minderheit der Stimmbürgerschaft bzw. eine parlamentarische Minderheit ein Referendum auslösen kann.30 Plebiszite31, die in der Regel durch die Regierung ausgelöste Ad-hoc-Referenden sind, für die keine Verfassungs- oder andere gesetzliche Provisionen bestehen, und normierte, durch die Regierungsmehrheit ausgelöste fakultative Referenden sind den passiven, kontrollierten Referenden zuzuordnen. Volksinitiativen und fakultative Referenden, die vonseiten des Volkes respektive einer Minderheit lanciert werden können, stellen hingegen Formen aktiver, unkontrollierter Referenden dar.32
Auch die Verfassung respektive andere Gesetzgebung kann als auslösende Instanz fungieren, wenn eine Abstimmung (verfassungs-)rechtlich vorgeschrieben und die Auslösung somit automatisch erfolgt. Laut Vatter (2014) nehmen solche obligatorisch genannten Referenden eine mittlere Stellung zwischen kontrollierten und unkontrollierten Referenden ein, da einerseits die Regierung hier das Agenda-Setting (siehe unten) übernimmt, sie andererseits aber keine Kontrolle über die Durchführung der Abstimmung hat, da diese automatisch stattfindet. Laut Setälä (2006: 711) zeichnen sich obligatorische Referenden somit durch mittlere Regierungskontrolle aus.33
Analog zu dieser dichotomen Kategorisierung lassen sich auch die Ausprägungen des zweiten Kriteriums, der Urheberschaft des Abstimmungsgegenstands, in zwei Kategorien zusammenfassen: Entweder stammt die Vorlage vom Volk oder von den Regierenden. Dies ist ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium. Es unterscheidet danach, ob das Volk lediglich sein Veto gegen parlamentarisch verabschiedete Gesetze einlegen kann oder ob es selbst aktiv die Agenda mitzubestimmen und gesetzesinitiativ tätig zu werden vermag. Letzteres stellt dabei das stärker machtteilungsorientierte Instrument dar, da hier das Volk auch gegen den Willen der Regierungsseite Themen auf die politische Agenda setzen und Entscheidungen erzwingen kann. Eine Gesetzes- oder Verfassungsinitiative, bei der eine Minderheit die Agenda bestimmt, erlaubt der Regierung also weniger Kontrolle als ein fakultatives Referendum oder Plebiszit, bei denen die Mehrheit die alleinige Agenda-Setting-Macht innehat.
Zentral ist neben dem ersten und zweiten auch das vierte genannte Kriterium34, dessen Merkmalsausprägungen sich danach differenzieren lassen, ob Entscheidungen mit einfacher Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen getroffen werden können, oder aber ob bestimmte Quoren gelten. Letztere lassen sich wiederum in Zustimmungs- und Beteiligungsquoren unterteilen. Mit Beteiligungsquoren soll eine gewisse Repräsentativität und Legitimität des Entscheids gewährleistet werden, indem für die Gültigkeit einer Abstimmung vorausgesetzt wird, dass sich ein bestimmter Prozentsatz der Wahlberechtigten beteiligt. Bei Zustimmungsquoren geht es hingegen um die «Maximierung der Zustimmung». Als Beispiele sind eine Zweidrittelmehrheit oder eine Mehrheit der Abstimmenden in einer Mehrheit der Gliedkörperschaften (Schweiz: Kantone) zu nennen, derer es bedarf, damit eine Vorlage als angenommen gilt. Auch hiermit sollen Legitimität und Repräsentativität erhöht werden. Somit lässt sich auch das vierte Kriterium dichotom in Abstimmungen mit einfachem Mehr versus Abstimmungen, bei denen ein (Zustimmungs- oder Beteiligungs-)Quorum gilt, unterscheiden, wobei das einfache Mehr eher dem Mehrheits- und das qualifizierte Mehr eher dem Konsensusprinzip entspricht (Vatter 2000, 2009).
Zusammenfassend können Volksabstimmungen also danach differenziert werden, wer die auslösende Instanz, wer der Urheber der Vorlage und ob ein einfaches oder qualifiziertes Mehr erforderlich ist. In Anlehnung an Jung (2001) und Vatter (2000, 2009, 2014) lassen sich die direktdemokratischen Verfahren wie folgt (Abbildung 2.1) einordnen:
Wie Vatter (2000, 2009, 2014) darlegt, können die verschiedenen Typen direktdemokratischer Instrumente im Lijphart'schen Demokratieraum zwischen Mehrheits- und Konsensusdemokratie verortet werden (Abbildung 2.2). Während also Plebiszite klar auf der Seite der Mehrheitsdemokratie stehen, befinden sich obligatorische Referenden, die per Verfassung, Gesetz oder anderen rechtlichen Normen dem Volk zwingend vorgelegt werden müssen, zwischen den beiden Lijphart'schen Demokratiespielarten, da die Regierungsseite zwar einerseits die Agenda bestimmt, andererseits aber keinen Spielraum in Bezug auf die Auslösung des Referendums hat. Aktive fakultative Referenden, die durch das Volk oder beispielsweise eine Parlamentsminderheit ausgelöst werden, sich aber auf eine bereits verabschiedete Regierungsvorlage (sprich ein Gesetz o.Ä.) beziehen und somit dem Volk nur ein Vetorecht einräumen, entsprechen eher dem Prinzip der Machtteilung. Noch stärker ist dies der Fall bei Volksinitiativen, bei denen das Volk (oder eine Parlamentsminderheit) nicht nur Auslöser der Abstimmung ist, sondern auch den Inhalt der Vorlage bestimmt und somit gesetzesinitiativ tätig wird.
Wie Vatter (2000), der sich hier auf das vierte Kriterium von Jung stützt, aufzeigt, ist es jedoch nicht nur nötig, den Machtteilungs-Charakter eines direktdemokratischen Instrumentes in Bezug auf dessen Auslösung zu betrachten, sondern auch jenen in der Entscheidungsphase. Jung (1996) und Vatter (2000, 2009) heben deshalb die substanziellen Unterschiede zwischen Abstimmungen mit einfachen und qualifizierten Mehrheiten hervor. Dabei verstärken Quoren dank dem aus ihnen resultierenden Minderheitenschutz den Konsensuscharakter eines direktdemokratischen Instruments (Vatter 2009).
Mithilfe der von Jung verwendeten Kriterien und der von Vatter vorgenommenen Einbettung in die Lijphart'sche Demokratietypologie lassen sich somit die direktdemokratischen Instrumente typologisieren und auf der Skala der Mehrheits-Konsensusdemokratie verorten. Dies soll im nächsten Abschnitt mit den direktdemokratischen Instrumenten der Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene konkretisiert werden.
2.2Institutionen und Praxis der direkten Demokratie auf der Bundesebene
Wie im letzten Abschnitt ausgeführt, kann die direkte Demokratie unter den Bedingungen der Moderne «nur» einen ergänzenden Status im politischen System eines Staates haben und stellt deshalb keinen der repräsentativen Demokratie diametral gegenüberstehenden Demokratietypus dar. Dies ist auch in der Schweiz der Fall, wo direktdemokratische Instrumente in ein System eingebaut wurden, das ursprünglich – mit Ausnahme des obligatorischen Verfassungsreferendums und der Volksinitiative auf Totalrevision der Verfassung – rein repräsentativ verfasst war (Vatter 2014). Entsprechend verwendet Linder (1999, 2012) den Begriff «halbdirekte Demokratie», wenn er von der Gesamtheit des Schweizer Entscheidungssystems spricht, in dem Regierung, Parlament und Volk zusammenwirken. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die Formen der Direktdemokratie kennen, gibt es in der Schweiz das halbdirektdemokratische System jedoch nicht nur auf Ebene der Teilstaaten (Kantone), sondern auch auf nationaler Ebene. Im Folgenden sollen nun zunächst die direktdemokratischen Instrumente oder «Volksrechte» auf Schweizer Bundesebene vorgestellt werden und es wird der Versuch unternommen, diese in die oben eingeführte Typologie der direkten Demokratie einzubetten. Tabelle 2.1 zeigt eine Übersicht der direktdemokratischen Instrumente auf Bundesebene. An ihr lässt sich zudem die graduelle Einführung der direkten Demokratie in der Schweiz nachverfolgen (vgl. Kasten 2.1).35
Kasten 2.1: Entwicklung der direkten Demokratie in der Schweiz
Exkurs: zur Entwicklung der direkten Demokratie in der Schweiz
«Sowohl Landsgemeinden als auch Rousseau» ist laut der neueren verfassungsgeschichtlichen Forschung die Antwort, die auf die Frage nach den Wurzeln der direkten Demokratie in der Schweiz gegeben werden kann (Tschentscher 2010). Denn einerseits lässt sich argumentieren, dass es in der Schweiz eine Art mentale Kontinuität der versammlungsdemokratischen Kultur in den Landsgemeindekantonen (wie wohl auch der Genossenschaften) seit dem Spätmittelalter gibt, andererseits die Entwicklung in den Schweizer Kantonen unter dem verfassungsrechtlichen Einfluss der Französischen Revolution – und damit Rousseaus – stand (Tschentscher 2010, siehe besonders auch Kölz 1992, 1998), die der Entwicklung der direkten Demokratie auf Bundesebene vorausging (Linder 2005).
Zu Beginn des 19.Jahrhunderts konnte in der Schweiz – mit Ausnahme der acht Landsgemeindekantone und zwei föderativer Republiken – von direktdemokratischer Mitbestimmung keine Rede sein. Die vorherrschende Staatsform entsprach eher einer durch Zensus und anderen Vorrechten aristokratisch gefärbten Repräsentativverfassung. Erst mit dem Aufkommen der liberalen Regenerationsbewegung der 1830er-Jahre wurden – unter starkem Druck der mobilisierten bäuerlichen Bevölkerung sowie von Radikalen und Demokraten – in beinahe allen neuen Kantonsverfassungen das obligatorische Verfassungsreferendum und in immerhin sechs Kantonen die Volksinitiative auf Verfassungsänderung eingeführt. Die Wirksamkeit dieser Instrumente wurde jedoch stark zugunsten des repräsentativen Prinzips eingeschränkt, und ihre Einführung bedeutete somit noch nicht eine prinzipielle Veränderung des Staatsaufbaus in den Kantonen. In einer zweiten Phase übernahmen Mitte des 19.Jahrhunderts erstmalig einige Kantone das fakultative oder obligatorische Gesetzesreferendum, allerdings dominierte in den 1840er- und 1850er-Jahren nach wie vor das durch die mehrheitlich herrschenden Liberalen bevorzugte Repräsentativsystem. Erst mit der Durchsetzung der Forderungen der von Radikalen, Demokraten und Sozialisten getragenen demokratischen Bewegung in den 1860er-Jahren und der Einführung insbesondere des obligatorischen Gesetzesreferendums auch in Nicht-Landsgemeindekantonen wurde das bisher geltende Repräsentativitätssystem nicht nur tendenziell, sondern prinzipiell durchbrochen, was die Staatsform der Kantone in nachhaltiger Weise veränderte. Dieser Demokratisierungsprozess hatte seine ideellen Wurzeln dabei weniger in den konservativen Landsgemeindekantonen, sondern vielmehr in den Schriften der Französischen Revolution. Allerdings waren es die Deutschschweizer Kantone, welche die Volksrechte nicht nur zu einem frühen Zeitpunkt einführten, sondern auch weniger restriktiv gestalteten als die französisch- und italienischsprachigen Kantone (Vatter 2007a, 2014).
Auf Bundesebene bildeten sich die heutigen Formen des Referendums und der Volksinitiative erst gegen Ende des 19.Jahrhunderts heraus. Die Verfassung von 1848 enthielt nur Provisionen für das obligatorische Verfassungsreferendum sowie die Volksinitiative auf Totalrevision der Verfassung. Erst die Einführung des fakultativen Gesetzesreferendums 1874 und der Volksinitiative auf Teilrevision der Verfassung 1891 veränderten den noch stark repräsentativ geprägten Charakter des politischen Systems hin zur halbdirekten Demokratie, wie sie die Schweiz heute kennt. Weitere Modifikationen im 20.Jahrhundert sind die Einführung (1921) und Erweiterung (1977, 2003) des Staatsvertragsreferendums, das dem Volk Mitspracherecht in aussenpolitischen Entscheidungen einräumt, sowie das fakultative und obligatorische resolutive Referendum, das 1949 eingeführt wurde, um Dringlichkeitsrecht dem Referendum zu unterstellen. Nach Einführung des Frauenstimmrechts im Jahre 1971 wurde 1977 die Zahl der erforderlichen Unterschriften für das fakultative Referendum von 30000 auf 50000 und jene für die Volksinitiative von 50000 auf 100000 erhöht.
Für eine detailliertere Darstellung der Geschichte der direkten Demokratie in der Schweiz siehe Kölz (1992, 1996), Auer (1998, 1996), Adler (2006), Linder (2005, 2012), Vatter (2007a, 2014) sowie Tschentscher (2010).
2.2.1Das obligatorische Referendum
Das einzige direktdemokratische Instrument, das neben der Initiative auf Totalrevision der Verfassung (siehe unten) bereits in der ersten Verfassung des modernen Schweizer Bundesstaates von 1848 enthalten war, ist das obligatorische Verfassungsreferendum. Es wurde 1921 bzw. 1977 durch das obligatorische Staatsvertragsreferendum und 1949 durch das resolutive Referendum erweitert. Nach Art.140Abs.1 (Obligatorisches Referendum) der Bundesverfassung von 1999 (BV) werden Volk und Ständen
•jegliche Änderungen der Bundesverfassung,
•der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften sowie
•dringlich erklärte Bundesgesetze, die keine Verfassungsgrundlage haben und deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt,
zwingend vorgelegt. Die dringlichen Bundesgesetze ohne Verfassungsgrundlage müssen dem Volk innerhalb eines Jahres nach Annahme durch die Bundesversammlung zur Abstimmung unterbreitet werden (siehe unten).
Da die Kompetenzvermutung in der Schweiz ohne anderweitige Kompetenzvergabe durch die Verfassung aufseiten der Kantone liegt und nach Art.3 BV jegliche neue Kompetenz dem Bund nur durch Verfassungsänderung erteilt werden kann, kam dem obligatorischen Referendum mit dem Ausbau der Bundesaufgaben seit den 1960er-Jahren eine grössere Bedeutung zu und es wurde häufiger genutzt. Dies lässt sich auch an der Tabelle 2.2 ablesen, die einen Überblick über die Nutzung der Volksrechte in der Schweiz von 1840 bis 2013 bietet. Der grösste Teil der obligatorischen Referenden betrifft daher die Erweiterung oder Veränderung von Bundeskompetenzen (Linder 2005), während das Staatsvertragsreferendum seltener, aber im Rahmen von wichtigen Abstimmungen wie z.B. über den Beitritt zur UNO (1986, gescheitert) oder zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR (1992, gescheitert) genutzt wurde.
Die Übersicht über die Nutzungshäufigkeit der direktdemokratischen Instrumente auf Bundesebene und deren Ergebnisse macht deutlich, dass die Volksrechte unterschiedliche Annahmeraten haben. So wurden von den 215 obligatorischen Referenden, die in der Schweiz seit der Gründung des modernen Bundesstaates 1848 stattgefunden haben, 160 von Volk und Ständen angenommen und 55 verworfen. Dies bedeutet, dass in etwa 75Prozent der Fälle das Volk der Vorlage des Parlaments zustimmte und es in einem Viertel der Fälle sein Veto einlegte (siehe Abbildung 2.3).
Ein Grund für die relativ hohe Hürde für die Annahme eines obligatorischen Referendums ist das Doppelmehr-Erfordernis: Es bedarf der Zustimmung sowohl einer einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der gesamtschweizerischen Stimmbevölkerung als auch einer Mehrheit der Stände, d.h. einfacher Mehrheiten der abgegebenen gültigen Stimmen in den einzelnen Kantonen. Das Ergebnis der Volksabstimmung im Kanton gilt dabei als dessen Standesstimme (Vatter 2014). Wie Linder (1998) ausführt, handelt es sich beim Ständemehr um eine Verknüpfung des demokratischen Prinzips «eine Person eine Stimme» mit dem föderalistischen Prinzip «jedem Kanton die gleiche Stimme», welche in der Verbindung von Demokratie und Föderalismus der Schweiz im Verfassungsgebungsprozess von 1848 den Kompromiss zwischen dem «Status quo einer unzufriedenstellenden Konföderation und einem unwillkommenen Zentralstaat» (Linder 1998: 44, Übersetzung durch die Verfasser) ebnete. Zwar bedeutet dies de facto, dass beispielsweise die Stimme eines Wählers im Kanton Appenzell Innerrhoden etwa 40-mal mehr Gewicht hat als jene eines Wählers im Kanton Zürich (Vatter 2014), die Interessen kleinerer Kantone durch diese «föderalistische Beteiligung» (Linder 1998: 93) der Gliedstaaten an der direktdemokratischen Entscheidfindung jedoch gewahrt sind und der Minderheitenschutz in diesem Sinne gewährleistet ist. Kehrseite dieser Medaille ist, dass eine Minderheit in den kleineren Kantonen dadurch effektiv eine beträchtliche Vetomacht besitzt (Vatter 2014).
Für das Ständemehr haben 20 der 26Kantone eine volle und sechs Kantone (Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden) je eine halbe Standesstimme. Bei 11,5 zu 11,5Stimmen gilt die Vorlage als abgelehnt. Bisher scheiterten acht vom Volk angenommene obligatorische Referenden sowie eine Volksinitiative am Ständemehr und eines der von den Ständen angenommenen obligatorischen Referenden sowie zwei Volksinitiativen am Volksmehr. In der Regel stimmen also Volks- und Ständemehr überein, die Kollisionsgefahr hat aber aufgrund der demografischen Entwicklung im Lauf der Zeit zugenommen.
Kasten 2.2: Kollision zwischen Stände- und Volksmehr bei Abstimmung über Verfassungsänderungen
Am Ständemehr gescheiterte Verfassungsvorlagen
1866: Obl. Referendum zu Mass und Gewicht: Volk 50,4% Ja, Stände 9,5:12,5
1955: Initiative «Mieter- und Konsumentenschutz»: Volk 50,2% Ja, Stände 7:15
1970: Obl. Referendum zur Finanzordnung: Volk 55,4% Ja, Stände 9:13
1973: Obl. Referendum zum Bildungswesen: Volk 52,8% Ja, Stände 10,5:11,5
1975: Obl. Referendum zum Konjunkturartikel: Volk 52,8% Ja, Stände 11:11
1983: Obl. Referendum zum Energieartikel: Volk 50,9% Ja, Stände 11:12
1994: Obl. Referendum zum Kulturartikel: Volk 51,0% Ja, Stände 11:12
1994: Obl. Referendum erleichterte Einbürgerung: Volk 52,8% Ja, Stände 10:13
2013: Obl. Referendum zum Familienartikel: Volk 54,3% Ja, Stände 10:13
Am Volksmehr gescheiterte Verfassungsvorlagen
1910: Initiative «Proporzwahl des Nationalrats»: Volk 47,5% Ja, Stände 12:10
1957: Obl. Referendum zum Zivilschutzartikel: Volk 48,1% Ja, Stände 14:8
Quelle: Schweizerische Bundeskanzlei (www.admin.ch).
Es besteht beim obligatorischen Referendum demnach kein Beteiligungs-, aber ein Zustimmungsquorum. Dass dennoch drei Viertel der obligatorischen Referenden diese Hürde passieren, hat mit dem vergleichsweise geringen Konfliktgrad der Vorlage im Parlament und innerhalb der Bevölkerung zu tun.
Mit dem Verfassungsreferendum hat die Schweiz somit ein direktdemokratisches Instrument, das in der gezeigten Typologie als qualifiziertes obligatorisches Referendum einzustufen ist und das im Rahmen des Lijphartschen Demokratieverständnisses zwischen Mehrheits- und Konkordanzcharakter eingeordnet werden kann.
Tabelle 2.3 zeigt eine Auswahl obligatorischer Referenden, über die während der letzten zwei Dekaden abgestimmt wurde. Sie bietet damit einen Überblick über die Themenspannbreite und die Höhe der Stimmbeteiligung sowie die Ja-Stimmen bei Volk und Ständen. Es fällt auf, dass die Stimmbeteiligung je nach Vorlage stark schwankt: Beteiligten sich am EWR-Entscheid 1992 mehr als drei Viertel aller Stimmberechtigten, belief sich die Partizipation bei der Abstimmung über den Bildungsartikel 2006 nur auf etwas mehr als ein Viertel der Stimmbevölkerung. Dies weist bereits darauf hin, dass die Themen der Vorlagen nicht gleich prädisponiert sind bzw. die Stimmbevölkerung nicht gleich interessieren und dass es nicht unbedingt die obligatorischen Referenden auf der Normstufe der Verfassung sind, bei denen die konfliktträchtigsten Themen zur Abstimmung gelangen und die dementsprechend Kampagnenwirkung entfalten. Dies ist stärker beim fakultativen Referendum der Fall, das – auch aus diesem Grund – eine generell niedrigere Annahmerate hat als das obligatorische Referendum.
Betrachtet man die Themen der eidgenössischen Volksabstimmungen auf der Bundesebene über alle direktdemokratischen Instrumente hinweg, so wurde – vor allem in den letzten 20Jahren – am häufigsten über Vorlagen zur Sozialpolitik entschieden. Auch Abstimmungen über Infrastruktur und Lebensraum sowie zur Staatsordnung fanden häufig statt (Vatter 2014). Die Abstimmungsgegenstände reflektieren dabei generell die (wahrgenommenen) politischen Brennpunkte, wobei anzumerken ist, dass auch im gleichen Politikbereich nicht immer dieselben politischen Strömungen vom Gebrauch direktdemokratischer Instrumente profitieren. Im Bereich der Sozialpolitik beispielsweise konnte die rechtskonservative Opposition in den 1970er- und 1980er-Jahren mit dem Referendum erfolgreich den Ausbau des Sozial- und Leistungsstaates bremsen, dies vor allem aufgrund des Vorteils, den der Status quo in Abstimmungen besitzt. Andererseits erlaubt das Referendum auch linken Strömungen, den im Zuge von Liberalisierungsbestrebungen unternommenen Versuch des Abbaus sozialstaatlicher Leistungen zu unterminieren, auch dies dank dem Status-quo-Bias in der Stimmbevölkerung (Linder 2012, und siehe unten). Dies betrifft jedoch vor allem das fakultative Gesetzesreferendum, das im Folgenden vorgestellt wird.
2.2.2Das fakultative Referendum
Das fakultative (Gesetzes-)Referendum wurde auf Bundesebene durch die Totalrevision der Verfassung 1874 eingeführt und 1921 respektive 1977 durch das fakultative Staatsvertragsreferendum sowie 1949 durch das fakultative resolutive Referendum ergänzt. Laut Art.141 der BV von 1999 werden dem Volk
•Bundesgesetze,
•dringlich erklärte Bundesgesetze, deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt,
•Bundesbeschlüsse, bei denen Verfassung oder Gesetz ein fakultatives Referendum vorsehen, sowie
•völkerrechtliche Verträge, die unbefristet und unkündbar sind, die den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen oder die wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordern,
vorgelegt, sofern dies 50000Stimmberechtigte oder acht der 26Kantone innerhalb von 100Tagen ab der amtlichen Veröffentlichung des Erlasses verlangen. Im Gegensatz zum obligatorischen Referendum, das Recht auf Normstufe der Verfassung betrifft, ist für die Annahme des fakultativen Referendums nur das einfache Volksmehr, d.h. die einfache Mehrheit der gesamtschweizerisch abgegebenen Stimmen, und nicht die Mehrheit von Volk und Ständen, nötig. Von den 169 fakultativen Referenden, die bis 2011 auf Bundesebene stattgefunden haben, gingen 96 zugunsten der Behördenvorlage aus, was eine Annahme der Vorlage des Parlaments durch das Volk bedeutet. Bei 76Vorlagen bzw. etwa 44Prozent der fakultativen Referenden entschied das Volk anders als das Parlament und nutzte das Referendum erfolgreich als Veto.
Wie aus Tabelle 2.5 ersichtlich, muss die mit etwa 44Prozent relativ grosse Vetomacht des fakultativen Referendums jedoch etwas relativiert werden, da im Zeitraum von 1874 bis 2011 nur bei 193 von den mehr als 2500 referendumspflichtigen Vorlagen das Referendum eingereicht wurde. Von diesen 193 eingereichten Referenden kamen 169 zustande, d.h. es wurden die erforderlichen Fristen eingehalten und die nötige Anzahl gültiger Unterschriften eingereicht. Mit anderen Worten, es wurden nur etwa 7Prozent der vom Parlament verabschiedeten Gesetze, Beschlüsse und Verträge dem Referendum ausgesetzt und – bei einer Erfolgsrate von 44Prozent – nur etwa 3Prozent durch ein Referendum zu Fall gebracht.
Diese Zahlen weisen bereits darauf hin, dass eine Art Referendumsvermeidungsstrategie des Parlaments besteht, d.h., dass die Parteien im National- und Ständerat sowie Verwaltung und Interessengruppen bemüht sind, bei der Ausarbeitung der Vorlagen bereits in der vorparlamentarischen Phase einen konsensfähigen Kompromiss zu finden, um das Referendum möglichst zu umgehen (Neidhart 1970). Sieht eine Gruppe ihre Partikularinteressen durch eine Vorlage gefährdet und erkennt sie die Möglichkeit, dass der ausgehandelte Kompromiss durch eine Volksabstimmung angreifbar ist, ergreift sie das Referendum. Findet dann eine Abstimmung statt, ist die Behördenseite nur in etwas mehr als der Hälfte aller Fälle erfolgreich, d.h., sie hat ein Interesse daran, ein Referendum möglichst im Vorhinein zu verhindern.
Ein Sonderfall ist das resolutive Referendum. Die Bundesverfassung von 1874 sah in Art.89Ausnahmen von der Referendumspflicht vor, wenn in Krisen- oder Kriegszeiten ein Gesetz keinen Aufschub duldete. Dieses Dringlichkeitsrecht wurde in der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre sehr häufig genutzt, sodass 1930 und auch 1949 eine zeitliche Beschränkung sowie die Möglichkeit bzw. Notwendigkeit eines fakultativen respektive obligatorischen resolutiven Referendums eingeführt wurde (Art.165 BV).
Generell gilt, dass jeder dringliche Bundesbeschluss befristet ist. Übersteigt die Gültigkeit die Dauer eines Jahres, so muss der Beschluss aufgehoben werden, wenn erfolgreich das fakultative Referendum ergriffen wird. Betrifft der Beschluss das Verfassungsrecht, so ist dieser nach einem Jahr automatisch dem obligatorischen Referendum unterstellt.
Ein weiterer Sonderfall des fakultativen Referendums ist das sogenannte Kantonsreferendum, das laut Art.141 BV von acht der 26Kantone ergriffen werden kann, wobei die jeweilige Kantonsverfassung regelt, welches Organ das Referendum im Namen des Kantons auslösen kann. In den meisten Kantonen ist dies das Kantonsparlament. Lange war die Verfassungsprovision für das Kantonsreferendum ein toter Buchstabe (Vatter 2014). Sie wurde 2003 das erste Mal von elf Kantonen gegen das sogenannte Steuerpaket36 ergriffen, eine vom Parlament verabschiedete Gesetzesvorlage, die eine Neuordnung der Familienbesteuerung sowie Änderungen in der Wohneigentumsbesteuerung beinhaltete. Denn die Kantone sahen durch die Vorlage ihre (fiskalen) Interessen bedroht. In der auf das Kantonsreferendum folgenden Volksabstimmung vom 16.Mai 2004 wurde die Vorlage vom Volk mit 65,9Prozent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt. Die Volksabstimmung hätte jedoch auch ohne das Kantonsreferendum stattgefunden, da zeitgleich 50000Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht wurden.
Kasten 2.3: Wie ergreift man das fakultative Referendum?
Wer kann das fakultative Referendum ergreifen?
Das fakultative Referendum kann von jeder in der Schweiz stimmberechtigten Person ergriffen werden, auch wenn sie ihren Wohnsitz im Ausland hat.
Wie ergreift man das fakultative Referendum?
1.Generell wird ein Referendumskomitee gegründet. Die Gründung kann der Bundeskanzlei mitgeteilt und ihr eine Kontaktperson genannt werden. Nicht mitgeteilt werden muss die Anzahl Komiteemitglieder, deren Identität oder die beteiligten Organisationen. Gegen das gleiche Gesetz oder den gleichen Parlamentsbeschluss können mehrere Referendumskomitees gegründet werden.
2.Bevor das bestrittene Gesetz oder der bestrittene Beschluss im Bundesblatt (BBl), der amtlichen chronologischen Sammlung der Erlasse und amtlichen Dokumente der Bundesverwaltung, veröffentlicht wird, bereitet das Komitee die Unterschriftenbögen vor. Die Bundeskanzlei stellt dem Referendumskomitee auf Anfrage Muster für diese Unterschriftenbögen zur Verfügung. Diese Bögen müssen zwingend bestimmte Angaben umfassen, insbesondere den genauen Titel des bestrittenen Gesetzes oder Beschlusses und das Datum der Verabschiedung in der Bundesversammlung. Wenn das Referendumskomitee es will, kann es den Unterschriftenbogen bei der Bundeskanzlei überprüfen lassen.
3.Von jenem Moment an, in dem das bestrittene Gesetz oder der bestrittene Beschluss im Bundesblatt erscheint, hat das Komitee 100Tage Zeit, um die nötigen 50000Unterschriften zu sammeln, sie von den Gemeinden bestätigen zu lassen und sie bei der Bundeskanzlei einzureichen. Da in der Regel nicht alle Unterschriften gültig sind, empfiehlt es sich, über 50000Unterschriften zu sammeln. Zu beachten ist auch, dass die Gemeinden für die Prüfung der Unterschriften eine gewisse Zeit benötigen. Die Unterschriften müssen deshalb rechtzeitig bei den Gemeinden eingereicht werden, denn die Frist von 100Tagen ist unumstösslich.
4.Eine Volksabstimmung wird organisiert, wenn die Bundeskanzlei mindestens 50000Unterschriften für gültig erklärt.
Quelle: www.ch.ch
Wie oben beschrieben, kann das fakultative Referendum gegen alle Parlamentsentscheidungen zu Bundesgesetzen und einen erheblichen Teil der Bundesbeschlüsse ergriffen werden und betrifft dementsprechend Vorlagen aus den unterschiedlichsten Politikfeldern. Tabelle 2.6 gibt einen beispielhaften Überblick über verschiedene Themen, über die in den letzten zwei Dekaden abgestimmt wurde.
Auch die Beteiligung an fakultativen Referenden unterliegt Schwankungen und hängt von der Prädisponiertheit und dem Interesse der Stimmbürgerschaft an den jeweiligen Themen ab. So zeichnen sich Abstimmungen über europapolitische Fragen (z.B. die bilateralen Verträge mit der EU), die gewissermassen Arena für die Austragung von Konflikten neuer politischer Spaltungslinien in der Schweiz sind, durch eine relativ hohe Stimmbeteiligung aus. Bei weniger konfliktgeladenen Vorlagen fällt die Stimmbeteiligung tiefer aus. Generell setzt jedoch das Ergreifen des fakultativen Referendums zumindest eine gewisse Konflikthaftigkeit der entsprechenden Vorlage voraus, da ansonsten das Referendum nicht ergriffen worden wäre.
Beim fakultativen Referendum, wie auch bei allen anderen direktdemokratischen Instrumenten auf Bundesebene, gibt es kein Mindest-Beteiligungsquorum. Mit anderen Worten: Ist ein Referendum (oder eine Volksinitiative) einmal zustande gekommen, spielt es keine Rolle, wie viele Stimmberechtigte sich an der Abstimmung beteiligen. Die Mehrheit der Teilnehmenden an einer Abstimmung entscheidet über das Ja oder Nein, auch wenn beispielsweise nur ein Viertel der Stimmbevölkerung an die Urne gegangen ist.
Die Schweiz verfügt damit über ein direktdemokratisches Mittel, das in der oben beschriebenen Typologie direktdemokratischer Instrumente als nicht qualifiziertes, aktives fakultatives Referendum einzustufen ist. Es gibt dem Volk oder einer Minderheit der Kantone als auslösende Instanz zwar Veto-, aber keine Agenda-Setting-Vollmacht. Da beim fakultativen Referendum in der Schweiz weder ein Beteiligungs- noch ein Zustimmungsquorum gilt, ist es im Rahmen der Lijphart'schen Demokratieformen zwar eher auf der Seite der direktdemokratischen Instrumente mit Machtteilungscharakter einzuordnen, jedoch nicht so deutlich wie die Volksinitiative, die im Folgenden behandelt wird.
Abschliessend ist hier noch auf das resolutive Referendum hinzuweisen, das in einer obligatorischen und einer fakultativen Form auftritt. Analog zum obligatorischen Referendum handelt es sich beim obligatorischen resolutiven Referendum in der Typologie direktdemokratischer Instrumente um ein qualifiziertes obligatorisches Referendum, das in der Mitte der Lijphart'schen Demokratietypen steht (Vatter 2014). Analog zum fakultativen Referendum kann das fakultative resolutive Referendum hingegen als ein nicht qualifiziertes, aktives fakultatives Referendum typologisiert werden, das generell eher auf der Seite der direktdemokratischen Instrumente mit Machtteilungscharakter einzuordnen ist. Laut Jung (2001: 88) sind fakultative abrogative Referenden, also Referenden über bereits seit Längerem bestehende Gesetze, jedoch ein Sonderfall. Zwar stellen sie formell eine Form des aktiven fakultativen Referendums dar und geben somit dem Volk «nur» eine Vetomöglichkeit. Sie zwingen jedoch den Gesetzgeber, bei ihrer Annahme im Sinne des Referendumsurhebers gesetzgeberisch tätig zu werden und sind somit funktional eher mit der Gesetzesinitiative gleichzusetzen.
2.2.3Die Volksinitiative
Neben den Formen des Referendums verfügt das Volk mit der Verfassungsinitiative auch über ein Instrument, mit dem es eine Verfassungsrevision initiieren und somit aktiv die Politikagenda mitbestimmen kann. Art.138 der BV von 1999 legt das Initiativrecht auf Totalrevision, d.h. Änderung der gesamten Verfassung fest,37 Art.139 das Recht auf Teilrevision der Verfassung bzw. die Änderung einzelner Artikel. Zur Auslösung einer Volksinitiative bedarf es 100000Unterschriften, die innerhalb von 18





























